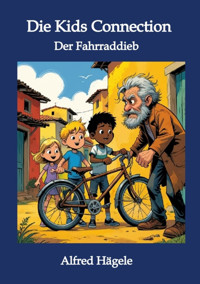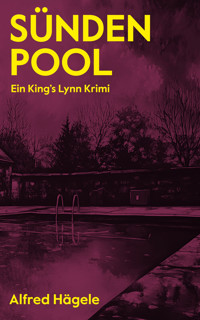2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der 16-jährige polnischer Zwangsabeiter Pjotr verbringt im Jahr 1944 ein halbes Jahr auf einem Bauernhof im Berchtesgadener Land. Er verliebt sich in die Tochter des Bauern. Bevor er ins KZ nach Auschwitz deportiert wird, gelingt ihm die Flucht zurück in seine Heimat. 60 Jahre später, Polen gehört nun zur EU. Pjotr reist wieder nach Inzell, um die damalige Zeit wieder aufleben zu lassen. Doch statt positiver Erinnerungen erfährt er, dass seine einstige Geliebte ein schlimmes Schicksal erleiden musste.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 288
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Alfred Hägele
Pjotr und Paul
Schicksalsroman
Impressum
© 2025 Alfred Hägele
Druck und Distribution im Auftrag des Autors:
tredition GmbH, Heinz-Beusen-Stieg , 22926 Ahrensburg, Germany
www.alfred-haegele.de
Paperback ISBN 978-3-384-53162-9
E-Book ISBN 978-3-384-53163-6
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich.
Jede Verwendung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verarbeitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter:
Alfred Hägele, Seitsberger Str. 2, 73433 Aalen, Germany
www.alfred-haegele.de
Kontaktadresse nach EU-Produktsicherheitsverordnung: [email protected]
Inhalt
Vorwort
Über den Autor
Prolog
Pjotr
TEIL 1
2004
TEIL 2
1944
1944 - 1945
1945 - 1958
1959 - 1993
2003
TEIL 3
2004
TEIL 4
2004
1944
1945
1955
1956 - 1961
1961 - 2004
2000
2004
Epilog
Weitere Veröffentlichungen
Vorwort
Die Geschichte ist reine Fiktion. Aber, sie hätte sich genauso abspielen können. Sämtliche Handlungen und Personen sind frei erfunden. Jede Ähnlichkeit mit wirklichen Personen, ob lebend oder tot, wäre rein zufällig und vom Autor nicht beabsichtigt. Sollte sich dennoch jemand an sich selbst oder einen Angehörigen erinnert fühlen, so bittet der Autor schon im Vorfeld um Verzeihung. Ihm liegt nichts daran, Menschen zu verunglimpfen oder ihnen Böses nachzusagen.
Er möchte mit dieser Geschichte nur eines erreichen:
Seid wachsam!
Über den Autor
Der Autor wurde 1957 in einem kleinen Ort in Süddeutschland geboren. Er wuchs als jüngstes von 9 Kindern in einfachen Verhältnissen auf einem Bauernhof auf. Durch Erzählungen der Mutter sowie der älteren Geschwister, welche die Schreckensherrschaft der Nazi-Zeit am eigenen Leib miterlebt hatten, wurde seine grundlegende Haltung für eine stabile Demokratie begründet. Der Direktor seiner Schule, der noch im letzten Kriegsjahr als 18-Jähriger zur Wehrmacht eingezogen wurde, und ebenso über die Zeit berichtete, festigte im Autor den Willen alles zu tun, dass so etwas nie wieder passieren darf.
So war es nicht verwunderlich, dass der Autor die ersten Fragmente dieser Erzählung Anfang der 2000er-Jahre im Anschluss eines Besuches des NS-Dokumentationszentrums Obersalzberg niederschrieb. Die Ausstellung bewegte ihn und animierte ihn, sich mit der dunkelsten Zeit deutscher Geschichte zu befassen. Es entstand die fiktive Handlung Pjotr und Paul. Zunächst war nicht beabsichtigt, die Geschichte zu veröffentlichen, doch die aktuellen politischen Entwicklungen haben im Autor ein Umdenken bewirkt. Es ist ihm ein Anliegen, die Menschen wachzurütteln. Daher hat er das Manuskript weiterentwickelt und diesen Schicksalsroman entstehen lassen.
Mehr über den Autor und seine Veröffentlichungen können Sie auf den Seiten am Ende des Buches sowie auf seiner Homepage unter https://alfred-haegele.de erfahren.
Prolog
Nichts ist so stark wie die Schwäche eines Volkes.
Pjotr
Pjotr Adamski beschloss, sein Leben noch einmal zu leben. Welch ein verwegenes Ansinnen! Als ob man sechzig Jahre einfach auslöschen und neu erfinden könnte. Jahre der Liebe, Jahre des Leidens. Sechzig gute Jahre, sechzig schlechte Jahre, sechzig Jahre Freude und sechzig Jahre Trauer. Jahre, die Pjotr am liebsten aus seiner Erinnerung gestrichen hätte, und Jahre, an die er gerne dachte. Doch in all den Jahren, den Guten wie den Schlechten, gab es Tage, die ihn entzückten, die in ihm jubelten, und es gab Tage, die ihn traurig machten.
Der 8. Mai war für ihn immer ein Tag der Freude und der Trauer gleichzeitig gewesen. Freude, weil eine Schreckensherrschaft geendet; Trauer, weil eine neue begonnen hatte.
Und dann gab es den 1. Oktober. An jenem Tag im Jahr 1944 hatte die große Liebe zu seiner Anna begonnen und gleichzeitig wieder geendet. Was für ein Schicksal!
Dieser Tag hatte sich für immer und ewig als Tag des Glücks und als Tag der Trauer in seine Gefühle gegraben.
TEIL 1
2004
An einem regnerischen Tag in den ersten Junitagen fuhr Pjotr mit der Stadtbahn zum Warschauer Hauptbahnhof und kaufte die Fahrkarten. Sein Herz klopfte, als er der Schalterbeamtin seinen Wunsch vortrug.
»Einmal Inzell/Deutschland und zurück. Sobald wie möglich, bitte schön.« Nicht dass der Sommer wieder so heiß wird wie im vergangenen Jahr, dachte er. Außerdem, je länger die Wartezeit gewesen wäre, desto mehr hätte er über die bevorstehende Reise nachgedacht und sie womöglich wieder abgeblasen. Doch diese Sorge nahm ihm die Dame am Schalter sofort.
»Moment bitte«, sagte sie freundlich, »ich schau mal nach.« Sie tippte auf ihre Tastatur und am Bildschirm blätterten die Verbindungen auf. »Da habe ich mehrere Möglichkeiten. Sie können über Berlin oder Wien … «
»Berlin«, unterbrach Pjotr und seine Stimme wirkte barsch. »Ich will durch Deutschland fahren«, schob er sanftmütig nach, nachdem ihn die Frau streng anblickte.
»Also Berlin«, wiederholte sie und tippte wieder in ihren Computer. »Da habe ich auch mehrere Alternativen. Sie können morgens ab sieben Uhr fünfzig, nein, das ist nicht gut, da kommen Sie spät abends in München an und stehen da, ohne weiterzukommen. Besser, Sie nehmen den Nachtzug. Der geht hier in Warschau um kurz vor sechs am Abend ab, in Poznan steigen Sie um und sind gegen elf in Berlin.« Ohne aufzusehen, zählte sie die Zwischenstopps auf, als ob sie zu sich selbst reden würde und nicht zu einem Kunden. »Sie fahren dann die Nacht durch und sind am nächsten Tag gegen elf Uhr am Vormittag in München, wo Sie den Regionalzug bis Traunstein nehmen, von dort geht es mit dem Bus weiter bis Inzell. Um zwei werden Sie ankommen, sofern alles pünktlich fährt, was man heutzutage nicht so genau weiß. Sie können aber auch von Traunstein aus den Zug bis Ruhpolding nehmen und von dort aus den Bus nach Inzell. Würde ich aber nicht machen, da müssen Sie noch einmal umsteigen. Soll ich Ihnen die Verbindung ausdrucken?«
»Bitte ja.« Der Redeschwall der Dame überforderte ihn, aber was sie sagte, klang irgendwie plausibel. »Und wann kann ich dann fahren? Ich mein, wie lange muss man da im Voraus buchen?«
»Moment«, wieder haute die Frau in die Tasten, »wenn Sie wollen, gleich morgen, ansonsten, na ja, eigentlich jeden Tag. Die Züge sind nie ausgebucht. Fahren ja alle mit den Autos, die Leute, oder fliegen. Also, ich würde nicht in ein solches Flugzeug steigen. Die fallen doch alle naselang vom Himmel. Wissen Sie, neulich … «
Pjotr unterbrach die Dame. «Ist ja gut, ich fliege nicht. Ich fahre mit der Bahn.« Und dann dachte er an früher. Wie sich doch die Zeit änderte. Noch vor wenigen Jahren konnte man überhaupt nicht in die BRD reisen und jetzt? Jetzt sollte es so schnell gehen? So einfach von einem auf den anderen Tag!
Er überlegte kurz, schaute auf die Uhr und entschied sich. »Jawohl, buchen Sie mir für morgen einen Platz. Jawohl«, fügte er zur Bekräftigung nach, »ich mach das jetzt gleich.«
Es war ein Dienstag, an dem Pjotr die Fahrt ins Ungewisse startete. Die Nacht über schlief er sehr schlecht, wachte immer wieder schweißgebadet auf, weil die Träume ihn in die Vergangenheit zogen. Am Vormittag packte er seine sieben Sachen zusammen; für die paar Tage nur das Nötigste.
Nach einer leichten Mahlzeit, er verspürte kaum Appetit, fuhr er zeitig mit dem Bus zum Bahnhof. Die Gazeta Wyborcza, die größte überregionale Tageszeitung, schwadronierte in dicken Lettern über den Sinn des polnischen EU-Beitritts. Pjotr schüttelte nur den Kopf. Solch eine dumme Frage, daher kaufte er sich stattdessen lieber die Przeglad Sportowy, die größte und einzige polnische Sportzeitung. Diese lamentierte mal wieder über die verpasste Qualifikation der Nationalmannschaft zur Fußball-Europameisterschaft, die in wenigen Tagen in Portugal beginnen sollte. Pjotr machte sich eigentlich nicht viel aus Fußball, aber Sport bot im Gegensatz zu dem ewigen politischen Gezeter wenigstens ein wenig Zerstreuung und Ablenkung.
Als er in den Zug stieg, raste sein Herz.
Sein Abteil war nahezu leer, scheinbar trauten die Leute der neu gewonnenen Freiheit noch nicht ganz. Vielleicht fehlte auch nur das Geld. Bis Poznan, das früher einmal Posen hieß, dauerte es zweieinhalb Stunden, die recht schnell vorbeigingen. Inzwischen waren einige Gäste zugestiegen, mit denen Pjotr ein paar belanglose Worte wechselte. Nach einem kurzen Aufenthalt, bei dem er umsteigen musste, ging die Fahrt weiter Richtung Deutschland. Sein Herz pochte in der Brust, als eine Durchsage die Grenze ankündigte. Gab es also noch immer Grenzkontrollen? Trauten sich die beiden Länder doch nicht vollständig über den Weg? Wieder beschlich ihn ein unangenehmes Gefühl. Die beiden Herren, je ein polnischer und ein deutscher Polizist, waren sehr freundlich, als sie ihn um seinen Ausweis baten und ihn nach dem Zweck der Reise befragten. Sein Puls beruhigte sich bald wieder.
Pjotr schaute auf seine Armbanduhr. Ein edles Stück. Nicht, dass er damit hätte protzen wollen, aber ein bisschen stolz war er schon deswegen, schließlich hatte er das teure Geschenk zum Abschied in den Ruhestand von seinem Chef bekommen. Ja, auch in Polen hatte sich einiges getan.
Zweiundzwanzig Uhr, zeigten die Zeiger, kein Wunder, dass er langsam müde wurde. Er schloss die Augen und nur wenige Minuten darauf fiel er in einen leichten Schlaf. Sein Hirn arbeitete weiter und sandte ihm wirre Träume. Da war Ludwina, wie sie tot neben ihm im Bett lag, da war Ludwina als redselige Fahrkartenverkäuferin am Warschauer Bahnhof und da war Ludwina als junges Mädchen, einen Rechen schwingend und über bayerische Bergwiesen tänzelnd. Im Schlaf kniff er die Augen zusammen und aus Ludwina, wurde Anna, und aus dem Rechen auf ihrem Rücken wurde ein Gewehr, welches wiederum auf der Schulter eines einbeinigen Soldaten in brauner Uniform lag.
Den nächsten Halt in Frankfurt/Oder verschlief Pjotr, bis sich die Tür zu seinem Abteil öffnete und eine Gruppe Halbstarker hereinpolterte. Vier, fünf junge Burschen, schwarz gekleidet mit klobigen Stiefeln an den Füssen, kurz geschorenen Haaren und jeder Menge Piercings im Gesicht.
»Hey Alter«, pöbelte einer der Kerle, »mach mal Platz hier, das is unser Abteil.«
Pjotr schaute den Jungen an. »Nein, mein Junge, das ist mein Platz und den habe ich auch bezahlt«, antwortete er ruhig. »Hier im Zug gibt’s noch genügend freie Sitzplätze für euch.«
»Ich glaub’s nich«, zuckte der Junge. »Willste etwa aufmucken? Hier, ich geb dir gleich was aufs Maul.« Der Junge erhob die Hand zum Schlag.
»Schlag nur zu, mein Junge. Ich hab keine Angst.«
Der Kerl ließ die Fäuste sinken.
Pjotr fuhr in aller Seelenruhe fort. »Angst hatte ich früher mal. Aber weißt du, als ich in deinem Alter war, war Krieg in Europa. Ich war Zwangsarbeiter, habe die ganze braune Scheiße mitgemacht und habe sie überlebt, die Russen sind über uns hergefallen, ich hab’s überlebt und ich habe fünfzig Jahre Sozialismus überlebt. Und jetzt soll ich vor dir Angst haben? Nein, mein Junge, so weit käm’s noch. Schlag mich, von mir aus schlag mich tot. Ich hab mein Leben ohnehin gelebt, aber du, du hast das Deine noch vor dir. Musst selber wissen, was du damit machst.«
»Spinn ich?«, keifte der Junge, »so einer wie du is mir ja noch nie untergekommen. Bist wohl ein Polacke und willst zum Märtyrer werden.« Wieder erhob der Kerl seine Fäuste.
»Komm, lass ihn, Fran.« Ein anderer aus der Gruppe legte dem Jungen den Arm auf die Schulter. »Lass ihn, ist nicht wert, dass du dich wegen dem ins Schlamassel reitest.«
»Nee, nee Jo, so geht das nicht. Die Polacken können nich kommen und uns alles wegnehmen. Der soll von hier verschwinden, oder ich hau ihm eins aufs Maul.«
»Fran«, mischte sich jetzt ein Weiterer aus der Gruppe ein. »Der Alte hat dir nichts getan. Lass uns weitergehen, im Zug gibt’s Platz genug.«
»Hast recht, mein Junge«, stimmte Pjotr zu, »und nicht nur im Zug, auch in ganz Europa ist Platz genug für uns alle. Für Polen, für Deutsche und für noch viel mehr.« Pjotr machte mit dem Arm eine einladende Geste. »Selbst hier in meinem Abteil ist noch genügend Platz. Setzt euch hierher, und wir können gemeinsam friedliches Europa spielen.«
»Lass gut sein, Alter«, sagte der, der Jo genannt wurde, »wir ziehen weiter. So lieb haben wir dich dann doch nicht. Und du«, er stieß seinen aggressiven Kumpel an, »du kommst mit und lässt den Mann in Ruhe. Bist eh auf Bewährung.« Er zog ihn am Arm und drängte ihn weg von Pjotr.
»Da fällt dir nix mehr ein«, protestierte der Kerl. Widerwillig ließ er sich von seinen Kumpanen weiterschieben. »So weit isses gekommen.« Maulend verließ er das Abteil, Pjotr kümmerte sich bereits nicht mehr um ihn. Müde schaute er aus dem Fenster und sah zu, wie die dunkle Landschaft an ihm vorüberzog.
Bald fiel er wieder in einen leichten Schlaf, der ihn bis zur Ankunft in Berlin gefangen hielt. Auf dem Bahnsteig herrschte reges Treiben. Pjotr wunderte sich, wie viele Menschen sich noch zu solch später Stunde auf dem Bahnhof tummelten. Reisende mit Koffern auf der Suche nach der Verbindung, Bedienstete der Spätschicht, Obdachlose in zerschlissener Kleidung, Nachtschwärmer, für die die Nacht erst jetzt richtig begann. Ein jeder von denen schrieb seine eigene Geschichte. Auch Pjotr schrieb seine Geschichte und war gerade dabei, ein neues Kapitel hinzuzufügen.
Ein wichtiges Kapitel? Ein entscheidendes Kapitel? Ein letztes Kapitel?
Das Treiben in der Bahnhofshalle bedrückte ihn ein wenig. Wie konnte man so spät nur so viel Tumult wollen? Freiwillig? Er liebte diesen Trubel nicht. Er liebte die Ruhe und Beschaulichkeit, und er schätzte es, jederzeit ein warmes, wohlbehütetes Heim zu haben, wenngleich seit Ludwinas Tod viel Wärme in seinem Inneren verloren gegangen war.
Auf den Bahnsteigen sorgten Baustellen für Chaos. Mehrmals verlief er sich, bis er endlich den richtigen Zug nach München fand und einstieg. Ein freundlicher Mann im Anzug und mit Krawatte wuchtete ihm den schweren Koffer in das Gepäcknetz. Der Mann setzte sich ihm gegenüber, packte seinen Laptop aus einer Aktentasche, nickte Pjotr entschuldigend zu, murmelte ein paar unverständliche Worte und hackte in die Tastatur.
Langsam fuhr der Zug los. Pjotr schlug die Sportzeitung auf. Michael Schuhmacher hatte wieder einmal ein Autorennen gewonnen, eine Nachlese berichtete von einem wichtigen Fußballspiel um einen europäischen Titel zwischen einer portugiesischen und einer französischen Mannschaft, welches in Gelsenkirchen stattgefunden hatte. Zuvor duellierten sich in diesem Wettbewerb Mannschaften aus Italien, Spanien, England und Deutschland. Ja, sogar welche aus Russland und Tschechien. Und das olympische Feuer würde in drei Tagen seinen Weg von Griechenland rund um den Erdball beginnen, bis es wieder nach Hellas zurückkehren und die Spiele der Welt eröffnen würde. Und die Menschen rund um den Globus würden den Fackelläufern freundlich zuwinken. ›Gebt die Flamme weiter, vereinigt die Welt‹, lautete das Motto des Staffellaufes. Ging es also doch, das friedliche Miteinander in Europa, in der Welt, und man maß sich nur im sportlichen Wettkampf, statt mit Waffen. Die Nachrichten gefielen ihm.
In Hannover stieg er um. Auf dem wenig belebten Bahnsteig kaufte er einen Becher heißen Kaffees und eine Boulevardzeitung. Die Schlagzeile dort beunruhige ihn. Rechtsradikale zündeten in Köln vor einem türkischen Friseursalon eine Nagelbombe! Gab es doch noch immer diesen braunen Sumpf? Erst die Jugendlichen zwischen Frankfurt/Oder und Berlin und nun das hier. War Deutschland doch nicht so, wie es der Sportteil verhieß? Würden wieder irgendwelche braune Schergen das Heft in die Hand nehmen und für Chaos sorgen? Pjotr betete inständig, dass es nicht so weit kommen möge. Die Staatengemeinschaft würde es nicht zulassen. Wie gut, dass Polen jetzt Mitglied dieser Gemeinschaft war, es würde dafür sorgen, solche Richtungen schon im Ansatz zu bekämpfen.
Die Zeiger der Uhr zeigten drei Uhr in der Früh und Pjotr stieg in den Zug, der ihn mit wenigen Zwischenhalten, und ohne weiteres Umsteigen bis München transportieren würde.
Kurz nach der Abfahrt schlief er ein. Die Reise strengte ihn mehr an, als er gehofft hatte. Kein Wunder, schließlich war er bereits sechsundsiebzig Jahre alt und das Leben hatte ihm allerhand Kraft abgenötigt. In seinen Träumen, die ihn immer wieder einholten, wirbelte seine Vergangenheit wild durcheinander. Die früheren Erlebnisse in den bayerischen Bergen kochten in ihm hoch wie heiße Milch. Die Menschen, die ihn damals begleiteten, ja beherrschten, tauchten in seinen Träumen auf, flogen durch die Lüfte, lösten sich auf und kehrten wieder. Bauern und Soldaten, Nazis und Befreier, gute Menschen und böse Menschen. Alle wirbelten wild durcheinander. Und immer wieder war da Anna, deren Sommersprossen in der milden Spätsommersonne tänzelten. Anna, derentwegen er diese Reise machte, Anna, die während seines ganzen Lebens seine Träume beherrschte. Nur die letzte Nacht mit Anna erschien in seinen Träumen nicht.
Der Respekt vor Ludwina, der Gütigen, verbot es.
TEIL 2
1944
»Wollt Ihr wohl still sein, verdammte Polacken-Brut!« Der kleine Mann brüllte aus Leibeskräften, doch keiner hörte ihm zu.
Erst als der Feldwebel, der zur Bewachung der Gruppe polnischer Zwangsarbeiter abgestellt war, das Gewehr hob und über den Köpfen der Männer einen Schuss abfeuerte, kehrte Ruhe ein. Vor ihm hatten sie ein wenig Respekt, wenngleich er in Wirklichkeit keine große Bedrohung darstellte. Er war verkrüppelt, hatte nur ein Bein und wäre wohl kaum in der Lage gewesen, sich gegen die Männer aufzulehnen, wenn diese denn Widerstand geleistet hätten. Doch keiner rührte sich, jeder fügte sich in sein Schicksal. Hier in dem kleinen bayerischen Ort Inzell, nahe der österreichischen Grenze, sollten die Männer arbeiten, sollten den Bauern die Söhne ersetzen, die an den verschiedenen Fronten der Wehrmacht einen aussichtslosen Kampf führten. Sie hatten die Arbeit der Gefallenen zu tun und sie mussten tun, was Greise nicht mehr und Kinder noch nicht tun konnten. Und sie sollten die Versorgung der deutschen Bevölkerung mit Lebensmitteln sicherstellen, einer Bevölkerung, die es in diesem letzten Kriegsjahr 1944 schon fast nicht mehr gab.
Pjotr Adamski war einer der Zwangsarbeiter, gerade mal sechzehn Jahre alt, seinem Elternhaus in Luborzyca, einem winzigen Nest in der Nähe Krakaus, entrissen, seiner Träume und Sehnsüchte von einer glücklichen Zukunft, ja mehr noch, seiner gesamten Jugend beraubt. Seit Tagen schon war er unterwegs gewesen, mal in langen Fußmärschen, mal lag er zusammengepfercht mit anderen auf harten Lkw-Pritschen, mal war er eingesperrt in Eisenbahnwaggons, durch die der eisige Wind pfiff, und oft lagerte er mit seinen Genossen im Freien, den Widerwärtigkeiten der Natur ausgesetzt. Denn obwohl es bereits Anfang April war und die warme Jahreszeit bevorstand, bliesen in diesem Frühjahr die Winde kälter als sonst, und die Nieselregen krochen in die lumpigen Kleiderfetzen der Männer. Fröstelnd und ausgemergelt, hungrig und durstig und doch voller Hoffnung auf ein besseres Leben waren sie in Inzell angekommen.
Wieder erhob der kleine Mann seine schrille Stimme. »Jeder wird jetzt einem Hof zugewiesen«, keifte er und fuchtelte mit den Armen. Vor Kriegsausbruch war Rudolf Keitl Beamter in der Landkreisverwaltung gewesen, der Partei beigetreten, hatte sich dann vor den Karren des Nazi-Regimes spannen lassen und fungierte seither als Blockwart des Dorfes, als Spitzel, der alles und jeden an die Gestapo verriet, nur um für sich selbst ein paar kümmerliche Vorteile zu erhaschen.
Aus einer schmierigen Aktentasche kramte er eine Liste. Darauf waren die Namen der Zwangsarbeiter vermerkt, die er nun vorlas. Brav, einen nach dem anderen.
»Woronjanski Radomir«, er blickte in die Runde. Ein hagerer alter Mann reckte seinen Kopf. »Du kommst zum Wiesenbauer.«
Aus den umstehenden Leuten löste sich eine Frau in einer dunklen Mantelschürze.
»Der Wiesenbauer ist tot«, sagte sie tonlos. »Ihr habt ihn mir genommen.« Sie trat vor den Polen und musterte ihn von oben herab. »Was will ich mit diesem Knochengerüst?« Sie schüttelte den Kopf. »Was ist nur aus uns geworden?«
Keitl schien keine Notiz von der Szene zu nehmen. »Brschinsky Woicech«, radebrechte er, »du kommst zur Mühle, Koicik Ludwik und Lodolski Bogdan, ihr geht zu den Torfstechern.«
Nach und nach zählte er jeden der Männer auf, die sich zögernd zu ihren neuen Arbeitgebern gesellten. Die meisten fügten sich wortlos in ihr Schicksal, nur diejenigen, die den Steinbrüchen zugewiesen wurden, protestierten leise, doch der Blockwart akzeptierte keine Widerrede.
»Ihr Hunde, was wollt ihr? Ich lass euch erschießen, wenn ihr nicht gehorcht.« Er brüllte und deutete auf den einbeinigen Soldaten mit dem Gewehr.
Die Menge nahm kaum Notiz von den Drohungen des Mannes. Jeder im Dorf kannte ihn. Ein Wichtigtuer, ein Emporkömmling.
Alle waren sie heute auf den Beinen. Die Ankunft der Zwangsarbeiter versprach ein wenig Hoffnung auf Hilfe für die gebeutelten Bauern, aber auch Angst und Sorge, was für Leute da kommen würden. Groß und Klein, Alt und Jung erwarteten die Fremden, die begafft wurden wie die Tiere im Zoo. Obwohl man im Ort von jeher an Fremde gewohnt war, waren diese Männer etwas Besonderes. Keine Kurgäste, keine Sommerfrischler, die seit der Gründung des Verkehrs- und Verschönerungsvereines vor mehr als dreißig Jahren den Tourismus in dem bayerischen Alpendorf entstehen ließen. Nein, bei diesen Männern handelte es sich nicht um Gäste; das waren Straftäter, Aufrührer oder einfach minderwertige Menschen. So hatte man der Bevölkerung weisgemacht. Und heute umsäumten die Dorfbewohner in Scharen den kleinen Dorfplatz und warteten auf die Ankunft dieser Verbrecher.
Endlich kam Pjotr als einer der Letzten an die Reihe. Der Junge hatte sich lange umgesehen, bevor er aufgerufen wurde. Er blickte in düstere Gesichter, in Gesichter, die Hass und Trauer ausdrückten, in Gesichter, die keine Hoffnung hatten. Doch hin und wieder blitzte in den Augen der Leute auch etwas wie Mut, Freude und Zuversicht auf. Und dann sah er das Mädchen. Kaum älter als er selbst stand sie da, hielt den Blick meist ehrfürchtig gesenkt, doch wenn sie den Kopf hob, dann strahlten die Augen einen Glanz aus, den Pjotr bis dahin noch bei keinem Menschen gesehen hatte. So hell und so klar und voller Lebensfreude. Ihre Wangen leuchteten in einem feinen Rosa, und eine Handvoll Sommersprossen hatte sich auf die Nase gesetzt. Das strohblonde Haar des Mädchens glänzte in der kalten Frühlingssonne und erinnerte Pjotr an das Gold der Weizenähren in seiner Heimat.
Ihre Blicke trafen sich kurz. Er zuckte zusammen und auch das Mädchen schien über den Blick erschrocken. Schnell senkte sie den Kopf und Pjotr sah, wie sich das feine Wangenrosa in kräftiges Rot verwandelte.
Beinahe hätte er seinen Namen überhört, als er aufgerufen wurde, so sehr hatte das Mädchen ihn in ihren Bann gezogen.
»Adamski Pjotr«, keifte Keitl. »Hurensohn, wo bist du!«, schrie er noch mal, nachdem sich dieser nicht sofort meldete.
Pjotr ballte die Faust und trat vor den kleinen Mann, der einen halben Schritt zurückwich.
»Willst du mir etwa drohen? Mach nur, du kommst zum Ohligsbauer. Der wird dir die Flausen schon austreiben.« Der Blockwart lachte. »Ohlig, wo bist du? Kannst den Burschen gleich mitnehmen. Aber dass du ihn mir auch gut behandelst.« Die Häme triefte aus der Stimme des kleinen Nazibeamten.
Aus der Gruppe der Wartenden trat ein vierschrötiger alter Mann mit kantigem Kopf und kahlem Schädel.
»Her mit dem Polacken«, grölte er und schwang eine Knute. »Den werd ich schon zähmen. Hab noch jeden Wilden zur Räson gebracht. Und nicht nur wilde Stiere.« In schweren, genagelten Stiefeln stapfte der Bauer auf Pjotr zu.
»Was guckst du so blöde?«, herrschte er und ließ die Peitsche knallen. »Hier, nimm, und hier noch mal.« Die Gerte sauste auf Pjotrs Körper nieder.
»Recht so«, lachte Keitl. »Zeig’s den Verbrechern, wo’s langgeht.«
Pjotr duckte sich, als weitere Peitschenhiebe auf seinem Rücken niedersausten, und sein Blick huschte dabei erneut in die Richtung des Mädchens. Es entging ihm nicht, wie diese bei jedem Hieb zusammenzuckte, als ob sie selbst die Schläge erhielte.
»Was soll ich mit diesem alten Gestell?«, hörte Pjotr, wie einer der Bauern seinen Zwangsarbeiter begutachtete. »Der kann mir nicht mal einen Sack Getreide tragen. Wie will der meinen Sepp ersetzen?«
»Halt’s Maul, Bichlbauer. Sei froh, dass du überhaupt jemanden bekommst. Schließlich hast du noch deinen Schorsch. Aber wart, ich werd schon dafür sorgen, dass der auch noch eingezogen wird. Wär doch jammerschade, wenn ein junger Bursche mit gerade mal einundzwanzig nicht der Wehrmacht dienen dürfte, sondern zu Hause im Mist wühlen müsste.« In seinem schwarzen Ledermantel, den der kleine Nazi mit stinkendem Schmalz eingerieben hatte, wirkte er wie ein Kind, das in die Jacke des Großvaters geschlüpft war. Aus ihm würde nie etwas werden, auch wenn er noch so sehr den SS-Leuten in Berlin nacheiferte.
»Du Lackaffe«, ereiferte sich der Bauer. »Wer hat denn den größten Hof hier. Dreißig Hektar habe ich zu bewirtschaften, und da ist der Wald noch gar nicht dabei.«
»Musst halt deinen Hintern selbst mal heben und nicht nur arbeiten lassen«, lachte der Blockwart. Er schien den Lackaffen überhört zu haben, zumindest tat er so. Dem Bichlbauer wäre er ohnehin nicht gewachsen gewesen. »Und nun schert euch fort mit eurem Pack, bevor ich es mir anders überlege und das ganze Gesindel nach Reichenhall ins Salzbergwerk schaffen lasse.«
Die Menge löste sich langsam auf, und Pjotr trottete vor seinem neuen Herrn her. Er hatte keine Ahnung, wohin man ihn bringen würde, aber eines wusste er genau. Vor diesem Ohligsbauern hatte er sich vorzusehen.
»Schau mal Bichl, was ich hier habe«, höhnte der Ohligsbauer, als dieser mit Pjotr an der kleinen Menschengruppe um Bichl vorbei kam. »Das ist ein Arbeiter. Wenn ich den ein bisschen dressiere, da kommt was dabei heraus. Stimmt’s, du stinkender Polacke!« Wieder sauste die Peitsche über Pjotrs Rücken, noch bevor dieser sich dem Hieb entziehen konnte.
Doch viel mehr als der Streich auf seinem Rücken traf ihn der Blick des Mädchens, der wie ein Stich durch seinen Körper jagte. Da stand sie. Inmitten der kleinen Gruppe um den stolzen Bichlbauern. Ein weiteres Mädchen, vielleicht ein paar Jahre jünger, ein Kind und ein kräftiger Kerl standen daneben. Alle hatten die gleichen rosa Bäckchen und gesunde, wettergegerbte Gesichter.
Leszek, ein alter kranker Mann, mit dem Pjotr die Reise aus seinem Heimatland bis hierher mitgemacht hatte, stand mit gebeugtem Rücken daneben. Pjotr wusste, Leszek würde es besser haben als er selbst. Bei diesem Mädchen musste man es gut haben.
Noch bevor der Bichlbauer auf die Frotzelei von Ohlig eingehen konnte, hob dieser erneut die Peitsche und trieb Pjotr vor sich her. Wie ein Stück Vieh jagte er den jungen Mann aus dem Dorf hinaus in Richtung Moor. Hier in dem sumpfigen Gebiet zog sich der Weg in unzähligen Windungen hin bis zu einer kleinen Anhöhe, von welcher aus man den Ort fast vollständig überblicken konnte.
Ein schönes Dorf, dachte Pjotr, hier ließ es sich bestimmt gut wohnen. Und dann schwenkte er seinen Blick nach rechts und er sah, wie dort eine kleine Menschengruppe aus dem Moor trat. Goldgelbe Haare leuchteten inmitten dieser Gruppe, und in Pjotrs Herz begann es ebenfalls zu leuchten.
Die ersten Tage waren schrecklich. Pjotr konnte des Nachts kaum schlafen. Durch die Kammer direkt über dem Stall pfiff der Wind, denn anstatt geschnittener Bretter bestanden die Außenwände nur aus groben Schwarten. Die Fugen zwischen den Bodendielen klafften zentimeterweit auseinander und der Gestank frischen Kuhdungs drang in den Verschlag und haftete an der ganzen Umgebung. Alles war spartanisch. Ein aus groben Brettern zusammengenageltes Bettgestell mit einem fauligen Strohsack und einer schimmligen Pferdedecke, eine alte Holzkiste zur Unterbringung der wenigen Habe und ein Schemel. Das war es. Weder ein Tisch noch eine Lampe, geschweige denn irgendwelche Bücher oder Bilder an den Wänden. Solche Behausungen gab es nicht einmal zu Hause in Luborzyca.
Manchmal weinte Pjotr, wenn der Ohligsbauer wieder zu fest mit der Peitsche zugeschlagen hatte, nur weil die Arbeit nicht schnell genug getan war. Und manchmal pochte sein Herz schneller, wenn es auf dem Weg zu einem Acker vorbei am Bichlhof ging, obwohl er das blonde Mädchen mit dem herzlichen Blick nie zu Gesicht bekam.
Bis zu jenem vierzehnten April. Die Aussaat des Sommergetreides war gerade beendet, da kam Keitl, der Blockwart, zu Ohlig. Pjotr stand eben mit dem Bauern vor dem Stall und striegelte eine abgemagerte Kuh.
»Du musst deinen Polacken hergeben«, sagte der Beamte kleinlaut und duckte sich ängstlich. »Hier«, er deutete auf ein vergilbtes Blatt Papier und schien sich dahinter verstecken zu wollen. »Befehl von oben. Von ganz oben.«
»Verdammt, wieso? Wer soll denn diesen Taugenichts bekommen?« Ohlig war aus dem Häuschen. Er griff nach der Knute und begann auf Pjotr einzuschlagen.
»Der Bichl ist es«, sagte der kleine Mann, »zum Bichl kommt der Adamski.«
Pjotrs Herz schlug bis zum Hals, als er diesen Namen hörte.
»Der Bichl, der Bichl«, in Ohlig stieg die Zornesröte auf.
»Dem hat man den Schorsch auch noch eingezogen.«
»Was geht mich der Bichl Schorsch an?« Ohlig schüttelte den Kopf.
»Der Bichl hat halt mehr Vieh und mehr Milch und das braucht man.«
»Vieh! Pah! Milch! Pah! Und wer schafft meine Arbeit? Ich selbst vielleicht?«
»Dir bring ich den Alten. Leszek heißt der, kann zwar kaum mehr arbeiten, aber besser als nichts ist er allemal. Und nun mach schon, lass den Jungen am Leben, dass ich ihn mitnehmen kann.«
»Tot schlag ich den, dann hat der Bichl, was er braucht. Tot! Tot! Tot!« Mit jedem Wort hieb Ohlig auf Pjotr ein, der immer noch zu keiner Gegenwehr imstande war. Die Nachricht, das goldgelbe Mädchen wiederzusehen, lähmte ihn.
»Halt ein. Ich gönn’s dem Bichl ja auch nicht. Aber was soll ich machen. Hier«, Keitl wedelte wieder mit dem Papier, »Bichl hat halt bessere Kontakte als wir.«
Die Wut des Ohligsbauern kannte keine Grenzen. Er hob die Peitsche und die Hiebe prasselten auf Pjotr nieder wie Hagelkörner. Sie zerschlugen dem jungen Mann den Rücken und erst als Blut in dicken Strömen aus den zerlumpten Kleidern troff, hielt der Bauer inne. Die Haut des Gepeinigten hing ihm in Fetzen, während der Nazibeamte mitleidslos zugesehen hatte. Er wäre auch nicht der Mann gewesen, dem unmenschlich barbarischen Treiben des Bauern Einhalt zu gebieten.
Wortlos verließ Keitl den Hof des Ohligsbauern, ohne sich nach Pjotr umzusehen.
Dieser erhob sich mühevoll und trabte dem kleinen Mann hinterher. Nicht einmal sein Bündel aus der Kammer über dem Stall nahm er mit.
* * *
»Dieses Pack da oben in Berlin. Nehmen mir den Schorsch auch noch weg. Verdammt, wie soll ich da die Felder bestellen?« Der Bichlbauer schüttelte den Kopf.
Im Grunde war er ein guter Mensch, doch die Zeit hatte ihn verbittert. Hatte ihn müde und mutlos gemacht. Nicht nur, dass man ihm den ältesten Sohn, den Sepp, kaum dass dieser neunzehn Jahre alt war, gleich zu Beginn des Krieges eingezogen hatte, nein, jetzt hatte man ihm auch den Georg, den jüngeren, weggeholt. So stand er ohne Arbeitskraft da. Alleine mit der achtzehnjährigen Anna, mit deren jüngerer Schwester Rosemarie, die am Schwachsinn litt, und dem kleinen Wilhelm, der noch nicht einmal zur Schule ging und bei dessen Geburt die Mutter im Kindbett gestorben war.
Und als man ihm den alten Leszek gebracht hatte, hatte er nur müde gelächelt. Dieses dürre Knochengerüst war keine große Hilfe für den Bichlhof.
Der Krieg war eine schlimme Sache.
»Mäßige deine Worte. Sonst muss ich dich melden.«
»Meld mich doch du Schwachkopf. Dann bin ich’s endlich los, diese Plackerei.«
»Hast jetzt ja einen jungen, starken Polacken bekommen. Der kann hinlangen.«
»Jung und stark, dass ich nicht lache. Schau ihn dir an. Abgemagert ist er bis auf die Knochen. Was will der schon schaffen können? Und das Blut läuft ihm aus dem Leib wie aus einem Sieb. Hat der alte Ohlig wieder nicht an sich halten können.«
»Kannst ihn ja aufpäppeln. Aber vergiss nicht. Den Pollacken steht pro Tag nur ein Kanten Brot, zwei Kartoffeln, ein halber Liter Milch und sonntags etwas Speck zu, aber nur ein kleines Stück. Mehr gibt es nicht. Keine Süßspeis natürlich, und auch kein Alkohol. Du weißt ja, alles Übrige muss abgeliefert werden.«
»Wie ich mein Vieh füttere, geht keinen etwas an. Merk dir das, du Stutzer.«
»Vieh ist gut, Bichl«, Keitl lachte. »Ich weiß, dass ihr Bauern genug Futter habt, um mehr als nur ein paar Stück Vieh zu ernähren. Aber treibt’s nicht zu weit. Die Augen Berlins sehen alles.«
»Besonders wenn sie durch die braune Brille der kleinen Nazi-Helfer schauen. Und nun verschwinde von meinem Hof, und lass dich erst wieder blicken, wenn du meine Jungs aus dem verdammten Krieg zurückbringst.«
»Bichlbauer, ich hab schon mal gesagt. Treib’s nicht zu weit! Jeder Krug muss brechen, wenn er zu oft zum Brunnen geführt wird.« Der Blockwart hob drohend den Finger.
»Komm, kleiner Pole, lass uns schauen, ob wir dich wieder zusammenflicken können.« Bichl nahm den Jungen am Arm und zog ihn ins Haus. »Hast bestimmt mit dem braunen Gesindel auch nix am Hut.«
Pjotrs Rücken schmerzte, dennoch zwang er sich, aufrecht zu gehen. In seinem Innern jedoch spürte er den Schmerz nicht, denn die Hoffnung auf das Mädchen, das ihm seit seiner Ankunft die Sinne vernebelte, verwandelte die Tränen des Schmerzes in Tränen der Freude. In kaum einer Nacht, die er bei Ohlig verbracht hatte, hatte er nicht von ihr geträumt. Und jetzt sollte er ihr nah sein? Auch wenn er nicht glaubte, sie, dieses anständige Kind, würde ihre Gefühle an einen wie ihn, an einen Zwangsarbeiter, verschwenden, so hoffte er doch heimlich, ihr Herz gewinnen zu können. So sehr er sich jedoch über sein neues Zuhause freute, mehr noch dauerte ihn Leszek. Der alte Mann würde die Drangsal bei Ohlig kaum überstehen.
Pjotr folgte dem Bichlbauern ins Haus. Die Wände im Flur waren weiß getüncht, sie strahlten mehr Freundlichkeit aus als selbst die gute Stube des Ohligsbauern, wie in dieser Region das Wohnzimmer genannt wurde. Ein einziges Mal durfte er dieses betreten, aber auch nur, um irgendwelche Gemeinheiten abzuholen. Nicht mehr daran denken. Die Zeit auf dem Ohligshof war vorüber, es kann nur besser werden.
Aus einem der hinteren Zimmer hörte Pjotr ein Geräusch. Ein Winseln und Klagen, als ob ein Hund heulte. Was oder wer mochte das sein? Bichl reagierte nicht auf die Laute. Er schien sie nicht einmal zu hören.
Pjotr folgte dem Bauern durch den langen Hausgang, an dessen Ende eine Treppe in das obere Stockwerk führte. Die Stufen knarzten, als sie nach oben stiegen. Dort gab es weitere Zimmer, wie die Türen verrieten. Die erste davon stand offen, der Bauer wies Pjotr hinein. Es war die Küche.
»Hier, setz di hin«, sagte er. »Ich schau nach der Anna, dass die dich wieder z’ammflickt. Wennst Hunger hast, dort auf dem Herd steht noch was zu essen. Kannst nehmen, was willst.«
Der Bichlbauer verließ die Küche. Pjotr blieb allein zurück. Er schaute sich um. Den rechten Teil des großen Raumes füllte eine mit grobem Polsterstoff bespannte Eckbank aus, davor stand ein riesiger Tisch. An diesem hätten gut und gerne zehn oder gar noch mehr Personen Platz gefunden. Links davon spannte sich über die halbe Länge des Raumes ein steinerner Ausguss, auf dem einige blank gescheuerte leere Töpfe umgedreht lehnten. Unter dem Fenster daneben stand ein großer Korb, gefüllt mit Holzscheiten als Brennmaterial für den Herd mit sechs Kochplatten, zwei Backröhren und zwei Wasserschiffen. An den Herd schloss sich ein deckenhoher, dunkelgrüner Kachelofen mit umlaufender Ofenbank an, über welcher sich ein Seil spannte. Dort hingen fein säuberlich aufgehängte Kleidungsstücke zum Trocknen. Die vierte Wand nahm ein riesiger Küchenschrank ein sowie einige offene Regale, über und über voll mit Kochgeschirr, Gefäßen mit Mehl, Salz, Zucker, Gewürzen und allerlei weiteren Zutaten.