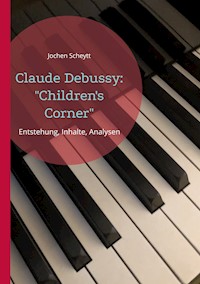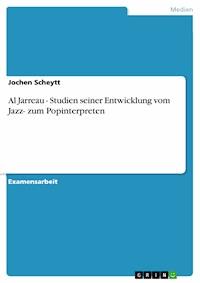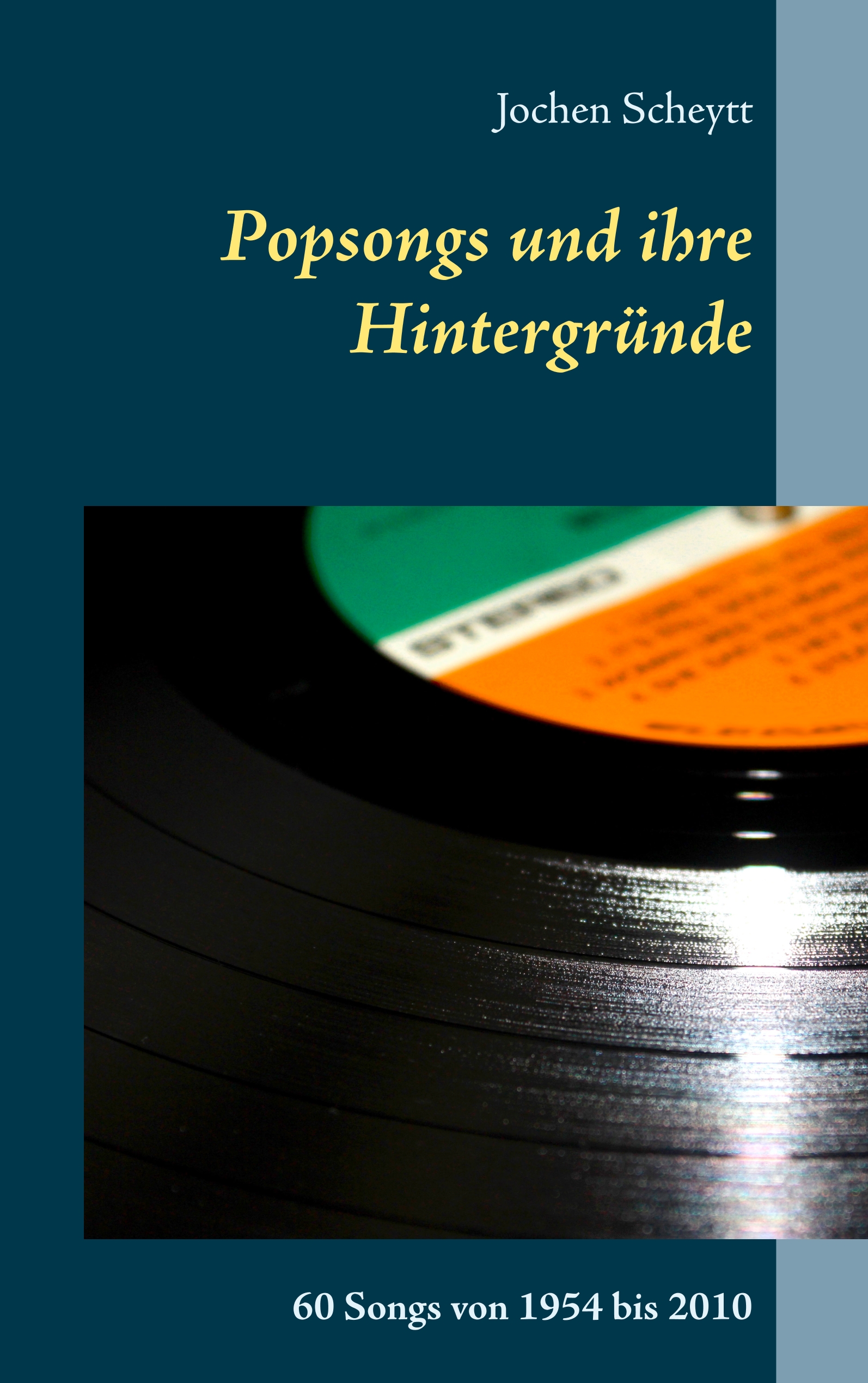
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Seit zwanzig Jahren im Internet - und jetzt endlich auch als Buch: Popsongs und ihre Hintergründe. In 60 Texten wird ein Blick unter die Oberfläche von 60 Songs der Jahre 1954 bis 2010 geworfen und Hintergründiges, Tiefgründiges und Wissenswertes zu Tage gefördert. Oder hätten Sie gewusst, was ein New Yorker Elektrohändler mit "Money For Nothing" von den Dire Straits zu tun hat, warum Bono bei einer Aufführung von "Pride (In The Name Of Love)" dem Tod ins Auge sah oder was genau eigentlich ein "Hound Dog" ist?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 266
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Jochen Scheytt wurde 1966 in Mühlacker geboren. Er studierte in Stuttgart Musik und Anglistik. Seit gut 20 Jahren unterrichtet er am Schlossgymnasium in Kirchheim unter Teck Musik und Englisch. Außerdem ist er als Dozent an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart tätig. Eine schriftstellerische Tätigkeit für verschiedene Schulbuchverlage rundet sein Tätigkeitsfeld ab. Seit 1999 ist Jochen Scheytt mit seiner eigenen Homepage www.jochenscheytt.de mit Beiträgen zu Claude Debussy, Popsongs, Al Jarreau und der Minstrel Show im Internet vertreten.
Inhaltsverzeichnis
Die 1950er Jahre
1954
Bill Haley:
Rock Around The Clock
Die zwei Leben des Rock’n’Roll-Klassikers – vom Partylied zum Symbolsong des jugendlichen Aufbegehrens
1956
Elvis Presley:
Hound Dog
Wissen Sie, was ein "Hound Dog" ist? Nun, ein Basset Hound mit Zylinder, Hemdkragen und Fliege jedenfalls nicht...
Die 1960er Jahre
1960
Ray Charles:
Georgia On My Mind
Ray Charles hat den richtigen Riecher, setzt seinen Sturkopf durch, und behält mal wieder Recht.
1963
Bob Dylan:
Blowin’ In The Wind
Eine Betrachtung über die musikalischen Wurzeln und formale Konzeption des wohl berühmtesten Protestsongs der 1960er Jahre
The Beach Boys:
Surfin' U.S.A.
Der Symbolsong der Surf-Kultur und seine verborgenen Wurzeln im Rock'n'Roll
1965
The Mindbenders:
A Groovy Kind Of Love
A groovy kind of Clementi. Wie aus einem klassischen Rondo ein Popsong werden kann.
The Beatles:
Yesterday
Rühreier, ein Streichquartett, drei tatenlose Beatles, ein bedeutungsvoller Traum und Georgia on Paul's mind
1966
The Beach Boys:
Good Vibrations
Eines der sonderbarsten Musikinstrumente, das Theremin, findet in einer Weiterentwicklung Verwendung im anspruchsvollsten Song der Beach Boys.
1967
The Beatles:
All You Need Is Love
Die Idee des Weltumspannenden, verbunden mit einer simplen, aber wirkungsvollen Botschaft
The Beatles:
Lucy In The Sky With Diamonds
Wer glaubt den Beatles? Eine versteckte Anspielung auf LSD oder unschuldige Kinderzeichnung?
The Beatles:
Strawberry Fields Forever
John Lennons Kindheitserinnerungen in einem äußerst surrealen Gewand
Procol Harum:
A Whiter Shade Of Pale
Einer der Klassiker des Classic Rock und seine Bezüge zum Werk Johann Sebastian Bachs
1968
The Beatles:
Back In The U.S.S.R.
Wie es dazu kommen konnte, dass die Beatles mitten im Kalten Krieg die Sowjetunion und die russischen Mädchen lobten.
Joe Cocker:
With A Little Help From My Friends
Ringos charmantes Liedchen mutiert zur gefeierten Bluesrock- und Gospelhymne
1969
Serge Gainsbourg & Jane Birkin:
Je t'aime (moi non plus)
Über den Skandalsong der späten 1960er und die Wirksamkeit von Verboten
The Band:
The Night They Drove Old Dixie Down
1865 fällt im Amerikanischen Bürgerkrieg die Stadt Richmond und besiegelt damit die Niederlage der Südstaaten.
Die 1970er Jahre
1970
George Harrison:
My Sweet Lord
Der Plagiatsfall
My Sweet Lord
-
He's So Fine
1971
Bill Withers:
Ain’t No Sunshine
You gotta mike the box.
Don McLean:
American Pie
Buddy Holly und der Tag an dem die Musik starb - Don McLeans verschlüsselte Hommage an die Musik der 1950er bis 1970er Jahre
1972
Cat Stevens:
Morning Has Broken
Ein altes gälisches Volkslied schafft die Verwandlung zu einem Popsong
Deep Purple:
Smoke On The Water
Rauch über dem Wasser und Feuer am Himmel - der Kasinobrand von Montreux und seine Folgen
1973
Elton John:
Candle In The Wind
Die wunderschöne Ballade über die viel zu früh ausgeblasene "Kerze im Wind": Marilyn Monroe
Roberta Flack:
Killing Me Softly
Wie eine schwarze Soulsängerin von einem Song beeindruckt war, den eine weiße Folksängerin schrieb, weil sie von Don McLean beeindruckt war, oder so ähnlich...
Pink Floyd:
Money
Machen Sie sich gefasst auf eine Beschäftigung mit ungeraden und zusammengesetzten Taktarten.
1974
Lynyrd Skynyrd:
Sweet Home Alabama
Lynyrd Skynyrds musikalische Reaktion auf Neil Youngs Südstaatenschelte und das Lob für die im Hintergrund tätigen Studiomusiker von Muscle Shoals
Bachman-Turner Overdrive:
You Ain’t Seen Nothing Yet
Wie Gary Bachman seinem Bruder Randy unfreiwillig zu einem Welthit verhalf
1975
Queen:
Bohemian Rhapsody
Auch dieser Artikel wird die Rätsel um Queen's wohl enigmatischsten Song nicht lösen können - was vielleicht auch gut ist...
1977
Bob Marley:
Exodus
Die geplante Rückkehr eines gepeinigten Volks in das Land seiner Väter
1978
Gerry Rafferty:
Baker Street
Ein Altsaxophon im Kofferraum, £27,50 Studiohonorar und merkwürdige Erinnerungslücken sind Teil von Gerry Raffertys größtem Erfolg.
1979
Village People:
Go West
Wir folgen dem Ratschlag der Village People und gehen nach Westen. Wo immer das auch sein mag.
Boomtown Rats:
I Don't Like Mondays
Wenn Jugendliche ausrasten - die erste Wahnsinnstat eines Teenagers an einer kalifornischen Schule und die lapidare Begründung
Sugarhill Gang:
Rapper's Delight
Die Hiphop-Kultur wurde mit diesem Song zwar nicht geboren, aber was wäre der Hiphop ohne
Rapper's Delight
?
Die 1980er Jahre
1980
Stevie Wonder:
Happy Birthday
Der Gedenktag für den amerikanischen Bürgerrechtler Dr. Martin Luther King
Bette Midler:
The Ros
e
Die durchaus romantische Entstehungsgeschichte zu einem durchweg romantischen Song
1981
Phil Collins:
In The Air Tonight
Rumour has it... Wenn die Gerüchteküche erst einmal kocht, ist kein Kraut dagegen gewachsen.
1982
Toto:
Africa
Wodurch wird ein Song zu einem Klassiker, der sich nicht abnutzt und den man immer wieder hören kann?
Michael Jackson:
Beat It
Eddie Van Halens virtuos-verrücktes Solo als Herausforderung, nicht nur für Jennifer Batten
Peter Schilling:
Major Tom
David Bowies einsamer Astronaut Major Tom erlebt in den 1980ern seine Wiederauferstehung.
1983
Udo Lindenberg:
Sonderzug nach Pankow
Udos ironischer und provokanter Liedtext über das DDR-Regime führt am Ende doch zum Ziel.
U2:
Sunday, Bloody Sunday
U2s Verarbeitung des Nordirlandkonflikts und der schwierige Kampf um die Deutungshoheit
Billy Joel:
This Night
Das Adagio-Thema aus Beethovens "Pathétique" im Doo-Wop-Sound auf Billy Joels Album
An Innocent Man
1984
Bruce Springsteen:
Born In The USA
Ein ewiges Missverständnis - würde der "Boss" doch nur etwas weniger nuscheln, und die anderen ein bisschen genauer hinhören...
U2:
Pride (In The Name of Love)
Ein Museumsbesuch, Martin Luther King und eine anonyme Todesdrohung
1985
Dire Straits:
Money For Nothing
Die Schimpftirade eines New Yorker Elektrohändlers über die Stars auf MTV
Falco:
Rock Me Amadeus
Das Genie im neuen Outfit - wie sich das Mozart-Bild in den Achtzigern änderte
1987
France Gall:
Ella, elle l'a
Sie hat es, das gewisse Etwas: Ella Fitzgerald, eine der begabtesten und berühmtesten Jazzsängerinnen aller Zeiten.
Sting:
An Englishman In New York
Stings emotionale Hommage an den Wahl-New-Yorker Quentin Crisp
Suzanne Vega:
Tom's Diner
18. November 1981: Suzanne Vega frühstückt in Tom's Restaurant in New York und hält ihre Eindrücke schriftlich fest.
1989
Simple Minds:
Belfast Child
Wenn die Kinder nicht mehr singen - die Simple Minds über den Religionskonflikt in Nordirland
Alannah Myles:
Black Velvet
Der Mythos Elvis lebt auch in diesem Song. Eine musikalische Pilgerfahrt nach Memphis.
Die 1990er Jahre
1990
The Scorpions:
Wind Of Change
Wie der Wind des Wandels Klaus Meine, dem Frontman der Scorpions, ins Gesicht bläst und was er daraus macht
1991
Marc Cohn:
Walking In Memphis
Marc Cohn nimmt uns mit auf eine persönliche Reise durch Memphis, Tennessee, und seine musikalische Geschichte.
1992
Vangelis:
Conquest Of Paradise
Vangelis' schöner Titelsong zum mittelmäßigen Film unter Verwendung von echt alten und pseudo-alten Elementen
1997
Robbie Williams:
Angels
Dies ist die Geschichte von Ray Heffernan, Robbie Williams und den Ergebnissen einer durchzechten Nacht.
Puff Daddy:
I'll Be Missing You
Der Krieg zwischen East Coast und West Coast Rappern, sein letztes Opfer und die goldene Nase, die sich so mancher damit verdient
Die 2000er Jahre
2005
Robbie Williams:
Advertising Space
Welcher Rockmusiker kann sich Elvis Presleys Einfluss entziehen? Auch fast 30 Jahre nach seinem Tod wieder eine Hommage an den King, diesmal von Robbie Williams
2006
Amy Winehouse:
Rehab
Ein ganz und gar unnötiger Song mit einer völlig falschen Message
2009
Alicia Keys:
Empire State Of Mind (Part II) Broken Down
Die emotionale Hymne auf New York in drei verschiedenen Versionen
Die 2010er Jahre
2010
Duck Sauce:
Barbra Streisand
Wir fahren mit der Bimmelbahn stark augenzwinkernd nach New York.
Cee Lo Green:
Fuck You a.k.a. Forget You
Die gezielte Provokation: Cee Lo Green, youtube und das berühmt-berüchtigte f-Wort
Anmerkungen
Personenregister
Songs alphabetisch
Interpreten alphabetisch
Die 1950er Jahre
1954
Bill Haley: Rock Around The Clock
Die zwei Leben des Rock’n’Roll-Klassikers – vom Partylied zum Symbolsong des jugendlichen Aufbegehrens
Als Bill Haley und seine Begleitband, die Comets, 1958 in Deutschland tourten, gab es mächtig Ärger. Schon im Sportpalast in Berlin hatten Ausschreitungen jugendlicher Konzertbesucher das Konzert überschattet. Als nächstes verwüstete der aufgebrachte Mob die Ernst-Merck-Halle in Hamburg. Dem jovialen, stets gut gelaunten, aber mit der Situation völlig überforderten Haley und seiner Band blieb nur die Flucht vor diesem überbordenden Vandalismus, der sich vor der Konzerthalle fortsetzte und erst spät am Abend von massiven Polizeikräften gestoppt werden konnte.
Es waren nicht die ersten Ausschreitungen dieser Art gewesen. Sie sollten den Rock'n'Roll auf seinem Weg begleiten und ihm ein negatives Image verschaffen. So bezeichnete das "Neue Deutschland" - als Organ der DDR natürlich ganz grundsätzlich nicht amerikafreundlich - Haley damals als "Rock'n'Roll-Gangster", der eine "Orgie der amerikanischen Unkultur" veranstaltet habe, aber auch der Cellist Pablo Casals erkannte in Haley's Musik "ein Distillat aus allen Widerwärtigkeiten unserer Zeit"(1)
Dabei konnte Haley gar nichts dafür, dass seine Konzerte für diesen organisierten Krawall missbraucht wurden. Er war ja auch beileibe nicht der Archetyp des provozierenden Rockers, der mit seiner Attitüde oder seiner Musik solche massiven Auswüchse mit ausgelöst haben könnte. Im Gegenteil, Haley war - ohne ihm zu nahe treten zu wollen - als fast 30-jähriger Familienvater mit seinen karierten Jacketts und seiner Schmalzlocke sicher der biederste der Rock'n'Roller der 1950er Jahre. Andere wie Elvis Presley besaßen das Potential, die Gesellschaft zu spalten, und waren trotzdem nicht Ziel dieser Attacken. Wie konnte es also dazu kommen?
Der Grund lag nur in einem einzigen Song: Rock Around The Clock. Wobei das so nicht stimmt, denn an dem Song selbst lag es definitiv nicht. Denn bei Rock Around The Clock handelt es sich um ein harmloses knapp über zwei Minuten dauerndes Liedchen bar jeglichen Aggressionspotentials. Am deutlichsten wird dies, wenn man sich die Filmaufnahmen der damaligen Zeit betrachtet. Bill Haley als rhythmisch wippender Gute-Laune-Garant mit akustischer Gitarre vor einer Riege mitwippender Backgroundmusiker-Musiker, die weder einen musikalischen noch einen gesellschaftlichen Umbruch im Sinn haben. So löste der Song bei seinem Erscheinen im Jahr 1954 folgerichtig auch wenig aus, am ehesten noch das Tanzfieber, das im Song ja auch besungen wird.
Man hatte dem Song auch von Beginn an nichts Besonderes zugetraut. Die Aufnahmesession, für Rock Around The Clock begann verspätet, weil Haley und die Band auf einer auf Grund gelaufenen Fähre festsaßen. Als sie endlich im Studio eintrafen, war nur noch circa dreieinhalb Stunden Zeit, die allerdings fast komplett für die Aufnahme eines anderen Songs, Thirteen Women (And Only One Man In Town) genutzt wurde. Für Rock Around The Clock hatte man nur noch knapp 40 Minuten. Da war es ein Glück, dass die Band den Song schon oft gespielt hatte und die Sessionmusiker schnell in den Song hineinfanden. Der Sessiongitarrist Danny Cedrone spielte in der Not ein Solo, das er schon bei zwei weiteren Aufnahmen genau so gespielt hatte. Nur zwei Takes konnten aufgrund des engen Zeitrahmens eingespielt werden. Da beim Take 1 der Gesang zu leise war, spielte man den zweiten Take mit zurückgenommener Begleitung ein. Beide Takes wurden später von einem Toningenieur zu einer Aufnahme zusammengemischt - eine nicht zu unterschätzende Leistung bei den damaligen Möglichkeiten im Studio.
Auch bei der Veröffentlichung spielte Rock Around The Clock (im Übrigen als "Foxtrot" betitelt!) eine zweitrangige Rolle und wurde nur als B-Seite ausgewählt. Auf der A-Seite war der schon erwähnte Titel Thirteen Women (And Only One Man In Town) aus der gleichen Aufnahmesession zu finden. Die Verkaufszahlen waren ganz in Ordnung, aber den Durchbruch schaffte Rock Around The Clock bei diesen Startbedingungen nicht.
Wahrscheinlich wäre es auch dabei geblieben, wäre da nicht Peter Ford, der damals zehnjährige Sohn des Schauspielers Glenn Ford gewesen. Glenn Ford spielte eine der Hauptrollen im Film Blackboard Jungle, auf deutsch Die Saat der Gewalt, der 1955 in die amerikanischen Kinos kam. Dieser Film handelt von einer Gruppe Schüler an einer Schule in der Bronx, die recht gewalttätig gegen Lehrer und System rebellieren. Als der Film abgedreht war, war man immer noch auf der Suche nach einer Titelmusik. Als Regisseur Richards Brooks bei den Fords zu Besuch war, stieß er in Sohn Peters Plattensammlung auf Rock Around The Clock und war sich sicher, die richtige Musik gefunden zu haben.
Doch welchen Effekt die Kombination aus Film und Song dann wirklich haben sollte, konnte sich wohl niemand im Vorfeld ausmalen. Denn die Reaktionen waren heftig. Die Revolte von der Leinwand übertrug sich auf die jugendlichen Kinobesucher und schlug auch um in reelle Gewalt, so dass zuerst viele Kinosäle daran glauben mussten. Und auf fatale Weise verknüpften sich diese Gewaltausbrüche fest mit Rock Around The Clock. Gleichzeitig aber bescherte dies dem Song eine neue, bisher nicht dagewesene Popularität und sorgte dafür, dass Rock Around The Clock 1955 schnell wiederveröffentlicht wurde und sich dann millionenfach verkaufte.
So waren es gut 40 Minuten im Aufnahmestudio, die Bill Haleys Leben prägen sollten. Er machte das beste daraus, wäre er doch ohne Rock Around The Clock nicht in die Geschichtsbücher eingegangen. So beklagte er sich Zeit seines Lebens nie darüber, auf diesen einen Titel reduziert zu werden, auf den er sich immer verlassen konnte, wenn eine Show mal nicht so lief. Nicht umsonst nannte er den Song darum sein kleines Goldstück. (2)
1956
Elvis Presley: Hound Dog
Wissen Sie, was ein "Hound Dog" ist? Nun, ein Basset Hound mit Zylinder, Hemdkragen und Fliege jedenfalls nicht...
Am 25. Juli 1956 befand sich der 213 Meter lange italienische Luxusliner Andrea Doria, der Genua am 17. Juli verlassen hatte, kurz vor dem Zielhafen New York. Um 23.10 Uhr geschah die Katastrophe. Die Andrea Doria kollidierte im dichten Nebel mit dem kleineren Passagierschiff Stockholm, das am Mittag von New York aus gestartet war. Die Stockholm riss mit ihrem Bug ein großes Loch in die Seite der Andrea Doria, die von dem eindringenden Wasser schnell Schlagseite bekam. In der nun folgenden Rettungsaktion konnten fast alle Passagiere von der Andrea Doria evakuiert werden. Es überlebten 1660 Menschen das Unglück. 46 Passagiere starben, die meisten beim Aufprall der Stockholm. Elf Stunden nach der Kollision sank die Andrea Doria.
Die Schiffbrüchigen wurden von in der Nähe befindlichen Schiffen aufgenommen und nach New York gebracht. Unter den vielen Menschen, die dort auf ihre Angehörigen und Freunde warteten, befand sich auch der Textdichter Jerry Leiber. Er nahm seinen Freund und Geschäftspartner Mike Stoller und dessen Frau in Empfang. Leiber und der Komponist Stoller standen 1956 noch am Anfang ihrer Karriere, sollten aber bald zum einflussreichsten Songwriter- und Produzenten-Duo der 1950er und 1960er Jahre aufsteigen. Mike Stoller erinnert sich an den Moment, als die beiden sich am Kai wiedersahen. Er teilte seinem Kompagnon mit, dass sie mit Hound Dog einen Smash Hit gelandet hätten. Dieser fragte nach:
„'With Big Mama Thornton?' - 'No, some white chap named Elvis Presley' and I said: 'Elvis who??'"(3)
Stoller war mit seiner Frau auf dem Rückweg von einer dreimonatigen Europareise und hatte so nicht mitbekommen, dass Elvis Hound Dog am 2. Juli 1956 im Studio aufgenommen hatte, und dass der Song in dieser Version unaufhaltsam an die Spitze der Hitparaden unterwegs war.
Ursprünglich hatten Leiber und Stoller Hound Dog schon 1953 geschrieben. Zwei weiße jüdische, damals erst 20-jährige Jungspunde, die sich ausschließlich für Black Music interessierten und trotz ihrer Sozialisierung originäre Rhythm'n'Blues-Songs schreiben konnten. Der Bandleader Johnny Otis hatte die beiden angesprochen, ob sie nicht einen Song für seine neue Sängerin Willie Mae "Big Mama" Thornton schreiben könnten.
In nur ungefähr 12 Minuten (4) hatten die beiden den passenden Song für "Big Mama" geschrieben. Einen Song über einen Hound Dog, in diesem Fall kein Jagdhund, sondern ein unnützer Schürzenjäger, dem Thornton den Laufpass erteilt, weil er ihr etwas vorgemacht hat, sie ausnützt und dennoch immer wieder angekrochen kommt. Ein Song mit sexuellen Doppeldeutigkeiten, die damals im Blues und Rhythm'n'Blues durchaus gang und gäbe waren. Ein Song, der, vom "Lady Bear" gesungen, gehörig Eindruck hinterließ. Und ein Song, der sich erfolgreich verkaufte. Aber auch ein Song, der nur in der schwarzen Gemeinde rezipiert wurde und demnach auch nur in den R'n'B-Charts Platz 1 erreichte.
Für das weiße prüde Amerika war der Songtext nicht geeignet. So dauerte es nicht lange, bis eine entschärfte Variante auf der Bildfläche erschien, die von einem italo-amerikanischen Musiker namens Freddie Bell umgeschrieben worden war. Elvis hörte diese Version von Freddie Bell and the Bellboys und nahm den Song in sein Repertoire auf. Die ursprünglichen Autoren Leiber und Stoller bekamen davon nichts mit.
Über die neue, von sexuellen Doppelbödigkeiten bereinigte, und von einer Sängerin auf einen Sänger umgemünzten Version lässt sich trefflich streiten. Sie löste somit nicht nur beim ursprünglichen Autorenduo Kopfzerbrechen und Kopfschütteln aus, weil sie nicht das war, was die beiden geschrieben hatten, vor allem die Textzeile mit dem Kaninchen (4) löste nicht nur bei Jerry Leiber Kopfzerbrechen und Kopfschütteln aus:
"To this day I have no idea what that rabbit business is about. The song is not about a dog; it's about a man, a freeloading gigolo. Elvis' version makes no sense to me, and, even more irritatingly, it is not the song that Mike and I wrote."(5)
Es ist in gewisser Weise ironisch, dass genau diese von sexuellen Anspielungen befreite Version dann gerade wegen sexueller Anspielungen in die Schlagzeilen geriet. Geschuldet war dies einem Auftritt Elvis' am 5. Juni 1956 in der Milton Berle Show, die von der NBC ausgestrahlt wurde. Elvis spielte zuerst eine anderthalbminütige schnelle Version von Hound Dog, um dann, als eigentlich schon Schluss war, doch noch zwei Chorusse in langsamem Tempo anzuhängen. Schon während der schnellen Strophen sprühte Elvis geradezu vor Spiel- und Musizierfreude und legte eine unglaubliche Intensität und Energie in seinen Gesang und seine Bewegungen. Doch im langsamen Schlussteil trieb er die Gestik mit rhythmischen Bewegungen des Unterkörpers noch auf die Spitze, was ihm dann auch den Spitznamen "Elvis, the pelvis", "Elvis, das Becken" einbrachte. Dass vieles davon spontan entstand, und nicht abgesprochen war, kann man den überrascht lachenden Gesichtern seiner Begleitmusiker entnehmen.
Die Reaktionen jedenfalls waren immens und zwiespältig. Die konservativen Kräfte, allen voran die konservative Presse, jaulten, und die New York Daily News sprach von einer anzüglichen und vulgären Vorstellung und einem Animalismus, der in die Spelunken und Bordelle gehört (6), und der Showmaster Ed Sullivan befand Elvis für nicht familienkonform (7). Gleichzeitig schnellten die Einschaltquoten nach oben und Elvis' kometenhafter Aufstieg wurde durch die wütenden Proteste nur noch beschleunigt. So kamen auch Ed Sullivan sowie einige seiner Showmaster-Kollegen nicht umhin, Elvis für ihre Fernsehshows zu buchen.
Aber man ließ Elvis nicht ungeschoren davonkommen. Beim nächsten Auftritt mit Hound Dog, diesmal am 1. Juli 1956 in der Steve Allen Show, wurde Elvis genötigt, einen auf einem Sockel sitzenden, mit Zylinder, Hemdkragen und Fliege verunstalteten und belämmert dreinschauenden Basset Hound anzusingen. Nach dieser Demütigung beließ man es bei der folgenden Ed Sullivan Show dabei, ihn bis auf wenige Shots nur noch von der Hüfte aufwärts zu zeigen. Allerdings wäre das nicht nötig gewesen, denn wenn man sich diese Performances anschaut, dann sieht man einen Elvis, der ein reines Pflichtprogramm abspult und geradezu lustlos wirkt. Man kann sich vorstellen, wie sehr er im Vorfeld gebrieft worden sein muss, sich nicht daneben zu benehmen. Wenn man diese Auftritte mit der überbordenden Musikalität vergleicht, die seine ersten Auftritte ausgezeichnet haben, könnte man fast weinen – so wie der Hound Dog aus dem Liedtext.
Die 1960er Jahre
1960
Ray Charles: Georgia On My Mind
Ray Charles hat den richtigen Riecher, setzt seinen Sturkopf durch, und behält mal wieder Recht.
Es war im März 1960. Ray Charles war im Aufnahmestudio und sein persönliches Umfeld erklärte ihn mehr oder weniger für verrückt. Man fragte sich ernsthaft, was er da tat. Ob das sein Ernst war, oder ob er vielleicht nicht doch an plötzlicher Geschmacksverirrung litt. Doch Ray Charles meinte es ernst. Ohne Diskussionen.
Der Stein des Anstoßes war das große Streichorchester, das Ray Charles mit ins Boot geholt hatte, um die Songs für die neue Langspielplatte aufzunehmen. Rhythm’n’Blues und Streicher? Black music mit Zuckerguss? Nein, das ging in den Augen aller Beteiligter damals überhaupt nicht. Doch Ray Charles probierte es aus. Und er hatte nicht nur den nötigen Sturkopf, um es gegen alle Widerstände durchzuboxen, er hatte auch die feste Überzeugung, damit einen neuen Sound und gleichzeitig neuen Trend zu kreieren. Und er sollte Recht behalten.
Was Ray Charles damals tat, war nicht nur ein geschmacklicher Tabubruch, es war auch gesellschaftspolitisch gewagt, und es war ein finanzielles Risiko. Schwarze und weiße Musik waren strikt getrennt, der Begriff „race records“ drückt dies in entlarvender Eindeutigkeit aus. Wie wollte man da Erfolg haben, wenn man Elemente aus der weißen Musik mit dem Rhythm’n’Blues mischte?
Für Ray Charles gab es die Grenzen zwischen schwarz und weiß in musikalischer Hinsicht sowieso nicht. Schon früh hatte er in einer weißen Country-Band angeheuert, später sollte er beides – Country und Blues – erfolgreich zusammenführen. Charles hatte schon länger gespürt, dass er etwas Neues machen musste, dass er sich verändern musste, um persönlich und musikalisch weiterzukommen.
Darum vor allem kehrte er 1959 seiner Plattenfirma Atlantic den Rücken und kam bei der viel größeren ABC Paramount unter. Nur dort hatte er die Bedingungen, die er benötigte, um seine Pläne umzusetzen. Wie zum Beispiel das große Streichorchester bei Georgia On My Mind.
Schon die Einleitung zum Song ist bemerkenswert. Es ist ausschließlich das Streichorchester zu hören, das von Ralph Burns auf geradezu klassische Weise arrangiert wurde. In gerader Rhythmik und einfacher Melodik, leicht süßlich in hoher Lage beginnend, weist nicht nichts auf das hin, was musikalisch folgt: ein Jazzstandard.
Verglichen mit seinen bisherigen Aufnahmen nimmt Ray Charles sein bluesiges Klavierspiel stark zurück, reduziert dies auf Fills in Gesangspausen, und konzentriert sich auf seinen ausdrucksstarken Bluesgesang. Auch die Rhythmusgruppe ist sehr zurückgenommen und soundtechnisch nach hinten gemischt. Im Vordergrund stehen ganz klar die beiden Gruppen der Streicher und die der Chorsänger und Chorsängerinnen. Dabei ist das Arrangement sehr vielseitig, wechselt zwischen den beiden Gruppen ab, und führt sie wieder zusammen. Im Chorpart singen manchmal nur die Männer, dann die Frauen; einstimmige Linien auf Tonsilben wechseln mit mehrstimmigem Gesang. Jazzakkorde sorgen für einen spannungsvollen Klang. An manchen Stellen übernimmt der Chor die im Gospel übliche Rolle des Antwortgesangs (call & response).
Betrachtet man das Streicherarrangement im B-Teil, stellt man fest, dass Burns die Streicher beim ersten Mal einstimmig in tiefer Lage eine sogenannte Guide-Line, eine chromatisch auf- und absteigende Linie spielen lässt. Beim zweiten Durchgang findet eine enorme Steigerung statt. Die Streicher spielen, ohne die triolische Rhythmik der Rhythmusgruppe zu übernehmen, in geraden Achteln (straight eights) eine mehrstimmig ausgesetzte Gegenmelodie zur Gesangsstimme. Gerade diese kontrapunktische Setzweise zusammen mit dem rhythmischen Kontrast ergibt einen interessanten Effekt, der das Arrangement über das Übliche hinaushebt und auszeichnet.
Georgia On My Mind wurde zu einem Signature-Song für Ray Charles. Er lag ihm sicher auch deshalb sehr am Herzen, weil er, aus einem kleinen Ort im Grenzgebiet zwischen Florida und Georgia kommend, seine Heimatverbundenheit ausdrückte. Dabei war der Song schon 30 Jahre alt, als ihn Charles coverte. Autor war der Komponist Hoagy Carmichael, der den Song 1930 zusammen mit dem Texter Stuart Gorrell schrieb. Umstritten ist bis heute, ob Carmichael mit Georgia den US-amerikanischen Bundesstaat meinte, oder nicht doch eher seine Schwester, die auch Georgia hieß. Ob das den Politikern bewusst war, die Georgia On My Mind 1979 zur offiziellen Hymne von Georgia erklärten? Egal. Es ändert nichts daran, dass die Aufnahme von Georgia On My Mind auch nach knapp über 50 Jahren zeitlos und aktuell klingt.
1963
Bob Dylan: Blowin’ In The Wind
Eine Betrachtung über die musikalischen Wurzeln und die formale Konzeption des wohl berühmtesten Protestsongs der 1960er Jahre
Bob Dylans Blowin' In The Wind ist DER archetypische Protestsong. Zur Friedensbewegung Anfang der 1960er passend ist die Thematik: eine Aneinanderreihung von rhetorischen Fragen über die Sinnhaftigkeit, beziehungsweise wohl eher Sinnlosigkeit des Kriegs. Von Dylan selbst immer wieder in unnachahmlicher Art vorgetragen, am eindringlichsten in der originalen Version, die außer seiner Stimme nur seine Gitarren- und Mundharmonikabegleitung beinhaltet.
Von der Folk-Bewegung herkommend, kommt der Song mit recht einfachen musikalischen Mitteln aus. Zur Begleitung reichen drei Akkorde: Tonika, Subdominante und Dominante, im Original in D-Dur durchaus gitarrentypisch, kommt man doch beim Nachspielen mit den einfachen Wandergitarren-Griffen aus. Auch die Großform bedient sich einfacher Mittel: ein kurzes Intro, das nur aus zwei Takten Gitarrengroove in D-Dur besteht, ist alles, was Dylan benötigt. Dazu gibt es noch zwei achttaktige, die Strophen voneinander trennende Interludes, bei denen die Mundharmonika zum Einsatz kommt. Rein harmonisch handelt es sich bei dem Interlude nur um eine Wiederholung der davor gespielten acht Takte, und auch die Melodie der Mundharmonika orientiert sich an der Melodik der acht Takte davor. Diese Simplizität ist durchaus beabsichtigt. Unterstützt sie doch die Aussage des Songs, die dadurch im Mittelpunkt stehen kann und von der man nicht abgelenkt wird.
Auf dieser einfachen Grundlage kommt Dylans Gesang gut zur Geltung. Er schafft es durch seine etwas schnoddrige, raue Gesangsweise den Finger in die Wunde zu legen, ohne den moralischen Zeigefinger zu stark zu strapazieren. Obwohl seine Stimme fast tonlos ist, hat sie eine bemerkenswerte Intensität. Diese etwas merkwürdige Mischung aus dahingesungener Unbeteiligung bei gleichzeitiger Eindringlichkeit macht die Darbietung so bemerkenswert und half Dylan dabei, innerhalb kurzer Zeit zu einer Ikone der Protestbewegung aufzusteigen.
Die Singer-Songwriter der 1960er Jahre schrieben ihre Songs in der Regel selbst. Bei Blowin' In The Wind muss man das differenziert betrachten. Komponist und Texter ist offiziell Bob Dylan, wobei er sich aber bei der Melodie sehr stark an dem Spiritual No More Auction Block orientierte und dies bearbeitete.
No More Auction Block handelt von den Sklavenauktionen, bei denen die aus Afrika verschleppten Negersklaven an die weißen Gutsbesitzer verkauft wurden. Bei diesen Auktionen wurde keinerlei Rücksicht auf familiäre Bindungen genommen und die Sklaven oftmals sogar bewusst getrennt, um ihren Willen zu brechen. Der "auction block" diente dabei als Podest, auf dem die Sklaven versteigert wurden. Der Liedtext drückt somit die Hoffnung und den Wunsch aus, das durch den auction block symbolisierte Joch der Sklaverei abwerfen zu können.
No More Auction Block besteht aus nur acht Takten, von denen die ersten vier auf einem Halbschluss enden, bevor am Ende der acht Takte mit der Tonika als Ganzschluss der Schluss der Strophe erreicht wird. Damit folgt das Spiritual im Grunde einer klassischen europäischen musikalischen Periode, bestehend aus einem je viertaktigen Vorder- und Nachsatz, die jeweils aus zwei zweitaktigen Phrasen bestehen. Dabei ist die jeweils erste Phrase von Vorder- und Nachsatz identisch.
Dylan übernimmt diese formale Gestaltung in ihren Grundzügen, dehnt die Form allerdings von acht auf insgesamt 32 Takte aus. Er macht also aus jeder zweitaktigen Phrase des Originals eine achttaktige.
Doch steckt formal noch mehr in Blowin' In The Wind. Sozusagen als weitere Schicht zu dieser rein klassischen Periodisierung lassen sich auch Elemente der Bluesform entdecken. Das ist eigentlich nicht verwunderlich, berufen sich die frühen Singer-Songwriter doch auf die Folk-Bewegung, die ihrerseits stark vom Blues beeinflusst war. Die Bluesform besteht ja bekanntlich meist aus 12 Takten, unterteilt in drei Viertakter. Von diesen drei Viertaktern wird der erste wiederholt, um mit dem dritten Viertakter quasi eine Lösung, Folgerung, oder Erkenntnis zu bringen. Diese inhaltliche Form, die sich auch in der melodischen Gestaltung wiederfindet, wird mit AAB bezeichnet. Als Beispiel soll der Backwater Blues dienen:
A When it rains five days and the sky turns dark as night,
A When it rains five days and the sky turns dark as night
B There is trouble taking place in the lowlands tonight.
Die Wiederholung der Phrase A hat etwas Insistierendes, soll Spannung aufbauen, Nachdruck erzeugen, bevor dies mit der Phrase B aufgelöst wird. Vergleicht man diese Anlage mit Blowin' In The Wind so fällt auf, dass hier nicht nur zwei, sondern sogar drei insistierende Wiederholungen als Fragen vorgestellt werden, bevor die Schlussphrase die Spannung auflöst und die Antwort gibt (die hier allerdings lautet, dass es keine Antwort geben kann). Es handelt sich bei Blowin' In The Wind nun natürlich nicht direkt um einen Blues, denn diese Wiederholung ist auch ein wichtiges Stilmittel der Rhetorik. Es handelt sich im Grunde um eine Anapher, also eine Wiederholung eines oder mehrerer Wörter am Satz- oder Abschnittsanfang.
Die Anapher wird häufig bei Reden angewandt. Man denke da nur an die berühmte Rede Dr. Martin Luther Kings die er im Jahr 1963 vor dem Lincoln Memorial in Washington D.C. hielt und bei der er am Ende der Rede virtuos von der Anapher Gebrauch machte: insgesamt acht Mal beginnt er einen Gedanken mit den Worten "I have a dream that..."(1) und gegen Ende seiner Rede sechsmal mit "Let freedom ring..."(2) und beschwört damit den Wandel geradezu herauf.
Bob Dylan und die Bürgerrechtsbewegung, das passt nun auch wieder wunderbar zusammen, setzte sich Bob Dylan ja vehement für die Rechte der afro-amerikanischen Bevölkerung ein. Wie unterschiedlich beide waren: beschwörend, predigend Dr. Martin Luther King, beinahe beiläufig, abgeklärt Bob Dylan; und doch kämpften sie für die gleichen Ziele und haben zeitlos Gültiges geschaffen, das heute aktueller ist denn je.
1963
The Beach Boys: Surfin' U.S.A.
Der Symbolsong der Surf-Kultur und seine verborgenen Wurzeln im Rock'n'Roll
Mir fällt in diesem Zusammenhang immer wieder Sebastian Krumbiegel ein, der mit den Prinzen 1993 den Song Alles nur geklaut trällerte. Ob sich das gut 30 Jahre zuvor wohl auch Brian Wilson gedacht hatte, als er Surfin' U.S.A. schrieb? Hoffte er, dass es nicht auffallen würde, oder hielt er sich wirklich für den Komponisten des Songs? Oder was es doch alles nur grenzenlose Naivität? Tatsache ist, dass Wilson als Komponist von Surfin' U.S.A. aufgeführt wurde, und nicht der wahre Urheber.
Wir wissen nicht, wo Chuck Berry Surfin' U.S.A. zum ersten Mal hörte. Man kann sich sein Erstaunen aber gut vorstellen, denn der Titel dürfte ihm zurecht sehr bekannt vorgekommen sein. Handelte es sich doch um nicht viel mehr als eine Coverversion von Berrys Komposition Sweet Little Sixteen, die dieser fünf Jahre zuvor, also 1958, veröffentlicht hatte. Trotzdem ließ sich eben Brian Wilson als Komponist von Surfin’ U.S.A. eintragen. Als der Musikverlag Arc Music, der die Rechte am Song besaß, bei den Beach Boys vorstellig wurde und mit einem Prozess drohte, bekam Berry die Rechte von Murry Wilson, dem Vater und Manager der Wilson-Brüder, zugesprochen. Bei dieser Gelegenheit fielen Berry, beziehungsweise Arc Music auch gleich noch die Rechte am Liedtext zu, was dann des Guten allerdings doch etwas zu viel war. So bekam Brian Wilson die Rechte am Text wohl in den 1990er Jahren im Zuge einiger Prozesse wieder zurück. (3)