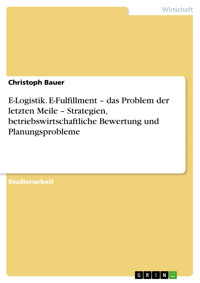79,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Campus Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Professionelles Pricing setzt Gewinnpotenziale frei. Keine Bank, Sparkasse oder Versicherung kann es sich leisten, auf diese zu verzichten – bei der Festlegung von Kreditzinssätzen ebenso wie bei den Gebühren für Kontoführung, Kreditkarten oder Fonds. Die Autoren schöpfen aus den umfassenden Erfahrungen bei der weltweit tätigen Unternehmensberatung Simon-Kucher & Partners. Sie liefern Antworten auf erfolgskritische Fragen der Preissetzung und zeigen, wie durch intelligente Preisstrategien Erträge gesteigert werden können.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 432
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Christoph Bauer, Georg Wübker
Power Pricing für Banken
Wege aus der Ertragskrise
Campus Verlag Frankfurt/New York
Über das Buch
Professionelles Pricing setzt Gewinnpotenziale frei. Keine Bank, Sparkasse oder Versicherung kann es sich leisten, auf diese zu verzichten – bei der Festlegung von Kreditzinssätzen ebenso wie bei den Gebühren für Kontoführung, Kreditkarten oder Fonds. Die Autoren schöpfen aus den umfassenden Erfahrungen bei der weltweit tätigen Unternehmensberatung Simon-Kucher & Partners. Sie liefern Antworten auf erfolgskritische Fragen der Preissetzung und zeigen, wie durch intelligente Preisstrategien Erträge gesteigert werden können.
Über den Autor
Christoph Bauer ist Director bei Simon-Kucher & Partners.
Dr. Georg Wübker ist Partner bei Simon-Kucher & Partners.
Inhalt
Geleitwort
Vorwort zur ersten Auflage
Vorwort zur zweiten Auflage
Vorwort zur dritten Auflage
Einleitung
1. Ein Blick über den Tellerrand
1.1 Power Pricing-Ansätze aus der Industrie
1.2 Power Pricing-Erkenntnisse aus der Psychologie
2. Grundlagen des modernen Pricings
2.1 Zunehmende Bedeutung des Pricings
2.2 Preiskrieg: Falsche Preisstrategie und Gewinnvernichtung
2.3 Der Preis als der Gewinntreiber
2.4 Grundlegende Analysen von Preisänderungen
3. Strategische Aspekte und Vielfalt des Pricings
3.1 Shareholder Value und Pricing
3.2 Die zehn Erfolgsfaktoren eines ganzheitlichen und strategischen Preismanagements
3.3 Pricing-Prozess: Von der Strategie zur Umsetzung
3.4 Strategische Ziele und Pricing-Guidelines
3.5 Positionierung und Wettbewerbsvorteile
3.6 Segmentierung und Pricing
3.7 Marke und Pricing
4. Methoden zur Preisoptimierung
4.1 Die Erlös-Risiko-Matrix
4.2 Methoden zur Ermittlung der Preis-Absatz-Funktion
4.3 Fallbeispiel Conjoint Measurement
4.4 Besonderheiten der Preis-Absatz-Messung
5. Intelligente Preisdifferenzierung
5.1 Der Grundgedanke der Preisdifferenzierung
5.2 Leistungsbezogene Preisdifferenzierung
5.3 Multi-Channel-Pricing
5.4 Euro-Pricing
5.5 Nichtlineare Preisbildung
5.6 Mehr-Personen-Pricing
5.7 Preisbündelung
5.8 Managementempfehlungen
6. Psychologische Aspekte des Pricings
6.1 Psychologie und Pricing
6.2 Preiswahrnehmung
6.3 Preisbeurteilung: Referenzpreis- und Prospekttheorie
6.4 Steuerung von Preiswahrnehmung und Preisbeurteilung
7. Umsetzungsaspekte des Pricings
7.1 Umsetzung und Pricing
7.2 Pricing-Organisation
7.3 Preisinformationssysteme
7.4 Preisdurchsetzung und Vertriebsincentivierung
8. Fallstudien: Power Pricing in der Praxis
8.1 Einführung
8.2 Fallstudien zum Power Pricing
9. Erkenntnisse für Manager in der Financial-Services-Industrie
Literatur
Anmerkungen
Register
Geleitwort
Banken und Sparkassen zeichneten sich traditionell durch eine eher zurückhaltende Vornehmheit gegenüber dem Thema »Preis« aus. Sie sprachen von Gebühren, Courtagen, Konditionen, Agio oder Ähnlichem, aber vermieden es, den Preis beim Namen zu nennen. Befördert wurde die verbreitet passive Einstellung zum Thema Preis durch Rahmenbedingungen, Zinsvereinbarungen und Regulierungen vielfacher Art, die den meisten Instituten ein auskömmliches Leben ermöglichten.
Das alles hat sich in den letzten Jahren nach der Lehman-Pleite radikal geändert. Der Wettbewerb zwischen Finanzdienstleistern ist national und international in voller Stärke entbrannt. Neue Regularien wie MiFid II, SEPA oder Basel III verstärken den Margen- und Preisdruck. Die Rolle des Preises als entscheidender Gewinntreiber und Wettbewerbsparameter tritt damit noch stärker in den Mittelpunkt des Interesses. Allerdings kann man auch heute noch nicht sagen, dass alle Manager die Chancen und Bedrohungen, die in diesem Instrument stecken, in vollem Umfang erkannt hätten. Das vorliegende Buch integriert neue Aspekte des Preis- und Produktmanagements und behandelt damit ein strategisch hochgradig relevantes Thema für alle Vorstände und Führungskräfte.
In diesem Buch zeigen die Autoren auf, was Power Pricing für Banken und Sparkassen ist, wie Manager es erfolgreich in der Praxis anwenden können, warum man durch Pricing Wettbewerbsvorteile erzielen und wie man die Gewinne fühlbar steigern kann. Die Autoren verzahnen dabei Erkenntnisse aus der Wissenschaft, der Beratung und der Finanzindustrie. Sie greifen auf ihr Wissen zurück, das sie als langjähriger globaler Leiter beziehungsweise Director des Competence Centers Banking von Simon-Kucher&Partners mit ihren Teams in zahlreichen Projekten erworben haben. Sie liefern Antworten auf zahlreiche erfolgskritische Fragen, an denen sie weltweit mit Top-Managern aus der Finanzwelt gearbeitet haben. Diese Fragen werden praxisnah behandelt.
Das Buch profitiert durchgängig in hohem Maße von den Hunderten von Preisprojekten, die die Autoren bei Simon-Kucher&Partners für in- und ausländische Finanzinstitute bearbeitet haben. Das Buch ist kein akademisches Werk, sondern liefert Handwerkszeug für den Bank- und Sparkassen-Praktiker. Der Leser erhält praxisnahe und umsetzungsgerechte Empfehlungen. Ich bin überzeugt, dass dieses Buch jedem Manager hilft, die Erträge seines Institutes im Rahmen der jeweiligen Vorgaben und Strategien zu optimieren.
Ich wünsche dem Buch am Markt eine weiterhin gute Aufnahme und seinen Lesern neue Einsichten in ein spannendes Thema sowie hohen Praxisnutzen.
Bonn, im September 2014
Prof. Dr. Hermann Simon
Vorwort zur ersten Auflage
Wie viel Prozent Ihrer Zeit und Energie verwenden Sie auf den Preis beziehungsweise Zins? Vermutlich viel zu wenig! Dabei ist der Preis der Gewinntreiber schlechthin. Um die Wirkung des Preises und möglicher Preisänderungen auf den Gewinn zu verstehen, betrachten wir folgendes Beispiel. Ein Finanzdienstleister verkauft sein Produkt für 100 Euro. Der Jahresabsatz beträgt 1 Million. Die variablen Stückkosten betragen 80 Euro, so dass der Stückdeckungsbeitrag (Marge) 20 Euro ist. Das Institut erzielt einen Deckungsbeitrag von 20 Millionen Euro (= 20 × 1 Mio.). Das Management glaubt, dass der Preis von 100 Euro zu hoch ist und prüft eine Preissenkung um 10 Prozent. Um wie viel müsste sich nun der Absatz erhöhen, damit der gleiche Deckungsbeitrag realisiert werden kann? Die Antwort: Um 100 Prozent! Warum? Die Marge wird bei einer Preissenkung von 10 Prozent um 50 Prozent, das heißt von 20 Euro auf 10 Euro reduziert. Folglich müsste der Vertrieb seinen Absatz verdoppeln – also von 1 Million auf 2 Million erhöhen, um lediglich den gleichen Deckungsbeitrag zu erzielen. Ein eher unrealistisches Unterfangen. Das Beispiel zeigt, wie wichtig es ist, die Wirkungen des Preises auf Absatz und Gewinn zu verstehen. Gerade in der Finanzkrise (Subprime) müssen sich Manager wesentlich intensiver um die Erlös- und Preisseite kümmern. Dort liegen heute größere unausgeschöpfte Gewinnsteigerungspotenziale als bei den Kosten.
Trotz dieser Erkenntnis hat die Preisgestaltung in der Finanzindustrie noch längst nicht den Grad an Professionalität erreicht, der methodisch möglich ist. Es mangelt am grundlegenden Verständnis für Preisfragen genauso wie am gezielten Einsatz hoch entwickelter Methoden. Das vorliegende Buch leistet Pionierarbeit, da hier erstmals das Preismanagement für Banken und Finanzdienstleister umfassend – Strategie, Methodik, Umsetzung – behandelt wird.
Meinem Mentor, Herrn Prof. Dr. Hermann Simon, Chairman von Simon-Kucher&Partners, gilt mein ganz besonderer Dank. Er gab mir den Anstoß sowie zahlreiche äußerst konstruktive Anregungen für dieses Werk. Bedanken möchte ich mich auch bei meinen Eltern, Schwiegereltern, Kollegen, Bekannten und Freunden für Anmerkungen und Hinweise zum Buch. Zu ganz besonderem Dank verpflichtet bin ich meinen Kollegen Dr. Dirk Schmidt-Gallas, Jens Baumgarten, Dr. Jan Engelke, Dr. Frank Niemeyer, Dr. Jochen Krauss, Dr. Enrico Trevisan, Dr. Men-Andri Benz, Dr. Thomas Haller, Silvan Meier, Maren Jäger, Dieter Lauszus, Dr. Andreas von der Gathen sowie Dr. Rainer Linnemann und Andrea Kohlgraf vom Campus Verlag.
Entscheidende Hilfe und moralische Unterstützung habe ich während der gesamten Arbeitszeit durch meine Frau Andrea erhalten. In zahllosen Gesprächen sowie in Form von entbehrter Zeit und großem Verständnis hat sie erheblich zum Entstehen dieser Arbeit beigetragen. Deshalb widme ich ihr die vorliegende Arbeit.
Königswinter, im März 2006
Dr. Georg Wübker
Vorwort zur zweiten Auflage
In den letzten zwei Jahren hat sich in der Finanzindustrie einiges bewegt. Liest man die Wirtschaftspresse, so geraten viele Banken (UBS, IKB, Citibank), Landesbanken (West LB, Sachsen LB) oder Versicherungen (AIG) durch die Finanzkrise (Stichwort: Subprime) unter enormen Ertragsdruck. Vor diesem Hintergrund gewinnt das aktuelle Thema »Power Pricing« zunehmend an Bedeutung. Das vorliegende Buch ist um die aktuellen Entwicklungen und Zahlen der letzten zwei Jahre ergänzt worden. Wir haben erkannt, dass das Thema nicht nur für Banken, sondern insbesondere auch für Sparkassen und Versicherungen eine hohe strategische Bedeutung hat. Bedanken möchte ich mich bei meiner Familie und meinen Kollegen sowie dem Campus Verlag für diese zweite aktualisierte Auflage.
Königswinter, im Mai 2008
Dr. Georg Wübker
Vorwort zur dritten Auflage
Hermann Simon hat den Begriff »Power Pricing« mit seinem gleichnamigen 1997 erschienenen Standardwerk wie kein anderer Managementdenker geprägt. Die letzte Auflage unseres auf die Banken übertragenen Standardwerkes kam gerade heraus, als Lehman pleiteging. Seitdem hat sich in der Finanzindustrie viel verändert. Neue Regularien wie SEPA, MiFiD II oder Basel III sind entworfen worden. Diese beeinflussen massiv die (neueren) Preis- und Geschäftsmodelle von Banken. Neue Wettbewerber wie PayPal mischen den Markt auf. Kunden informieren sich und agieren zunehmend durch das Internet. Power Pricing gewinnt folglich an Bedeutung.
Vor diesem Hintergrund haben wir unser Standardwerk aktualisiert, neue Erkenntnisse aus der Preispsychologie integriert sowie zahlreiche neue Praxisbeispiele dargestellt.
Doch eines ist klar: Power Pricing ist ein zeitloses und dauerhaft relevantes Top-Management-Thema für Banken. Denn der Preis ist der Gewinntreiber Nummer eins.
Königswinter, im September 2014
Dr. Georg Wübker und Christoph Bauer
Einleitung
»Modernes Bankmanagement kommt an dem Thema ›professionelles Pricing‹ nicht mehr vorbei.«
Dr. Josef Ackermann
Der Begriff »Power Pricing« stammt von Simon und Dolan (1997) – zwei der weltweit führenden Preisforscher und -berater. Die Autoren beschreiben diese moderne Form des Pricings wie folgt: »Progressive Unternehmen setzen den Preis aktiv als Hauptinstrument ein, um ihre Ziele zu erreichen. Diese Anhänger des Power Pricings haben die Bedeutung des Preises als Bestimmungsfaktor für den Gewinn erkannt und entwickeln daher die Pricing-Kompetenz, die nachhaltig den Gewinn verbessert.«1
In diesem Buch wird dargestellt, wie Banken und Versicherungen ihre Gewinne mithilfe des Power Pricings signifikant steigern können. Dafür werden folgende Kernfragen eines erfolgreichen Preismanagements im Finanzsektor geklärt:
Was können Sie von intelligenten Power Pricing-Ansätzen in anderen Industrien lernen?
Wie können Sie die neuesten Erkenntnisse aus der Preispsychologie für die Preisgestaltung nutzen?
Was sind die Gründe des gestiegenen Stellenwertes des Preises für Banken, Versicherungen und Finanzdienstleister? Wie können Sie mittels Pricing profitabel wachsen?
Wie erarbeiten Sie eine Preisstrategie und eine Preisverfassung?
Warum brauchen Sie Pricing-Grundsätze? Wie erarbeiten Sie diese?
Wie entwickeln Sie eine zielführende Preispositionierung für Banken?
Mit welchen Strategien verhindern Sie einen Preiskrieg? Was sind die Ursachen für einen Preiskrieg in der Finanzindustrie? Wie entkommen Sie der Preisfalle?
Wie organisieren Sie den Pricing-Prozess?
Was ist eine Pricing-Datenbank? Wie entwickelt man diese?
Was ist eine Preis-Absatz-Funktion? Wie kann man diese Funktion zuverlässig und valide für Finanzprodukte und -dienstleistungen ermitteln? Wie können Sie zum Beispiel die ertragsoptimalen Zinsen bestimmen?
Wie beeinflussen psychologische Aspekte (zum Beispiel Darstellung des Zinses und der Konditionen) die Preis- und Produktgestaltung?
Welche Implikationen ergeben sich für die Preiskommunikation?
Wie wenden Sie intelligente Formen der Preisdifferenzierung (zum Beispiel Zinsstaffeln, Kontopakete oder Familientarife) an? Was müssen Sie dabei berücksichtigen?
Welche Auswirkungen hat das Pricing auf die eigene Organisation?
Gibt es einen Head of Pricing in der Bank oder in der Sparkasse?
Welche Umsetzungsaspekte (zum Beispiel die Organisation von Zinsentscheidungen) sind beim Power Pricing zu beachten?
Wie erfolgt das Preiscontrolling in Banken?
Wie werden die Herausforderungen des Pricings in den verschiedenen Bereichen (zum Beispiel Zahlungsverkehr, Baufinanzierung, Einlagen, Kredite, Wertpapiergeschäft) und Segmenten (Retail Banking, Private Banking, Firmenkunden) gelöst?
Der Aufbau des Buches orientiert sich an den obigen Fragestellungen und gliedert sich in neun Kapitel.
Im ersten Kapitel wagen wir einen Blick über den Tellerrand, und zwar in zweifacher Weise. Zum einen stellen wir einige bekannte Preismodelle aus modernen Industrien dar. Bankmanager können von diesen innovativen Modellen viel lernen. Zum anderen beschreiben wir kurz, prägnant und mittels konkreter Praxisbeispiele die neuesten Erkenntnisse der Preispsychologie. Denn die wenigsten Menschen entscheiden wie ein Homo oeconomicus. Preiswahrnehmung ist Realität.
Das zweite Kapitel stellt die Grundlagen des modernen Pricings dar. Es behandelt zunächst die zunehmende Bedeutung des Preises, zeigt auf, wie groß die Gewinnvernichtung durch falsches Preismanagement ist und warum der Preis der Gewinntreiber Nummer eins ist. Im dritten Kapitel werden die strategischen Aspekte des Pricings (Pricing-Prozess, strategische Ziele und Pricing-Guidelines, Positionierung und Wettbewerbsvorteile, Segmentierung, Marke und Pricing) behandelt. Das vierte Kapitel beschäftigt sich mit den Methoden zur Preisoptimierung, die sich in der Finanzbranche bewährt haben. Hierzu zählen insbesondere das Expert Judgement sowie das Conjoint Measurement. Im fünften Kapitel werden intelligente Formen der Preisdifferenzierung dargestellt. Preisbündelung, nichtlineares Pricing sowie die Mehr-Personen-Preisbildung sind solche innovativen Anwendungskonzepte des Power Pricings.
Im sechsten Kapitel werden ausgewählte psychologische Aspekte des Pricings (Preiswahrnehmung, Preisbeurteilungsprozess und Preisschwellen) beschrieben. Das siebte Kapitel geht auf die wichtige Frage ein, was Bankmanager bei der Umsetzung des Pricings (Pricing-Organisation, Preisinformationssysteme, Preisdurchsetzung) beachten sollten. Im achten Kapitel werden zahlreiche Fallstudien aus der Finanzindustrie (zum Beispiel Retail Banking, Private Banking, Corporate Banking, Asset Management oder Payments) präsentiert. Im Mittelpunkt der Ausführungen stehen Methoden und Konzepte, die in der Praxis erfolgreich von Banken eingeführt und umgesetzt wurden. Die Arbeit findet ihren Abschluss im neunten Kapitel, welches die gewonnenen Erkenntnisse thesenartig zusammenfasst.
Ziel des vorliegenden Buches ist es, die Grundlagen der Preisgestaltung in kompakter und praxisgerechter Form zu vermitteln. Es wird deutlich, welche enormen Gewinnpotenziale Banken durch professionelles Pricing realisieren können. Checkfragen und konkrete Handlungsempfehlungen zum besseren Pricing werden beschrieben und herausgearbeitet.
Der Leser erhält praxisnahe Empfehlungen zu den folgenden Bereichen: preispsychologische Effekte, Preiskriege, strategische Aspekte des Pricings, Wirkung des Preises auf den Absatz, Optimierung der Preise, intelligente Formen der Preisdifferenzierung sowie Preisprozesse, -organisation und -implementierung. Ziel ist es, die Wirkungen des Preises auf den Absatz und den Gewinn besser zu verstehen und konkrete Wege aufzuzeigen, wie man durch professionelles Power Pricing die Erträge steigern kann.
Kapitel 1Ein Blick über den Tellerrand
»The single most important decision in evaluating a business is pricing power.«
Warren Buffet
1.1 Power Pricing-Ansätze aus der Industrie
Hermann Simon hat den Begriff »Power Pricing« geprägt. In den letzten dreißig Jahren hat sich die Pricing Power bei vielen Banken erstaunlicherweise kaum verbessert: Die von Simon-Kucher&Partners durchgeführte »Global Pricing Study 2012«, an der 2713 Entscheider teilgenommen haben, hat ergeben, dass 75 Prozent der Banken nicht in der Lage sind, den Preis durchzusetzen, den sie verdienen. Einige Unternehmen hingegen managen die Preise und Konditionen sehr professionell und erfolgreich. Diese Fans des Power Pricings haben die Bedeutung des Preises als Gewinntreiber Nummer eins erkannt. Die meisten Banken managen ihre Preise, Zinsen und Konditionen noch nicht professionell genug. Dies ist umso erstaunlicher, als dass der Preis der Gewinntreiber schlechthin ist.
Was können Bankmanager folglich von besten Power Pricern aus anderen Industrien lernen? Wie können Banken ihr Pricing ganzheitlich und nachhaltig professionalisieren? Wie können Bankmanager sich in der Preisgestaltung ihrer Produkte und Dienstleistungen von anderen Unternehmen und Industrien inspirieren lassen?
In diesem Abschnitt beschreiben wir einige anschauliche Praxisbeispiele, die verdeutlichen, wie wichtig professionelles und aufeinander abgestimmtes Preis-, Produkt-, Vertriebs- und Kommunikationsmanagement für Banken ist.
Die Autoindustrie wendet sehr professionell das sogenannte »Value Pricing« an: Die Manager optimieren die Preise auf Basis des wahrgenommenen Kundennutzens unter Berücksichtigung der Kosten und Wettbewerbspreise. Zuvor dominierte in dieser Industrie die Kosten-Plus-Kalkulation. Hierbei wird auf Basis der Kosten eine Zielmarge aufgeschlagen. Wie wichtig es hingegen ist, die Preise auf Basis der Zahlungsbereitschaften der Kunden beziehungsweise des Kundennutzens zu optimieren, zeigt das folgende Praxisbeispiel: Wie hoch sind die Kosten für eine Metallic-Lackierung? Wir stellen Bankenmanagern häufig diese Frage. Die Standardantwort lautet: »400 Euro«. Unsere Antwort von etwa 40 Euro löst dann Erstaunen aus. Was viele Manager meinen, ist ihre Zahlungsbereitschaft für die Metallic-Lackierung, das heißt, wie viel sie für die Lackierung bereit sind zu zahlen. Nehmen wir an, die Autoindustrie würde nach wie vor auf Basis der Kosten-Plus-Kalkulation ihre Preise bestimmen. Unterstellen wir, die Kosten für die Metallic-Lackierung lägen bei 40 Euro. Bei einer großzügigen Kalkulation von 100 Prozent Marge würde der Preis 80 Euro betragen. Nun führt das Unternehmen eine professionelle Kundenbefragung durch. Der auf Basis dieser Informationen ermittelte optimale Preis beträgt 400 Euro (entspricht der Zahlungsbereitschaft der Kunden). Das ist gegenüber der Kosten-Plus-Kalkulation eine Margenerweiterung um netto 320 Euro. Bei einem Absatz von einer Million Autos bedarf es keines weiteren Kommentars im Hinblick auf die Gewinnauswirkungen. Banken können daher von der Autoindustrie bei Umsetzung des Value-Pricing-Konzepts viel lernen.
Unternehmen mit einem professionellen Preismanagement zeichnen sich weiterhin durch die vielfältige Anwendung der verschiedenen Formen der Preisdifferenzierung aus. Ihnen gelingt es, die Kunden mithilfe der großen Kraft der Preisdifferenzierung fest an das Unternehmen zu binden. »Loyalty Pricing« ist der Fachbegriff dafür. Die sechs wesentlichen Instrumente des Loyalty Pricings sollen anhand bekannter Preiskonzepte aus anderen Industrien beschrieben werden (siehe auch Abbildung 1).
[Bild vergrößern]
Abbildung 1: Power Pricing-Ansätze aus der Industrie zur Inspiration für Banken
Preisbündelung: Der Marktführer McDonald’s wendet seit mehr als 15 Jahren äußerst erfolgreich das Konzept der gemischten Preisbündelung an. Kunden können dabei sowohl die Einzelprodukte (zum Beispiel Getränk, Burger oder Pommes) als auch verschiedene Menüs auswählen. Fast automatisch wählen die meisten Kunden die Menüs. Sie nehmen zum Beispiel die Pommes Frites und die Cola dazu, obwohl sie insbesondere wegen des Burgers gekommen sind. Warum? Das Bündel der Leistungselemente ist günstiger als die Summe der Einzelprodukte. Der Preis für das Bündel liegt damit häufig im Gegensatz zu der Summe der Einzelpreise gerade noch im akzeptablen Bereich des Kunden und deckt dann auch den Burger noch ab. Außerdem empfindet der Kunde durch die höheren Einzelpreise den »Deal Effect« beim Menü (vergleiche Abschnitt 1.2). Das Gleiche gilt für einen Kunden, der den Burger dazu nimmt, obwohl er eigentlich nur wegen Pommes und Cola gekommen ist. Liegen unterschiedliche Zahlungsbereitschaften mit Blick auf die einzelnen Bündelleistungen vor, ist die Preisbündelung eine besonders ertragsoptimale Möglichkeit, mehr Produkte abzusetzen.
Daher ist die Preisbündelung auch in der Software-Industrie sehr beliebt. Das Office-Paket von Microsoft hat sich als Standard weltweit durchgesetzt. Microsoft hat das Bundling immer wieder eingesetzt, um den Erfolg bei einem bereits etablierten Produkt (zum Beispiel Word) auf ein anderes neues Produkt (zum Beispiel PowerPoint) zu übertragen. Das ist ihnen perfekt gelungen.
Bankenmanager können das Konzept der Preisbündelung besonders gut im Girokontobereich anwenden. Die zu bündelnden Leistungselemente sind Transaktionen (beleghaft, beleglos, …), Karten, Dispozinsvorteile, Guthabenverzinsung, mobileTANs und vieles mehr (siehe hierzu auch unsere Fallstudien in Kapitel 8). Aber auch in der Baufinanzierung lassen sich attraktive Bündelangebote rund um die Themen »Flexibilität« und »Sicherheit« erstellen.
Eine inspirierende Vorlage zu einem Flexibilitätspaket in der Baufinanzierung liefert die Lufthansa: Sie offeriert neben einem »Economy Saver« und einer »Economy Basis« einen »Economy Flex«-Tarif. Dort kann der Kunde kostenlos umbuchen, etwa wenn er den Flug verpasst hat. Auch erstattet Lufthansa ihrem Kunden seinen Flugpreis bei einer Änderung seiner Reisepläne. Ein weiterer Vorteil der Flex-Tarife liegt darin, dass bis zuletzt Kontingente, das heißt Sitzplätze in diesem Tarif, vorgehalten werden. Somit können die Kunden also sehr kurzfristig noch einen Flug buchen. Die Preisdifferenzierung zwischen Saver- und Flex-Tarif liegt bei einem Flug von Köln nach Berlin bei 75 bis 500 Euro. Kunden, die eine hohe Zahlungsbereitschaft haben, wählen den für sie sehr bequemen Flex-Tarif und profitieren von den hohen Flexibilitätsrechten. Kunden mit sehr geringer Zahlungsbereitschaft finden in dem Saver-Tarif eine günstige Alternative. Sie müssen jedoch auf Flexibilitätsrechte verzichten, das heißt sehr frühzeitig buchen, ohne die Möglichkeit zu haben, ihre Reiseplanung später zu verändern. Dadurch wird ein »Zaun« um dieses günstige Angebot gezogen, der Kunden mit hoher Zahlungsbereitschaft davon abhält, dieses Angebot zu wählen. Man nennt dies in der Fachsprache »Fencing«. Es gibt immer Kunden mit hoher Zahlungsbereitschaft, auch bei Banken. Diese nicht durch ein differenziertes Angebot zu nutzen, bedeutet, Erträge zu verschenken. Gleichzeitig gibt es immer sehr preissensible Kunden. Diesen nicht einen »geschützten« günstigen Tarif zu offerieren, bedeutet ebenfalls, Erträge zu verschenken, weil diese Kunden dann nicht gewonnen werden können. Das Fencing ist die hohe Kunst der Preisdifferenzierung.
Übertragen auf die Baufinanzierung bedeutet dies, einen sehr attraktiven Basistarif anzubieten, der jedoch keine oder nur sehr geringe Flexibilitätsrechte enthält. Der teurere Flex-Tarif enthält dann umfangreiche Sondertilgungsrechte, das Recht zur Änderung der Darlehensrate während der Laufzeit und das Recht zur vorübergehenden Aussetzung der Tilgung. Je nach Zahlungsbereitschaft und Bedürfnis werden sich die Kunden für eines der Modelle entscheiden.
Die Kompatibilität unterschiedlicher Produkte ist ein weiteres Instrument des Mehr-Produkt-Pricings. Man nennt es Systemgeschäft. Der Software-Hersteller Microsoft hat mit den Office-Paketen solch ein System geschaffen. Die Programme sind miteinander verknüpft. Einmal eingeloggt, wird man zum loyalen Kunden. Besonders bekannte Systemgeschäfte haben auch Anbieter wie Gillette und Hewlett Packard aufgebaut. Kunden, die den Rasierapparat zusammen mit 5 Klingen für einen attraktiven Preis erworben haben, sind anschließend an das System gebunden. Beim Nachkauf der hochpreisigen Rasierklingen verdient der Anbieter dann prächtig. Ähnliches gilt bei Druckern. Der Drucker als Startinvestition ist in der ersten Wahrnehmung der Kunden extrem günstig, Folgekäufe für Druckerpatronen werden von vielen Kunden nicht bedacht. Nach dem Erstkauf ist der Kunde dann technisch gebunden. Beim Nachkauf der Druckerpatronen verdienen die Anbieter viel Geld, weil sie – auch aufgrund der Wechselkosten der Kunden – hohe Preise durchsetzen können.
Auch Apple hat ein System aufgebaut, das die Kunden sukzessive komplettieren wollen. Apple hat mit iPad, iPhone und iPod ein konsistentes Produktsystem aufgebaut. Nach dem Lock-in des Kunden beim Erstkauf entsteht der Wunsch, das komplette Set der »i-Produkte« (ggf. in der gleichen Farbe) aufzubauen. Wettbewerberprodukte werden nicht mehr beachtet, Preise nicht mehr verglichen; zu groß ist der Wunsch, das System zu komplettieren. Das ist eine Idealvorstellung für jeden Anbieter.
Nichtlineare Preisbildung: Die nichtlineare Preisbildung ist eine weitere intelligente Form der Preisdifferenzierung. Ein sehr gutes Praxisbeispiel stellt die BahnCard der Deutschen Bahn AG dar. 1993 wurde die BahnCard 50 eingeführt: Der Kunde zahlt eine einmalige Jahresgebühr und erzielt einen Rabatt von 50 Prozent auf jede Fahrkarte. Damit wurden Bahnreisen im variablen Preis billiger als Fahrten mit dem eigenen PKW oder dem Flugzeug. Die BahnCard ist mittlerweile ein Riesenerfolg für die Deutsche Bahn AG. Mit ihrer Hilfe hat sie Umsatz und Gewinn nachhaltig erhöht und Kunden wirksam an sich gebunden. Was macht das Preismodell so erfolgreich? Drei wesentliche Gründe lassen sich anführen:
Nach Kauf der BahnCard haben die Kunden das Bestreben, die Karte auch einzusetzen. Ansonsten wäre deren Kauf ja ein Fehlinvestment gewesen.
Die einmaligen Kosten der BahnCard sind schnell vergessen beziehungsweise – wissenschaftlicher gesprochen – bei Folgeentscheidungen nicht mehr entscheidungsrelevant. Die Kunden vergleichen also den um 50 Prozent reduzierten Preis mit den Preisen der Wettbewerber, ohne den vorab gezahlten Grundpreis auf die Bahnfahrt umzurechnen. Warum auch? Die Entscheidung für die BahnCard wurde ja in der Vergangenheit bereits getroffen. Das bringt einen großen Vorteil gegenüber den Wettbewerbern mit sich. Das ist Pricing-Intelligenz!
Aufgrund des preispsychologischen »Separation Effects« können die Kunden die einzelne Bahnfahrt mehr genießen, wenn zumindest ein Teil der Kosten nicht im Zusammenhang mit der konkreten Nutzung steht. Die Bahnfahrt wird dann weniger infrage gestellt (»Muss ich da wirklich hinfahren?«).
Eine Befragung von Bahnkunden bestätigte die Bindungswirkung der BahnCard. 59 Prozent der BahnCard-50-Kunden, 55 Prozent der BahnCard-25-Kunden, aber nur 39 Prozent der Kunden ohne BahnCard gaben an, bei ihrer Bahnfahrt keine Alternative erwogen zu haben.2
Der BahnCard-Preistarif ist eine besonders zielgenaue Variante des Loyalty Pricings, da Kunden mit jedem weiteren gefahrenen Kilometer rechnerisch einen niedrigeren Preis pro Kilometer erhalten. Der Preis pro Kilometer konvergiert bei einer BahnCard 50 sukzessive gegen einen Preisvorteil von 50 Prozent. Wer mehr kauft, bekommt einen besseren Preis. Diese alte »Kaufmannsregel« wird also perfekt abgebildet.
Banken und Sparkassen haben verschiedene Anwendungsmöglichkeiten für nichtlineare Preisbildung. Zwei Produktfelder sind besonders geeignet:
Depotgeschäft:
Statt einer BahnCard 50 ist auch eine DepotCard 50 darstellbar. Die Effekte sind die gleichen wie bei der BahnCard: Der Kunde zahlt für die DepotCard und erhält dann zum Beispiel 50 Prozent Preisvorteil auf jede Transaktion. Die Volksbank Offenburg, aber auch die Deutsche Bank hat im Depotgeschäft ein solches Preismodell. Auch bei der DepotCard wird der Kunde die Transaktionen bei der Bank bündeln, um die DepotCard zu nutzen. Der reduzierte Preis wird mit den Wettbewerberpreisen verglichen, ohne eine Verrechnung mit dem Grundpreis vorzunehmen. Und der Kunde ist zufriedener bei der einzelnen Transaktion, weil diese kostenmäßig nicht so große »Schmerzen« verursacht. Eine Transaktion, die er vorher gegebenenfalls aus Kostengründen nicht getätigt hätte, wird nun durchgeführt. Die Transaktionsanzahl steigt bei der Bank. Vor dem Hintergrund der negativen Entwicklung der Transaktionsanzahl in vielen Banken und Sparkassen in den letzten zwei bis drei Jahren ist das sicher eine gute Nachricht.
Geschäftskontomodelle:
Statt einer BahnCard 25 oder BahnCard 50 ist hier eine BankCard 25 oder BahnCard 50 denkbar. Der Kunde zahlt einen erhöhten Grundpreis und erhält einen Preisvorteil von 25 oder 50 Prozent auf alle Buchungen und Karten. Firmenkunden haben oft bei mehreren Banken eine Kontoverbindung. Jede weitere Buchung, die sie von einer anderen Bank zu der Bank verlagern, die die BankCard anbietet, wird mit 25 oder 50 Prozent Preisvorteil verbucht. Das schafft starke Anreize, den Zahlungsverkehr bei einer Bank zu bündeln. Das erklärt, warum neben der Deutschen Bank auch immer mehr Regionalbanken ein solch intelligentes Preismodell auf die Geschäftskonten übertragen.
Mehr-Personen-Pricing: Das Mehr-Personen-Pricing ist ein weiteres Instrument des Loyalty Pricings. Ziel des Mehr-Personen-Pricings ist es, ganze Verbünde von Personen (meist Familien) über Anreizsysteme an den Anbieter zu binden. Ist die Preisgestaltung abhängig von der Kundenbeziehung zum Familienverbund, entstehen aufgrund der hohen Komplexität hohe Wechselkosten. Ein Beispiel hierfür ist das Preismodell von Vodafone für Familien. Der Kauf von Partner-SIM-Karten für Familienangehörige wird durch attraktive Preisvorteile angeregt. Die Familienangehörigen können dann kostenlos mit ihrem Vodafone-Tarif miteinander telefonieren. Weiteres Element dieser Mehr-Personen-Pricing-Philosophie bei Vodafone ist der »CallYa SuperFlat Teens«-Tarif. Das ist ein durch die Eltern zubuchbarer Prepaid-Tarif für die Kinder. Selbst wenn kein Guthaben mehr auf der Karte ist, können die Kinder die Nummern der Eltern immer noch weiter antelefonieren. Das gibt Sicherheit. Weitere Leistungen wie ein »Handy-Taschengeld« komplettieren das Angebot. Ist der gesamte Familienverbund erst einmal beim gleichen Anbieter, ist ein Wechsel sehr unwahrscheinlich, da die Wechselkosten zu hoch sind. Das ist schlaues Pricing im Sinne einer nachhaltigen Ertragspower.
Den gesamten Familienverbund als Kunde zu gewinnen, ist auch das Ziel vieler Banken. Die Deutsche Bank offeriert ihren Kunden zum Beispiel einen 50-Prozent-Familienbonus im Girokontobereich. Kostenlose Buchungen zwischen Familienangehörigen oder im Firmenkundensegment zwischen Tochterunternehmen wären weitere Ansatzpunkte.
Pricing nach Dauer der Kundenbeziehung: Die vierte Form des Loyalitäts-Pricings ist eine Preisdifferenzierung nach Dauer der Kundenbeziehung. Fitnessstudios bieten häufig günstigere Tarife an, wenn die Kunden sich längerfristiger an das Fitnessstudio binden. So bietet die Fitnessstudiokette VeniceBeach folgende Tarife an:
8,95 Euro wöchentlich bei 24 Monaten Laufzeit
10,95 Euro wöchentlich bei 12 Monaten Laufzeit
12,95 Euro wöchentlich bei 6 Monaten Laufzeit
Ein weiteres klassisches Beispiel für ein Pricing nach Dauer der Kundenbeziehung sind Dauerkartenangebote von Fußball-Clubs. Borussia Dortmund bietet eine Dauerkarte an, in der alle 17 Bundesliga-Heimspiele der nächsten Saison und die drei Heimspiele der Gruppenphase der Champions League enthalten sind. Der Preis für diese Dauerkarte entspricht in den unterschiedlichen Kategorien dem Einzelpreis von 15 Bundesliga-Heimspielen. Der Kunde erhält also für seine Zusage, alle Heimspiel-Karten einer Saison abzunehmen, einen Preisvorteil von zwei Bundesliga-Heimspielen plus drei Champions-League-Spiele. Borussia Dortmund hat so abgesicherte Erträge über die Saison und der Kunde einen attraktiven Preisvorteil. Eine klassische Win-Win-Situation. Zusätzlich bietet Borussia Dortmund die Möglichkeit, zwei Zusatzpakete zuzubuchen. Beim »National«-Paket erhält der Inhaber der normalen Dauerkarte zusätzlich alle DFB-Pokalheimspiele per Dauerkarte, bei »International« alle weiteren Champions-League-Heimspiele.
Auch mit Blick auf diese Form des Loyalitäts-Pricings gibt es viele Anwendungsmöglichkeiten im Bankgeschäft. Ganz besonders geeignet hierfür ist das Einlagengeschäft. Je länger der Kunde der Bank das Geld zur Verfügung stellt, desto höher ist der Zins. Für die Bank ergeben sich zwei Effekte: Zum einen hat sie über einen längeren Zeitraum sichere Erträge und Refinanzierungsmittel. Zum anderen kann sie das Geld längerfristiger anlegen. Je verbindlicher die Zusage des Kunden ist, desto weniger Zinsänderungsrisiken ergeben sich für die Bank aus der längerfristigen Anlage. Insofern sollten sich immer die Dauer des zugesagten Anlagehorizonts und die Verbindlichkeit der Zusage im Pricing niederschlagen, um die Kunden zu loyalen Kunden zu machen.
Statusorientiertes Pricing: Kunden können einen großen (emotionalen) Nutzen empfinden, wenn sie einen Tarif wählen, der nach außen hin ihre Stärke, Finanzkraft oder ihren Status dokumentiert. Dabei gilt es auch Erkenntnisse der »Farbenlehre« zu beachten.
Ein Beispiel hierfür liefert die Farblogik der unterschiedlichen Bremssättel von Porsche-Modellen. Diese Bremssättel sind in den Rädern der Autos für alle Betrachter gut sichtbar. Alle Fahrzeuge haben je nach Motorleistung standardmäßig entweder schwarze (Basis- und Dieselmotoren), silberne (ausgewählte S-Modelle) oder rote Bremssättel (ausgewählte S- und alle Turbo-Modelle). Die absoluten Top-Modelle (zum Beispiel Porsche 911 GT2 RS) haben gelbe Bremssättel inklusive. Bei der »gelben Bremse« handelt es sich um eine besonders leichte Keramik-Bremse. Diese Bremse kann bei allen anderen Modellen zugebucht werden. Der Preis für diese Extra-Leistung: über 8000 Euro.
Von der Farbe der Bremssättel geht ein Signal aus mit Blick auf die Motorleistung und den Wert des Sportwagens sowie den Zukauf besonderer und sehr teurer Extras. Die für alle gut sichtbare Farblogik ist ein Marketing-Instrument, um besonders hochpreisige Modellvarianten und Extras an statusorientierte Kunden zu verkaufen. Nicht jeder, der die gelben Bremssättel wählt, braucht diese vermutlich, um seine Performance auf der Rennstrecke zu verbessern. Auch in der Stadt stiften die Bremsen ihren Fahrern Nutzen, und zwar nicht nur beim Bremsen.
Auch im Bankgeschäft gibt es viele Gelegenheiten, über statusorientiertes Pricing eine umfangreichere und hochwertigere Leistung an den Kunden zu verkaufen. Ganz besonders geeignet für diese Form der Preisdifferenzierung ist das Kartengeschäft. So bietet die HypoVereinsbank ihren Private-Banking-Kunden (Zugang ab ca. 500000 Euro verwaltetem Vermögen) eine schwarze Premium-Card. Das ist eine Kreditkarte mit vielen Leistungsvorteilen. Die Karte verschafft ihrem Inhaber kostenfreien Zugang zu über 600 Airport Lounges. Auch ein Concierge-Service ist inkludiert. Dazu kommt natürlich auch hier der nicht zu unterschätzende »Signaling-Vorteil«. Mit der Karte zu zahlen, bereitet vielen Kunden Freude. Sie fühlen sich gut. Sie genießen die Anerkennung und die Aufmerksamkeit, die ihnen von einem Händler, einem Gastronom oder einem anderen Kunden entgegengebracht wird. Ergebnis des Angebots sind ein zufriedener Kunde und eine zufriedene Bank, die einem loyalen Kunden ein umfangreiches Leistungspaket bieten kann.
Loyalitäts-/Bonusprogramme: Die Einführung eines Loyalitäts-/Bonusprogramms ist die letzte und umfassendste Form des Loyalty Pricings. Bekannte Bonusprogramme sind das Programm »Miles&More« von Lufthansa oder das unternehmensübergreifende Punktesammelprogramm Payback. Bei Payback wird der Kunde vor allem durch die Vergabe von Sachprämien zum Wiederkauf angeregt. Nicht bei jedem Einsatz der Payback-Karte erhält der Verbraucher eine Bonusleistung, sondern erst, wenn die gesammelten Punkte in Prämien eingelöst werden. Payback kooperiert u.a. auch mit Partnern aus dem Finanzdienstleistungsbereich. Wer bei der readybank einen »ready&go credit« aufnimmt, erhält einen Payback-Punkt je 10 Euro Kreditbetrag. Ob dadurch tatsächlich eine stärkere Bindung zur readybank entsteht oder »nur« zu Payback, ist kritisch zu hinterfragen.
Das beste bestehende Loyalitäts- und Bonusprogramm ist vermutlich das »Miles&More«-Programm der Deutschen Lufthansa. Über 70 Prozent der Teilnehmer einer Studie bestätigten, dass sie ohne Miles&More weniger mit der Lufthansa fliegen würden.3 Besonders wichtig sind den Kunden neben den Prämienmeilen insbesondere die Statusmeilen. Das bestätigt die Mehrheit der befragten Kunden. Lufthansa unterscheidet die folgenden vier Statuslevels: Basis, Frequent Traveller, Senator und HON Circle. Je nach Statuslevel profitiert der Kunde von Extraleistungen. Ein wesentliches Element ist der Zugang zu exklusiven Lounges an den Flughäfen. Inhaber der Frequent Traveller Card haben Zugang zur Business Lounge. Senator-Kunden können die Senator-Lounge nutzen und dort auch kostenlos essen. HON-Kunden stehen die First Class Lounges offen. Dort profitieren sie von einem Personal Assistant, einem gediegenen Ambiente, der Möglichkeit, ein Bad zu nehmen oder zu schlafen und exklusive Speisen und Getränke zu sich zu nehmen. Alles inklusive. Diese Status- und Servicevorteile erklären auch, warum die Studie zur Kundenbindung ergab, dass 72 Prozent der Frequent Traveller und 64 Prozent der Senator-/HON-Circle-Karteninhaber auch dann den Lufthansa-Flug präferieren würden, wenn sie im Gegensatz zum Flugangebot einer anderen Airline umsteigen müssen. Alles nur, um die Lufthansa-Statusmeilen zu bekommen und das Statuslevel abzusichern beziehungsweise das nächste zu erreichen. Das ist Loyalität, die sich jedes Unternehmen von seinen Kunden nur wünschen kann.
Von diesem Beispiel können Banken viel lernen. Jede Bank sollte das Ziel haben, die Beziehungen zu den Kunden zu verbessern beziehungsweise zu intensivieren und sich als Hausbank zu positionieren. Kundenloyalität verspricht zufriedenere Kunden und auf der Erlösseite signifikanten ökonomischen Erfolg. Loyale Kunden nutzen als Ergebnis einer ganzheitlichen Beratung mehr Leistungen ihrer Hausbank, sind weniger wechselbereit, greifen weniger auf Zweitanbieter zurück, empfehlen das Kreditinstitut aktiv weiter und sind weniger preissensibel. Kurzum: Ein treuer und zufriedener Kunde ist ein rentabler Kunde.
Fazit:Banken können von der Pricing-Exzellenz führender Unternehmen in anderen Branchen viel lernen. Das gilt insbesondere auch beim Ansatz des vielfältigen Menüs der Preisdifferenzierung zur Bindung der Kunden. Preisbündelung ist insbesondere im Produktfeld Privatgirokonto und Baufinanzierung sehr gut einsetzbar. Das nichtlineare Pricing passt perfekt in das Depotgeschäft und für Preismodelle im Bereich der Geschäftsgirokonten. Pricing nach Dauer der Kundenbeziehung ist eine Möglichkeit, im Einlagengeschäft Kunden zu binden. Diese Formen des Loyalty Pricings in den einzelnen Produktfeldern sollten kombiniert werden mit einem umfassenden Loyalitäts-/Bonusprogramm, das immer auch Statuselemente enthalten sollte. In den folgenden Kapiteln zeigen wir auf, wie Banken solche innovativen Konzepte erfolgreich umsetzen können.
Checkfragen:
Inwieweit und wie oft lassen Sie sich von Best Practices aus anderen Branchen inspirieren?
Die Übertragung welches branchenfremden und innovativen Preismodells auf Ihr Institut würde Ihnen am meisten helfen, Ihre Wettbewerber zu verblüffen?
Beachten Sie bei der Optimierung der Preise stets die Zahlungsbereitschaft der Kunden und nicht nur die Kosten (Stichwort: Metallic-Lackierung)?
Welche Formen des Loyalty Pricings setzen Sie ein?
Wie stellen Sie sicher, dass Ihr Institut die Hausbank Ihrer Kunden ist?
1.2 Power Pricing-Erkenntnisse aus der Psychologie
»Esse est percipi.«
George Berkeley, englischer Philosoph
Die wenigsten Menschen verhalten sich wie ein Homo oeconomicus, denn emotionale Aspekte haben eine große Bedeutung in Entscheidungsprozessen. Bei der Entscheidung für ein Preis-/Leistungsangebot gilt dies ganz besonders, wenn die Motivation und die Fähigkeiten, sich mit den Angeboten auseinanderzusetzen, eher gering sind. Dies trifft auf viele Bankprodukte zu. Bankmanager, die den subjektiven Wahrnehmungsprozess ihrer Kunden genau verstehen, entwickeln daher auch die erfolgreicheren Leistungsangebote. Die wissenschaftliche Disziplin der Preispsychologie kommt immer weiter voran. Auf den folgenden Seiten geben wir daher einen Einblick in die neuesten Erkenntnisse über preispsychologische Effekte und präsentieren fünf der wichtigsten.4 Wir haben sie in dieser aktualisierten Auflage vorangestellt, da sie unserer Ansicht nach Pflichtlektüre für jeden Bankmanager sind. Deren Verständnis können Bankmanager leicht und innerhalb kürzester Zeit in signifikante Mehrerträge umwandeln. Denn der Preis ist wie gesagt der Gewinntreiber Nummer eins. In Kapitel 6 werden wir dann weitere Erkenntnisse der Preispsychologie darstellen.
1.2.1. Der »Deal Effect«
Der erste wichtige Effekt der Preispsychologie ist der sogenannte »Deal Effect«. Der Kunde vergleicht einen Preis mit einem »internen Akzeptanzniveau«. Ist das Angebot fair? Hat er das Gefühl, einen »guten Deal« zu machen, nimmt er ein Angebot zufrieden an. In Abbildung 3 sehen Sie das Ergebnis eines Experimentes zum »Deal Effect«. Wir haben Kunden gefragt, welches der Angebote A oder B beziehungsweise A, B oder C sie wählen würden. Wird nur die Variante A und B angeboten, würden 41 Prozent das pure Girokonto und 59 Prozent das gebündelte Angebot von Girokonto und Kreditkarte wählen. Bietet die Bank im zweiten Fall hingegen zusätzlich eine bedeutungslose Alternative B an, verschiebt sich die Verteilung deutlich in Richtung des Bündelangebots C. Jetzt würden 81 Prozent Variante C nehmen. Warum? Weil der Kunde das Gefühl hat, ein gutes Geschäft gemacht zu haben. Er bekommt Girokonto und Kreditkarte zum Preis der Kreditkarte.
[Bild vergrößern]
Abbildung 2: Wichtige Effekte der Preispsychologie im Überblick
Fazit:Setzen Sie immer den richtigen Preisanker innerhalb Ihrer Preismodelle, zum Beispiel im Girokontobereich durch ein Individualkonto. Dann erlebt der Kunde den »Deal Effect« in den Pauschalmodellen. Die Ertragseffekte durch die Nutzung solch einer Erkenntnis der Preispsychologie können erheblich sein!
[Bild vergrößern]
Abbildung 3: Richtige Ankerpreise für den »Deal Effect« (1/2)
Ein weiteres Beispiel für einen solchen »Deal Effect« finden Sie in Abbildung 4. Dort wird ein Bündel von Kaffee/Cappuccino mit einem Croissant vor 10:30 Uhr zu einem Vorzugspreis angeboten. Zusätzlich werden die regulären Preise angegeben. Sie sind zwar in den meisten Fällen bedeutungslos, da das vorgestellte Bündel typischerweise ohnehin vor 10:30 Uhr gewählt wird. Sie schaffen jedoch einen Preisanker, der das Bündelangebot besonders attraktiv erscheinen lässt. Der Kunde empfindet den »Deal Effect« und greift zufrieden zu. Übertragen auf das Bankgeschäft bedeutet dies: Prüfen Sie, ob Sie zusätzlich zu dem bestehenden Preis-/Leistungsangebot hohe Ankerpreise für einzelne Leistungselemente kommunizieren können, ohne sie wirklich durchsetzen zu wollen. Sie dienen jedoch dazu, die Wahrnehmung der bestehenden Preise zu verbessern. So könnten Sie in der Anlageberatung Preise für Beratung und Betreuung kommunizieren (zum Beispiel 100 Euro pro Stunde), die dann in den Depotpreismodellen als Teil des Preises für »Verwahrung und Verwaltung« (zum Beispiel 0,2 Prozent p.a.) komplett enthalten sind. Die zusätzliche Angabe dieser Einzelpreise wird die Durchsetzung des bestehenden Preises bei »Verwahrung und Verwaltung« deutlich verbessern – mit entsprechenden Ertragswirkungen. Das sind die Effekte der Preispsychologie.
[Bild vergrößern]
Abbildung 4: Richtige Ankerpreise für den »Deal Effect« (2/2)
Beachten Sie den »Deal Effect« auch bei der Kommunikation von Rabatten beziehungsweise Preisvorteilen. In Abbildung 5 finden Sie ein weiteres Preisexperiment. Wir haben Befragte mit folgenden Entscheidungssituationen konfrontiert: Sie wollen einen Monitor (Fall 1) beziehungsweise einen Taschenrechner (Fall 2) in einem Elektronikgeschäft kaufen. Die dortigen Preise sind 125 Euro für den Monitor beziehungsweise 15 Euro für den Taschenrechner. Dann erfahren Sie, dass Sie das jeweilige Produkt bei einem anderen Händler, dessen Geschäft 20 Autominuten entfernt liegt, 5 Euro günstiger erhalten. Nehmen Sie den Aufwand auf sich und fahren zu diesem Händler oder kaufen Sie vor Ort das jeweilige Produkt? Die meisten Befragten würden im Falle des Taschenrechners fahren, um den Preisvorteil von 5 Euro zu nutzen, den Monitor aber vor Ort kaufen und auf den günstigeren Preis verzichten. Warum? 5 Euro sind doch 5 Euro, egal ob man sie beim Monitor oder Taschenrechner einspart? Das ist richtig, aber nur rational betrachtet. Die »irrationale« Preiswahrnehmung ist eine andere: Nur im Falle des Taschenrechners empfinden die Kunden den »Deal Effect«. Beim Monitor wirken die 5 Euro im Vergleich zum Ausgangsniveau von 125 Euro als zu gering. Das Webersche Gesetz beschreibt dieses Phänomen wissenschaftlich wie folgt: Die Empfindung der Differenz zwischen zwei Reizen verhält sich proportional zum absoluten Niveau dieser Reize. Das heißt konkret für unser Beispiel: Der Preisvorteil beim Monitor müsste auch bei 33 Prozent, also bei rund 40 Euro liegen, um den gleichen »Deal Effect« zu erzeugen wie beim Taschenrechner.
[Bild vergrößern]
Abbildung 5: Richtige Ankerpreise für die Kommunikation von Preisvorteilen
Fazit:Beziehen Sie Preisvorteile als Reiz immer auf den richtigen Anker. Das bedeutet beispielsweise konkret: Wenn Sie ein Bonusprogramm einsetzen und pro 5000 Euro Einlagenvolumen 1 Euro Bonus kommunizieren, pro 1000 Euro Kreditkartenumsatz 2 Euro usw., dann werden Sie den »Deal Effect« nicht erreichen. Der Kunde wird sein Verhalten nicht verändern. Die Rückvergütung kostet nur Geld. Schaffen Sie stattdessen lieber eine interne Punktewährung, die etwas gewaltiger wirkt (50 Punkte je 1000 Euro Einlagenvolumen) und rechnen Sie die aggregierten Punkte anschließend als Rabatt auf den monatlichen Preis für das Girokonto um. Der Preis für das Girokonto steht häufig am meisten im Fokus der Kunden und steht absolut betrachtet in einem günstigen Verhältnis zu den Rückvergütungen: Ab X Punkten erhalten Sie das Girokonto kostenlos beziehungsweise zum halben Preis. Das erzeugt eine Wirkung!
Der »Deal Effect« erklärt auch, warum Kunden bereit sind, für ein Produkt ganz unterschiedliche Preise zu bezahlen. Stellen Sie sich folgende Situation vor: Sie liegen an einem heißen Tag an einem herrlichen Strand im Liegestuhl und haben Lust auf ein Bier. Ein Freund bietet Ihnen an, Ihnen ein kühles und frisches Bier aus der Bar des 5-Sterne-Resort-Hotels hinter Ihnen mitzubringen. Er fragt Sie, was Sie dafür zu zahlen bereit wären. Was antworten Sie ihm? Viele würden jetzt 3 bis 4 Euro sagen. Diesen Preis würden sie zahlen und trotzdem sehr zufrieden sein. Gleiches Experiment, leicht andere Ausgangssituation: Hinter dem herrlichen Strand befindet sich nun kein 5-Sterne-Resort-Hotel, sondern ein Supermarkt. Der Freund geht dorthin, um genau das gleiche Bier (ebenfalls gekühlt) zu kaufen. Was wären Sie nun bereit zu zahlen? Wahrscheinlich deutlich weniger, oder? Aber warum? Das Bier ist genau das gleiche! Sie verlassen Ihren Liegestuhl in beiden Fällen nicht! Der Grund ist wiederum der »Deal Effect«. Ein teures Bier aus dem 5-Sterne-Hotel entspricht Ihrem Akzeptanzniveau. Im Supermarkt liegt dieses deutlich niedriger.
Und selbst wenn 5-Sterne-Hotel und Supermarkt direkt nebeneinander lägen, würden einige Kunden das Bier aus der Strandbar des Hotels holen und einen höheren Preis zahlen. Vielleicht weil die Bedienung in der Strandbar besonders attraktiv ist, das Bier in einem schönen Glas mit dem Namen des Hotels gereicht wird (Signalisierung der eigenen finanziellen Stärke) oder der Kunde einfach eine Premium-Leistung genießen will.
[Bild vergrößern]
Abbildung 6: Die differenzierte Depotlandschaft der Volksbank Offenburg
Fazit:Stellen Sie sicher, dass Sie in der Wahrnehmung der Kunden das 5-Sterne-Hotel sind! Denn Kunden sind durchaus bereit, für die gleiche Leistung unterschiedliche Preise zu bezahlen: Also bei Ihnen zum Beispiel 7,90 Euro pro Monat für das Konto anstatt bei einem Online-Anbieter 0,00 Euro. Entscheidend ist, ob der Preis mit dem Akzeptanzniveau des Kunden in Einklang steht. Die Preise der Wettbewerber sind dann zweitrangig.
Die Volksbank Offenburg hat zum Beispiel im Depotgeschäft viele Leistungen und Mehrwerte, die sie ihren Kunden bietet, zu drei attraktiven Leistungspaketen zusammengefasst. In Abbildung 6 findet sich ein Auszug aus dem interaktiven Depotmodell-Finder, den die Bank auf ihrer Homepage bereithält. Der Kunde hat die Möglichkeit, das ganzheitliche Leistungsspektrum einfach und transparent wahrzunehmen. Die Optik und die »Farbenlehre« der Angebote helfen dabei, die Hochwertigkeit des Angebots zu vermitteln. Das Akzeptanzniveau der Kunden mit Blick auf eine Bepreisung der Leistungen steigt.
1.2.2. Beachtung des »Separation Effects«
Der »Separation Effect« beschreibt die Beobachtung, dass eine bewusste zeitliche Trennung der Zahlung einer Leistung und deren Nutzung Kunden häufig einen größeren Nutzen stiften als eine Zahlung pro Nutzungseinheit. Ein Beispiel dafür sind Telefon-Flatrates: Der Kunde zahlt einen fixen Preis und erhält dafür ein Minutenpaket oder eine unbegrenzte Möglichkeit zur Nutzung bestimmter Netze (zum Beispiel Festnetz). Eine Befragung ergab, dass Kunden selbst dann eine Flatrate vorziehen, wenn sie wissen, dass eine Einzelabrechnung in den meisten Fällen günstiger wäre. Warum ist das so? Sie können die Nutzung, sprich in diesem Fall das Telefonieren, mehr genießen. Sie müssen nicht permanent über die zusätzlichen Kosten des Weitertelefonierens nachdenken. Ein anderes Beispiel sind Resort-Hotels, die ein All-inclusive-Angebot bieten. Kunden müssen hier nur für Extraleistungen zahlen. Buffet und Getränke sind inklusive. Viele Kunden schätzen dieses Angebot. Natürlich zahlen diese Kunden über den Hotelpreis letztendlich auch diese inkludierten Leistungen, vielleicht zahlen sie sogar mehr als bei Einzelabrechnung. Aber sie können auch hier die Nutzung, also etwa das Essen und Trinken, mehr genießen. Ein zusätzlicher Genuss verursacht keine zusätzlichen Kosten. Die Entscheidung für das Hotel und die damit verbundenen Kosten haben die Kunden in der Vergangenheit getroffen. Die Entscheidung ist abgehakt. Es gibt keinen Grund mehr, nachzudenken. Das gibt Entspannung. Vielleicht das berühmteste Preismodell, das sich den »Separation Effect« zunutze macht, ist die bereits angesprochene BahnCard. Der Kunde zahlt zum Beispiel bei der BahnCard 50 einmal pro Jahr eine Grundgebühr. Die BahnCard 50 berechtigt ihn dann, bei jeder Bahnfahrt einen Preisvorteil von 50 Prozent zu bekommen. Die einzelne Bahnfahrt tut dann in der Wahrnehmung der Kunden nicht mehr so weh. Die Leistung wird daher häufiger und zufriedener in Anspruch genommen. Eine Verrechnung von Teilen des Grundpreises für die Karte auf den Preis pro Bahnfahrt wird von den Kunden nicht vorgenommen. Der reduzierte Preis wird auch ohne Berücksichtigung des Grundpreises mit den Wettbewerbspreisen, etwa für einen Flug, verglichen.
Fazit:Prüfen Sie, ob Sie Nutzung und Zahlung des Kunden auch bei Bankleistungen voneinander trennen können. Bei Privatgirokontomodellen sind Flatrate-Lösungen schon relativ verbreitet. Alle beleglosen und oft auch alle beleghaften Buchungen sind inklusive. Im Bereich der Depotpreismodelle gibt es hier bei vielen Banken noch Nachholbedarf.
Die Volksbank Offenburg hat dieses Bedürfnis der Kunden erkannt. Analog zur BahnCard 50 hat sie quasi eine DepotCard 50 eingeführt. Der Kunde zahlt etwa für das Leistungspaket »Premium Aktiv« einen erhöhten Depot-Grundpreis und erhält dafür neben anderen Wertpapier-Dienstleistungen das Recht, jede Wertpapier-Transaktion mit einem Preisvorteil von 50 Prozent durchzuführen (siehe Abbildung 6 als Ausschnitt aus dem interaktiven Depot-Modellfinder). Die einzelne Transaktion verursacht daher nicht mehr so hohe Kosten und damit »Schmerzen«. Der Kunde ist bereit, häufiger Transaktionen zufrieden durchzuführen. Er muss sich über Transaktionskosten nicht mehr so viele Gedanken machen.
1.2.3. Beachtung des Effekts »Paradox of choice«
Das Phänomen »Paradox of choice« beschreibt, dass ein differenzierteres Leistungsangebot zwar als attraktiver wahrgenommen wird, die Entscheidungskosten für den Kunden aber steigen. Das soll durch folgendes Experiment verdeutlicht werden: Es wurden zwei Gruppen gebildet, die Marmeladen probieren und gegebenenfalls kaufen sollten: Die Gruppe 1 hat sechs Marmeladengläser zur Auswahl bekommen, der Gruppe 2 wurden 24 Marmeladen präsentiert. Welche Gruppe hat das Angebot als attraktiver wahrgenommen? Welche Gruppe hat mehr probiert? Welche Gruppe hat mehr gekauft? Die Gruppe 2 hat das Angebot als attraktiver wahrgenommen. Die höhere Anzahl an Möglichkeiten überzeugt den Kunden. Die Wahrscheinlichkeit, das beste Produkt, also eine neue »Lieblingsmarmelade«, zu finden, ist größer. Dieses Ergebnis entspricht der klassischen Wirtschaftstheorie. Entgegen der Wirtschaftstheorie probierten und kauften die Kunden der Gruppe 2 aber weniger. Die Entscheidungskosten waren zu groß. Die Entscheidung wurde vertagt. Häufig sieht man den Kunden dann nie wieder.
Diese Erkenntnis schafft für Bankmanager einen Trade-off. Auf der einen Seite kann durch ein differenziertes Angebot ein »Differenzierungsgewinn« erzielt werden: Die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kunden können besser adressiert werden. Die unterschiedlichen Zahlungsbereitschaften lassen sich besser abschöpfen. Das differenzierte Angebot wird als attraktiver wahrgenommen. Der Differenzierungsgewinn ist besonders groß bei einem Übergang von nur einer Preis-/Leistungsvariante zu einem zwei- oder dreigliedrigen Angebot. Der zusätzliche Differenzierungsgewinn nimmt dann mit jeder weiteren Leistungsalternative ab. In Abbildung 7 haben wir diesen Zusammenhang grafisch verdeutlicht. Dem Differenzierungsgewinn steht die höhere Komplexität eines differenzierten Angebots gegenüber. Die zusätzliche Komplexität steigt überproportional an. Das heißt, beim Übergang von nur einem zu zwei oder drei Leistungsvarianten ist die zusätzliche Komplexität noch überschaubar, steigt danach aber deutlich an. Ziel ist es, die größte Spanne von Differenzierungsgewinn und Komplexität zu finden. Ganz wichtig ist die Erkenntnis, dass die Komplexität differenzierter Leistungsangebote durch Modellfinder beziehungsweise Konfiguratoren deutlich reduziert werden kann. Der Kunde kann mithilfe solcher interaktiven Kommunikationsinstrumente passend zu seinen Bedürfnissen das richtige Leistungsangebot finden. Auf Basis seiner Eingaben erhält der Kunde eine klare Empfehlung. Der Kunde sieht quasi nur eines der Angebote, und zwar das richtige. Sprich: Die optimale Anzahl an Varianten ist bei Einsatz eines interaktiven Modellfinders höher als ohne.
[Bild vergrößern]
Abbildung 7: Differenzierung vs. Komplexität: den »Paradox of choice«-Effekt besiegen
Die Volksbank Offenburg hat im Depot-Bereich ein differenziertes Leistungsangebot aus Jungem Depot, einem Komfort-Depot, zwei unterschiedlichen Premium-Depots und einem Platin-Depot geschaffen. Die Logik der Differenzierung »auf der rechten Seite« der Depotlandschaft ist einfach: Der Kunde kann für einen erhöhten Grundpreis eine DepotCard 50 erhalten, die er zum einen für einen Preisvorteil von 50 Prozent auf »Verwahrung und Verwaltung« einsetzen kann (»Premium-Paket Strategie«). Das ist sinnvoll für Kunden mit einem hohen Depotvolumen. Sie zahlen mit jedem Euro mehr Depotvolumen einen niedrigeren Preis in Prozent des verwalteten Volumens. Die DepotCard 50 kann der Kunde alternativ auch für einen Preisvorteil von 50 Prozent auf alle Transaktionen einsetzen (»Premium-Paket Aktiv«). Dieses Angebot bietet sich für Kunden mit vielen Transaktionen an. Und Kunden, die sowohl 50 Prozent Preisvorteil auf Verwahrung und Verwaltung als auch auf Transaktionen wünschen, kaufen das Platin-Depotpaket. Das ist sinnvoll für Kunden mit hohem Depot- und Transaktionsvolumen. Trotz dieser bestechenden Logik ist diese Depotlandschaft im Vergleich zu einem Ein-Depot-Angebot, das die meisten Regionalbanken vorhalten, komplexer. Um die Komplexität zu beherrschen, setzt die Volksbank Offenburg sowohl auf ihrer Homepage als auch im Beratungsgespräch einen interaktiven Depot-Navigator ein.
Die Kunden erhalten auf Basis ihrer Eingaben zu Depotvolumen, Alter, Zugangskanal (online/telefonisch/über Berater), Transaktionsaufkommen und gewünschten Zusatzleistungen eine klare Empfehlung. Die Kunden und auch die Bank profitieren daher von dem Differenzierungsgewinn, ohne durch zu hohe Komplexität die Entscheidungskosten der Kunden in die Höhe zu treiben.
Fazit:Nutzen Sie den Differenzierungsgewinn und schöpfen Sie die unterschiedliche Zahlungsbereitschaft Ihrer Kunden in den einzelnen Produktfeldern besser ab. Gleichzeitig können Sie so die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kunden besser befriedigen. Um den dadurch drohenden »Paradox of choice«-Effekt zu besiegen, sollten Sie interaktive Modellfinder mit klaren Empfehlungen einführen. Diese helfen auch dabei, einen klaren Beratungsprozess für die einzelnen Produkte in der Bank zu verankern.
1.2.4. Beachtung des »Compromise Effects«
Mercedes-Benz bietet die drei Ausstattungspakete Classic, Elegance und Avantgarde an. Auch Lufthansa bietet die drei Tarife Economy Saver, Economy Basis und Economy Flex sowie zusätzlich die Business-Tarife an. Im Unterschied dazu stellte Air Berlin ihren Kunden zeitweise nur zwei Tarife zur Auswahl: einen Spar- und einen Flex-Tarif. Warum ist es jedoch niemals klug, nur zwei Tarife anzubieten? Weil es bei zwei Angeboten keine Mitte gibt. Kunden tendieren dazu, ein mittleres Angebot zu wählen. In der Mitte fühlen sie sich am wohlsten. Ein Angebot am Rand zu nehmen, verursacht Unbehagen. Das gilt insbesondere dann, wenn die Kunden sich nicht intensiv mit den Angeboten auseinandersetzen (wollen). Dieses irrationale Verhalten, das wissenschaftliche Analysen klar bestätigen, beschreibt der »Compromise Effect«. Diese Erkenntnis kann erhebliche Mehrerträge mit sich bringen, ohne bestehende Preise und Angebote »anfassen« zu müssen. Das soll das folgende Beispiel verdeutlichen:
Vor einigen Jahren beauftragte uns der Vorstand einer Bank, die Girokontolandschaft preislich zu optimieren. Voller Tatendrang bereitete das Projektteam die erste Sitzung vor. Die Unterlage war perfekt. Die Analysen messerscharf. Der Projektleiter legte los wie die Feuerwehr. Nach fünf Minuten unterbrach ihn der Vorstandsvorsitzende mit den Worten: »Sie dürfen bei uns alles ändern, nur nicht die Preise.« Für einen Preisberater ist das der GAU – keine Preisänderung, wie soll das gehen? Sofort war die Euphorie dahin. Wir schauten uns einige Minuten stillschweigend an. Nachdem wir uns wieder gefangen hatten, stand der Projektleiter auf, durchbohrte den Vorstandsvorsitzenden mit einem klaren Blick und sagte: »Kein Problem. Wenn wir die existierenden Preise für das Girokonto nicht ändern, ist das also OK für Sie?« »Ja«, sprudelte es aus dem Vorstandsvorsitzenden heraus. Der Berater legte nach: »Einverstanden, dann ergänzen wir die Landschaft rechts um das EIN oder ANDERE neue Produkt, sodass wir neue Bedürfnisse bei den Kunden wecken und somit Zahlungsbereitschaften erhöhen. Letzteres führt dann zu einer Veränderung der Kundenverteilung in die preislich höheren Modelle.«
Der Berater verdeutlichte seine Ausführungen anhand eines Beispiels von einem kürzlich erfolgreich umgesetzten Projekt aus dem Online-Weinhandel: Der Klient hatte zwei Rotweine im Angebot. Die eine Flasche kostete 5 Euro, die andere Flasche 10 Euro. 80 Prozent der Kunden orderten die günstigere Flasche, 20 Prozent der Kunden entschieden sich für die 10-Euro-Flasche. Der Weinhändler war mit der Verteilung nicht zufrieden und fragte uns, wie wir seine Erträge steigern könnten. Nach einigen Gesprächen und Marktanalysen kamen wir zu folgender Lösung: Wir ergänzten das existierende Angebot um eine höherwertige Flasche, die 15 Euro kostete. Nach einigen Wochen rief uns der Weinhändler begeistert an. Die Verteilung hatte sich deutlich verändert. Die Mehrheit (50 Prozent) kaufte jetzt die mittlere Flasche. Selbst die Premiumflasche wurde von 10 Prozent bestellt. Lediglich 40 Prozent hatten sich für die 5-Euro-Flasche entschieden. Der Ertrag stieg um mehr als 40 Prozent an.
Der Vorstandsvorsitzende war von der Idee begeistert. Nach einigen Monaten fundierter Marktanalysen ergänzten wir die Girokontolandschaft um zwei hochwertige Produkte (Premium und Platin). Wie beim Weinhändler veränderte sich die Kundenverteilung. Die Erträge erhöhten sich um mehr als 25 Prozent. Das Image der Bank verbesserte sich ebenfalls. Die höherwertigen Pakete passten zur Positionierung der Bank (»Qualitätsführerschaft«).
Fazit:Prüfen Sie, ob Sie in einzelnen Produktfeldern nur eine oder zwei Preisvarianten vorhalten. Wie viele Kunden nutzen bei einem Angebot mit zwei Varianten die rechte, teurere Variante? Machen Sie sich den »Compromise Effect« zunutze und erreichen Sie so durch zusätzliche Angebote »auf der rechten Seite« der Angebotslandschaft eine höhere Nutzungsquote von höherwertigeren, umfassenderen Leistungen. Das bedeutet auch, von erfolgreichen Unternehmen mit differenzierten Preis-/Leistungsangeboten, wie Mercedes Benz oder Lufthansa, zu lernen.
1.2.5. Beachtung des »Endowment Effects«
Der Eigentumseffekt soll durch das in Abbildung 8 skizzierte Beispiel erläutert werden: Eine junge Familie sitzt in einem Autohaus und konfiguriert zusammen mit dem Autohändler ihr neues Auto. Am Ende des Konfigurationsvorgangs ergibt sich ein Preis oberhalb der vorab gesetzten Preisgrenze. Der Verzicht auf einige der zuvor ausgewählten Zusatzleistungen würde einen akzeptablen Preis hervorbringen. Aufgrund des Eigentumseffekts verursacht ein solcher Verzicht jedoch so große »Schmerzen«, dass die Kunden die Preisgrenze nach oben verschieben und das konfigurierte Paket komplett kaufen.
Diesen Effekt machen sich Unternehmen wie Dell oder Autohersteller zunutze, indem sie Vorkonfigurationen in ihren Konfiguratoren vornehmen. Den Kunden fällt es schwer, ein »Ja« bei einer Vorkonfiguration wieder rauszunehmen. Es gehörte ihnen ja quasi schon – das zeigt das Beispiel ganz deutlich: Leistungen, die der Kunde einmal gedanklich in seinem Eigentum hatte, gibt er ungern wieder her. Der Grund ist: Der empfundene Wert dieser Leistungen ist nach dem gedanklichen Eigentums-Lock-in höher als die ursprüngliche Zahlungsbereitschaft für diese Leistung. Ariely (2008) hat diese Erkenntnis durch ein Experiment überprüft. Die Teilnehmer des Experiments wurden völlig zufällig in zwei Gruppen aufgeteilt. Gruppe 1 wurde nach ihrer Zahlungsbereitschaft für eine bestimmte dort präsentierte Tasse gefragt. Den Mitgliedern der Gruppe 2 wurde die gleiche Tasse hingegen geschenkt. Anschließend fragten wir sie, für wie viel Euro sie diese Tasse wieder verkaufen würde. Wie unterscheidet sich die Zahlungsbereitschaft der Gruppe 1 von der Preisforderung der Gruppe 2? Deutlich! Zufällig ausgewählte Mitglieder der Gruppe 1 waren bereit, 3 Euro für die Tasse zu bezahlen. Zufällig ausgewählte Befragte der Gruppe 2 wollten 6 Euro für die Tasse haben. Wären die Gruppen anders gebildet worden, hätten die gleichen Befragten, die 6 Euro für die Tasse haben wollten, nur 3 Euro Zahlungsbereitschaft für die Tasse gehabt. Wie kommt das? Die Erklärung liefert der Eigentumseffekt.