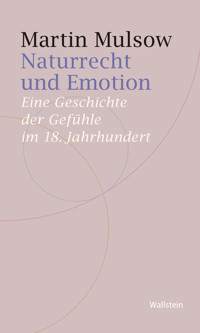25,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Martin Mulsow begibt sich auf die Spur der prekären Seite neuzeitlicher Wissensgeschichte in Europa: der Unsicherheit und Gefährdung von Theorie- und Wissensbeständen, des heiklen Status ihres Trägermaterials, des Risikos häretischen Transfers. Er präsentiert Taktiken, die Intellektuelle ersonnen haben, um mit diesen Fährnissen zu leben, ihre Rückzugsgesten und Ängste, aber auch ihre Versuche, verlorenes Wissen wiederzugewinnen. Prekäres Wissen handelt nicht von den großen Themen der Metaphysik und Epistemologie, sondern von Randzonen. Ein Buch voller spannender Fallstudien, eine andere Ideengeschichte der Frühen Neuzeit und der Versuch, den Begriff des Wissens neu zu denken.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 812
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Die Debatte um die Gestalt einer Wissensgeschichte des neuzeitlichen Europa bedarf der Korrektur. Es ist an der Zeit, endlich auch die prekäre Seite zu beleuchten: die Unsicherheit und Gefährdung bestimmter Theorie- und Wissensbestände, den heiklen Status ihres Trägermaterials, die Reaktion auf Bedrohung und Verlust, das Risiko häretischen Transfers. Martin Mulsow begibt sich auf die Spur dieses prekären Wissens mit dem Ziel, es in seiner Bedeutung für den Prozeß der europäischen Wissensgeschichte zu rehabilitieren. In materialreichen Fallstudien, die den Zeitraum von der Renaissance bis zur Aufklärung umspannen, präsentiert er die Taktiken, die Intellektuelle ersonnen haben, um mit diesen Fährnissen leben zu können, ihre Rückzugsgesten, ihre Ängste, aber auch ihre Ermutigungen und Versuche, verlorenes Wissen wieder zurückzugewinnen.
Prekäres Wissen handelt nicht von den großen Themen der Metaphysik und Epistemologie, vielmehr von Randzonen wie der Magie und der Numismatik, der Bibelinterpretation und der Orientalistik. Es geht nicht nur um Theorien, sondern auch um Furcht und Faszination, nicht um die großen Forschergestalten, statt dessen um vergessene und halbvergessene Gelehrte. Es ist ein Buch voller spannender Geschichten, eine andere Ideengeschichte der Frühen Neuzeit und zugleich der ambitionierte Versuch, den Begriff des Wissens selbst im Zeichen des »material turn«, des »iconic turn« und der Kommunikations- und Informationsgeschichte neu zu denken.
Martin Mulsow ist Direktor des Forschungszentrums Gotha für kultur- und sozialwissenschaftliche Studien der Universität Erfurt und hat dort den Lehrstuhl für Wissenskulturen der europäischen Neuzeit inne. Für seine Arbeiten erhielt er zahlreiche Preise, u. a. den Premio internazionale di storia della filosofia Luigi de Franco für das beste Buch auf dem Gebiet der Renaissancephilosophie und den Preis der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften.
Martin Mulsow Prekäres Wissen
Eine andere Ideengeschichte der Frühen Neuzeit
Suhrkamp
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation
in der Deutschen Nationalbibliografie;
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet
über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2012
© Suhrkamp Verlag Berlin 2012
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Umschlaggestaltung: Hermann Michels und Regina Göllner
Zur Gewährleistung der Zitierbarkeit zeigen die grau hinterlegten Ziffern die jeweiligen Seitenanfänge der Printausgabe an.
ISBN 978-3-518-78760-1
www.suhrkamp.de
Inhalt
Vorwort
Eineitung: Prekäres Wissen, riskanter Transfer und die Materialität der Erkenntnis
ERSTER TEILTAKTIKEN DES WISSENSPREKARIATS
I Die Persona des Radikalen
1. Das clandestine Prekariat
2. Die zwei Körper des Libertins
3. Porträt des Freidenkers als junger Mann
4. Die Kunst der Nivellierung, oder: Wie rettet man einen Atheisten?
5. Eine Bibliothek der verbrannten Bücher
II Vertrauen, Mißtrauen, Mut: Epistemische Wahrnehmungen, Tugenden und Gesten
6. Bedrohtes Wissen: Prolegomena zu einer Kulturgeschichte der Wahrheit
7. Harpokratismus: Gesten des Rückzugs
8. Sapere aude: Epistemische Tugend in historischer Perspektive
ZWEITER TEILFRAGILITÄT UND INVOLVIERTHEIT IN DER WISSENSBOURGEOISIE
III Problematischer Transfer 237
9. Die Tafel in der Hand: Historische Bildwissenschaft und philosophische Mikrohistorie
10. Familiengeheimnisse: Prekärer Transfer im inneren Zirkel
11. Das verlorene Paket: Zur Kommunikationsgeschichte der Philosophiegeschichtsschreibung in Deutschland
IV Faszinationsgemeinschaften und die Informationsgeschichte gelehrten Wissens
12. Wissensschutz und Schutzwissen: Abwehrzauber,Antiquarianismus und magische Objekte
13. Mobilität und Vigilanz: Zur Informationsgeschichte von Numismatik und Orientreise unter Ludwig XIV.
14. Mikrogramme des Orients: Navigation im gelehrten Wissen vom Notizheft bis zum Buch
Schlußwort
Bildteil nach Seite
Anmerkungen
Verzeichnis der Abbildungen und Nachweise
Namenregister
A CarloIl miglior fabbro
9Vorwort
Die Debatte um die Gestalt einer »Wissensgeschichte« des neuzeitlichen Europa bedarf der Korrektur. Zum einen benötigt sie Fallstudien, die sich nicht aus dem Fundus bekannter Geistesgrößen und dominanter Strömungen bedienen, sondern vorliegende Theorieangebote auf unbekannte Materialien anwenden. Zum anderen ist die Anhäufung, Organisation und Nutzung von Informationen und Wissen nunmehr genügend gefeiert worden. Es wird Zeit, die prekäre Seite, die Verlustseite zu beleuchten: die Unsicherheit und Gefährdung von bestimmten Theorie- und Wissensbeständen, den prekären Status der Trägerschichten dieser Bestände, die Reaktion auf Verlust und Bedrohung, das Risiko häretischen Transfers. All dies ist in seiner Bedeutung für den Prozeß der europäischen Wissensgeschichte nachzutragen und einzuklagen. Das Material ist reichhaltig genug, um zu zeigen, wie sehr insbesondere die Philosophie- und Philologiegeschichte profitieren kann, wenn sie sich den Kulturwissenschaften öffnet: dem »material turn«, dem »iconic turn« der Kommunikations- und Informationsgeschichte.
Die im vorliegenden Band zu einer Einheit zusammengefügten Fallstudien sind in den vergangenen sieben Jahren in Princeton, München, Rutgers und Erfurt/Gotha entstanden. Sie teilen das Interesse am Nachzeichnen einer »anderen« Ideengeschichte jenseits der ausgetretenen Pfade und versuchen, alternative Narrative anzubieten, die von der Situation derer ausgehen, die ich als das »Wissensprekariat« bezeichne. In manchem setzt dieses Buch meine früheren Studien Die unanständige Gelehrtenrepublik (2007) und Moderne aus dem Untergrund (2002) fort, doch es kommen neue Motive hinzu, vor allem eine größere Einbeziehung bildlicher Quellen und handschriftlicher Materialien sowie die verstärkte Aufmerksamkeit für Gesten und Einstellungen.
10Mein Dank gilt Eva Gilmer für ihr intensives Lektorat sowie Asaph Ben-Tov, Michael Multhammer, Kristina Petri und Stefanie Kießling für ihre Hilfe bei der Endredaktion des Manuskripts.
Das Buch ist Carlo Ginzburg gewidmet, dem Freund, der mir wie kein anderer Vorbild darin ist, über reine historische Forschung hinaus gegenwärtige Denkbewegungen mit einer untergründigen Geschichte zu verschmelzen.
Erfurt, im Frühjahr 2012
11Einleitung Prekäres Wissen, riskanter Transfer und die Materialität der Erkenntnis
Wissensverlust
Wir glauben, uns unseres Wissens sicher sein zu können. Aber das ist trügerisch. Wissen kann gefährdet sein. Es kann aus Informationen bestehen, die urplötzlich verlorengehen. Jedem ist heute die Erfahrung vertraut, daß eine Datei unauffindbar ist, gelöscht wird oder sogar der ganze Festplatteninhalt des eigenen Computers von einem Augenblick auf den anderen im Nichts verschwindet. Was passiert dann? Gedanken, die man eben noch für stabil, ja für schön und elaboriert hielt, haben ihren Träger verloren und existieren nicht mehr. Sie existieren nicht mehr in dem Maße, in dem sie nicht mehr memoriert und wiederhergestellt werden können. Schmerzlich empfinden wir den Kontrast zwischen der Überzeitlichkeit, die Propositionen ihrem Anspruch nach besitzen, und unserem Unvermögen, diese Propositionen in all der Komplexität, in der man sie erdacht hatte, wiederzuerlangen.
Ähnliches passiert, wenn Tier- oder Pflanzenarten aussterben. Auch hier ist der genetische Code an seine materiellen Träger gebunden, und wenn diese Träger sich nicht mehr reproduzieren, geht eine Art »Wissen« der Natur verloren: eine Konstitutionskomplexität, in der Erfahrungen des Überlebens, Anpassungsleistungen, evolutionäre Weiterentwicklungen und dergleichen gespeichert waren.
Wie der genetische Schatz von seltenen Tigern, von denen nur noch wenige Exemplare existieren, können Manuskripte oder gedruckte Bücher Einsichten enthalten, die mit ihren materiellen Trägern untergehen. Als der Antitrinitarier Michael Servet 1553 in Genf auf Betreiben von Calvin verbrannt wurde, verbrannte man mit ihm alle Exemplare seines Werkes 12Christianismi restitutio, deren man habhaft werden konnte. Nur drei Ausgaben entgingen den Henkern, und aus diesen entwickelte sich eine zaghafte Spur von neuem Leben und neuer Überlieferung, lange Zeit nur in Abschriften, bis aus diesen Abschriften im 18. Jahrhundert wieder ein Nachdruck wurde.1 Anders verlief der Fall der Hinrichtung von Kazimierz Lyszcynski 1689 – einer von vielen, bei denen die Vernichtung auch der Schriften des Verfassers so erfolgreich war, daß buchstäblich nichts von seinen Gedanken blieb.2
Was bedeutet dieser Aspekt von Seltenheit und Gefährdung für unseren Begriff des Wissens? Wenn von »Wissen« die Rede ist – gerade auch bei Komposita wie Wissenskulturen, Wissensgeschichte oder Wissensmanagement –, dann ist es essentiell zu klären, ob Wissen in einem engen oder in einem weiten Verständnis aufgefaßt wird. Im engen, epistemologischen Verständnis ist Wissen längst nicht mehr nur einfach mit Platon als wahre gerechtfertigte Meinung zu definieren. In neueren Diskussionen werden weitere Bedingungen diskutiert, die entweder internalistisch, externalistisch oder auf andere Weise bestimmt werden.3 Doch dieser rein epistemologische Begriff von Wissen scheint für viele an Kontexten interessierte Fragestellungen – wie auch die, um die es in diesem Buch geht – zu strikt zu sein. Ich werde daher im Folgenden einen weiteren Begriff von Wissen verwenden, der stärker von der subjektiven Seite ausgeht und vor allem begründete Überzeugungen meint, im Sinne von komplexeren, theoretischen Erwägungen, von denen man kleinere Wissensbestandteile als Informationen unterscheiden kann.4 Wissen ist dann gleichsam das aus der Rohmasse von Informationen zusammengesetzte und verarbeitete »Gekochte«; es ist organisierte und mit Erfahrungskontext getränkte Information, etwas also, das mit vielen anderen Informationen vernetzt und daher keineswegs isoliert ist.5 Natürlich sind auch Informationen (oder »small facts«) ihrerseits theoriebeladen, doch macht es wenig Sinn, hier schon auf solche Detailprobleme einzugehen. Festzustellen ist, daß, wenn es um das »Wissen« von Akteuren geht, der 13Wissensbegriff sich dem Sinnbegriff annähert, wie ihn Max Weber und Alfred Schütz als Orientierung im Handeln gefaßt haben.6 Da Sinn zumeist sozial abgeleitet, das heißt von anderen übernommen, sedimentiert und typisiert ist, läßt sich auch Wissen in dieser Weise als sozial gewordener Sinn verstehen. Man kann dann von subjektiven Wissensbeständen sprechen und über ihr Verhältnis zum institutionalisierten gesellschaftlichen Wissen nachdenken. Das Kriterium, daß dieses Wissen auch wahr sein müsse, läßt sich dann nicht sinnvoll vertreten, da auch »falsches« Wissen und fehlerhafte Theorien Handeln motivieren und anleiten können.
Wie dem auch sei: Auch die bis zum Siedepunkt des Wissens sublimierte Daten- und Informationsmenge kann verschwinden, wenn ihr Träger verschwindet. Die Welt sei ein Maximum an Substantialität, aber ein Minimum an Wissen, hat der Renaissancephilosoph Charles Bovelles geschrieben.7 Und umgekehrt, so fügt er hinzu, sei der Mensch ein Maximum an Wissen, aber ein Minimum an Substanz. Kaum ein Bild drückt die Gefährdung des Wissens im Menschen besser aus. Die materielle Basis ist schmal – sie könnte kaum schmaler sein. Verschwindet der einzelne Mensch, verschwindet auch seine Welt.
Oder ist das zu sehr von einem individualistischen Wissensverständnis her gedacht? Wenn Wissen sozial vermittelter Sinn ist, ist es dann nicht eher die Gruppe, die Institution, die Gesellschaft, die als Träger von Wissen aufzufassen ist, und nicht der einzelne Mensch? Ist nicht Wissen sicher in der gemeinsamen Sprache und Begrifflichkeit aufgehoben und von daher gegen den Verlust einzelner Verkörperungen gefeit?8 Selbst wenn einzelne Bibliotheken brennen, können Gesellschaften ihren Grundbestand an Wissen behalten. Diese Einsicht betrifft allerdings nicht »kleine«, spezielle, kontraintuitive, revolutionäre Wissenseinheiten, die rar sind und womöglich nicht einmal in gedruckter oder sonst wie »gemeinschaftlicher« Form vorliegen.
Vielleicht ist mit der Erfahrung vom Abstürzen des Computers eine neue Sensibilität für Wissensverlust entstanden. 14Doch die Konsequenzen sind noch nicht gezogen. Man hat noch nicht begriffen, daß der »material turn« für die Ideengeschichte die Hinwendung nicht nur zur Speicherung, sondern auch zur Gefährdung von Wissen bedeutet. Nicht nur Wunderkammern und exotische Objekte, auch verkohltes Papier und verblichene Tinte sind dann relevant. Wann ist Wissen gefährdet? Wer stellt ihm nach? Worin besteht der Unterschied, wenn Wissen in Menschen oder wenn Wissen in Texten verlorengeht? Wie ist auf die Bedrohung von Wissen reagiert worden? Das sind Fragen, die dieses Buch stellt. Bedenkt man all die Phantasmen von den sintflut- und feuersicheren ägyptischen »Säulen des Seth« bis zu den angeblich für Extraterrestrier lesbaren Informationsplatten der Pioneer-10-Sonde, dann scheint immer gleich das Menschheitswissen als Ganzes zur Disposition zu stehen.9 Doch in der Frühen Neuzeit wurde mit kleinerer Münze bezahlt, und die Probleme der Wissenssicherung waren oft ganz alltagspraktischer Natur. Wie konnte man garantieren, daß ein Kassiber, ein Brief, ein Päckchen seinen Empfänger wirklich erreichte? Wie ließ sich dem Leser an der Zensur vorbei eine bestimmte Botschaft übermitteln? Wie konnte man es erreichen, daß die Polizei nicht die ganze Auflage eines neuen Buches beschlagnahmte und vernichtete?
Prekarität
Ich versuche, all diese Phänomene mit dem Begriff »prekäres Wissen« zu fassen. »Prekär« bedeutet unsicher, heikel, mißlich, problematisch, widerrufbar. Diese Qualifizierung betrifft nicht in erster Linie den Inhalt des Wissens, sondern seinen Status. Daß dieser Status oftmals eine Folge des Inhalts darstellt – insbesondere wenn der Inhalt brisant und einer machttragenden Elite unerwünscht ist –, steht außer Frage, soll hier aber zunächst ausgeblendet werden. Vielmehr lassen sich drei Formen beschreiben, in denen der Status von Wissen prekär sein 15kann: prekärer Status des Wissensträgers, prekärer gesellschaftlicher Status sowie prekärer Status der Sprecherrolle und der Behauptungen.
Prekärer Status des Wissensträgers: Prekär ist der Status eines Wissensträgers dann, wenn dieser Träger leicht verlorengehen oder vernichtet werden kann. Das ist der Fall, wenn Texte oder Bilder nur als Unikate existieren, wenn sie nur handschriftlich in wenigen Exemplaren statt gedruckt vorliegen; wenn Wissen nur mündlich, nicht schriftlich existiert, und dies ohne die Absicherung durch eine Gruppe oder eine feste Tradierung10, wenn es also nur subjektiv im Kopf seines Trägers vorliegt.
Kardinalbeispiel ist die Samizdat-Literatur in den Ostblockländern zur Zeit des Kalten Krieges, die nur auf schreibmaschinengeschriebenen Blättern verbreitet wurde11, und ihre Vorgängerin, die clandestine Untergrundliteratur des 17. und 18. Jahrhunderts, in der in Frankreich, aber auch vielen anderen europäischen Ländern in handschriftlichen Kopien religionskritische Argumente »publiziert« wurden.12 All solche Texte waren hoch gefährdet: Sie waren verboten, die staatlichen und kirchlichen Autoritäten suchten nach ihnen, und nicht selten wurden sie nach der Konfiszierung vernichtet. Vom Theophrastus redivivus, einem umfangreichen gelehrten clandestinen Text der 1650er Jahre – dem möglicherweise ersten bekannten explizit atheistischen Philosophietraktat überhaupt – existieren gerade mal drei Exemplare.13 Leicht hätte der Zufall auch diese drei noch annihilieren können. Aber auch so unverfängliche Schriftstücke wie Notate von Opernarien waren prekär. In der Frühen Neuzeit war die Partitur eines Stückes zuweilen geschütztes Geheimwissen des Orchesters, das sie spielte, und wurde nicht gedruckt oder verbreitet, um den Exklusivanspruch des Opernensembles zu schützen; wenn sich das Ensemble auflöste, verloren sich meist auch die Spuren der Musik.14 Andere Formen von Exklusivwissen waren alchemische Rezepte oder wissenschaftlich-technische Erfindungen.15
16Zu erinnern ist aber auch an die philosophische »Literatur« vor Einführung der Schriftlichkeit, an die Lehren von Vorsokratikern wie Pythagoras, von denen nur noch wenige Fragmente durch Berichte späterer schriftlicher Quellen überliefert sind, und an Wissensformen vieler oraler Kulturen bis kurz vor unserer Gegenwart, deren Zeugnisse nicht mehr existieren, weil die Zeugen nicht mehr existieren.
Prekärer gesellschaftlicher Status: Prekär ist der gesellschaftliche Status von Personen, die bestimmte Überzeugungen haben, die als anstößig, gefährlich oder verboten gelten. Diese Personen sind gezwungen, ihre Überzeugungen im geheimen zu kommunizieren, sei es durch Verbergen ihrer Identität oder zumindest durch Verbergen ihrer Absichten und Meinungen.16 Wenn diese Ansichten bekannt werden, sind deren Urheber oft Repressionen ausgesetzt, bisweilen werden sie sogar verfolgt, und ihre Karriere, ihre Freiheit oder sogar ihr Leben steht auf dem Spiel. Es ist ihnen meist verwehrt, eine institutionalisierte Reproduktion ihres Wissens in Anspruch zu nehmen, also an Universitäten zu lehren und Schüler auszubilden. Durch den Buchdruck ist es für diese Personen in der Frühen Neuzeit zumindest leichter als zuvor gewesen, ihre Schriften drucken zu lassen, allerdings oft nur an bestimmten Orten und unter Beibehaltung von Vorsichtsmaßnahmen wie Anonymität, Verschweigen des Druckers und clandestine Distribution.17 Das ist und war eine Aktivität mit hohen Risiken.
Prekärer Status der Sprecherrolle und der Behauptungen: Um der Verfolgung zu entgehen, haben solche Personen oft raffinierte Formen gefunden, um ihre Überzeugungen – wenn sie sie nicht clandestin publiziert haben – zumindest indirekt einem größeren Publikum zugänglich zu machen, ohne dadurch für ihre Äußerungen verantwortlich gemacht werden zu können: Maskierung, die Konstruktion einer doppelten Persona und Pseudonymisierung, um nur einige Beispiele zu nennen.
Statt den Wahrheitsanspruch direkt zu erheben, wurde prekäres Wissen oft nur »gerahmt« geäußert: eingebettet in eine 17literarische Fiktion, durch eine Sprecherrolle in einem Dialog, verkleidet in einer ioco-seriösen Burleske, bei der nicht festzustellen war, ob ein Sprechakt ernst oder doch nur scherzhaft gemeint war, als »obskure« Performanz innerhalb eines Rätsels oder einer unklaren Anspielung oder schließlich in speziellen »problematischen« Sprechweisen, etwa akademischen »Dubia«.18 Immer ging es darum, eine klare Verpflichtung des Sprechers auf eine bestimmte Aussage zu vermeiden oder zu verunklaren, um sich im Zweifelsfall – also im Fall einer Anklage, Verfolgung und Beschuldigung – darauf zurückziehen, es nicht so gemeint zu haben.
Wenn wir dabei von »problematischen« Sprechweisen reden, soll Wissen im alten Sinn von »problematice« gemeint sein, der nach Kant bedeutet, daß bestimmte Urteile solche sind, »wo man das Bejahen oder Verneinen als bloß möglich (beliebig) annimmt«.19 Es wird also ein Wissen beziehungsweise eine Überzeugung zur Diskussion gestellt, die noch keinen Anspruch auf endgültige Fixierung im semantischen Netz erhebt. Nicht ihre Wahrheit oder Falschheit, sondern allein der propositionale Gehalt spielt hier eine Rolle. Dieser testet gleichsam das semantische Netz auf die Auswirkungen, die seine Integration in es haben würde. In diesem Sinne ist solches Wissen prekär. Das französische »précaire«, aus dem das deutsche »prekär« übernommen ist, hat nämlich auch die Bedeutung von »schwankend« und »widerrufbar«. Es leitet sich von »precarius« her, einem Fachbegriff aus der römischen Rechtswissenschaft. Prekäre Handlungsmöglichkeiten oder Besitzverhältnisse sind solche, die nur aufgrund von Bitten gewährt werden und zurückgenommen werden können, wenn die gewährende Person es verlangt.20 Auf unseren Kontext übertragen bedeutet das: Prekäres Wissen ist unsicher; es ist noch nicht ausgemacht, ob es gültig ist oder ob sein Wahrheitsanspruch wieder zurückgenommen werden muß, sei es aus inhaltlichen Gründen, sei es weil eine mächtige Instanz es so will: beispielsweise die Römische Inquisition, die Bücher auf den Index librorum prohibitorum setzte, oder auch 18der kaiserliche Hofrat, der ein Buch verdammen und seinen Autor reichsweit zur Verfolgung ausschreiben konnte.21
Die frühneuzeitliche Geschichte des Problematischen in diesem Sinne umfaßt eine Vielzahl von Genres und Äußerungsstrategien, die einen Schwebezustand möglich machten, nicht zuletzt die Ioco-seria-Formen der halb scherzhaften Rede.22 Als man ernsthaft zu erwägen begann, ob die Philosophie Epikurs nicht vielleicht doch eine gewisse Wahrheit besitze, tat man dies zunächst vorsichtig im Kontext eines Scherzbuchs.23 Kopernikus’ revolutionäre These über das heliozentrische Weltbild wurde von Andreas Osiander bekanntlich zunächst als rein mathematische Hypothese mit »problematischem« Status jenseits empirischer Wahr-falsch-Relevanz dargestellt.24
Das Wissensprekariat
Das Syndrom der diversen prekären Statusformen kann man in seiner Gesamtheit als Wissensprekariat bezeichnen. Der Neologismus »Prekariat« ist eine Verschmelzung von »prekär« und »Proletariat« und soll in der neueren Soziologie andeuten, daß die Verstetigung unsicherer Arbeits- und Lebensformen zu einer klassenartigen Unterschicht geführt hat, die dennoch nicht schichtspezifisch zu beschreiben ist, sondern amorph bis in traditionelle höhere Bildungsschichten hineinreicht.25 Es geht um eine Transformation des Verständnisses gesellschaftlicher Schichtung anhand des Kriteriums der Lohnsicherheit. Überträgt man dieses Verständnis auf Wissenskulturen, dann kann man von einem Wissensprekariat sprechen. Damit sind die Verstetigungen von prekären Wissensformen gemeint, die bei den Personen zu einer Verfestigung von entsprechenden Habitusformen führen, zu habituellen clandestinen Praktiken, verdeckten Aussageweisen, teilweise auch zum Verbergen der eigenen Identität. Auch diese Prekarität reicht, wie wir sehen werden, in »obere« Schichten der etablierten 19Wissenschaft hinein. Der Gegenbegriff wäre dann so etwas wie die Wissensbourgeoisie und würde die Schicht von Wissensträgern bezeichnen, die normalerweise auf sichere Formen von Publikation, Institutionalisierung und Schülerschaft bauen können, die einen Akzeptanzraum für ihre Äußerungen besitzen und nicht auf Dissimulation angewiesen sind. Man dürfte diese Wissensbourgeoisie (eigentlich müßte man von »Wissenssekuriat« sprechen) dabei natürlich ebensowenig wie das Prekariat als klar umrissene Klasse verstehen, sondern nur als amorphe Verteilung.
Nebenbei ergibt sich dadurch eine wissensgeschichtlich transformierte Sicht auf die gängige ideengeschichtliche Einteilung in radikale, moderate und orthodoxe Strömungen.26 Nicht die Klassifikation von Überzeugungen steht im Zentrum, sondern nun geht es um den Status der Wissensträger, und zwar konkret darum, ob er sicher und wie sicher er ist. Zwar ergab sich diese Sicherheit zumeist durch die gesellschaftliche Akzeptiertheit der Ansichten dieser Träger, so daß sie auf Professuren berufen und in Patronageverhältnisse eingebunden wurden, was ihnen eine Schülerschaft verschaffte und die Gewißheit, daß ihre Schriften gedruckt wurden. Doch das war nicht durchgängig der Fall. Gelegentlich konnten auch Radikale ihre Gedanken – zumindest zeitweilig – im geschützten Ambiente fürstlicher Patronage entwickeln (wie etwa der rationalistische Bibelübersetzer Johann Lorenz Schmidt am Hof der Gräfin von Löwenstein-Wertheim-Virneburg27), und umgekehrt konnten moderate Denker in prekäre Verhältnisse abrutschen. Manchmal verlief die Grenze zwischen Prekariat und Bourgoisie auch mitten durch eine Person hindurch, dann nämlich, wenn Theoretiker Wissensteilungen vornehmen mußten, wie Isaac Newton, der sehr genau zwischen seinen physikalischen Werken unterschied, die er veröffentlichte, und seinen alchemistischen und religionshistorischen Studien, die er nicht veröffentlichte.28 Ein anderes Beispiel ist Hermann Samuel Reimarus, der an der Oberfläche als anerkannter Hamburger Professor agierte und zahlreiche philosophische Werke 20veröffentlichte, zugleich aber auch mit einem Bein im Prekariat stand und heimlich an seiner offenbarungskritischen Apologie schrieb.29 Wissensprekariat und Wissensbourgeoisie sollten hier zunächst nur eine Gruppe von Personen bezeichnen; daneben wird es auch sinnvoll sein, sie ganz im Sinne Bruno Latours auf Ensembles von Personen, Manuskripten und Bildern zu beziehen, also »Wissensträger« im neutralen Sinne zu verwenden, der auch das reine Potential zur Wissensaktualisierung meinen kann.30
Anders als bei der Trichotomie Radikalaufklärung-moderate Aufklärung-Orthodoxie muß hierbei kein eng gefaßter Exklusionsbegriff in Anschlag gebracht werden, sondern es lassen sich Zonen schwächerer Integration31 durch geteiltes Wissen und geteilte Überzeugungen von Zonen stärkerer Integration unterscheiden, und Radikalisierung kann dann in ihren Folgen als Wissensprekarisierung beschrieben werden. Kapitel 3 wird zeigen, daß diese Transformation hilfreich ist in Fällen wie dem des »Freidenkers« Theodor Ludwig Lau, der als Kameralist sein Wissen in die gesellschaftlichen Debatten integrieren konnte, während ihm dies als Philosoph nicht vergönnt war.
Wissen in Nischen
Nimmt man Gregory Batesons Metapher einer »Ökologie des Geistes« für die Geistesgeschichte ernst, kann man mit Gewinn über Artenschutz und Gefährdung von Wissen und Einsichten nachdenken.32 Im Gegensatz zu einer an Normalfällen orientierten Auffassung von einer ideengeschichtlichen Evolution33 geht es dabei um die Grenzfälle, die Katastrophen und Beinahe-Katastrophen, in denen Wissen untergeht oder dabei ist, verlorenzugehen. Erst dann kommen all jene Nischen in den Blick, die von verfolgten Freidenkern, von Frauen oder innovativen Wissenschaftlern ersonnen worden sind, um ihre Einsichten zu schützen und trotz Gefährdung zu verbreiten.3421Ob es sich um einen Spinoza handelt, der das Manuskript seiner Ethik den engsten Freunden anvertraut mit der Auflage, es nach seinem Tod zu veröffentlichen,35 oder um einen Reimarus, der seine Apologie denjenigen Teilen seiner Familie überläßt, denen er in dieser Hinsicht vertraut (wir werden dies in Kapitel 10 genauer sehen): Immer ist die konkrete historische Situation zu rekonstruieren, die solche Nischenbildungen nötig machte. Veröffentlichungen und Nichtveröffentlichungen (bzw. postume Veröffentlichungen) sind Sprechakte, man handelt mit ihnen, und es gilt die Intentionen herauszufinden, es so und nicht anders zu machen.36
Nischen mußten nicht nur reale Verheimlichungen von Handschriften betreffen, sie konnten auch institutioneller und textueller Natur sein. Die sogenannten Averroisten an der Pariser Universität im 13. Jahrhundert haben versucht, der Philosophie eine institutionelle Nische zu verschaffen, indem sie philosophische und theologische Wahrheit nach Fachbereichen trennten.37 Religiöse Dissidenten im 16. und philosophische Libertins im 17. Jahrhundert benutzten die Äquivokation von Begriffen, um sich unangreifbar für die Nachstellungen ihrer Kritiker zu machen, oder sie dachten sich wie ihre Geistesverwandten im mittelalterlichen Judentum und Islam Strategien aus, zwischen den Zeilen anderes zu sagen als an der Textoberfläche.38
Wissen in solchen Nischen ist geradezu per Definition selten. Es ist elitär nicht in der Hinsicht, daß nur eine Oberschicht Zugang zu ihm hätte, sondern darin, daß nur begrenzte, eingeweihte Kreise es erwerben können. Es besitzt eine andere Logik als Wissen im ungefährdeten Zustand, in nicht umkämpften Situationen, im Mainstream der Great Tradition. Die grundsätzliche Differenzierung von Wissen nach seinen Trägerschichten ist altbekannt. Der Humanist Mario Nizolio, der im Anschluß an Lorenzo Valla und Jahrhunderte vor Wittgenstein die Sprachfallen der Berufsphilosophen – die er »Pseudophilosophen« nennt – entlarven will, unterscheidet 1553 die nur künstlich (idiōs) geschaffene und nicht durch den Sprachge22brauch gedeckte Wissensweise dieser Philosophen von der gewöhnlich (koinōs) benutzten der normalen Leute und der spezieller ausgerichteten (kyriōs) der geistigen Elite. Letztere ist definiert als das »Erfassen eines oder mehrerer Dinge, die wissenswert, schwierig zu erkennen und den gewöhnlichen Menschen unbekannt sind«.39 In diesem Sinne ist auch die Unterscheidung zu verstehen, die Averroes zwischen gewöhnlichem und ungewöhnlichem Wissen getroffen hat, wenn er der Ansicht war, Philosophen könnten mehr an Wissen und Wahrheit verdauen als das einfache Volk. Daher sei es legitim, wenn man dem Volk bestimmte Einsichten vorenthält: Man möchte ihm keine Magenschmerzen bereiten.40
Wissen bestimmten Gruppen vorzuenthalten ist per se kein Indiz für dessen prekären Status. Im Gegenteil, es kann sich um Herrschaftswissen handeln, beispielsweise der Kirche oder auch – als Arcana imperii – des Staates.41 Nur wenn das Wissen zugleich als »heiße« Information verstanden wird, das heißt als Wissensbestand, der im Gegensatz zu »kalten« konservierten Dogmen völlig frei ist für seine interne Weiterentwicklung, dann trifft wirklich zu, daß es einer robusten geistigen Verdauung im Sinne Averroes’ bedarf, um solches möglicherweise in unerwartete und unerwünschte Richtungen expandierendes Wissen zu integrieren. Wir werden weiter unten einen Begriff von »inferentieller Brisanz« entwickeln, der diese Eigenschaft beschreibt, eine »heiße« Information zu sein. Wenn man für dieses Wissen eine Schutznische schaffen will, hat man es mit dem Paradoxon zu tun, etwas einzugrenzen, das von seinem Gehalt her gerade nicht eingrenzbar ist, sondern allenfalls formal und vorläufig: sprachlich, indem man es im Latein beläßt, das die einfachen Leute nicht lesen können42, institutionell, indem man es an die philosophische Fakultät bindet. Doch der Konflikt ist angelegt, und nur allzu leicht können die sprachlichen und institutionellen Schranken niedergerissen werden, vor allem dann, wenn man es mit Wahrheitsenthusiasten oder gar -fanatikern zu tun hat. Wahrhaftigkeit – neben der Genauigkeit eine der beiden Kardinal23tugenden der Wahrheit, die Bernard Williams namhaft gemacht hat – duldet häufig keine kommunikativen Grenzen.43
Eine Wissensnische par excellence sind Fußnoten.44 In diesen Kellern der Gelehrsamkeit lagern nicht nur die guten Tropfen, wie Robert Minder es einmal ausgedrückt hat, sondern dort liegt auch die Schmuggelware, die man dem Blick des eiligen Betrachters entziehen, aber dennoch unterbringen will. Jacob Soll hat gezeigt, wie sich in Amelot de Houssayes Anmerkungen und Fußnoten zu antiken Historikern wie Tacitus oder politischen Theoretikern wie Machiavelli unterderhand eine Form kritischen Denkens etabliert hat, die schon im 17. Jahrhundert auf die Aufklärung vorausweist. Dieses kritische Denken entwickelte sich nicht an der Peripherie der Macht, sondern in deren Zentrum, in Paris. Möglich war es jedoch nur, weil die indirekten Formen von Kommentaren und Anmerkungen Freiheiten erlaubten, die einer Argumentation im Haupttext nicht angestanden hätten.45 Fußnoten haben Räume bereitgestellt, in denen man mit – brisanten – Gedanken experimentieren konnte, in die man Frechheiten oder Extravaganzen schmuggeln konnte, weil sie nicht in dem Maße im Fokus der Aufmerksamkeit standen wie der Haupttext. Implizites prekäres Wissen liegt hier im buchstäblichen Sinne einer Verschiebung des heiklen Gehalts in die »vorbewußte« Ebene am Fuß der Seite vor.
Das gilt noch stärker für den Fall der handschriftlichen Marginalie. Sie ist gleichsam eine private Fußnote oder auch ein intimes Kommunikationsangebot für denjenigen, dem man sein annotiertes Exemplar zur Lektüre überließ. John Toland kommunizierte auf diese Weise mit seinem Freund Robert Molesworth.46 Die Privatheit oder »Domestizität«47 der Marginalie kann in manchen Fällen ein Schlüssel zum Vorbewußten in diesem Sinne sein. Insofern kann man darüber spekulieren, wie gerade die Materialität und Einzigartigkeit von handschriftlichen Äußerungen einen Zugang zur affektiven Dimension von Wissenschaft, zur Faszinationsgeschichte des Exotischen, des Brisanten, des Problematischen eröffnen.
24Riskanter Transfer
Die Folgen des prekären Status von Wissen für die Kommunikation sind klar: Jede Übermittlung kann zum Risiko werden, sowohl für den Absender als auch für den Empfänger. Nicht selten sind bloße Besitzer von verbotenen Schriften wie De tribus impostoribus oder De vindiciis contra tyrannos zu drakonischen Strafen verurteilt worden. Selbst die physische Übermittlung der Nachricht kann bereits riskant sein. Sowenig die Universalität von Wissen Garant für seine materielle Dauerhaftigkeit ist, so wenig ist sie Garant für eine gelingende Übertragung von einem Wissensträger zum anderen. Natürlich ist im großen und ganzen die Kommunikationsgeschichte neuzeitlichen Wissens eine Erfolgsgeschichte. Mit dem Buchdruck kamen Standardisierung, Vergleichbarkeit, Objektivität sowie schließlich Toleranz und Öffentlichkeit.48 Diese Lektion haben wir gründlich gelernt. Ein wenig Skepsis ist aber angebracht, und insbesondere sind Differenzierungen nötig. Die Druckmedien, so Adrian Johns, haben nicht einfach, wie Elizabeth Eisenstein herausgearbeitet hat, gleiche Standards befördert, sondern auch Verschiedenheit und Differenz.49 Schaut man genauer hin, stellt sich die Kommunikationsgeschichte von Wissen auf einmal sehr viel weniger übersichtlich und unproblematisch dar. Drucker wechseln zwischen einzelnen Arbeitsvorgängen ganze Passagen aus, Blätter gehen verloren, die Autoren fügen rasch und in letzter Minute noch ein paar Ergänzungen hinzu.
Ähnliches gilt, wenn man das Wissen zwischen »normalem« und prekärem Wissen differenziert, denn dann wird sichtbar, daß das in Nischen überwinternde prekäre Wissen der Frühen Neuzeit eine ganze Reihe von Transferproblemen zu bewältigen hatte. Man führe sich nur das uns noch viel näher liegende Beispiel der Samizdat-Literatur im Osteuropa zur Zeit des Kalten Krieges vor Augen: Auf privaten Schreibmaschinen getippte und hektographierte Schriften und Pamphlete wurden 25unterderhand weitergereicht, »publiziert«, Wissen wurde unterdrückt, Autoren kamen in den Gulag. Jeder Transfer ging das große Risiko ein, zu mißlingen und den Absender wie den Empfänger der Botschaft in Gefahr zu bringen.
Zum einen betreffen die Transferprobleme den impliziten Charakter von Wissen: Das schwer entwirrbare Ensemble von Praktiken, Überzeugungen, generationenspezifischen Erfahrungen und persönlichen Aneignungen kann für eine neue Generation nur noch »altmodisch« sein; es können bestimmte Fähigkeiten, etwa die Beherrschung der lateinischen Sprache, versiegen oder bestimmte Praktiken, etwa das Übertragen von Lektürefrüchten in Loci-communes-Hefte, aussterben. Zum anderen gibt es Transferprobleme, die spezifisch das brisante Wissen betreffen: Zensur und Verfolgung machen Geheimhaltung nötig, befördern heimliche Verbreitungstechniken oder das Zwischen-die-Zeilen-Schmuggeln von Bedeutung mittels Anspielungen.50 Decknamen werden verwendet, ebenso falsche Druckerangaben oder fingierte Titel. Nicht selten haben diese Techniken nichts genutzt: die Bücher wurden konfisziert, die Auflagen vernichtet, die Autoren inhaftiert oder umgebracht. Oder die Techniken haben zu Mißverständnissen und Unverständlichkeiten geführt. Man kann daher der Untergrundszenerie eine gewisse Opakheit nicht absprechen, insofern die Akteure selbst es schwer hatten zu erfahren, wer ein Buch geschrieben hatte, wo sie ein Exemplar auftreiben konnten und was bestimmte Anspielungen bedeuteten.51
Die Kulturtransferforschung der letzten zwei Jahrzehnte hat eine Reihe von Begriffen entwickelt, die auch für den spezielleren Fall des Wissenstransfers von Nutzen sein können. So werden etwa »Strukturem« und »Kulturem« voneinander unterschieden oder die Ausgangskultur von der Referenzkultur. Es wird betont, wie sehr sich Bedeutungen wandeln, wenn Wissen, das in der Ausgangskultur entwickelt worden ist, in neuen nationalen oder kulturellen Kontexten rekonstituiert wird.52 Diese Rekonstitution kann bei prekärem Wissen in besonderem Maße zu Verzerrungen führen. Wissen, das in ei26ner Kultur völlig unproblematisch ist, kann in einer anderen Kultur – zum Beispiel in einer anderen Konfession oder Religion – plötzlich explosiv werden; so wurden die antichristlichen Argumente, die im 17. Jahrhundert handschriftlich unter den Juden von Amsterdam kursierten, zu tickenden Zeitbomben, als sie durch irgendwelche Zufälle in die Hände von Intellektuellen außerhalb dieser Zirkel gerieten und in einigen Fällen sogar gedruckt wurden.
Riskant ist Wissenstransfer freilich auch in der ganz simplen Weise, daß Pakete zuweilen schlicht nicht ankommen. Eine an Praktiken orientierte Rekonstruktion intellektuellen Austauschs kann an solchen Kontingenzen nicht vorbeisehen. Ich werde weiter unten in einer Fallstudie zeigen, daß ein verlorengegangenes oder sogar mutwillig von Gegnern vernichtetes Paket mit Aufzeichnungen zur Philosophiegeschichte den Fortgang der philosophischen Historiographie in Deutschland wesentlich mitbestimmt hat. Wenn man sich mit Bruno Latour darauf einließe, Handlungsfolgen so zu beschreiben, daß auch Dinge zu den Aktanten zu zählen sind, dann könnte man die Geistesgeschichte einer Epoche in solchen Fällen sogar unter Einbeziehung »handelnder« Manuskripte, Zensurvorschriften und Postwege schreiben.53 Für eine Informationsgeschichte des Prekären bedeutet dies, die gefährdete Spezies unmittelbar in den Mittelpunkt der Geschichte stellen zu können und zu einer Kartographie der funktionierenden, aber auch vor allem der dysfunktionalen Kommunikationen zu gelangen: An welcher Stelle hakte die Gelehrtenrepublik? Wo wurden Pakete aus dem Verkehr gezogen, statt sie weiterzuschicken?
Implizitheit: Ideengeschichte und Kulturwissenschaft
Die Disziplin des Wissensmanagements hat Michael Polanyis Begriff des impliziten Wissens aufgenommen und für Fragen der Unternehmensführung fruchtbar gemacht.54 Welche Rolle 27die Implizitheit bei Transferproblemen spielt, habe ich bereits angedeutet. Ich bin der Auffassung, daß sich die Überlegungen Polanyis auch verwenden lassen, um unterschiedliche Wissensformen in die Beschreibung des Wissensprekariats einzubeziehen. Insbesondere ist zu überlegen, ob paratextuelle, bildliche und praktische Wissensformen als implizit bezeichnet werden sollten. Polanyi versteht unter implizitem Wissen bekanntlich das Wissen, wie etwas getan wird, auch wenn der Akteur nicht explizit angibt oder anzugeben imstande ist, worin dieses Knowing-how besteht. Dies hat zum Teil damit zu tun, daß das implizite Wissen in habitualisierten Automatismen besteht, zum Teil aber auch nur damit, daß es nicht fokussiert wird, also lediglich den Hintergrund der handlungsleitenden Aufmerksamkeit ausmacht.
Beide Formen der Implizitheit können nun dazu dienen, neuere kulturwissenschaftliche Ansätze in die Wissensgeschichte zu integrieren. »Intellectual History« ist heute zu einem nicht geringen Teil eine Kulturgeschichte intellektueller Praktiken.55 Durch die Praktiken seiner Aneignung ist das Wissen in den Denkschemata und Handlungstypen der Menschen verankert, so daß auch die impliziten Modi des Wissens durchaus wirkungsmächtig sind. Demgemäß besagt eine der zentralen Einsichten Foucaults, daß solche impliziten Faktoren (er nennt sie diskursive Regeln) auch die Inhalte von Wissensformen prägen.
Die Kategorie des impliziten Wissens eignet sich auch dazu, um die Wissensgeschichte für andere Anregungen der Kulturwissenschaften zu öffnen. Bildlichkeit, Emotionalität und Gestik können als verkörperte oder nicht-fokussierte Ausdrücke von Wissen interpretiert werden – auch wenn sie später zu Objekten der Fokussierung werden können und dann explizit als Rahmungen von Aussagen einsetzbar sind. Nach Nonaka und Takeuchi ist der ständige Wechsel von Explizitheit und Implizitheit einer der Schlüssel zu erfolgreicher Wissensvermittlung in Unternehmen. Vielleicht muß man sich die Kommunikation im Wissensprekariat ähnlich vorstellen: als einen 28Wechsel von impliziter, persönlicher Weitergabe im kleinen Kreis von Vertrauten und expliziten Ausformulierungen in schriftlichen Dokumenten, die aber ihrerseits von Anspielungen, textuellen Gesten und Praktiken durchtränkt sind.
Implizit ist letztlich auch bildliches Wissen, insofern die (sprachliche) Beschreibung von Bildern nicht hinreicht, um deren Bedeutung ganz zu erfassen. Das Bewußtsein der Rarität von prekärem Wissen stellt dabei die Verbindung zur historischen Bildwissenschaft her, die die Beschränkung der Kunstgeschichte auf einen begrenzten Kanon von als Kunst anerkannten Werken aufgehoben und alle bildlichen Darstellungen, seien sie nun Kunst oder nicht, zum Gegenstand der wissenschaftlichen Aufmerksamkeit gemacht hat, also auch Filme, Reportagephotos, Comics, Graffiti oder wissenschaftliche Illustrationen.56 Was aber, wenn umgekehrt eine »historische Textwissenschaft« auch solche Texte zum Gegenstand ihrer Forschung erhebt, die nicht nur in Büchern oder Manuskripten enthalten sind? Wie die Fallstudie in Kapitel 9 zeigen wird, lassen sich bisher verloren geglaubte philosophische Gedanken aus Texten rekonstruieren, die in Gemälden überliefert sind. Hier treffen historische Bildwissenschaft und Textwissenschaft aufeinander, denn der Text wird als etwas begriffen, das auf prekäre Weise im Bild vermittelt wurde, und das Bild wird nicht in seinem Kunstcharakter, sondern als historisches Dokument gedeutet, das selbst wiederum in die Repräsentationsbedürfnisse einer Gelehrtenkultur eingebunden war.
Bilder aus der Gelehrtenwelt sind noch auf andere Weise für unseren Zusammenhang von Interesse. Sie können Reflexionen über den Status des Wissenden und über die Bedrohtheit von Wissen vermitteln. In der Form der Allegorie – das heißt freilich: verrätselt – stellen sie dar, daß Wissenskulturen durch Vertrauen beziehungsweise Mißtrauen strukturiert sind: Vertrauen zur kleinen Gruppe der Gleichgesinnten, die neues Wissen hervorbringt, Mißtrauen gegenüber den Mächten, die dieses Wissen nicht akzeptieren wollen, die es mißverstehen, 29mißachten und gefährden. Allegorien und Gesten sind für diese Metabetrachtung der Bedingungen von Wissen oft sprechender als Texte. In Emblemen, Porträts und inszenierten Handlungen ist der Doppelcharakter von »Repräsentation«, zugleich Vorstellung als auch Darstellung der sozialen Welt zu sein, besonders präsent.57
Implizit sind aber auch die – im weitesten Sinne – unbewußten Anteile von Wissenskomplexen und die emotionalen »Färbungen«, die Thesen oder Wissenselemente für eine Person haben können. Diese implizite Dimension reicht tief hinein in die Ambivalenzen moderner Lebensformen. Faszination, Scheu, Abgestoßensein – all dies spielt bei so manchen scheinbar abstrakten Beschäftigungen am Schreibtisch der Gelehrten oder im Labor der Forscher eine Rolle.
Zu den Schichten des impliziten Wissens dringt man dort am leichtesten vor, wo noch die handschriftliche Eintragung regiert: wo der Wissenschaftler seine Lektüre unmittelbar, zuweilen mit zitternder Hand, in Notizen umsetzt oder wo er seiner Begeisterung oder Ablehnung in handschriftlichen Marginalien im Buch Ausdruck verleiht. In diesen Fällen werden Aneignungen in ihrer ganzen kognitiv-emotionalen Breite sichtbar. Wissen über den Orient etwa – über die Sprache der Äthiopier, den legendären Priesterkönig Johannes, die syrischen Götter – konnte beides sein: faszinierend und brisant. Es hat, wie ich in Kapitel 14 ausführen werde, manchen frühneuzeitlichen Gelehrten aufgrund der darin enthaltenen Versprechungen einer exotischen, unbekannten Welt magisch angezogen, und es war gefährlich wegen der neuen Perspektiven, die sich daraus ergeben konnten: von möglichen politischen Allianzen gegen das Osmanische Reich bis zu Relativierungen der christlichen Religion.58 Zugleich forderte es die eingefahrenen gelehrten Praktiken bis aufs äußerste heraus, denn wer konnte schon die arabische, syrische, koptische und amharische Sprache meistern? Wie sollte man die Vielzahl der Informationen verarbeiten, die aus diesen Manuskripten gewonnen wurden? Wie waren sie in das semantische Netz einzubauen?
30Das Wissen über Magie besaß in der Frühen Neuzeit ein Maximum an Ambivalenz. Humanisten extrahierten es aus kabbalistischen Traktaten oder nekromantischen Handbüchern, stellten Bezüge zur antiken Philosophie her und versuchten, sich einen Reim auf die seltsamen Diagramme, Engelsnamen und Zaubersprüche zu machen, die sie vorfanden. Sie waren, wie in Kapitel 12 zu lesen sein wird, zugleich angezogen und abgestoßen von dieser Materie. Sie begannen, Talismane zu sammeln, wußten aber mit diesen »fremden Dingen« nichts anzufangen.59 Auch wenn aus den gelehrten Traktaten, die sie dann schließlich schrieben, fast alle Spuren dieser Faszination getilgt sind, wäre es doch völlig verfehlt, sich allein auf das Endprodukt, das heißt das publizierte Buch, zu konzentrieren, denn das dort dargelegte »explizite Wissen« ruht auf etlichen Schichten impliziten Wissens, das von scheuer und staunender Annäherung an die Magie zeugt, von uneingestandenen Experimenten oder auch von Sammelleidenschaft bezüglich magischer Objekte.
Inferentielle Brisanz
Bisher haben wir den Inhalt prekären Wissens beiseite gelassen, sowohl bei der Bestimmung dessen, was den Status von Wissen prekär macht, als auch bei der Einbeziehung kulturwissenschaftlicher Fragestellungen. Doch wäre es ein Fehler, vollständig und ausnahmslos von Inhalten zu abstrahieren, denn oftmals waren es die Inhalte, die den prekären Status derjenigen, die sie vertraten, bewirkt haben. Was sind typische Inhalte prekären Wissens?
In der Frühen Neuzeit haben die Aufklärer den orthodoxen Eliten häufig vorgeworfen, sie betrieben »Konsequenzenmacherei«, wenn sie Autoren beschuldigten, aus ihren Thesen ergäben sich atheistische, häretische oder gesellschaftlich gefährliche Konsequenzen. In der Tat ist dieses Geschäft nicht selten exzessiv betrieben worden, um die Grenzen der eta31blierten Orthodoxie möglichst eng zu ziehen und kompromißlos zu verteidigen. Dennoch hat die »Konsequenzenmacherei« einen wahren Kern: Brisant ist häufig nicht so sehr die abweichende Einzelbehauptung, sondern sind die Folgen, die diese Behauptung für den etablierten Wissensbestand hat.
Daher bietet es sich an, neben Polanyis Begriff der Implizitheit noch eine ganz andere, philosophisch sehr viel weiter gehende Verwendung von »implizit« in Anschlag zu bringen, die Robert Brandom entwickelt hat.60 Brandom bezeichnet seine Position als rationalistischen Pragmatismus, denn er versteht Behaupten und Überzeugtsein pragmatistisch über soziale Praktiken des Gebens und Verlangens von Gründen. Behaupten ist für ihn, grob gesprochen, implizites Wissen, wie etwas zu tun ist. Es läßt sich nun eine Verbindung zwischen ideengeschichtlichem Praktizismus und rationalistischem Pragmatismus knüpfen. Ersterer konzentriert sich auf die gelehrten Praktiken, die für Wissensformen charakteristisch sind: das Sammeln von Texten, das Verstecken und geheime Verbreiten von Manuskripten, das Exzerpieren von Büchern und das Hineinschmuggeln von Radikalem in Fußnoten. Der letztere konzentriert sich hingegen auf die Praktiken des Gebens von Gründen und des Ziehens von Schlußfolgerungen – das Eingehen sogenannter inferentieller Festlegungen: »Zu sagen oder zu denken, daß Dinge so und so sind, heißt, eine bestimmte Art inferentiell gegliederter Festlegung einzugehen: es als eine geeignete Prämisse für weitere Inferenzen vorzubringen, d.h. seine Verwendung als eine solche Prämisse zu autorisieren, und die Verantwortung dafür zu übernehmen, sich selbst zu dieser Festlegung zu berechtigen, die eigene Autorität unter den entsprechenden Umständen nachzuweisen, paradigmatischerweise dadurch, daß man sie als die Konklusion einer Inferenz aus den anderen Festlegungen ausweist, und zwar von solchen, zu denen man berechtigt ist oder berechtigt werden kann.«61
Der Begriff des Übernehmens von Verantwortung ist dabei für uns entscheidend. Denn man kann sagen, daß einige Takti32ken im Umgang mit prekärem Wissen gerade darin bestehen, solche Verantwortung nicht zu übernehmen; sie verweigern sich dem Explizitmachen. Vor allem Kapitel 2 wird zeigen, daß quasijuristische Konstruktionen erdacht worden sind, um nicht die epistemische Verantwortung für atheistische Sätze übernehmen zu müssen. Prekäre Sprechformen bemühen sich darum, wie wir gesehen haben, Sätze so zu äußern, daß sie nicht eindeutig dem Sprecher zugerechnet werden können.
Warum sollten sich Radikale weigern, ihre Thesen explizit zu machen? Nun, weil sonst die Folgerungen dieser Thesen sichtbar würden. Daher kann man sagen, daß prekäres Wissen oft eine inferentielle Brisanz besitzt. Inferentiell brisant ist Wissen dann, wenn seine Integration in den größeren Wissensbestand dazu führen würde, eine signifikant große Zahl dort etablierter Wahrheiten in diesem Bestand umzustürzen.62 Brisante Ideen sind wie »schwarze Schwäne«, höchst seltene und immer unerwartete Ereignisse oder Fakten, die, einmal eingetreten oder erkannt, massive Auswirkungen haben.63 Daher ist es mißlich, solches Wissen oder solche Informationen zu akzeptieren.
In der Kognitionswissenschaft ist von »semantischen Netzen« die Rede, wenn ausgedrückt werden soll, daß Wissen im allgemeinen so organisiert ist, daß Wissenselemente an bestimmten »Knoten« gespeichert werden, auf die sich dann bezogen wird, wenn durch Schlüsse auf Eigenschaften auch an anderen Knoten geschlossen wird.64 Entsprechend stark sind die Auswirkungen auf die Wissenslandschaft, wenn zentrale »Knoten«, beispielsweise bestimmte politische oder theologische Vorstellungen, anders besetzt werden. Um ein Beispiel zu geben: Michael Servetus’ Argumente gegen die christliche Trinitätslehre – etwa die faktuale Behauptung, es gäbe im Neuen Testament keine Stellen, auf die sich ein Trinitätsglaube stützen ließe – waren inferentiell brisant, denn hätte man sie akzeptiert, hätte man nicht nur ein Proprium des Christentums gegenüber den anderen monotheistischen Religionen aufgeben müssen, sondern auch die Göttlichkeit Jesu 33Christi wäre gefallen und viele andere Konsequenzen wären zu ziehen gewesen.
Ein anderes Beispiel ist Isaac La Peyrères These von 1655, die besagt, daß es schon vor Adam Menschen gegeben habe.65 Zunächst scheint dies eine bizarre exegetische Einzelthese zu sein. Aber eingebettet in den Wissenskosmos des 17. Jahrhunderts wird bald deutlich: daraus folgt, daß etwa die Völker des neuentdeckten amerikanischen Kontinents Nachkommen der präadamitischen Menschen sein könnten, daß dann aber für sie nicht die Heilsökonomie von Erbsünde und Erlösung durch Christus gelte; daß es dann vor der Schöpfung ältere Völker gegeben haben kann, die den Rahmen der biblischen Chronologie sprengen. Wenn aber die biblische Chronologie der etwa 6000 Jahre der Schöpfung nicht mehr gilt, fallen zahllose weitere Annahmen.
Da sowohl Servets Argumente als auch die La Peyrères nicht schlecht waren und nicht ohne weiteres hätten widerlegt werden können, waren sie brisant, und so versuchte man, dieses »Wissen« zu isolieren und aus dem Verkehr zu ziehen. Gegen solche Versuche stehen die mannigfaltigen Taktiken von Autoren, es dennoch, gegen alle Widerstände, zu verbreiten. Brisant können letztlich aber auch Wissensbestandteile sein, die zwar nicht direkt konträr zu gängigen Ansichten liegen, jedoch erratischen Charakter haben und sich nicht in den bestehenden Rahmen einpassen lassen. Lorraine Daston hat diese »strange facts« bei Francis Bacon genauer untersucht und ist zu dem Ergebnis gekommen, daß gerade die Seltenheit und Seltsamkeit dieser Tatsachen ein enorm destruktives Potential für das überlieferte aristotelische Weltbild bedeuteten.66
Prekäre Momente in der Wissensbourgeoisie
Aus meiner Sicht ist es wichtig, das Wissensprekariat immer im Kontext der Wissensbourgeoisie zu sehen, also der Versuchung zu widerstehen, einer Sozialromantik der »Außensei34ter«, der »Radikalen«, der »Freidenker« und der »Dissidenten« zu erliegen.67 Andernfalls läuft man Gefahr, isolierte Individuen oder kleine Gruppen, die aus ganz verschiedenen Gründen ins Abseits oder in den Protest geraten sind, zu einer Großgruppe zu stilisieren und eine Homogenität zu suggerieren, die es faktisch nicht gegeben hat. Daher schließe ich mich der gegenwärtigen soziologischen Forschung zum Prekariat an und versuche statt dessen, kleine Einheiten und Bereiche zu identifizieren, in denen prekäres Wissen dominant ist, wo, wie Robert Castel sagt, ein Defizit an traditionalen Bindungen herrscht – in unserem Fall an Bindungen traditionellen Wissens.68 Umgekehrt gibt es dann aber auch Zonen innerhalb gesicherter Wissenskulturen, die für prekäre Momente verwundbar sind. Dann kann man von Fragilität sprechen.
Ich betrachte es als eines der wichtigsten Ergebnisse meines Buches Moderne aus dem Untergrund, daß sich gerade im späten 17. und im frühen 18. Jahrhundert, also in einem entscheidenden Zeitraum der Dynamik der Moderne,69 Radikalisierungen immer nur im engen Kontext von etablierten Wissenschaftsdebatten ergeben haben. Weit davon entfernt, eine eigene unabhängige Tradition (zum Beispiel im Sinne eines Proto-Marxismus) auszubilden, waren es meist die konkreten Dynamiken von Debatten, die Räume für Radikalisierungen schufen. Die methodische Konsequenz heißt: Auch die frühneuzeitlichen Gelehrten, die in Amt und Würden standen und deren Wissensproduktion »sicher« war, sind in ein Tableau von den Zonen prekären Wissens einzubeziehen. Wir werden sehen, daß vor allem implizite Faktoren, wie Ambivalenzen und Faszinationen, das Wissen in etablierten Kreisen anfällig gemacht haben. Aber auch äußere Umstände wie Reisen oder das Verschicken von Materialien setzten das Wissen oder seinen Träger vielfältigen Risiken aus.
In diesem Sinne versucht dieses Buch, Elemente für eine Theorie und Geschichte prekären Wissens in der Frühen Neuzeit herauszuarbeiten, mit Beispielen aus ganz unterschiedlichen Zonen solchen Wissens. Zwar lassen sich Formen des 35Wissensprekariats auch in früheren oder späteren Epochen beobachten, aber ich beschränke mich hier, meinen Kompetenzen entsprechend, auf die Zeit von der Renaissance bis zur Aufklärung. Eine Gesamtgeschichte prekären Wissens und seines Transfers in der Frühen Neuzeit verfassen zu wollen wäre zum jetzigen Zeitpunkt ein vermessenes Unterfangen – und methodisch bedenklich. Vielmehr arbeitet sich dieses Buch an Fallstudien ab, die fast immer auf bestimmten Materialfunden basieren. Es zieht die Konsequenz aus der Problematik seines Gegenstands und verläßt sich nicht darauf, universelle Erörterungen im abstrakten Raum durchzuführen. Es steigt gleichsam – in theoretisierender Absicht – hinab zu den Alltagsproblemen des impliziten Wissens, begibt sich in die Hinterhöfe brisanter Überlegungen und an die Nahtstellen dysfunktionalen Transfers.
Die Kunst besteht darin, sich geeignete »Leitpersonen« zu wählen, die im Sinne von Blumenbergschen »Leitfossilien« einen Zugang zu diesen verborgenen Schichten der Ideengeschichte ermöglichen. Dafür eignen sich besonders Theoretiker zweiter oder dritter Klasse, die bislang kaum Beachtung gefunden haben, denn gerade sie können uns einerseits Aufschlüsse über zeittypische Denk- und Verhaltensweisen geben, uns andererseits in Bereiche hineinführen, die jenseits der Stereotype der Forschung liegen. Einige dieser Leitpersonen finde ich im Italien des frühen 17. Jahrhunderts, insbesondere in den libertinen Zirkeln Venedigs: vor allem den Maler Pietro della Vecchia, einen wenig bekannten Nachahmer Tizians und Giorgiones, der zugleich aber einer der wenigen Künstler ist, denen man Kontakte zu libertinen Intellektuellen nachweisen kann; aber auch Italienfahrer wie Gabriel Naudé oder Jacques Gaffarel, Otto Take oder Johann Michael Wansleben. Andere Leitpersonen für dieses Buch entdecke ich im Deutschland der Frühaufklärung: den Thomasius-Schüler Theodor Ludwig Lau, der sich so radikalisiert hat, daß sein Lehrer ihn nicht mehr stützen mochte; oder die Hamburger und Kieler Juristen Peter Friedrich Arpe und Johann Heinrich Heubel, die eine 36sublimierte Art von Radikalität gelebt haben, wie wir sehen werden. Daneben spielen die »Leitfossilien« der Wissensbourgeoisie eine tragende Rolle: der Pastor und Hebraist Johann Christoph Wolf, der zuweilen gebannt auf die ihn umgebenden prekären Häretiker schaut wie das Kaninchen auf die Schlange; der Antiquar und Numismatiker Charles-César Baudelot; oder der Göttinger Litterärhistoriker Christoph August Heumann, ein Professor zwar, aber mit eigenen Prekariatserfahrungen, weil er wegen einer »Jugendsünde« – einer zu gewagten Bibelinterpretation – lange vom akademischen Amt ausgeschlossen war. Für Angehörige der Wissensbourgeoisie waren die Bücher und Thesen der prekären Gestalten »strange facts«, wie ich in Kapitel 14 erläutern werde: seltsame und auch abstoßende Ansichten, die man trotzdem unbedingt kennen sollte, um den Kosmos des Möglichen abschätzen zu können.
Die »andere Ideengeschichte der Frühen Neuzeit«, die ich erzähle, handelt also nicht – oder nur wenig – von Descartes, Spinoza, Leibniz, Locke und Hume. Sie handelt von vergessenen und halbvergessenen Gelehrten; nicht von den großen Themen der Metaphysik und Epistemologie, sondern von Randzonen wie der Magie und Numismatik, der Bibelinterpretation und dem Naturrecht, der Philosophiehistorie und der Orientalistik; nicht nur von Theorien, sondern auch von Emotionen, Ängsten, Faszinationen und Ermutigungen. Es hat sie auch gegeben, diese andere Geschichte.
37ERSTER TEILTAKTIKEN DES WISSENSPREKARIATS
39I Die Persona des Radikalen
In der Wissenschaftsgeschichte spricht man seit einiger Zeit von der »scientific persona«.1 Inspiriert von Marcel Mauss’ Essay Une catégorie de l’esprit humain: La notion de personne, celle de moi, ist damit ein im Sinne neuzeitlicher Wissenschaft diszipliniertes Selbst gemeint, das bestimmte Regeln einhält, ein Wissenschaftlertypus, der sich, geprägt durch die Umstände, herausbildet und zwischen dem Individuum und der sozialen Institution anzusiedeln ist, die er miteinander vermittelt.2
Indes ist von vornherein eine Doppeldeutigkeit zu vermeiden: Persona kann auch im soziologisch-juristischen Sinne als Rolle oder Funktion gefaßt werden. Darauf werde ich mich in Kapitel 2 konzentrieren, wo einige quasi-juristische Rollenkonstruktionen vorgestellt werden, die dem Radikalen helfen sollten, seine Ansichten vorzutragen. Von dieser Bedeutung ist jenes erstgenannte Persona-Verständnis zu unterscheiden, das mehr auf den komplexen Habitus eines Wissenschaftlers oder Gelehrten abzielt, der sich aus gelehrten Praktiken, Beispielkulturen, Autoritätenakzeptanz, Verhaltensidealen und Argumentationsweisen zusammensetzt. Faktisch freilich gehen beide Weisen von Persona zuweilen ineinander über: Auch eine übernommene Rolle kann habituell werden.
Nun hat ein Projekt der australischen Philosophiehistoriker Ian Hunter, Stephen Gaukroger und Conal Condren spezifisch nach der Persona des Philosophen gefragt, und inbesondere Ian Hunter hat die Rekonstruktion philosophischer Personae als Alternative zu den von Skinner und Pocock als Sprechakte verstandenen Textereignissen in Stellung gebracht.3 Denn, so sein Argument, die Konzentration der Cambridge School auf Texte läuft auf eine Verkürzung der historischen Realität hinaus. Die Rivalität von philosophischen Schulen geht nicht auf einen Wechsel einander nicht verständlicher »Paradigmen« zu40rück, sondern ihr liegt oft eine ganz handgreifliche Konkurrenz von Personae, von Formen der wissenschaftlichen Reproduktion, zugrunde, die an soziale und intellektuelle Praktiken und ihre Verkörperungen gebunden sind.
Hunters Anliegen ist es, jedweden Rest von Transzendentalismus historistisch auszumerzen, und so ist es kein Zufall, daß er in seinen Beispielen auf Christian Thomasius und die Hallenser Frühaufklärung zu sprechen kommt; denn auch sachlich kann er an Thomasius anknüpfen, der die Metaphysik seiner Vorgänger durch eine nichtmetaphysische Konzeption ersetzte: »Thomasius stützte sich […] auf die christliche Lehrmeinung von der Trübung der geistigen Fähigkeiten des Menschen durch den Sündenfall und verband sie mit der epikureischen Lehre von der Machtlosigkeit der menschlichen Vernunft vor den körperlichen Leidenschaften, um damit gegen die Möglichkeit der Erkenntnis metaphysischer Objekte und gegen die angebliche Fähigkeit des Menschen zu vernunftgesteuerter Selbstbeherrschung zu argumentieren. Er entwickelte zudem eine kontextualisierende Philosophiegeschichte, die zum Teil auf den Arbeiten seines Vaters, Jacob, und auf Gottfried Arnolds umfangreicher Ketzergeschichte basierte, welche die Metaphysik und die Theologie als Ergebnisse der Verfälschung des christlichen Glaubens durch die platonische und aristotelische Philosophie begriff.« Das hat ihm, so Hunter, ermöglicht, die Wahrheitsansprüche der Metaphysik und Theologie in Frage zu stellen und sie statt dessen als lediglich historische Phänomene zu begreifen, deren Wirkung auf die Sphären des Rechts, der Politik und der bürgerlichen Gesellschaft man untersuchen kann.
Vor allem in der Moralphilosophie zeigt sich, mit welchen Praktiken eine Persona gebildet werden soll: »Thomasius setzte seine epikureische Affektenlehre auch zu einem moral-therapeutischen Zweck ein und benutzte sie als ethische Übung, um bei seinen Jurastudenten eine skeptische Haltung bezüglich ihres Vermögens zur Erkenntnis metaphysischer Objekte zu erzeugen. Er verlangte von ihnen, in ethischen Fragen Zu41rückhaltung zu zeigen und statt dessen das Beste aus dem zu machen, was im Vermögen des Menschen liegt, nämlich aus dem geschichtlichen und dem durch sinnliche Wahrnehmung gewonnenen Wissen. Er strebte nach einer psychisch-kognitiven Haltung, die der Metaphysik und Theologie feindlich gegenüberstand und sich statt dessen aufgeschlossen gab für eine Reihe neuerer Fächer – dem öffentlichen Recht, der Politikgeschichte, der politischen Philosophie von Hobbes und Pufendorf und der Theologie- und Philosophiegeschichte – und all das immer mit dem Ziel, die geistige Infrastruktur des frühneuzeitlichen Konfessionsstaats zu unterminieren.«4
Hunter gibt damit ein Beispiel für die bewußte Konstruktion einer neuen philosophischen Persona durch die Hallenser Frühaufklärung: Studenten werden durch Beispiele, neue historische Blicke, eine neue Disziplinenkombination und sogar andere Kleidung und anderes Verhalten in eine neue Sichtweise auf die Philosophie eingeübt.
Wendet man diesen Ansatz auf die prekären Wissenskulturen libertiner und »radikaler« Autoren an, zeigt sich schnell, daß deren Persona mehr ist als nur ein Sonderfall der philosophischen Persona. Radikale waren nie in der Lage, Schulen zu bilden wie die Hallenser und damit die Formierung von Personae zu bewirken. Aber sie haben im kleinen Rahmen Anregungen von gleichgesinnten Vorgängern übernommen – etwa das Ideal des Weisen, des »preud’homme«, des »sapiens«, der über den Meinungen der Menge steht und sich unorthodoxe Ansichten erlaubt.5 Kapitel 4 zeigt am Beispiel von Peter Friedrich Arpe, wie sich solche Persona-Ideale mit einer frühaufklärerisch sozialisierten Persona vermischen und wie in der Tat eine antimetaphysische Grundhaltung zu Neulektüren auch libertiner Texte führt – und sei es als ein Nivellieren von deren metaphysisch begründeter Kritik an der Religion. Kapitel 6 wird später in kunstgeschichtlicher Annäherung das Thema vom Ideal des »sapiens« erneut aufnehmen.
Wesentlich für die Persona des frühneuzeitlichen Radikalen – und damit unterscheidet sie sich von der eines Philoso42phen der Wissensbourgeoisie – ist, daß sie in besonderem Maße mit Taktiken vertraut ist, ja, sie ist auf Taktiken geradezu angewiesen, und zwar im Sinne von Michel de Certeaus Unterscheidung zwischen Strategieoptionen der Etablierten und dagegenhaltenden Taktiken der Nichtetablierten.6 Solche Taktiken können, wie wir in Kapitel 1 sehen werden, die prekären Sprech- und Aktionsweisen der clandestinen Autoren betreffen, teilweise sogar die Persona selbst prägen, insofern der Autor eine Rollenunterscheidung vornimmt, die ihm eine Nische für seine Äußerungen gewährt (Kapitel 2). Doch gerade hier eröffnet sich eine verwirrende Vielfalt. So ist bei Theodor Ludwig Lau die quasi-juristische Teilung seiner Persona in einen privaten Christen und einen öffentlichen »Heiden« eine ganz andere als die Teilung seiner habituellen Persona in einen clandestinen philosophischen Radikalen und einen nichtanonymen kameralistischen Reformer. Dies wird in Kapitel 3 vorgeführt.
Kapitel 5 greift dann in gewisser Weise vor auf die Wissenstransferprobleme, die in den Kapiteln 9 bis 11 erörtert werden. Denn es geht in ihm um die Rettung von Informationen über Texte, die vernichtet worden sind, die den Transfer in die Gegenwart nicht überstanden haben. Dabei ist das Problem der Persona des Radikalen immer noch virulent, denn das Sammeln von Informationen über verbrannte Bücher gehörte durchaus auch zu den möglichen Taktiken kritischer Intellektueller, dann nämlich, wenn der Aktivität das apologetische Motiv zugrunde lag, die radikalen Texte zu »retten«. Die »Bibliothek der verbrannten Bücher« ist recht eigentlich sogar das konsequente reflexive Projekt des Wissensprekariats, denn es ist sich des Gefährdungsstatus verbotener Texte bewußt und versucht daher, das prekäre Wissen aus seinem gefährdeten Zustand heraus ans Licht einer breiteren Öffentlichkeit zu bringen.
Ich möchte indes nicht so weit gehen wie Leo Strauss, der den (echten) Philosophen als solchen bereits als Radikalen begriffen hat, der immer gegen die Gesellschaft stehen muß, die 43ihn umgibt, und daher immer gefährdet ist. Demnach wäre jeder Philosoph auf eine Persona der Dissimulation verpflichtet.7 Das aber würde meines Erachtens die realen Verhältnisse verwischen und Unterscheidungen verhindern, die durchaus sinnvoll sind. Strauss’ Konzeption öffnet bekanntlich einer Hermeneutik des Verdachts Tür und Tor, die allen philosophischen Texten unterstellt, zwischen den Zeilen eine andere Lehre zu übermitteln als diejenige, die an der Oberfläche sichtbar ist. Das ist eine unzulässige Verallgemeinerung von eher seltenen Taktiken der Libertins.8
441. Das clandestine Prekariat
Ein nach strukturellen Merkmalen prekäres Beschäftigungsverhältnis konstituiert eine erwerbsbiographische Problemlage, die mehr oder minder aktiv bearbeitet und bewertet wird.1
Robert Castel und Klaus Dörre
Prekäre Biographien
Im Mai 1719, kurze Zeit nach der Frankfurter Frühjahrsmesse, riß sich Theodor Ludwig Lau die Pulsadern auf.2 Er war in die Stadt gekommen, weil er nochmals ein Buch hatte drucken lassen wollen. Das war riskant, denn er hatte seit 1717 Stadtverbot, als er schon einmal in Frankfurt heimlich ein freidenkerisches Werk veröffentlicht hatte, die Meditationes philosophicae de Deo, Mundo, Homine. Darin fügte er auf aphoristische Weise alles zusammen, was es an neuerer radikaler Literatur auf dem Markt gab: Spinoza und Vanini, Hobbes und Locke, Beverland und Toland.3 Lau war offensichtlich der Meinung, daß es an der Zeit war, solche Gedanken auch in Deutschland zu diskutieren. Das Buch von 1717 war sofort konfisziert worden. Daher wollte er nun, 1719, gewissermaßen nachlegen, wollte das Recht auf freie Publikation verteidigen und seinen Ansichten nochmals Nachdruck verleihen. Also mußte er ein weiteres Mal nach Frankfurt kommen, mußte ein weiteres Mal den riskanten Weg antreten. Immerhin galt die Messefreiheit, denn an den Tagen um die Messe herum durfte kein Messebesucher gerichtlich belangt werden.4 Daher nahm Lau das Risiko auf sich; außerdem kam er im Habit eines preußischen Rates. Doch irgend etwas lief schief. Lau wurde erkannt, die Messefreiheit wurde ignoriert, er verhaftet und ins Gefängnis geworfen. Nun nahm er eine Zange, die er fand oder die man ihm abzunehmen vergessen hatte, setzte sie an, und riß sich die Pulsadern auf.
Das ist eine prekäre Existenz am Rand der frühneuzeitlichen 45Gesellschaft im »politischen«, im »galanten«, im »frühaufklärerischen« Zeitalter.5 Ich könnte mehrere ähnliche Schicksale erzählen – und will es auch tun, um eine gewisse Grundlage für weitergehende Fragen zu erhalten, die das betreffen, was ich »clandestines Prekariat« nennen will, und die sich in drei Stufen stellen lassen. Die erste betrifft prekäre Biographien, die zweite prekäres Sprechen und die dritte prekäres Wissen.
Clandestines Prekariat – das sind Intellektuelle, die heimlich geschrieben haben, heimlich ihre Texte in Manuskriptform verbreitet (oder auch in der Schublade belassen) oder, wenn sie sie haben drucken lassen, anonym und pseudonym publiziert haben.6 Der Grund für diese Heimlichkeit lag im Inhalt dessen, was sie zu sagen hatten: politische Kritik in extremer Form, Kritik an der Religion, Mißachtung dessen, was als sittlich und anständig galt.7 Der Grund für den Status als Prekariat lag in der sozialen Unsicherheit, die fast zwangsläufig die Folge der clandestinen Tätigkeit war. Wenn die Intellektuellen als Autoren ihrer Texte identifiziert wurden, begann meist ein langer und erbarmungsloser Abstieg ins Außenseitertum. Lau, der seinen Selbstmordversuch von 1719 überlebte, hat danach immer wieder versucht, gesellschaftlich Fuß zu fassen, hat sich bemüht, in Erfurt und dann in Königsberg einen Einstieg in die Universitätslaufbahn zu finden, doch immer lief ihm die Denunziation als Spinozist voraus, die man in Kompendien des Typus historia atheismi lesen konnte.8 Am Ende sieht man Lau im Asyl in Altona, völlig verarmt und psychisch schwer angeschlagen.9
Doch nicht das Ende prekärer Existenzen soll uns hier beschäftigen, sondern eher ihr Anfang. Und ich bin weit davon entfernt, Sozialromantik zu betreiben, die Radikalaufklärer im Rahmen einer »Whig-History« als Vorläufer der Moderne zu heroisieren.10 Gesucht ist eher eine adäquate Beschreibung des prekären Status solcher sogenannter Radikalaufklärer, die nicht nur der sozialen Lage, sondern im Verbund mit ihr der intellektuellen Situation, der Sprech- und Kommunikationsweisen dieser Personen gerecht wird. »Prekär« soll in seiner 46ganzen Bedeutungsbreite verstanden werden, also nicht nur als unsicher und mißlich, sondern auch – von seinem Ursprung im römischen Recht her – als jederzeit widerrufbar.11
1719 war Lau in einer Phase, die man mit Roger Chartier als »die Zeit, um zu begreifen« bezeichnen kann.12 Er war seit 1711 arbeitslos. Er hatte bei Christian Thomasius studiert, war lange Zeit auf Bildungsreise gewesen – sechs Jahre lang – und hatte dann vielversprechend eine Karriere als Staatsrat und Kabinettsdirektor des jungen Herzogs von Kurland, Friedrich Wilhelm, begonnen. Bis dieser 1711 starb. Danach: keine Neuanstellung mehr, nur schriftstellerische Tätigkeit, kameralistisch, um sich zu bewerben, philosophisch, um seine Ansichten kundzutun. Es gab zu viele gut ausgebildete Juristen, die in die Ämter der Territorialverwaltungen drängten.
Die zu hohen Studentenzahlen im Reich in den Jahren zwischen 1690 und 1710 fallen mit der Zeit zusammen, die man die Frühaufklärung nennt.13 Es wäre natürlich naiv zu behaupten, die deutsche Frühaufklärung wäre aufgrund einer Studentenschwemme entstanden. Eine ähnliche Korrelation von Radikalisierung und »alienated intellectuals« hat 1962 Mark H. Curtis in seinem klassischen Aufsatz The Alienated Intellectuals of Early Stuart England behauptet.14 Aus den frustrierten und entfremdeten Gelehrten, die keine angemessen bezahlten Stellen bekommen hatten, hätte sich die Trägerschicht des späteren Puritanismus und Republikanismus herausgebildet. Aber diese Korrelation ist problematisch. Für die deutschen Verhältnisse muß man überdies sagen: Es hat keine Revolution im frühen oder mittleren 18. Jahrhundert gegeben, die Verhältnisse waren leidlich stabil, es gab nur vereinzelte Radikale – wenn auch eine recht breite Schicht liberaler Aufklärer, die allerdings mit dem Fürstenstaat paktiert haben. Man denke an all die Thomasianer und Wolffianer, die in den Jahren von 1700 bis 1750 in staatliche Positionen strebten.