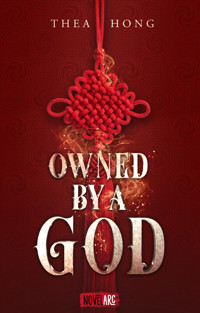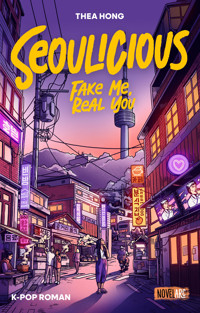14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Prinzessin der tausend Diebe-Reihe
- Sprache: Deutsch
Dieses Buch gibt es in zwei Versionen: mit und ohne Farbschnitt. Sobald die Farbschnitt-Ausgabe ausverkauft ist, liefern wir die Ausgabe ohne Farbschnitt aus.
Sora ist die rechtmäßige Erbin eines koreanischen Firmenimperiums, das einer Familie gehört, die seit Jahrhunderten über magische Kräfte verfügt und damit zu Reichtum und Macht gelangte: dem Clan der Diebe. Aber sie ist für ihre Familie eine große Enttäuschung, denn sie ist offenbar magielos. Daher lebt sie fernab der glitzernden Metropole Busan auf der Insel Jeju, wo sie ein kleines Café führt und sich um ihre kranke Mutter kümmert. Bis sie eines Tages einen versiegelten Brief mit einer Einladung erhält, der ihr gesamtes Leben auf den Kopf stellt. Sie trifft auf Menschen, die sie nie wiedersehen wollte, und auf einen attraktiven gefangenen Gott, der ihre Hilfe so sehr braucht wie sie seine.
Ein K-Drama zwischen zwei Buchdeckeln: Thea Hong schreibt über alte Legenden und das moderne Südkorea
Auftakt einer mitreißenden Romantasy-Dilogie mit koreanischem Setting
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 547
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhalt
Cover
Inhalt
Über das Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Content Note
Playlist
Widmung
Vorwort
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Danksagung
Glossar
Die Geschichte geht weiter
Cover
Inhaltsverzeichnis
Titelseite
Inhaltsbeginn
Impressum
Über das Buch
Dieses Buch gibt es in zwei Versionen: mit und ohne Farbschnitt. Sobald die Farbschnitt-Ausgabe ausverkauft ist, liefern wir die Ausgabe ohne Farbschnitt aus.
Sora ist die rechtmäßige Erbin eines koreanischen Firmenimperiums, das einer Familie gehört, die seit Jahrhunderten über magische Kräfte verfügt und damit zu Reichtum und Macht gelangte: dem Clan der Diebe. Aber sie ist für ihre Familie eine große Enttäuschung, denn sie ist offenbar magielos. Daher lebt sie fernab der glitzernden Metropole Busan auf der Insel Jeju, wo sie ein kleines Café führt und sich um ihre kranke Mutter kümmert. Bis sie eines Tages einen versiegelten Brief mit einer Einladung erhält, der ihr gesamtes Leben auf den Kopf stellt. Sie trifft auf Menschen, die sie nie wiedersehen wollte, und auf einen attraktiven gefangenen Gott, der ihre Hilfe so sehr braucht wie sie seine.
Ein K-Drama zwischen zwei Buchdeckeln: Thea Hong schreibt über alte Legenden und das moderne Südkorea
Auftakt einer mitreißenden Romantasy-Dilogie mit koreanischem Setting
Über die Autorin
Thea Hong ist studierte Musikpädagogin und führte musikwissenschaftliche Forschungen in Seoul durch. Heute lebt sie mit ihrem Hund in Hamburg, wo sie als Projektmanagerin arbeitet. Ihre Lieblingsautor:innen sind bell hooks, Elizabeth Lim, Pablo Neruda und Rainer Maria Rilke. Sie liebt ihr Leben in Deutschland ebenso wie ihre Familienbesuche in Korea. Ihre Leidenschaft für K-Dramen, koreanische Mythologie und Geschichte spiegelt sich in ihrem Werk wider.
THEA HONG
Prinzessin der tausend Diebe
BETRAYED
Roman
Vollständige E-Book-Ausgabedes in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Originalausgabe
Dieses Buch wurde vermittelt von der Literaturagentur erzähl:perspektive, München www.erzaehlperspektive.de
Copyright © 2025 byBastei Lübbe AG, Schanzenstraße 6–20, 51063 Köln, Deutschland
Bei Fragen zur Produktsicherheit wenden Sie sich bitte an: [email protected]
Vervielfältigungen dieses Werkes für das Text- und Data-Mining bleiben vorbehalten. Die Verwendung des Werkes oder Teilen davon zum Training künstlicher Intelligenz-Technologien oder -Systeme ist untersagt.
Textredaktion: Ulrike Gerstner, ElmshornUmschlaggestaltung: © Stephanie Gauger | Guter Punkt, MünchenUmschlagmotiv: © 김스타 KIMSTARKartenillustration: Mi Ha | Guter Punkt MüncheneBook-Erstellung: two-up, Düsseldorf
ISBN 978-3-7517-8410-8
luebbe.delesejury.de
Content Note
Ableismus
Blut
Body Horror
Emotionale Manipulation
Folter
Gewalt
Klassismus
Krankheit
Mord
Selbstverletzung
Sexuelle Handlungen
Suizid
Tod
Trauer
Vergiftung
Playlist
Dynasty – Rina Sawayama
Sacrifice (Eat Me Up) – Enhypen
Chk Chk Boom – Stray Kids
Strong – Amaranthe, Noora Louhimo
Fake Love (Rocking Vibe Mix) – BTS
Dark Winter – Kevin Olusola
Gravity – Taeyeon
Always Been You (Orchestra) – Henry
Everytime We Touch (Slowed) – Daneet
I will rise (Sora) – Novemberbeetle
Der Song für Sora I will rise wurde eigens für den Roman geschrieben.Ihr könnt ihn hier hören:
Für alle, die sich immer wieder selbst erschaffen haben
Vorwort
Jede meiner Geschichten beginnt mit Fragen, die ich mir in schlaflosen Nächten stelle. Beim Schreiben dieser Geschichte habe ich mich gefragt: Wie erkämpfst du dir deinen rechtmäßigen Platz in einer Welt, die nicht für dich gemacht wurde? Was tust du, wenn dich jeder Schritt näher an den Abgrund bringt? Und wie gehst du mit Macht um, wenn du bislang nur Ohnmacht kanntest?
Ich bin gespannt, ob du, liebe Leserin und lieber Leser, am Ende unserer gemeinsamen Reise eine Antwort auf meine Fragen hast.
Prolog
Man nannte mich Bastard.
Liebhaber. Verräter. Lügner und Betrüger. Bettler. Mörder.
König.
Und ich habe jeden meiner Namen mit Hingabe genossen.
Sie waren eine Auszeichnung und der Beweis dafür, dass ich dieser Welt meinen Stempel aufgedrückt habe. Ich war der Sohn einer Hure für die einen, der Sohn eines Königs für die anderen. Ich hatte den schönsten Gisaeng zu den Klängen ihrer Gayageum die Tränen von den Wangen geküsst und die Herzen naiver Yangban aus ihren erkaltenden Körpern geschnitten, weil sie ihr Leben verwettet hatten. Wer so töricht war und glaubte, gegen mich in einem Kartenspiel zu gewinnen, der verdiente nichts Geringeres, als dass seine Eingeweide wie ein Blumengedeck aus dem Brustkorb quollen. Ich lachte amüsiert, und Blut füllte meinen Mund, schwer und samtig wie der überreife Pflaumenwein, den mein Vater so gern serviert hatte. Was für ein Ende, dachte ich und starrte in den wolkenlosen Nachthimmel. Die harte Erde unter mir war mein letztes Bett, während die Sterne, so kalt und majestätisch funkelnd, den Halbmond umrahmten. Die weiße Sichel wirkte auf mich wie ein Grinsen der Nacht. Als ob mich die Götter auslachten und mich für meinen letzten Coup verhöhnten. Aber nein, ich war der Mann der tausend Gesichter, der tausend Namen, der das Undenkbare geschafft hatte – für jemanden wie mich war der Tod nur eine weitere Chance.
Niemals aufgeben. Niemals gehorchen.
Mich konnte nichts und niemand besiegen.
Ich klammerte mich im Geiste an meine Prinzipien, mit denen ich den Grundstein meiner Unsterblichkeit gelegt hatte.
Niemals aufgeben. Niemals gehorchen.
Während ich spürte, wie das Leben langsam aus mir sickerte, sah ich noch einmal sein Gesicht vor mir. Er, der all meine Namen kannte und dennoch der Einzige war, der mich Freund genannt hatte.
Mein größter Fehler. Meine einzige Schwäche.
»Warte auf mich.« Meine Stimme war nur mehr ein nasses Gurgeln in der Dunkelheit. »Warte auf mich, mein finales Meisterwerk.«
Kapitel 1
Regel Nr. 18 aus dem Buch der Diebe: Hass ist die schönere Schwester der Liebe.
Ich war eine Abnormalität in einer Welt voller Wunder. Ich war das Beige, das es nicht in den Regenbogen geschafft hatte – ich war normal.
Ich schloss die Tür des Cafés hinter mir und nahm die breiten Stufen zum Strand. Das rhythmische Schlagen der Wellen und die orange glühende Abendsonne verliehen der Westküste von Jeju etwas Magisches, alles wirkte so friedvoll und ruhig. Als sei das Meer nicht voller Meermonster, die sich mit Genuss über die Leichenteile Ertrunkener hermachten oder unachtsame Schwimmer ins Verderben zogen, um sich deren abgerissene Köpfe wie Bälle zuzuwerfen.
Jedenfalls erzählte man sich das in unserer Familie, nachdem einer meiner Onkel auf offenem Meer gekentert und nicht zurückgekommen war. Für die Außenwelt war der Hong-Clan eine Chaebol-Dynastie, eine Familie, die ein riesiges Firmenimperium besaß. In Wahrheit aber waren wir eine Familie mit einer Macht, die kein Mensch besitzen sollte.
Hinter den Kulissen hielt der Clan die politischen Fäden in der Hand, stellte Athleten, Schauspieler und Wissenschaftler, die durch ihr Mana einen geheimen Vorteil gegenüber anderen Menschen hatten. Es gab keinen Bereich, in dem wir nicht verstrickt waren, seien es legale oder illegale Aktivitäten.
Ich zog mir die Schuhe aus und ging langsam zum Wasser, dort, wo die Wellen den Sand küssten. Das kühle Nass kitzelte meine bloßen Füße, und für einen Moment hielt ich den Atem an, als eine stärkere Welle meine Knöchel umspielte und sich anfühlte wie eine Hand, die jeden Moment zupacken könnte – aber natürlich passierte nichts.
»Tsk.«
Ich hatte nicht mal gemerkt, dass ich den Atem angehalten hatte, und lachte über mich selbst. Was hatte ich erwartet?
Nicht mal die Geister und Fabelwesen, die diese Welt bewohnten, hatten Interesse an mir. Ich war zu seltsam für die, die die Wunder nicht sahen, zu normal für die, die selbst Teil der magischen Welt waren.
Es war nicht das erste Mal, dass ich mir wünschte, die Geschichten des Wassers hören zu können, mörderische Meerjungfrauen hin oder her. Den Wind zu fragen, welche Geheimnisse er wohl gefunden hatte. Oder einfach nur mit den letzten Sonnenstrahlen des Tages zu tanzen. All das wäre für mich möglich gewesen, besäße ich nur Mana – angeborene Magie – wie alle in meiner Familie. Stattdessen war ich etwas, was nicht existieren durfte, meine bloße Existenz eine Zumutung für den Familienstolz. Denn alles abseits der Perfektion war nicht entschuldbar. Die Erstgeborene des Clanoberhauptes ohne einen Funken Mana? Unmöglich. Eine Schmähung, die niemals hätte geboren werden sollen.
War ich überhaupt sein Kind? War ich die, die den Clan ins Unglück stürzen würde? Wer würde einer Erbin wie mir Gehorsam schwören – eine, die nicht schützen konnte, sondern beschützt werden musste?
Egal was ich tat, egal wo ich war, die hässlichen Gedanken folgten mir. Umklammerten mich, umarmten mich wie ein Liebhaber und flüsterten mir zu, wie mein Leben hätte verlaufen können – wenn ich nicht durch die Laune der Natur zum Versagen verdammt worden wäre.
Die Sonne überzog das Meer mit goldenem Licht und ließ es glänzen wie flüssiges Metall. So schön, dachte ich, während etwas tief in mir versuchte, sich instinktiv mit der Magie um mich herum zu verbinden. Aber wie so oft versagte ich. Wie ein Radio, das ewig auf der falschen Frequenz sendet und keine Hörer findet.
Ich ballte frustriert die Fäuste. Wusste, spürte, dass etwas da war. Auf mich wartete. Doch ein nebliger Schleier lag zwischen der Welt, nach der ich mich sehnte, und mir.
Die salzige Meeresluft wurde kühler und ich atmete tief ein. Atmete aus.
Wieder ein.
Nichts.
Die Atemübungen, die den Kindern meines Clans beigebracht wurden, um ihr Mana zu regulieren, waren etwas, was ich – obwohl ich wusste, dass sie nichts bewirken würden – automatisch jeden Abend machte. Hoffnung, so fürchterlich und niederschmetternd, war etwas, was schwer umzubringen war. In diesem Moment hasste ich alles. Die Schönheit des Augenblicks. Meine Herkunft, von der ich mich nicht befreien konnte.
Und vor allem mich selbst.
»Sora?« Die brüchige Stimme meiner Mutter ließ mich so schnell herumwirbeln, dass ich beinahe das Gleichgewicht verlor.
»Eomeoni! Es ist viel zu kalt!« Ich beschleunigte meine Schritte und eilte zu ihr, mein Selbstmitleid vergessend und durch Sorge verdrängt. »Lass uns wieder reingehen.«
»Aigoo.« Meine Mutter klapste mir spielerisch auf den Arm, aber die Berührung war so leicht wie die einer Daunenfeder. Seit ihrer Erkrankung hatte sich so vieles verändert.
Früher war meine Mutter so stark gewesen, wie eine unbezwingbare Festung, die mich immer beschützt hatte. Mütter durften nicht schwach sein.
Das Brennen in meinen Augen und der Kloß im Hals waren Zeichen einer Allergie. Keine Gefühle, das sagte ich mir.
»Ich brauche Sonne und frische Luft.«
Meine Mutter ließ sich dennoch widerstandslos von mir zurück zum Haus führen, und ich war froh, dass sie wenigstens an ihre Jacke gedacht hatte. Der Frühling war wärmer als sonst, aber nach der ersten Runde ihrer Chemotherapie fror sie viel schneller, und jede Erkältung konnte ein Todesurteil für sie sein.
Für den kurzen Weg zurück brauchten wir eine halbe Ewigkeit, und kaum hatten wir das Café erreicht, half ich meiner Mutter auf das breite Sofa, das direkt unter den bodentiefen Fenstern stand. Sie seufzte und starrte auf das Meer, das die untergehende Sonne mittlerweile blutrot färbte. Kein Wunder, dass das Sofa der liebste Platz aller Gäste war, die sich an diesen abgelegenen Ort verirrten.
»Ich mache uns was zu essen.« Ohne ihre Antwort – dass sie keinen Appetit hatte – abzuwarten, verschwand ich in der angrenzenden Küche. Seit meine Mutter das kleine Café von ihrem Ersparten gemietet hatte, war das unsere Routine: Am Tag kümmerte ich mich um die wenigen Stammgäste, abends um sie. Und nachts lag ich wach, obwohl die Müdigkeit ein steter Untermieter meiner Knochen war und mein Herz voller Angst, ob sie morgen noch atmen würde.
Ich war die Tochter von Meisterdieben. Die Nachfahrin von Mördern. Hatte das Blut eiskalter Politiker und Krieger in mir. Aber bei allen Göttern, ich bekam nicht einmal einen banalen Keks gebacken.
Und so begann mein neuer Morgen mit einem verkohlten Blech, auf dem die Überreste von etwas lagen, was eigentlich Schokoladenkekse hätten werden sollen. Zum Glück wurden uns in der Früh Kuchen, Gebäck und alles, was wir im Café auslegten, geliefert. Andernfalls stünde es schlecht um uns. Die Beziehung zwischen mir und allem, was Mehl in sich hatte, konnte man als ernsthaft zerrüttet bezeichnen. Und es half nicht, dass mir meine Mutter ihren »Ich hab’s dir doch gesagt«-Blick zuwarf.
Sie räusperte sich. »Ich weiß, ich habe dir vorgeschlagen, dass du alles ausprobieren sollst, was du möchtest, aber du bist klug genug, um zu wissen, dass das nichts für dich ist, hm?«
Ich wusste nicht mal mehr, wie oft ich versucht hatte, irgendetwas zu backen. Egal, ob Brot, Kuchen oder Kekse – nichts verließ den Backofen in essbarem Zustand.
Was war schiefgelaufen? Ich starrte auf die unförmige, verkohlte Masse vor mir und ging noch einmal alle Zutaten durch. Nichts! Daran war nichts falsch.
Ich liebte das Backen, aber offensichtlich wurde diese Liebe nicht erwidert. Als ein Teil des verbrannten Keksteigs vor unseren Augen zu Asche zerbröselte, erschauderte ich. Würde Magie auf mich wirken, hätte ich den Verdacht gehegt, dass mich die Göttin des Feuers verflucht haben musste.
»Ich weiß, dass ich es kann. Irgendwann. Ich brauche nur Übung«, grummelte ich und schlurfte mit dem Blech zur Mülltonne. Backen ist eine Wissenschaft, das Abwiegen von Zutaten, das Halten der richtigen Temperatur, und es wurmte mich, dass ich es trotz aller Versuche nie schaffte, wenigstens einen genießbaren Keks aus dem Ofen zu holen.
»Zum Glück hat nichts Feuer gefangen«, meinte Mutter mit einem unschuldigen Lächeln, und ich unterdrückte das Bedürfnis, gegen die Tonne zu treten. Immerhin hatte sie ihren Spaß, auch wenn es auf meine Kosten ging.
»Ich kann backen. Nur noch nichts Essbares.« Selbst ich hörte den Trotz in meinen Worten, aber ich konnte nicht anders. Backen war das Aufregendste, was gerade in meinem Leben los war, so traurig es auch klingen mochte.
»Nur weil du etwas liebst, heißt das noch lange nicht, dass es auch funktioniert.«
Ich wusste, dass meine Mutter nicht die Kekse meinte, hielt aber den Mund, weil ich nicht auch noch diese Büchse der Pandora aufmachen wollte.
Nachdem ich meine Mutter dazu gebracht hatte, im Obergeschoss eine Pause einzulegen, schnappte ich mir meine Schürze und die Schlüssel, um das Café für den Tag zu öffnen. Für ein Café in Jeju, einem der beliebtesten Orte Südkoreas, hatten wir nicht viele Besucher. Die meisten waren Stammgäste, die schon fast zum Inventar gehörten und es genossen, bei uns den Tag zu verbringen.
Kim Ahjussi zum Beispiel, ein mürrischer und wortkarger Mann, der mir erzählt hatte, dass er Schriftsteller sei, und der so schrecklich kurzsichtig war, dass er regelmäßig die künstlichen Blumen auf unseren Tischen mit Salat verwechselte. Oder das ältere Ehepaar, das nach vierzig Jahren aus den USA zugezogen war und mit dem niedlichsten Konglish sprach.
Und dann besuchte uns seit ein paar Wochen ein junges Paar, bei dem es sich um K-Pop-Idols oder Kriminelle handeln musste, so viel Trinkgeld, wie sie jedes Mal gaben. Oder vielleicht waren sie beides? Mir war es herzlich egal, woher das Geld kam, solange es seinen Weg in unsere Kasse fand. Vermutlich hätte ich eine größere Summe verdienen können, wenn ich der Klatschpresse heimlich ein Foto der beiden zugesteckt hätte, aber ich mag vieles sein, eine Verräterin bin ich nicht. Außerdem war es zuckersüß zuzusehen, wie sie ganz offenbar noch in der ersten Phase ihrer Verliebtheit miteinander flirteten.
Selbst mein zynisches Herz war für einen Moment weich geworden, als ich sah, wie der junge Mann die Fingerspitzen seiner Begleiterin geküsst hatte. Ihre roten Ohren und wie sie versuchte, ihm mit der bestellten Laugenstange eins überzuziehen, hatten mir genug Romantikvorrat für ein Jahr verpasst. Insgeheim hatte ich die beiden Karies-Couple getauft, weil sie so süß waren.
Es war aber kein Wunder, dass sich nicht viele Menschen hierher verirrten. Unser Café war nun mal kein Ausflugsort für Einheimische, und trotz der verträumten Lage war Sorikkun – wie unser Café hieß – weder auf Naver noch auf Google gelistet und somit für Touristen so gut wie unsichtbar.
Ich hatte meine Mutter gefragt, ob ich ihr mit Social Media oder irgendeiner Art von Werbung helfen sollte, aber sie hatte nur lachend abgewinkt. Nein, hatte sie gesagt, die, die es finden wollen und finden müssen, werden kommen.
Sie war zwar keine gebürtige Hong, aber ihre Vorahnung hatte meine Mutter noch nie im Stich gelassen, und ich hatte es irgendwann aufgegeben, das Café bekannter machen zu wollen.
Es war nicht die klügste Businessentscheidung, aber immerhin verdienten wir genug, um über die Runden zu kommen. Im Moment zumindest.
Nun, ich hatte keinen Grund, mich zu beschweren, ich nahm morgens die Lieferungen mit Essen und Getränken entgegen, kümmerte mich um unsere wenigen Gäste und hielt das Café sauber. Die meiste Zeit verbrachte ich damit, hinter der Theke ein Buch zu lesen und darauf zu achten, dass meine Mutter genug aß, weil sie durch die Medikamente so gut wie keinen Hunger hatte.
Für eine Studienabbrecherin wie mich war das der perfekte Job. Und wahrscheinlich war das auch der einzige Ort, an dem ich arbeiten konnte, ohne einen Abschluss zu haben. Korea war einfach das Land, wo anscheinend alle auf der Uni gewesen waren. Zumindest führte in Seoul gefühlt jeder Zweite einen Doktortitel im Namen.
Bereut hatte ich meinen Studienabbruch nie. Ich hatte die Uni gehasst und die oberflächliche Welt Seouls nie verstanden. Der Gestank der Verzweiflung, die Falschheit, die jedem anhaftete – auch mir. Der konstante Lärm und wie beschäftigt sie alle taten, ohne jemals irgendetwas zu erreichen. Als meine Mutter beschlossen hatte, ihre Therapie in Jeju fortzusetzen, und unser gesamtes Geld in Sorikkun steckte, war ich ihr, ohne zu zögern, gefolgt.
Natürlich, um ihr zu helfen, aber insgeheim war es auch eine Entscheidung für mich, um einem Leben im Hamsterrad zu entkommen. Es war eine Ironie des Schicksals, dass ausgerechnet ich, die Normalste meiner Familie, etwas außerhalb der Konformität suchte.
Du musst dein Geld sparen und wieder studieren, hatte mir meine Mutter letztes Weihnachten gesagt. Dann hatte sie mir einen dicken Batzen Geld zugesteckt und einen Klaps auf den Arm gegeben, als ich ihn zurückgeben wollte.
»Das kann ich nicht annehmen, eomeoni!« Sie sollte es für sich verwenden. Ich hatte das Gefühl, immer nur genommen zu haben. Nie gegeben.
Aber sie hatte nur gelacht. »Meine Zeit neigt sich dem Ende zu, meine Liebe. Und deine hat noch nicht einmal begonnen. Du hattest Träume, Sora. Du solltest wieder anfangen zu träumen.«
Ich wollte weinen. Ich wollte etwas zerstören. Jemandem wehtun. Manchmal hatte ich das Gefühl, dass ich nur noch lebte, weil ich nicht sterben konnte.
Wieder träumen?
Früher hatte ich von vielem geträumt. Von Ruhm. Von Wissen. Von Liebe. Aber jetzt? Ich sah keinen Nutzen in Träumen, die lediglich die Hoffnung am Leben erhielten, mich das Leben selbst jedoch nie fühlen ließen.
Nachdem sich die Krankheit meiner Mutter verschlimmert hatte, war mir klar geworden, dass aller Ehrgeiz sinnlos war. Das Leben war zu kurz, um unerreichbaren Träumen nachzujagen.
Natürlich fragte ich mich heimlich, wie es wäre, wenn uns das Sorikkun gehören würde. Wenn wir uns keine Sorgen mehr um das Geld machen müssten und ich meiner Mutter die beste medizinische Versorgung bieten könnte. Aber nein.
Träume sind Luxus. Träume erfüllen sich nur für diejenigen, die die Mittel haben, sie in dieser kapitalistischen Welt zu erreichen. Würden normale Menschen wie ich anfangen zu träumen, triebe es sie nur in die Verzweiflung, und verzweifelte Menschen machten Fehler. Ich selbst war ja schon ein lebender Fehler, für weitere Fehlentscheidungen gab es keinen Spielraum. Ich konnte es mir einfach nicht erlauben, zu träumen und zu hoffen.
»Du solltest Spaß haben. Triff dich mit deinen Freunden.« Meine gutherzige, ahnungslose Mutter hatte mir zugezwinkert. »Küsse einen gut aussehenden Jungen. Verliebe dich.«
Mein Lächeln war gequält, denn ich brachte es nicht über das Herz, ihr zu sagen, dass ich weder Freunde noch einen festen Freund hatte. Für beides brauchte man Zeit, Geld und Geduld, und das war alles nichts, was ich in ausreichendem Maß besaß.
Nachdem Herr Kim als letzter Gast das Café verlassen hatte, machte ich mich daran, die Tische zu wischen, und nach einem letzten Rundgang durch den Raum schnappte ich mir ein paar übrig gebliebene Äpfel für meine Mutter aus der Küche.
Für meine Mutter zu sorgen, war teils Liebe, teils Pflicht. Ja, es gab unsichtbare Fesseln, die mich an sie banden, aber ich würde sie nie als Zwang betrachten. Ich musste an ihrer Seite sein, weil ich nirgendwo anders hinkonnte – oder wollte.
»Du bist so eine gute Tochter. Und du hast das Pflichtbewusstsein deines Vaters.« Meine Mutter saß aufrecht auf ihrem Bett, eingewickelt in die Tagesdecke, und lächelte mir zu. Sie konnte nicht viel essen, doch sie liebte Äpfel, und ich war dabei, diese in dünne Scheiben zu schneiden.
Aber als sie meinen Vater erwähnte, verschlechterte sich meine Stimmung schlagartig, und ich unterdrückte die aufsteigende Übelkeit. Jegliche Erwähnung meines Vaters löste in mir eine sofortige körperliche Reaktion aus, als ob jede Zelle meines Körpers auch die flüchtigste Erinnerung an ihn ablehnte.
»Ich bin nicht wie er«, sagte ich und war stolz darauf, bei diesen Worten nicht vor Zorn in Flammen aufgegangen zu sein. Vielleicht war es ja doch ganz gut, dass ich kein Mana hatte. Wer weiß, was ich in die Luft gesprengt hätte, hätte ich die Kräfte dafür gehabt.
Ich war nicht wie er. Obwohl, das stimmte nicht ganz. Ich hatte seine grauen Augen, sein ungewöhnliches, leicht gewelltes Haar und das winzige Muttermal unter meinem linken Auge. Aber zumindest in meiner Einstellung war ich das genaue Gegenteil von ihm. Ich würde nie meine Familie verraten. Würde nie alles für Macht aufgeben. Würde nie die Person, die ich angeblich liebte, verletzen oder alleinlassen.
Nein, ich würde lieber alle und alles niederbrennen, die sich mir in den Weg stellten.
Ich würde nie das Wohl des Clans, der sich an veraltete Traditionen klammerte, über das Leben meiner Lieben stellen.
»Er ist dein Vater.« Trotz ihrer Zerbrechlichkeit hatte die Stimme meiner Mutter eine unmissverständliche Härte, als sie meine Abneigung bemerkte. Egal, was man ihr angetan hatte, was er ihr und uns angetan hatte, sie hatte ihm längst vergeben.
Sie nannte es Liebe, aber für mich war es nichts anderes als Unterwerfung.
Ich ignorierte ihren strafenden Blick und schob ihr stattdessen eine dünne Apfelscheibe zwischen die trockenen Lippen. Sie sah heute viel besser aus, zwar noch blass und zerbrechlich wie eh und je, doch ihr Blick war nicht länger stumpf, sondern wieder voller Leben.
Im Nachhinein hätte ich es wissen müssen. Ich hätte es wissen müssen, als sie meinen Vater erwähnt hatte, und mich wappnen müssen für das, was nun kam.
»Schau mal, Sora, was heute am Fenster lag.«
Beinahe wäre das Messer am Apfel vorbei in meinem Finger gelandet, als ich das altmodische Siegel auf dem Brief erblickte. Für einen Moment sah ich nur schwarz vor Wut, als ich das Siegel erkannte.
Der Brief musste auf magische Weise verschickt worden sein, denn mit der Post war er sicher nicht gekommen. Den hätte ich sonst abgefangen.
Ich hätte den Brief auf der Stelle verbrannt, wenn ich ihn vor ihr gefunden hätte. Scheiß auf den Inhalt.
Es wäre so einfach für ihn gewesen, mit uns in Kontakt zu bleiben. Nur ein Bruchteil von Mana für ihn. Warum kam, nach all den Jahren, gerade heute ein Lebenszeichen von ihm?
»Es ist von der Familie.« Als ob ich nicht wüsste, dass der Brief von ihm war! Nur mein Vater, das Oberhaupt des Hong-Clans, benutzte dieses Siegel, das die zerbrochenen Hälften eines Gakshital – einer Brautmaske – und eines Eunjangdo – eines reich verzierten Messers – zeigte.
Meine Mutter nickte. »Er ist nicht für mich. Es ist eine Einladung für dich.« Sie strahlte mich an und es war keine Spur von Groll zu sehen. »Ist das nicht großartig?«
Großartig?
Das war der Moment, in dem ich wirklich verstand, was Hass war. Denn in dieser Sekunde hätte ich nicht gezögert, das Obstmesser in meiner Hand in das Gesicht desjenigen Mannes zu rammen, der es wagte, sich mein Vater zu nennen.
Gewalt, zumindest der Gedanke daran, war mir nicht fremd; ich war in eine Familie von Bestien in menschlicher Haut hineingeboren worden. Und ich war dazu erzogen worden, sie zu führen – bis meine Mutter und ich vertrieben wurden.
»Was will er?«, fragte ich knapp, und nur die Sorge um meine Mutter ließ mich nicht auf der Stelle einen Wutanfall bekommen. Nach all den Jahren ohne ein Wort, ohne einen einzigen Won Unterhalt. Keine Antwort, als ich meinen Stolz abgelegt und ihm wegen der Erkrankung meiner Mutter geschrieben hatte.
Ich würdigte den Brief keines Blickes, obwohl meine Mutter ihn mir mit unsicherer Hand entgegenhielt.
Nur das schabende Geräusch des Messers, mit dem ich den Apfel schälte, war zu hören.
»Es ist für deinen Geburtstag«, sagte meine Mutter schließlich, als ich weiterhin eisig schwieg, und ihre Stimme zitterte vor Aufregung. »Er wird dir in Busan nachträglich eine Feier zu deiner Volljährigkeit ausrichten.«
Jetzt? Mein neunzehnter Geburtstag, mit dem man in Korea volljährig wurde, war schon längst vorbei. Ich wurde bald einundzwanzig. Diese verdammte Dreistigkeit.
Er wollte jetzt plötzlich Familie spielen?
Was zum Teufel dachte er sich dabei?
Brauchte die Familie Publicity und wollte ein Märchen der verstoßenen und wieder aufgenommenen Tochter herumerzählen?
Ah.
Ich hielt inne, als mir eine Idee kam.
Ich verfügte vielleicht nicht über Magie, aber die Hartnäckigkeit hatte ich geerbt. Und die Rücksichtslosigkeit, so viel konnte ich meinem – ich erschauderte bei diesem Wort – Vater zugestehen.
Ich glaubte nicht an Happy Ends, es gab immer einen Preis zu zahlen. Aber wenn ich diese unerwartete Karte richtig ausspielte, würde der Stolz derer, die meine Mutter und mich verspottet hatten, eine mächtige Delle erleiden.
Es denen heimzahlen, die uns einst vertrieben hatten? Das klang wie eine große Verheißung. Die Demütigung und das Bild meiner weinenden Mutter hatten sich tief in mein Gedächtnis eingebrannt, und nichts würde mich das jemals vergessen lassen.
Meine Finger umklammerten den Griff des Obstmessers. Mein erster Impuls war gewesen, den Brief in Stücke zu reißen, aber es gab einen anderen, kalten, berechnenden Teil in mir, der Grund dafür, dass ich bis jetzt überlebt hatte. Und dieser Teil entschied sich nun dazu, die Gelegenheit zu nutzen, um zurückzuschlagen.
Jede Faser meines Körpers schrie und kämpfte dagegen an, nach Busan zurückzukehren. Kein Wunder, eine meiner letzten Erinnerungen an diesen Ort galt einer Gruppe schwarz gekleideter Männer, die mich aus dem Haus zerrten, während meine Mutter sie auf Knien anflehte, mir nichts anzutun.
Nachts, wenn die Stille für mich zu laut wurde, fragte ich mich, was wohl passiert wäre, wenn meine Mutter ihren Stolz als Ehefrau des Oberhauptes des Hong-Clans nicht aufgegeben und nicht auf dem dreckigen Boden um mein Leben gebettelt hätte. Nichts schätzte der Hong-Clan mehr als Stolz – und sie war den Regeln des Clans immer gefolgt. Bis zu jenem denkwürdigen Tag, an dem sie alles für mich aufgegeben hatte.
Hätten die Männer mich damals getötet? Meinen Körper in die Grube geworfen, in der alle Verräter und Versager begraben wurden? Und wer hatte sie geschickt? Bis heute wusste ich nicht, ob sie auf Geheiß meines Vaters gekommen waren. Und ich hatte Angst vor der Antwort auf diese Frage.
Als ich vor vielen Jahren von der Schule nach Hause gekommen war, weinend, weil man mich als vaterloses Kind unerbittlich schikaniert hatte, gestand ich ihr, ich wünschte, nie geboren worden zu sein. Meine heißen Tränen wollten damals nicht versiegen. Bis ich auch meine Mutter weinen sah. Es war das zweite Mal in ihrem Leben. Und gleichzeitig das letzte Mal.
»Du wirst geliebt, meine Tochter«, hatte sie mich beruhigt, ihre Umarmung fest und warm. »Du wirst geliebt. Ich würde tausend Tode sterben, um dich zu beschützen. Du bist der Beweis für alles Gute, was man mir gegeben hat.«
Erst viel später verstand ich, dass sie damit meinte, dass ich die Tochter meines Vaters war. Ihre Erinnerung daran und der Beweis dessen, dass er sie irgendwann einmal geliebt hatte.
Warum sie es mir nicht übel nahm, dass ich ihr Leben zerstört hatte, wusste ich nicht. Tat es nicht mehr weh, die Erinnerung an die verlorene Liebe für immer an seiner Seite zu haben? Mich anzusehen und das Gesicht des Mannes zu erkennen, der sie verstoßen hatte?
Aber ich nahm es ihr übel. Ich war wütend auf sie, auf mich, auf unsere Familie. Ich hasste es, dass ich mich nach den Möglichkeiten sehnte, die ich nie erhalten hatte. Nach der Zukunft, die meine Mutter gehabt hätte, wenn ich mit Magie geboren worden wäre. Ich hatte mich so oft gefragt, wer ich wohl geworden wäre, flösse Mana in meinen Adern.
Und wie viele Leben ich nicht zerstört hätte, trotz alledem.
»Sora.« Meine Mutter nahm mir den Teller mit den fast zerhackten Apfelstücken weg. Ich hatte gar nicht gemerkt, wie sehr ich den Apfel malträtiert hatte. »Bitte, tu es für mich. Wer weiß, vielleicht kannst du mit deinem Vater Frieden schließen.«
Frieden? Ich unterdrückte mein verächtliches Schnaufen nur mit viel Mühe. Kapitulation traf es wohl eher. Frieden konnte nur auf Augenhöhe bestehen. Die federleichte Berührung meiner Mutter gab mir aber den Rest. Und die pure Hoffnung, die ich in ihrem Blick sah. Hoffnung in jemanden zu setzen, war vielleicht das Schlimmste, was man einem anderen Menschen antun konnte.
Was er ihr hatte antun können.
Allein dafür verdiente mein Vater ein Messer mitten ins Herz. Meine Mutter mochte zwar die ganze Zeit die Hoffnung in ihrem Herzen getragen haben, aber ich wollte nicht, dass diese Hoffnung auch in mir wieder Wurzeln schlug, sich irgendwann womöglich ausbreitete und blühte. Ich hatte die zarten Keimlinge so lange erbarmungslos aus mir herausgerissen, dass ich dachte, ich wäre längst immun dagegen, aber nein. Dieser gefährlich dekadente Hoffnungsschimmer, er funkelte bedrohlich in meine Richtung.
Ich unterdrückte mit aller Willenskraft die Gefühle, die mich zu verschlingen drohten. Alles, was passierte, jede Begegnung, alles in dieser Welt war inyeon. Ein Schicksal und eine Chance, daran glaubte ich.
Und hatte man mir nicht als Kind, das kaum laufen konnte, beigebracht, dass wahre Clanoberhäupter auf den Leichen ihrer Feinde ruhten und ihr Blut als Dünger für ihre Felder verwendeten? Ich nahm den Brief an mich und bemerkte, dass in dem schweren Umschlag auch Flugtickets steckten.
Die Dreistigkeit sollte ihm im Hals stecken bleiben.
»Okay, ich fliege hin«, sagte ich langsam, und die Augen meiner Mutter leuchteten auf. »So eine Chance sollte ich mir vermutlich nicht entgehen lassen.«
Wahrscheinlich dachte sie, ich sei auf dem Weg, mich mit meinem Vater zu versöhnen, um seine Liebe und Unterstützung zurückzugewinnen.
Ha.
Ich war auf dem Weg, um ihn zu erpressen.
Wie eine echte Hong.
Fasziniert strich ich über sein langes Haar.
Es ist wie Feuer, dachte ich, wie Feuer, das in seiner Glut für die Ewigkeit eingefangen wurde. Selbst in der Dämmerung leuchteten seine Haare so rot, dass mir die Augen schmerzen wollten.
»Hör auf, das kitzelt.«
Es klang wie ein Fauchen, aber ich wusste, dass er es nicht ernst meinte – schließlich bewegte er sich keinen Zentimeter von mir weg. Sein Kopf lag noch immer schwer auf meinen Oberschenkeln, und ich war froh, mich an die Eiche hinter mir lehnen zu können.
»Lügner.« Ich nahm den hölzernen Kamm aus dem offenen, mit Ochsenhorn verzierten Kästchen und begann, sein Haar zu kämmen. Er knurrte, als ich zu fest zog, und ich murmelte eine leise Entschuldigung.
»Hast du nichts Besseres zu tun, als den ganzen Tag zu trinken, zu spielen und Unsinn zu treiben?« Er gähnte und schloss die Augen.
Ich lächelte, als seine Stimme immer schläfriger wurde.
»Wenn ich mit dir zusammen sein kann.«
»Hm.«
Wie unschuldig er war, dachte ich und unterdrückte ein Lachen, als ich die Röte auf seinen Wangenknochen bemerkte.
Was konnte es Schöneres geben, als einen Gott in den Armen zu halten?
Kapitel 2
Regel Nr. 82 aus dem Buch der Diebe: Gewalt ist nie eine Lösung. Sie ist die Lösung.
Von diesem Moment habe ich immer geträumt. Schon als Kind stellte ich mir meine triumphale Rückkehr vor: die verlorene Tochter, die von ihrem Vater mit offenen Armen empfangen wird und für immer glücklich im Kreise ihrer Familie lebt. Ein Happy End wie im Bilderbuch.
Was für ein Bullshit.
Alles, was ich fühlte, als ich nach Busan zurückkam, war eine Welle der Ablehnung, gefolgt von Verwirrung und hilfloser Wut.
Eine Wut, die mir wie ein Eisblock im Magen lag und das Blut in meinen Adern gefrieren ließ, während wir die lange Auffahrt zum Hauptgebäude hinauffuhren.
Der Stammsitz meiner Familie lag in der Nähe des Ahopsan-Waldes und stand den historischen Königspalästen in Seoul in nichts nach. Neunhundertneunundneunzig – so viele Zimmer hatte der Gebäudekomplex des Hong-Clans, und es waren nur deshalb keine eintausend, weil diese Zahl den Königen vorbehalten war.
Ich hatte mich geirrt, dachte ich, als ich durch das getönte Fenster der Limousine blickte und die eleganten Kiefern an uns vorbeiziehen sah. In meiner Erinnerung war dies ein warmer Ort gewesen, mein Zuhause, meine Zuflucht. Aber davon war nichts mehr übrig. Was ich heute sah, war eine abstoßende Zurschaustellung verschwenderischen Reichtums und Macht. Die Limousine glitt lautlos an perfekt gepflegten Blumenwiesen vorbei, deren Unterhalt wahrscheinlich höher war als die Jahreseinnahmen unseres Cafés. Und war das dort oben auf den Dächern etwa verdammtes Gold?
Meine Fingernägel gruben sich in die Handflächen und hinterließen kleine Halbmonde in der Haut. Ein wenig mehr Druck, und ich würde Blut sehen.
Ich hatte jede Münze zusammengekratzt, mich über jedes Stück Kuchen gefreut, das im Café übrig geblieben war – und auf diesen Dächern klebte genug Geld, um meiner Mutter für die nächsten Jahrzehnte einen Platz im besten Krankenhaus Koreas zu sichern? Von mir aus konnte die ganze Sippe unter ihrem Reichtum begraben werden – aber natürlich erst, nachdem ich mir meinen Anteil gesichert hatte.
Was hatte sich mein Vater bei dieser Farce eigentlich gedacht? Warum las man mir seit der Minute, in der ich das Flugzeug bestiegen hatte, jeden Wunsch von den Augen und behandelte mich, als wäre ich ein Mitglied der königlichen Familie? Oder schlimmer noch: als hätte man Angst vor mir? Es war wie in einer seltsamen Parallelwelt. Natürlich hatte ich einen gewissen Luxus erwartet, mein Vater musste schließlich sein Gesicht wahren. Eine verwahrloste Tochter, die via Touristenklasse und Bus zu Besuch kam, passte nun mal nicht ins Bild des Patriarchen Hong. Aber ich hatte nun wirklich nicht damit gerechnet, dass er deshalb gleich das ganze Flugzeug charterte und mir eine persönliche Stylistin zur Seite stellte, die mir ein komplettes Makeover verpasste und einen schicken Koffer voller Kleider mitbrachte. Natürlich ohne Preisschilder – aber als ich die eingenähten Markennamen sah, wurde mir schwindelig.
»Agassi, junge Dame, Sie haben die perfekte Figur«, hatte die Stylistin geschwärmt, und ich wusste, dass sie es nett meinte. Aber wer nur wenig Nahrung und viel Stress in sich hineinfrisst, bleibt schlank. Ich rechnete mir aus, wie viel Geld ich verdienen würde, wenn ich die Designerklamotten wieder verkaufen könnte.
Vier Monate, dachte ich. Ja, es würde wehtun, sich von diesen Kleidern zu trennen, aber vom Erlös könnten wir bestimmt vier Monate leben. Es war fast obszön, wie viel Geld sich in diesem kleinen Koffer befand.
Ich zwang mich, mich zu entspannen, und schloss für einen Moment die Augen. Die weichen Sitze der perfekt temperierten Limousine und das leise Surren des Motors machten mich schläfrig. Obwohl der Flug von Jeju nach Busan nicht einmal eine Stunde gedauert hatte, spürte ich, wie sich meine Anspannung allmählich in Müdigkeit verwandelte. Ich griff nach der kühlen Wasserflasche vor mir und hielt sie an meine Wange, um wach zu bleiben. Ich durfte auf keinen Fall nachlässig werden. Meine Mutter war naiv genug zu glauben, dass die Einladung ein Friedensangebot war, aber ich machte mir keine Illusionen. Ich war auf dem Weg ins Feindesland und rechnete jeden Moment mit dem Schlimmsten.
Der Wagen hielt und jemand öffnete mir die Tür.
»Willkommen, Sora Agassi.«
Die in Hanbok gekleideten Bediensteten des Clans standen mit gesenkten Köpfen und gefalteten Händen Spalier. Ich stieg mit wackligen Beinen aus dem Auto und schirmte die Augen mit der Hand ab, als mich das grelle Sonnenlicht blendete. Umrahmt von bambusbewachsenen Hügeln lag das große Anwesen meiner Familie wie ein Relikt aus längst vergangenen Tagen inmitten unberührter Natur. Als wäre die Zeit seit Jahrhunderten stehen geblieben, war kein Stadtlärm zu hören. Nur friedliche Stille, unterbrochen vom Zwitschern der Vögel und dem Rauschen des Windes.
Was Geld und Magie alles erkaufen können, dachte ich und senkte die Hand, als ich mich an das Licht gewöhnt hatte.
»Ich hoffe, Sie hatten eine gute Reise, Sora Agassi.« Ein hagerer, freundlich lächelnder Mann mit silbergrauem Haar verbeugte sich. »Hier, eine Erfrischung.«
Automatisch nahm ich ein kleines Tuch für meine Hände, das mit kaltem, parfümiertem Wasser getränkt worden war.
»Ah.« Als er mir das benutzte Tuch abnahm, erkannte ich ihn wieder.
Muyeol, die rechte Hand meines Vaters und verantwortlich für das Anwesen. Ein ehemaliger Auftragsmörder und im achten Grad mit meinem Vater verwandt. Ich erinnerte mich an die Bonbons, die er mir heimlich zugesteckt hatte. An die blutrünstigen Gutenachtgeschichten, die er mir erzählt hatte, mit dem Hinweis, dass ich als Erbin des Clans die Verantwortung hätte, den Clan genauso weise zu führen wie mein Vater. Ich hatte ihm vertraut. Und wie so viele andere hier hatte er mich bitter enttäuscht.
»Bitte folgen Sie mir, Sora Agassi. Der Patriarch bittet Sie zu einem Gespräch und einem gemeinsamen Abendessen.« Muyeol behandelte mich, als wäre ich tatsächlich die lang erwartete Tochter des Hauses, und ich war zu benommen, um etwas zu erwidern.
Ich zögerte, als ich die breiten Stufen sah, die zum imposanten Hauptgebäude hinaufführten, und bemerkte nur beiläufig, wie Muyeol einen anderen Bediensteten anwies, mein Gepäck hineinzutragen.
Es tat mehr weh, hier zu sein, als es sollte.
»Bitte, Sora Agassi.«
Ich versuchte, die ungebetenen Gedanken abzuschütteln und Muyeol zu folgen – vergeblich. Ich erinnerte mich an jede Stufe. An jedes Knarren der Holzbretter. An jede Biegung und an das Geräusch der Schiebetüren, die sich wie von Geisterhand vor mir öffneten und hinter mir schlossen.
Und jede Erinnerung stach wie eine Nadel in mein Herz. Eine Nadel war vielleicht nicht so schlimm, aber Hunderte? Tausende?
Wie hatte ich glauben können, dass ich diese Löcher in mir jemals wieder füllen würde? Ich fühlte mich wie ein altes, durchstochenes Nadelkissen, das nur noch mit Mühe zusammengehalten wurde. In meiner Erinnerung hörte ich mich lachen und sah mich vor Freude quietschend durch die Gänge rennen. Damals hatte ich noch nicht gewusst, wie austauschbar ich doch war. Und wie sehr Erinnerungen schmerzen konnten.
»Hallo, Schwester.«
Es war eine sanfte Stimme, durchdrungen von reiner Bosheit – eine Stimme, die ich seit Jahren nicht mehr gehört und doch nie vergessen hatte.
Meine Halbschwester wartete vor dem Arbeitszimmer meines Vaters auf uns, und ich schätzte mich glücklich, von Vaters vertrautem Diener begleitet zu werden. Wer weiß, welche Demütigung ich sonst erlitten hätte? Schließlich war es dasselbe Mädchen – nein, inzwischen war sie schon eine Frau –, das mir als Kind giftige Schlangen ins Bett gelegt und sich köstlich darüber amüsiert hatte, wie ich mit ihnen um mein Leben kämpfte. Jia war alles, was ich nicht war: Sie besaß so viel Mana, dass sie es nur mit Mühe in sich zurückhalten konnte. Selbst ich, die ich kein Mana besaß, konnte diese unglaubliche Kraft spüren.
Sie war noch mächtiger geworden, dachte ich und ließ zu, dass mein Neid wie eine Welle über mir zusammenschlug. Es hatte keinen Sinn zu leugnen, wie sehr ich mich danach sehnte, das zu besitzen, was Jia im Überfluss besaß: Mana.
Wenn ich nur einen Bruchteil ihrer Kraft besessen hätte, hätten meine Mutter und ich Busan nie verlassen müssen. Diese Emotionen, die mich zu verschlingen drohten, konnte ich gerade nicht gebrauchen.
Jia klang, als wollte sie sich bei dem Wort »Schwester« übergeben, und ausnahmsweise war ich mit ihr einer Meinung. Aber das hier musste warten. Ich hatte Wichtigeres zu tun – zum Beispiel Geld von meinem Vater zu erpressen. Ich hatte Prioritäten, und ein dickes Bankkonto war mir wichtiger als die kurze Befriedigung, Jia in einen Wutanfall zu treiben.
Sie schürzte ihre vollen Lippen und kam mit kleinen, bedächtigen Schritten auf mich zu. Sie hatte den milchig-weißen Teint und das glänzende Haar von jemandem, der sich seine natürliche Schönheit erkauft hatte – und einen perfekt geschnittenen Pony, den ich ihr am liebsten vom Kopf gerissen hätte.
Aber ihr puppenhaftes Aussehen täuschte mich nicht. Ich wusste, dass sie die Kraft hatte, mich auf der Stelle zu töten. Zum Glück gab es Zeugen, die sie daran hindern würden.
»Warum ist sie hier?« Jia stellte sich Muyeol in den Weg, doch er verlangsamte seine Schritte nicht, sodass sie unbeholfen und mit einem empörten Laut zur Seite treten musste.
»Der Patriarch hat Sora Agassi in sein Arbeitszimmer gebeten.« Muyeol verbeugte sich leicht in meine Richtung und fasste nach den schweren Messinggriffen der Türen, die mich von meinem Vater trennte.
So nah, dachte ich, und mein Herz begann zu rasen. Ich wischte mir die feuchten Hände an der Hose ab. Nach all den Jahren.
»Warum darf sie ins Arbeitszimmer, wenn ich noch nie dort war?« Jias empörte und zugleich weinerliche Stimme stoppte meine aufkeimende Panik. Ich verdrehte die Augen angesichts ihrer Erbärmlichkeit. Wo war ihre Würde geblieben? Sich so zu benehmen vor jemandem, der im Dienst der Familie stand und damit – so anmaßend das auch klang – unter ihr.
»Es ziemt sich nicht für mich, darauf zu antworten«, erwiderte Muyeol in einem Ton, der an Unhöflichkeit grenzte, und ich sah kaum verhohlenen Zorn auf Jias Gesicht aufblitzen. Etwas Kaltes, Berechnendes lag in ihrem Blick, und ich zwang mich, nicht zurückzuweichen.
Wir wussten alle, was unausgesprochen zwischen uns schwelte: Muyeol hatte mit seiner Antwort gezeigt, dass ich wichtiger war als Jia und dass er als Diener mehr Macht hatte als sie. Denn das Wissen, das er ihr vorenthielt, war letztlich Macht.
Interessant.
Aber dafür hatte ich jetzt keine Zeit, die Schadenfreude musste warten, bis ich wieder in Jeju war – mit einem vollen Konto, das mich über die erlittene Schmach hinwegtrösten würde. Denn nach allem, was ich bisher gesehen hatte, würde mein sogenannter Vater ein paar Milliarden Won nicht wirklich vermissen.
»Können wir endlich reingehen, ich habe nicht den ganzen Tag Zeit.« Ich versuchte, so gelangweilt wie möglich zu klingen, und Muyeol wurde plötzlich eifrig.
»Natürlich, Sora Agassi.« Sein respektvoller Ton mir gegenüber war Jia keineswegs entgangen. Während sie mit geballten Fäusten zusah, klopfte Muyeol laut an die schwere Holztür und kündigte mich mit dröhnender Stimme an. Die Tür schwang auf und eine vertraute Stimme empfing uns.
»Herein.«
Fast hätten meine Beine beim Klang seiner Stimme nachgegeben, aber ich biss die Zähne zusammen. Ohne Muyeol oder meine Halbschwester eines weiteren Blickes zu würdigen, trat ich ein.
Meine Vorfahren wären sicher stolz auf mich gewesen, dachte ich zynisch, als sich die Tür hinter mir schloss und ich mich in einem lichtdurchfluteten Raum wiederfand.
In der Mitte des Raumes stand ein massiver Schreibtisch aus dunklem Holz, an den Wänden lehnten hohe, bestickte Wandschirme, seitlich bodentiefe Fenster gaben den Blick frei auf einen sorgfältig gepflegten Innengarten, in dessen Mitte eine uralte Eiche wuchs.
Auch für mich war es das erste Mal, dass ich das Arbeitszimmer betrat, denn normalerweise empfing der Patriarch hier nur Ehrengäste oder das nächste Clanoberhaupt.
Er war so alt geworden.
Ich konnte die Sehnsucht, die mir aufblühte, nicht ignorieren, obwohl ich mir vorgenommen hatte, nichts mehr für diesen mir fremden Mann zu empfinden.
Wie hatte er so alt werden können?
Hier saß der Mann, der meiner Mutter und mir so viel Kummer bereitet hatte. Der so schwach war, dass er sein Ansehen über die Liebe gestellt hatte. Der glaubte, die Pflicht gegenüber seinem Clan sei wichtiger als die Pflicht gegenüber seiner Frau und Tochter.
Ja, Jihoon war immer noch ein gut aussehender Mann, aber in meiner Erinnerung war er stolz und voller Leben. So jung. Das Gesicht des Mannes vor mir jedoch prägten Falten, sein Haar war bereits leicht ergraut, und er blickte mir entgegen, als wäre ich sein wertvollster Besitz.
»Sora.« Er erhob sich. Seine Stimme zitterte leicht. »Ich war mir nicht sicher, ob du meiner Einladung folgen würdest.«
Welche Macht hatten Eltern über ihre Kinder, dass wir ihnen alles verziehen? Dass wir uns nach ihnen sehnten, sie liebten? Auch wenn sie uns einst verstoßen hatten? Und wie konnte er es wagen, mit Liebe und Sehnsucht in der Stimme zu mir zu sprechen? Wie konnte er es wagen, mir Gefühle zu entlocken?
Trotzdem konnte ich mich kaum zurückhalten und hätte mich beinahe in seine ausgestreckten Arme geworfen, als wäre ich nicht erwachsen, sondern wieder neun Jahre alt.
Absichtlich krallte ich die rechte Hand in meinen linken Unterarm, damit der Schmerz mich zur Vernunft brächte. Nein, ich würde ihm nicht in die Hände spielen, ich würde diese Farce, die er hier aufführte, nicht mitmachen.
Er wirkte verletzt, als ich nicht zu ihm kam, sondern kühl nickte. »Bitte setz dich.«
Ich gehorchte, blieb aber angespannt. Ich würde ihm das Reden überlassen und mir gut überlegen, wie ich am besten über das Geld sprechen könnte.
Doch auf einmal war alles anders.
»Ich weiß, dass du mich wahrscheinlich nicht sehen wolltest, da alle meine Briefe ungeöffnet zurückkamen«, sagte er, und meine Augen weiteten sich.
Was hatte er da gesagt?
»Deshalb habe ich meinen letzten Brief direkt an deine Mutter geschickt. Ich …«, er hielt inne, schaute grimmig und fuhr dann fort, »ich darf das eigentlich nicht, aber ich musste diese Regel brechen.«
»Moment mal. Welche Briefe?« Ich wäre fast vom Stuhl wieder aufgesprungen. »Ich habe nie etwas von dir bekommen.«
»Was?« Er sah noch verblüffter aus als ich, und ich hätte fast gelacht, denn ich war mir sicher, dass noch niemand den Patriarchen so sprachlos erlebt hatte.
»Ich habe nie etwas von dir erhalten. Weder Briefe noch irgendeine Art von Unterstützung.« Ich bemerkte seinen eisernen Griff um die Lehne seines Stuhls. »Ich habe dir sogar geschrieben, als Mutter krank wurde und wir Geld für ihre Behandlung brauchten, aber du hast nie geantwortet.«
»Heesun ist krank?«
Er sah aus, als hätte man ihm einen Stich versetzt, mitten hinein in ein Herz, das er nicht hatte. Wie kann das sein, dachte ich verwirrt, während mir unangenehme Gedanken durch den Kopf schossen. Er hätte meine Mutter sonst doch nicht beim Vornamen genannt, er wusste es offenbar wirklich nicht.
Seine Hand zitterte, und seine Augen waren voller Schmerz. »Was ist mit ihr? Was hat sie?«
Meine Kehle war wie zugeschnürt und meine Gedanken rasten.
Er rieb sich mit den Händen über das Gesicht, und ich versuchte, den aufkommenden Gedanken zu unterdrücken, dass meine Mutter ihm doch nicht gleichgültig war. Nein, dachte ich trotzig, ich werde mich nicht von ihm einlullen lassen.
»Muyeol.« Die Stimme meines Vaters war fast zu leise, um sie zu hören, aber dennoch erschien sein treuer Diener direkt neben mir. Ich fuhr vor Schreck zusammen, doch keiner der Männer schien es zu bemerken.
»Durchsucht den Westflügel. Nimm nur deine vertrauenswürdigen Schatten mit und agiere als meine Stimme und Hand. Kommt erst zurück, wenn ihr Beweise gefunden habt.«
»Ja, Meister.« Muyeol löste sich in Luft auf und mir wurde schwindelig. Durchsuchung des Westflügels? Was sollte das?
War im Westflügel nicht …
»Ich wollte dich und deine Mutter nicht wegschicken, aber ich musste es tun.« Jihoon ging um den Schreibtisch herum und trat auf mich zu, während ich versuchte, das gerade Erfahrene zu verarbeiten. »Es war die einzige Möglichkeit, dich zu beschützen, aber jetzt sehe ich, dass … dass dich keine Hilfe, die ich dir all die Jahre über habe zukommen lassen, je erreicht hat.«
Ein schrecklicher Verdacht schlich sich in meinen Kopf. Etwas, worüber ich noch nie nachgedacht hatte, das aber nach dem Befehl Jihoons an Muyeol Sinn ergab.
Konnte das sein? Ich begann zu ahnen, dass manche Dinge nicht so einfach waren, wie ich es mir vorgestellt hatte.
»Ich werde es wiedergutmachen, ich schwöre es.« Er kniete vor mir nieder, seine warmen Hände umklammerten meine. In seiner Stimme lag Verzweiflung und in seinen Augen so viel Liebe und Bedauern. »Für dich und deine Mutter.«
Meine Fingerspitzen wurden taub, und ich widerstand der Versuchung, mich loszureißen.
Dieser Schock, diese langsam aufblühende Erkenntnis war für mich schlimmer als die Jahre des Wartens auf ein Zeichen meines Vaters. Ich war gar nicht verlassen worden, und meine Mutter wurde immer noch geliebt. All diese verlorenen Jahre. Die Tränen, die Demütigungen, die Hoffnung – und Hoffnungslosigkeit. Wofür?
Ohnmächtige heiße Wut erfüllte mich, sie schwappte über wie kochendes Wasser in einem Topf. Ich taumelte auf die Beine, der Stuhl hinter mir kippte um. Er war das verdammte Oberhaupt des Hong-Clans, ein Meister des Manas. Mit so viel Macht und Ressourcen, die ihm zur Verfügung standen.
Er hätte in der Lage sein müssen, über die oberflächlichen Manipulationen hinwegzusehen, er hätte mehr tun müssen, er hätte sich kümmern müssen. Er hätte uns retten müssen.
Er hätte zu mir kommen müssen.
Ich versuchte verzweifelt, meine Tränen zurückzuhalten, als das kleine einsame Kind in mir endlich seine Wut herausschreien wollte.
Wenn er wirklich mehr über uns hätte wissen wollen, wenn er uns hätte helfen wollen, dann hätte er das tun können.
»Ich habe euch nicht direkt kontaktiert, um euch beide zu schützen. Bitte glaub mir«, sagte er eindringlich, und die Worte klangen für mich wie das Quietschen von Kreide auf einer Tafel.
»Um mich zu schützen?« Ich sah rot. »Dir glauben?«
Da war so viel Zorn in mir, der hervorbrach durch die Worte, die ich so lange in mir behalten hatte. »Es gab Tage, da hat meine Mutter gehungert, nur um mich zu ernähren! Sie hat alles verkauft, was sie hatte, sonst wären wir obdachlos geworden. Und du besitzt die Frechheit, mir zu sagen, dass du uns nicht kontaktiert hast, weil du uns beschützen wolltest?«
Jihoon wollte mir die Hand reichen, aber ich schüttelte den Kopf.
»Du hättest das alles wissen können, wenn du dich nicht feige hinter Familientraditionen versteckt und dich von anderen hättest manipulieren lassen.«
Als er gequält die Augen schloss, fühlte ich Trauer und Genugtuung zugleich. In diesem Moment war es mir egal, ob auch er ein Opfer war, ich wollte nur verletzen, so wie ich verletzt worden war.
Scheiß auf die Formalitäten. Scheiß auf alles. Scheiß auf das Geld.
Meine Mutter hatte mich ihr ganzes Leben lang beschützt, jetzt war es an mir, sie zu beschützen. Ich wollte ihm zeigen, dass wir ihn nicht mehr brauchten. Ihm wehtun, so gut ich konnte, weil ich zu verletzt war. Ich konnte nicht länger hierbleiben und mich wieder von dieser verdammten Familie erdrücken lassen. Und am allerwenigsten wollte ich Mitleid mit Jihoon haben.
»Ich hätte nie herkommen sollen.« Ich wollte seinen schweren Schreibtisch zertrümmern, die komplizierten Kunstwerke auf den Wandschirmen um uns herum herunterreißen, Chaos und Zerstörung hinterlassen, bevor ich ging. Aber ich beherrschte mich, denn sosehr ich auch wollte, ich war machtlos ohne Mana. Ich hatte keine Magie, nur meine Worte, die ich als Waffe einsetzen konnte.
»Ich weiß nicht, warum du entschieden hast, jetzt Interesse an mir zu zeigen, aber ich brauche es nicht. Nicht mehr. Ich brauche weder dich noch irgendetwas, was du mir anbieten könntest. Ich würde lieber betteln gehen, als irgendetwas von dir anzunehmen.«
Ich war eine Närrin gewesen, zu glauben, ich könnte Geld von ihm fordern – nicht einmal das war er wert. Wenngleich es so aussah, als hätte er es nicht gewusst, als wären seine Nachrichten an uns blockiert und seine Unterstützung umgeleitet worden, änderte das nichts an dem tosenden Gedanken in mir: Er hätte es wissen müssen.
»Du hast den Clan, den du willst. Die Erbin, die du willst. Belassen wir es dabei. Du hast einen flüchtigen Blick auf die Versagerin von einer magielosen Tochter geworfen, die du einst hattest, ab jetzt trennen sich unsere Wege. Für immer.«
»Du bist keine Versagerin, Sora!« Seine Stimme war ein Donnern, und ich spürte, wie der Boden unter meinen Füßen bebte. »Du bist das Beste und Reinste, was zwischen deiner Mutter und mir je passiert ist.«
Für einen Moment wurde mir vor Wut schwarz vor Augen und ich vergaß das Beben.
Seine Worte, die denen meiner Mutter so ähnlich waren, klangen für mich wie Hohn.
Das Beste?
Bring mich nicht zum Lachen.
»Wage es nicht, so mit mir zu sprechen. Du hast kein Recht, so mit mir oder meiner Mutter zu reden, besonders wenn du die ganze Zeit mit deiner perfekten Familie gelebt hast.« Ich wollte die Welt in Brand stecken und alle zu Asche verbrennen. Mich eingeschlossen. »Deine zweite Frau, deine perfekte Tochter, du hattest alles. Und wir waren verzweifelt. Wage es nicht, jetzt Vater zu sein. Das Einzige, was uns verbindet, ist unser Nachname. Warum hast du mich denn jetzt kontaktiert? Ich habe immer noch keine Magie, also bin ich nutzlos für dich.« Schwer atmend holte ich Luft, als mich unerwartet eine Druckwelle traf und nach hinten taumeln ließ.
»Du bist nicht nutzlos!«, brüllte Jihoon mit rauer Stimme, und die Magie seines Zorns erschütterte das Gebäude. Die Lichtblitze und das mittelschwere Erdbeben unter mir ließen mich den Halt verlieren, ich fiel hin.
Die Angst, die mich durchflutete, war ernüchternd.
Mit klopfendem Herzen sah ich, dass der Baum vor dem Fenster in zwei Hälften gespalten war und Rauch aus dem Stamm aufstieg. Kalter Schweiß brach mir aus, und ich versuchte, mein Zittern unter Kontrolle zu bringen.
Wie hatte ich nur eine Sekunde lang vergessen können, dass mich eine mörderische Kraft umgab? Dass jede Person in diesem Anwesen letztlich ein Monster war?
Jihoon hatte seine Hände zu Fäusten geballt, und ich war mir sicher, dass er den Baum gespalten hatte.
Na toll.
Ich hatte jemanden mit Wutproblemen und genug Mana provoziert, der mich dafür bezahlen lassen könnte, dass ich meinen Frust an ihm ausgelassen hatte.
»Hör zu, ich habe mich geirrt. Ich brauche nichts von dir.« Ich rappelte mich auf und stolperte zur Tür.
Ich gab den Plan, Geld zu fordern, endgültig auf, denn es war wichtiger, am Leben zu bleiben. »Ich gehe zurück nach Jeju.«
Ich würde überleben, wie ich es immer getan hatte, und einen anderen Weg finden, um für meine Mutter zu sorgen. Und dann, vielleicht, würde ich eines Tages endlich anfangen zu leben. Weit weg von dieser verrückten Familie und ihren kriminellen Machenschaften.
»Du hast Angst vor mir?« Er klang schockiert. »Warum?«
Hatte er das wirklich gefragt?
Hatte er nicht gerade eben einen hundert Jahre alten Baum vor meinen Augen gespalten? Wie konnte ich auch nur für einen Augenblick vergessen, dass ich in die Höhle der Ungeheuer eingedrungen war, umgeben von Wesen, die zwar eine menschliche Haut trugen, in ihrem Inneren aber tödliche Kreaturen waren?
»Bitte bleib«, beschwor er mich, »nur ein paar Tage. Ich schwöre bei deiner Mutter, dass ich es wiedergutmachen werde.«
»Nein. Ich lasse mich nicht mehr von der Hoffnung überwältigen, nie wieder.« Das Mantra in meinem Kopf spielte sich unermüdlich ab. »Ein paar Tage würden nichts ändern, du hattest Jahre Zeit – es ist vorbei.« Ich drehe ihm den Rücken zu. »Ich gehe jetzt.«
Ich versuchte, die Tür zu öffnen, aber sie bewegte sich nicht. »Mach die verdammte Tür auf«, zischte ich, jetzt schon wieder mehr wütend als ängstlich.
»Bleibst du?«, fragte er fast flehend. »Niemand wird dir etwas tun. Ich habe angeordnet, dass du unser Ehrengast bist. Ich schwöre, ich werde es wiedergutmachen. Bitte bleib.«
»Öffne die verdammte Tür und finde heraus, ob ich bleibe oder nicht.« Als die Tür endlich aufschwang und ich hinausstürmte, war ich kurz vorm Durchdrehen. Ich brauchte Ruhe, um alles gründlich zu überdenken und um das zu verarbeiten, was gerade geschehen war. Dass man meiner Mutter und mir all die Jahre die notwendige Unterstützung versagt und die Briefe meines Vaters abgefangen hatte.
Ich eilte durch die Gänge, wusste aber selbst nicht, mit welchem Ziel. Nur eines war mir klar: Einer meiner größten Vorteile war, dass ich mich anpassen konnte. Ich konnte zwar nachtragend sein und gelegentlich explodieren, aber wie mein lieber Vorfahre wusste auch ich, wie ich eine Situation geschickt zu meinen Gunsten wenden konnte. Ich sollte in der Lage sein, das Beste aus der Verzweiflung meines Vaters über die Enthüllungen zu machen und vielleicht …
»Uff!« Meine Füße rutschten weg, und beinah wäre ich gestürzt, wenn mich nicht jemand aufgefangen hätte.
»Hey, du solltest nicht rennen, der Boden ist glatt hier.« Ein starker Arm um meine Taille verhinderte, dass ich hinfiel.
Ich blinzelte. Ein freundliches Gesicht blickte mich lächelnd an. Es kam mir definitiv bekannt vor. Schneeweißes, widerspenstiges Haar, graue Augen und eine athletische Statur. Dazu dieses schiefe, jungenhafte Lächeln.
Hong Min. Mein Cousin, oder besser gesagt, einer meiner entfernten Verwandten. Wie viele Grade trennten uns? Ich hatte ihn in den Zeitungen gesehen, in denen er als der neue Star der koreanischen Olympiamannschaft im Schwimmen angepriesen wurde. Was würde die Welt sagen, wenn sie wüsste, dass er die Wassergeister beherrschte, die ihm beim Schwimmen sicher einen Vorteil verschafften?
»Min.«
Er strahlte mich fröhlich wie ein kleines Kind an, und beinahe hätte ich zurückgelächelt.
»Du weißt noch, wer ich bin!« Er sah so glücklich und aufgeregt aus und erinnerte mich an einen zu groß geratenen Golden-Retriever-Welpen.
»Ah …« Ich kannte ihn nur aus der Zeitung, aber dann tauchte eine längst vergessene Erinnerung auf. An einen kleinen Jungen, der mir nachlief und immer versuchte, mich einzuholen. Der weinte, wenn ich zu schnell war, Rotz und Tränen im Gesicht, bis ich zurückkam.
»Du warst so süß damals«, platzte ich heraus, ohne nachzudenken. Er wurde rot und kratzte sich am Kopf.
»Ha, ha, ja, und du …«
Ich unterbrach Min mit einer heftigen Handbewegung, als ich ein Knistern von Mana auf meiner Haut spürte und wusste, dass es nur meine Halbschwester sein konnte. Es war seltsam, dass ich ihr Mana spüren konnte, aber es musste an der gegenseitigen Abneigung liegen, die uns verband. Sie musste in der Nähe auf mich gewartet haben, um mich abzupassen.
»Was hast du gemacht?« Ohne weitere Formalitäten versperrte Jia uns den Weg.
Hatte sie nichts Besseres zu tun, als mir hinterherzujagen? Es gab eine Zeit, in der ich jede Aufmerksamkeit meiner Familie in mich aufgesogen hätte wie ein Schwamm, aber nun sehnte ich mich nach Jeju zurück, wo man mich einfach nur in Ruhe ließ.
Ich stellte mich ahnungslos. »Ich habe keine Ahnung, was du meinst.«
»Ich habe dich gefragt, was du getan hast.« Ihre Bewegungen waren fließend, zu koordiniert, um als menschlich bezeichnet zu werden.
Min versuchte unauffällig, mich hinter sich zu schieben, aber ich schlug seine Hand weg. Ich ahnte, warum Jia so empört war, und ich konnte das Gefühl, das ich dabei hatte, als köstlich bezeichnen. Als würde man in eine Torte mit viel Quark und Erdbeeren beißen. Ich lächelte, und ich musste es nicht einmal vortäuschen. »Was genau meinst du?«
Jia war wütend, und die Schadenfreude in mir tanzte förmlich. »Du musst etwas zu Vater gesagt haben, sonst hätte sein Lakai nicht unseren Flügel durchsucht!«
Ah.
»Warum fragst du Vater nicht selbst?«, antwortete ich schnippisch, und obwohl ich genau wusste, dass ich im Begriff war, etwas Dummes zu tun, konnte ich mich nicht länger zurückhalten. Ich riss die Augen auf und machte ein übertriebenes stummes »Oh« mit dem Mund. »Oje, um ihn zu fragen, müsstest du in sein Arbeitszimmer gehen, und da darfst du ja nicht rein. Wie schade!«
»Das wirst du bereuen!« Mit einem Schrei und einer Handbewegung färbte sich die Luft um Jia herum schwarz. Eine Welle von tödlichen Speeren aus Stahl und Rauch baute sich vor mir auf. Der Angriff erfolgte so abrupt, dass ich ihn nicht kommen sah – ich hatte nicht einmal Zeit, Angst zu haben.
War Jia verwöhnt oder dumm? Oder beides?
Es musste von der Familie ihrer Mutter kommen, ein Hong konnte nicht so dumm sein und sich den Befehlen des Patriarchen widersetzen. Ich mochte einen Groll gegen meinen Vater hegen, aber ich zweifelte nicht einen Moment lang an seinen Worten, dass ich sein Ehrengast sei. Und als Ehrengast war ich vor Angriffen sicher. Niemand stand über seinen Befehlen und Regeln. Man musste sich nur anschauen, was mit meiner Mutter und mir geschehen war.
»Du darfst deine Kräfte nicht benutzen.« Min war vor mich getreten und ein verschwommener Schild aus Wasser schützte uns vor den Speeren aus Rauch.
»Halt’s Maul, Min«, zischte Jia und stieß ihn blitzschnell so heftig gegen die Brust, dass er gegen die Wand krachte und der Stein hinter ihm Risse bekam.