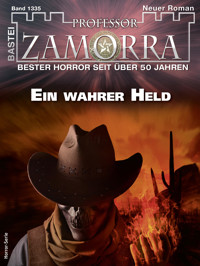
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Der Dämon kicherte. Ein Transport des wertvollen Artefakts aus Governor City barg unzählige Risiken, besonders die Aufmerksamkeit der Forscher. Wer konnte sich um das Ding kümmern, wenn alle Einheiten für die Offensive gebraucht wurden? "Natürlich", sagte er leise, und ein dämonisches Lächeln huschte über sein Gesicht. Es gab da jemanden, der ihm bereits zuvor bei einer ähnlichen Sache sehr hilfreich gewesen war. Dieser Jemand hörte auf den Namen Zamorra, Hexenmeister Zamorra ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 128
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhalt
Cover
Inhalt
Ein wahrer Held
Vorschau
Impressum
Cover
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsbeginn
Impressum
Ein wahrer Held
von Stefan Hensch
Lister übernahm die Führung, und Zamorra war nicht unglücklich darüber. Er war zwar ein passabler Reiter, aber dies hier war definitiv das Metier seines Freundes.
»Haben wir überhaupt noch eine Chance, den Kerl einzuholen?«
Die Gesichtszüge des Cowboys waren wie in Stein gemeißelt, als er Zamorra ansah. »Du hast so lange eine Chance, wie du glaubst, eine zu haben.«
Zamorra schluckte hart, um sich ein Lächeln zu verkneifen. Es gab Menschen, die mit deutlich schlechteren Slogans ein Vermögen gemacht hatten ...
Professor Maxwell Dinkleberg sah sich zufrieden auf der Ausgrabungsstelle um. Sie war sein Baby. Insgesamt gab es vier Gruben, in denen seine Leute mit Arbeitern tätig waren. Governor City war ein echter Glücksfall. Vor achtzig Jahren hatte die Stadt noch auf den Namen Hudson gehört. Einer kurzen Blüte war ein rapider Niedergang gefolgt. Die Stadt war zur Geisterstadt geworden, und die letzten Bewohner kehrten ihr den Rücken zu.
Der Ausbau der Eisenbahnstrecke bis nach Brixton hatte das alte Hudson aus der Vergessenheit gerissen. Die ersten Siedler fanden überraschend gut erhaltene Gebäude vor, denen das trockene Wüstenklima wenig geschadet hatte. Schnell wurden weitere Unterkünfte für Neuankömmlinge benötigt, weshalb mit Bauarbeiten begonnen wurde. Arbeiter waren währenddessen auf die Reste einer noch älteren Siedlung gestoßen. Dies war nun die Zuständigkeit Dinkleburgs und seiner Leute.
Heißer Wind kam auf und wehte dem Professor ins Gesicht. Schweißtropfen standen auf seiner Stirn. Er griff in seine Hosentasche und wischte sich mit einem Stofftaschentuch durchs Gesicht. Ihm war es viel zu heiß, aber darauf konnte er keine Rücksicht nehmen. Hier galt es einen Auftrag zu erfüllen, und genau das würde er tun.
Mit genau bemessenen Schritten ging Dinkleburg zum Rand der großen rechteckigen Grube. Vier Arbeiter legten die Grundmauern des ehemals größten Baus mit ruhigen Bewegungen weiter frei. Packard, der Jüngste der Archäologen, stand etwas abseits und starrte auf eine Karte in seinen Händen.
Ohne sich um den jüngeren Mann zu kümmern, legte Dinkelburg einen Zollstock an die Grundmauern an. 3,5 Zoll. Er befeuchtete seinen Zeigefinger und blätterte in seinem Notizbuch und trug das Maß ein. »1,25 Zoll tiefer sind nicht gerade viel«, murmelte er vor sich hin.
Jetzt bemerkte Packard den Professor und faltete die Karte zusammen. »Guten Morgen, Professor.«
»Guten Morgen, Anthony. Liegen Sie im Plan?«
Packard zögerte. »Zwei meiner Arbeiter kamen gestern nach der Mittagspause nicht zurück.«
Dinkleburg sah zu den Männern hinüber. Glücksritter, Abenteurer und Gesetzlose bevölkerten das Städtchen Governor City, das aus den Ruinen von Hudson erblühte. Mit dem Lohn, den die Universität zahlte, konnte man im besten Fall Taugenichtse anwerben, und genauso sahen die vier Kerle auch aus. Immerhin hatten sie keinen Alkohol dabei und rochen auch nicht danach.
»Sie müssen ihren Leuten klar machen, dass sie nicht fürs Nichtstun bezahlt werden.«
Packard presste die Lippen zusammen und nickte dann. »Ich dachte, ich hatte mich deutlich genug ausgedrückt ... «
Der Professor lachte schnaubend. »Sie sollten nicht zu viel denken, Tony. Setzen Sie einfach ihre Anordnungen durch.«
Der Professor hatte das Gesicht des Archäologen aufmerksam beobachtet. Natürlich gefiel Packard die Ansprache nicht. Anthony Packard war aber nicht irgendwer, sondern sein potenzieller Schwiegersohn. Und was seine Tochter anging, da hatte Professor Dinkleburg ziemlich genaue Vorstellungen.
»Haben wir uns verstanden?«
Wieder frischte der Wind auf und trieb ihnen seine Hitze entgegen.
»Natürlich, Professor Dinkleburg.«
Als Nächstes stattete der Ausgrabungsleiter den beiden angrenzenden Ausgrabungsgebieten einen Besuch ab. Das erste Areal lag in Harald Hendersons Verantwortungsbereich, einem erfahrenen Mitarbeiter.
»Sie kommen gut voran«, kommentierte Dinkleburg und machte sich weitere Notizen in seinem kleinen Buch.
Beim nächsten Abschnitt glomm Wut in ihm auf. Werkzeuge und Arbeitsmaterialien lagen überall verstreut. Die Arbeiter hatten sich zusammengerottet, lachten und spielten mit einem sandgefüllten Baumwollsäckchen, das es mit Armen und Beinen in der Luft zu halten galt. Der Verantwortliche starrte in Richtung Sonne und trank hochprozentigen Fusel aus einer Glasflasche.
»Was ist hier los, Molyneux?«
Der Angesprochene fuhr herum und sah den Professor mit blutunterlaufenen Augen an. »Ich kann nicht mehr, Max.«
Wie Henderson gehörte auch Molyneux seit langer Zeit zum Team. So lange, dass sie bereits zur vertraulichen Ansprache gewechselt hatten. Nie zuvor hatte Dinkleburg eine solche Schlamperei bei Molyneux erlebt. Dafür musste es eine Erklärung geben.
»Mein verfluchter Zahn. Er hält mich jede Nacht wach, und ohne Whiskey halte ich es einfach nicht aus«, sagte Molyneux und legte die Linke auf die Wange.
Dinkleburg hatte seinem Mitarbeiter gesagt, dass er vor ihrem Aufbruch zum Arzt gehen sollte. Molyneux hatte auch einen Termin vereinbart, jedoch war er aufgrund einer Krankheit des Zahnarztes abgesagt wurden. So etwas passierte, wenn es auch ärgerlich war.
»Du machst für heute Feierabend, Peter. Erkundige dich bei deinen Leuten, ob es in der Stadt einen Dentisten gibt. Notfalls reitest du in die Nachbarstadt.«
»Danke, Max«, seufzte der Archäologe.
Dinkleburg hatte schon gar nicht mehr hingehört. Für den kaputten Zahn konnte Molyneux nichts, der Ausgrabungsleiter allerdings auch nicht. Am Ende würde er dem Direktor der Universität für die entstandenen Kosten Rechenschaft schulden.
Schlecht gelaunt bewertete er den Fortschritt der Arbeiten und trug die Details in sein Notizbuch ein. Er ließ das Buch geräuschvoll zusammenklappen und giftete zu den gut amüsierten Arbeitern hinüber. Das Spiel hielt sie so sehr gebannt, dass sie Dinkleburg gar nicht bemerkten. Der Professor drückte die Wirbelsäule durch und schritt hoch erhobenen Hauptes auf die Gruppe zu.
»Möchtet ihr heute keinen Lohn?«, fragte der Professor aus nächster Nähe.
Die Gespräche und das Lachen erstarben, das sandgefüllte Säckchen prallte gut hörbar auf die Erde. Vier Augenpaare richteten sich auf Dinkleburg.
»Wir haben auf Mister Molyneuxs Anweisungen gewartet. Als keine kamen, haben wir uns die Zeit vertrieben.«
Dinkleburg sah die Männer scharf an. »Nun gut. Räumt den Saustall hier schnellstmöglich auf. Ich komme in einer halben Stunde wieder. Wenn dann keine Ordnung herrscht, fliegt einer nach dem anderen raus!«
Bis zum Mittag blieb Dinkleburg auf Molyneuxs Herrschaftsgebiet, beaufsichtigte die Arbeiten und trieb die Tagelöhner an. So geschah wenigstens irgendetwas auf diesem Teil der Ausgrabung.
Gegen Mittag verließ der Professor die Gruppe und hielt auf den letzten Abschnitt zu, der die Form eines Parallelogramms aufwies. Der Unterschied zu den anderen Arealen war auffällig. Die Arbeiter glichen emsigen Bienen und arbeiteten zuverlässig. Beeindruckt näherte er sich der verantwortlichen Archäologin. Dabei musste er ein Geräusch verursacht haben, denn die Rothaarige drehte sich um.
»Ich hatte dich schon früher erwartet, Vater«, sagte sie lächelnd.
Der Professor breitete die Arme aus. »Molyneux hat starke Zahnschmerzen und ist auf dem Weg zum Dentisten. Da er seinen Pflichten nicht mehr nachgekommen ist, musste ich sein Herrschaftsgebiet in Ordnung bringen.« Er wischte sich mit dem Handrücken über die Stirn. »Aber jetzt zu dir, Victoria. Täuscht es, oder bist du etwas auf der Spur?«
»Sieh selbst, Vater«, sagte die junge Frau und ging mit ihm zu einer Stelle, an der die Arbeiter einen Schacht freilegten.
»Das sieht nicht wie eine gewöhnliche Hütte aus«, sagte Dinkleburg nachdenklich.
Die Rothaarige schob sich eine Strähne aus dem Gesicht.
»Wir haben die üblichen und zu erwartenden Reste einer ehemaligen Behausung gefunden: Tonscherben, Asche und Reste von Werkzeugen. Die früheren Bewohner haben jedoch auch einen Keller besessen.«
»Ungewöhnlich«, presste Dinkleburg hervor.
Einer der Arbeiter stieß mit einem Spaten zu und machte einen überraschten Satz aus dem Loch heraus, als der Boden unter ihm nachgab. Der Zugang war frei.
»Du bist genau zur rechten Zeit gekommen«, sagte Dinkleburgs Tochter. »Hey Lance, bring mal bitte die Lampe her!«
Kurz darauf hielt Victoria die zischende Gaslaterne in der Rechten und leuchtete von oben in den dunklen Schacht.
»In die Wände sind Sprossen geschlagen«, bemerkte Dinkleburg.
Geschickt stieg die junge Frau hinab. Der Professor seufzte leise. Natürlich ließ sich seine Tochter dieses Privileg nicht nehmen und kletterte als Erste hinunter. Er selbst hätte sich nicht anders verhalten, aber Vicky war nicht irgendein billig ersetzbarer Arbeiter, sondern seine Tochter. In weniger als einer Minute verschwanden die roten Haare im Schacht.
Er schluckte hart und spürte feinen Staub auf der Zunge. Linkisch nahm er seine Taschenuhr hervor. Es dauerte drei Minuten, bis der rote Lockenkopf seiner Tochter wieder im Loch sichtbar wurde. Erleichtert atmete Professor Dinkleburg auf.
Leichtfüßig kletterte Victoria aus dem Schacht. Sie hielt einen Gegenstand unter dem Arm an den Körper gepresst, mit dem sie die Karbidlampe hielt.
»Das musst du sehen, Vater. Es ist wunderschön!«
Der Gegenstand war in ein Tuch eingeschlagen. Wenn Dinkleburg es nicht besser gewusst hätte, hätte er es für so etwas wie ein Öltuch gehalten. Die schlanken Finger seiner Tochter schlugen den Schutz zurück, und silbernes Funkeln blendete ihn kurz.
Nachdem sich seine Augen an den Lichtreflex gewöhnt hatten, sah er etwas Unglaubliches. Es war ein gut handtellergroßer Würfel, der aus zahlreichen filigranen Prismen bestand. Wunderschön, kostbar und sehr, sehr alt.
»Das passt so gar nicht zu unseren bisherigen Fundstücken«, sprach Victoria das Offensichtliche aus.
Der Professor nickte. »Wir schicken einen der Arbeiter per Pferd zur Telegraphenstation nach Rexville. Mit dem Fund alleine ist unserer Ausgrabung ein fulminanter Erfolg.«
Stolz und tiefe Befriedung erfüllten den weißhaarigen Archäologen.
Colonel John Lucius Decker stand im Schützengraben. Seit dem gestrigen Abend regnete es ununterbrochen. Der dunkelblaue Hut mit den goldenen Insignien war ebenso durchnässt wie der Uniformmantel. Egal, den Männern um ihn herum erging es nicht anders. Gedankenverloren holte er seinen Feldstecher hervor und rieb ihn mit einem Baumwolltuch trocken, ehe er hindurchsah.
Die Nekroindianer marschierten langsam aber unaufhaltsam. Wenn sie das Tempo beibehielten, würden sie gegen Nachmittag ihre Position erreichen. Und dann gnade uns Gott. Die Untoten werden jedenfalls keine kennen.
»Was halten Sie von einem vorgezogenen Angriff unserer Kavallerie, Colonel?«, hörte er die Stimme seines Stellvertreters Major Lloyd neben sich.
Mit regungsloser Miene sah Decker den rangniederen Lloyd an. Der Vorschlag war genauso idiotisch, wie es der Major selbst war. Die Verluste der Armee waren so entsetzlich hoch, das Schlachtfeldbeförderungen an der Tagesordnung waren.
Lloyd war als Privatier in die Armee eingetreten und dann die Hierarchie raufgefallen. Gefallene mussten ersetzt werden, und dazu konnte man sich nur der vorhandenen Kräfte bedienen. Lloyds einzige Leistung bestand darin, am Leben geblieben zu sein. Leider machte ein glanzvoller Kragenspiegel aus einem Einfaltspinsel keinen Krieger.
»Wir müssen behutsam mit unseren Kräften umgehen, Major. Die Reiter greifen erst dann an, wenn wir sie mit unseren Geschützen unterstützen können.«
Decker sah, dass sein Vertreter die Antwort nicht verstand. Einmal mehr spielte der Colonel mit dem Gedanken, Lloyd beim nächsten Angriff hinterrücks eine Kugel zu verpassen. Wenn der Trottel je seine Nachfolge antreten sollte, käme das einem Todesurteil für seine Männer gleich. In der Ferne grollte Donner und riss Decker aus seinen rabenschwarzen Gedanken.
»Ich sehe mir mal den Schützengraben an, Major. Sie halten hier die Stellung.«
Decker hatte sich alles mehrfach angesehen, wollte seinen steifen Gliedern jedoch etwas Bewegung verschaffen. Außerdem brauchte er ab und an eine Pause von diesem Simpel neben sich.
Bis auf die Beobachter saßen die meisten Soldaten im Schützengraben, mit dem Rücken an dessen Wände angelehnt. Sie salutierten, wenn sie ihn sahen. Der Einsatz dauerte bereits viel zu lange. Die Bärte waren lang und verfilzt, die Uniformen ausgeblichen und verdreckt. Einige der Männer spielten Karten, andere würfelten, und wenige lasen Briefe aus der Heimat. Über ihnen hing das drohende Damoklesschwert des bevorstehenden Gefechts mit den Nekroindianern.
Die Kanonen befanden sich außerhalb der Gräben und hatten sich langsam im morastigen Boden festgefahren. Wasser lief kontinuierlich in den Schützengraben hinein. Regelmäßig mussten sie vom Schlamm befreit werden. Das Wetter war ihnen keine große Hilfe.
Decker durchquerte die befestigten Stellungen in ihrer Gänze und sah in jedes einzelne Gesicht. Viele der Männer würden morgen nicht mehr am Leben sein. Vielleicht traf das sogar auf ihn selber zu. Sterben gehört zu den Aufgaben eines Soldaten, wenn es auch die schlimmste war.
Höchstwahrscheinlich konnten sie den Gegner nicht stoppen. Dann wäre das eben die Aufgabe nachfolgender Einheiten.
Decker holte ein Amulett hervor und klappte es auf. Auf der einen Seite lächelte ihm seine Frau Camille entgegen und auf der anderen seine Enkelin Mathilde. Ob er sie je wiedersehen würde?
Instinktiv legte er die Rechte auf den Griff seines Säbels. Entgegen der Vorschriften trug er weiterhin die Waffe, die er schon als junger Kavallerist benutzt hatte. Wenn es sein musste, würde er bis zum letzten Atemzug kämpfen. Die Waffe erinnerte ihn an seinen Neffen James, denn er hatte den selben Säbel an der Seite.
James Conway war erst vor Kurzem zum Captain befördert worden. Er war ein schneidiger junger Mann, der nicht vor Risiken zurückschreckte. Lucius hatte seiner Schwester versprochen, auf Jamie aufzupassen. Bei einem Reitersoldaten war dieses Versprechen kaum zu halten, zumal sein Neffe ein Draufgänger war. Erfreulicherweise war James auch einer der gerissensten Hunde, die der Colonel je kennengelernt hatte. Außerdem war Decker erfahren genug, um zu wissen, dass er Familienmitglieder nicht bevorzugen durfte, wenn er die Moral seiner Truppe nicht untergraben wollte.
Unter John Lucius Decker kämpfte jedes Mitglied seiner Einheit, naja, bis auf den verfluchten Lloyd vielleicht.
Momentan hielt sich James, zusammen mit den anderen Kavalleristen und ihren Pferden, ein Stück hinter ihnen auf. Die Tiere brauchten Ruhe und mussten versorgt werden, damit die Reitertruppe zur rechten Zeit als Geheimwaffe eingesetzt werden konnte.
Der Colonel beendete seinen Rundgang und kehrte an seinen Platz zurück.
»Wenn Sie möchten, können Sie sich mit einem Kaffee im Befehlsstand aufwärmen, Lloyd.«
Der Major antwortete nicht, sondern starrte wie gebannt durch den Feldstecher.
»Lloyd?«
Keine Reaktion. Decker rieb einmal mehr sein Fernglas trocken und setzte es an die Augen. Er erwartete die Nekroindianer zu sehen, und so war es auch. Trotzdem überrumpelte ihn der Anblick. Die Streitmacht änderte die Marschrichtung! Anstelle stoisch auf ihre Stellung zuzumarschieren, wandten sie sich jetzt nach Westen und entfernten sich damit.
»Kaum zu glauben«, flüsterte Lloyd.
In Lucius' Kopf überschlugen sich die Gedanken. Sie würden nicht gegen die Untoten kämpfen müssen, und das war gut. Was aber lag der Kursänderung zugrunde? In westlicher Richtung gab es vor allem Weideland und unbesiedelten Raum und ... Da war noch etwas. Der Offizier dachte angestrengt nach. Es fiel ihm beim besten Willen nicht ein.
»Die ehemalige Geisterstadt, Lloyd, wie heißt die noch mal?«, fragte er seinen Stellvertreter.
Der Major sah in mit leerem Blick an. »Geisterstadt, Sir?«
»Zum Teufel, Lloyd. Wo sind Sie zur Schule gegangen?«
Ein Räuspern erklang, und das Gesicht von Sergeant Major Bosco beugte sich zu ihm. »Sie meinen Governor City, Colonel?«
Lucius nickte. »Der Feind bewegt sich anscheinend genau dorthin. Die Stadt ist vielleicht einen Tagesritt entfernt und völlig ahnungslos.«
»Wir könnten unsere Stellungen aufgeben und die Nekros verfolgen.«
Decker ignorierte den Vorschlag seines Vertreters, da er ihn schnurstracks vor ein Kriegsgericht bringen würde.
»Schicken Sie Captain Conway mit seiner Schwadron nach Governor City. Unsere Reiter werden weit vor den Nekroindianern da sein und können die Verteidigung organisieren. Mit etwas Glück erhalten sie Verstärkung aus Fort Templeton.«
Bosco zögerte kurz. »Sind Sie sicher, Sir, dass Captain Conway ... «
Der Colonel unterbrach den Unteroffizier. »Ja, mein Neffe soll die Mission übernehmen. Schicken Sie außerdem eine Nachricht ans Hauptquartier. Der Generalstab muss von der Entwicklung unterrichtet werden.
Der Governor musste an die drei Sklavinnen denken, die er in die Rauchkammer im Keller gesteckt hatte. Er mochte das Fleisch gerne salzig. Ein Lächeln stahl sich auf sein Gesicht. Aber es war leider nicht die Zeit für dieses Vergnügen. Ein Bote hatte am Nachmittag ein Telegramm aus Governor City gebracht. Was für ein klangvoller Name für eine Stadt.





























