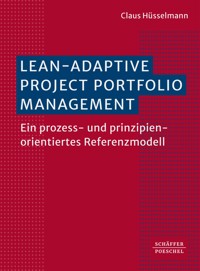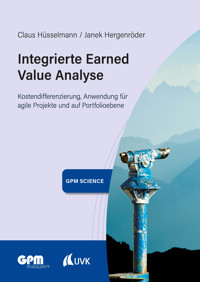Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Narr Francke Attempto Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Projekte sind komplex und erfordern zielgerichtete Planung und Steuerung - besonders für Führungskräfte, die Projekte leiten oder begleiten. Das Buch vermittelt in kompakter und praxisnaher Form die wichtigsten Methoden und Vorgehensweisen, um Projekte erfolgreich zu planen und durchzuführen. Es bietet einen strukturierten Einstieg ins Projektmanagement und unterstützt Sie dabei, die Qualität der Projektergebnisse zu sichern, Kosten und Termine einzuhalten und Projekte souverän zum Erfolg zu führen. Praktische Übungen und hilfreiche Tools fördern Ihr Lernen, sodass Sie das Gelernte direkt in die Praxis umsetzen können. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf IT-Projekten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 315
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Prof. Dr. rer. oec. Claus Hüsselmann ist Leiter der PPM-Labors im FB Wirtschaftsingenieurwesen an der TH Mittelhessen. Er wirkte nach Studium der Technomathematik zunächst als leitender Entwickler in einem SAP-Systemhaus. Bei Scheer verantwortete er anschließend zwanzig Jahre lang mehrere (Groß-)Projekte, den Bereich Project Operations & Risk Control für das Consulting-Geschäft sowie als Partner den Beratungsgeschäftsbereich Project Performance Management. 2012 bis 2015 war er als Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Projektmanagement GPM engagiert. Seine Schwerpunkte und Publikationen umfassen u.a. das Multiprojektmanagement (Ko-Leitung der GPM-Fachgruppe) sowie hybride PM-Ansätze (Lean PM).
Claus Hüsselmann
Projektmanagementfür Führungskräfte
Ein Grundlagenkurs in 5 Takten
Unter Mitwirkung von Philipp Diehl
Umschlagmotiv: © zakokor · iStockphoto
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.
DOI: https://doi.org/10.24053/9783381142620
© UVK Verlag 2025
‒ Ein Unternehmen der Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KG
Dischingerweg 5 · D-72070 Tübingen
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Alle Informationen in diesem Buch wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Fehler können dennoch nicht völlig ausgeschlossen werden. Weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen übernehmen deshalb eine Gewährleistung für die Korrektheit des Inhaltes und haften nicht für fehlerhafte Angaben und deren Folgen. Diese Publikation enthält gegebenenfalls Links zu externen Inhalten Dritter, auf die weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen Einfluss haben. Für die Inhalte der verlinkten Seiten sind stets die jeweiligen Anbieter oder Betreibenden der Seiten verantwortlich.
Internet: www.narr.de
eMail: [email protected]
Einbandgestaltung: siegel konzeption | gestaltung
ISBN 978-3-381-14261-3 (Print)
ISBN 978-3-381-14263-7 (ePub)
Geleitwort
Es hat mir als Dozent des Online-Seminars ‚IT-Projektmanagement‘ große Freude bereitet, das umfangreiche Wissen, das im Buch ‚Projektmanagement für Führungskräfte ‒ Ein Grundlagenkurs in 5 Takten‘ von Claus Hüsselmann enthalten ist, mehrfach in Online-Seminaren an Führungskräfte aus mittelständischen Unternehmen weitergeben zu dürfen. Das auf dem Buch basierende Seminar hat nicht nur die Teilnehmer befähigt, ihre IT-Projekte erfolgreich zu initiieren und umzusetzen, sondern auch gezeigt, wie komplexe Theorie mit außergewöhnlicher Klarheit und Praxisnähe in den Unternehmensalltag übertragen werden kann.
Besonders beeindruckend ist die Fähigkeit von Claus Hüsselmann, Wissen nicht nur zu vermitteln, sondern echte Transformation zu ermöglichen – ein Verdienst, der sich in den begeisterten Rückmeldungen der Teilnehmer widerspiegelt. Dank innovativen Methoden, wegweisenden Tools wie dem Agilometer oder dem Unified Project Management Framework (UPMF), sowie dem durchdachten Konzept der Transferaufgaben konnten selbst Skeptiker praxisnahe Lösungen für ihre Herausforderungen finden. Das Buch ‚Projektmanagement für Führungskräfte‘ ist weit mehr als ein Fachbuch – es ist ein wertvoller Kompass für alle, die insbesondere IT-Projekte erfolgreich gestalten wollen.
Dr. Michael Schulz, PM-Berater und -Trainer
Vorworte
Projektmanagement – ein Begriff, der in vielen Führungsetagen entweder für bewunderndes Kopfnicken oder für leichtes Stirnrunzeln sorgt. Denn so manches Projekt scheint sich zu entwickeln wie ein freilaufender Gartenschlauch: Es sprudelt, es windet sich, es trifft selten das Ziel – aber irgendjemand wird schon nass.
In meiner langjährigen Praxis als Projektmanager, Leiter eines Project Management Offices und Berater ist mir wiederholt vor Augen geführt worden: Viele Führungskräfte stehen ihren Projekt-Teams mit großer Verantwortung – aber manchmal eben auch mit leichtem Fragezeichen gegenüber. Nicht unbedingt aus Unwillen, sondern weil Zeit, Problembewusstsein oder schlichtweg das passende Grundlagenwissen fehlen. Genau hier setzt dieses Buch an.
Fünf kompakte Takte, praxisnah, strukturiert und direkt auf den Führungsalltag zugeschnitten, sollen helfen, das Projektgeschehen nicht nur zu verstehen, sondern es aktiv und souverän zu gestalten. Dabei geht es nicht darum, Projektmanagement zum neuen Lebenszweck zu machen. Vielmehr möchte dieses Buch zeigen, wie Sie mit dem richtigen Maß an Struktur, Methodik und Empathie Ihre Projekte möglichst sicher auf Kurs halten – auch wenn der Wind mal von vorn kommt.
Das Buch basiert auf einem mehrtägigen Grundlagenkurs, den ich für die ADG Akademie Deutscher Genossenschaften entwickeln durfte – mein herzlichster Dank gilt Philipp Diel und dem gesamten Team für die inspirierende Zusammenarbeit und die großzügige Freigabe der Inhalte. Ergänzt wird das Ganze durch zahlreiche bewährte Impulse aus meiner Projektmanagement-Vorlesung an der TH Mittelhessen, wo Theorie und Praxis regelmäßig aufeinandertreffen – manchmal mit überraschenden, oftmals aber sehr lehrreichen Ergebnissen.
Ich lade Sie ein, dieses Buch nicht einfach nur zu lesen, sondern es als Werkzeugkasten zu verstehen. Mit Übungen, Aufgaben und praxistauglichen Tools – für mehr Klarheit, bessere Kommunikation und erfolgreichere Projekte.
Viel Freude beim Lesen, Lernen und Umsetzen – und vielleicht beim nächsten Projekt auch ein bisschen weniger Gartenschlauch-Gefühl.
Ihr
Claus Hüsselmann
Das vorliegende Projektmanagement-Grundlagenbuch für Führungskräfte basiert auf der langjährigen praktischen Erfahrung und wissenschaftlichen Expertise von Prof. Dr. Claus Hüsselmann. Sein klar strukturierter, praxisorientierter Ansatz zieht sich wie ein roter Faden durch alle Kapitel. Gerade Führungskräfte erhalten so ein zuverlässiges Navigationsinstrument für ihre Projektarbeit – unabhängig davon, ob es sich um klassische, agile oder hybride Vorhaben handelt.
Die Inhalte des Buches sind über mehrere Jahre hinweg gereift – nicht nur in der Theorie, sondern auch in der erfolgreichen didaktischen Umsetzung. In Form eines Web Based Trainings zum Thema IT-Projektmanagement wurden sie bereits zahlreichen Lernenden zur Verfügung gestellt. Ob als Teilnehmende in einem begleiteten Online-Kurs oder im Selbststudium – das Feedback war durchweg positiv. Die hohe Akzeptanz unterstreicht die Relevanz und Qualität des vorliegenden Materials.
Einen besonderen Mehrwert bieten die begleitenden Lernvideos: Sie fassen zentrale Inhalte prägnant zusammen, visualisieren komplexe Sachverhalte und helfen, das Gelernte in den individuellen Arbeitsalltag zu übertragen. Damit wird das Buch zu einem multimedialen Werkzeugkasten, der weit über reines Fachwissen hinausgeht.
Die Zusammenarbeit mit Prof. Hüsselmann bei der didaktischen Aufbereitung der Inhalte war für mich nicht nur inspirierend, sondern auch ausgesprochen produktiv. Der gemeinsame Austausch war geprägt von gegenseitigem Respekt, Ideenvielfalt und einem tiefen Verständnis für die Bedürfnisse unserer Zielgruppe.
Dieses Buch ist ein wertvoller Begleiter für alle, die IT-Projekte mit strategischem Weitblick, methodischer Klarheit und einem Gespür für die Realität im Unternehmensalltag gestalten wollen. Wer es nutzt, wird schnell feststellen: Die Praxiserfahrung des Autors ist auf jeder Seite spürbar – und das macht den Unterschied.
Philipp Diel, Produktmanager, Akademie Deutscher Genossenschaften e.V., Montabaur
Inhaltsverzeichnis
Geleitwort
Vorworte
Hinweise
Zusammenfassung
Abstract
1Takt 1: Projekt-Setup
1.1Einleitung
1.2Definitionen
1.3Überblick Projektvorbereitung
1.4Das Projektumfeld
1.4.1Umfeldanalyse
1.4.2Stakeholder-Management
1.4.3Lösungen
1.5Projektauftrag
1.5.1Vom Antrag zum Auftrag
1.5.2Ziele
1.5.3Lösungen
1.6Der Projekterfolg
1.6.1Das erweiterte Magische Dreieck
1.6.2Erfolgsmessung
1.6.3Business Case
1.6.4Erweiterte Wirtschaftlichkeitsbetrachtung
1.7Projektbeschreibung − Project Canvas & Co
1.8Erfolgsfaktoren − Wie gelingt erfolgreiches Projektmanagement?
1.9Das PM-Framework
1.9.1Überblick
1.9.2Inhalte des UPMF
1.10Transferaufgaben Takt 1
1.10.1 Prozesse
1.10.2 Erfolgsfaktoren
2Takt 2: Projektplanung
2.1Requirements Management
2.1.1Grundlagen
2.1.2Minimum Viable Product
2.1.3Produktvision
2.1.4User Stories
2.1.5Atmender Scope − Neues Verständnis der Scope-Festlegung
2.1.6Lösungen
2.2Projektstrukturplanung
2.2.1Projektstrukturplan
2.2.2Arbeitspakete
2.2.3Vorgehen zur Aufstellung eines Projektstrukturplans
2.2.4Aufwandsermittlung
2.3Projektablaufplanung
2.3.1Projektlebenszyklus
2.3.2Projektphasen
2.3.3Meilensteine
2.3.4Projektabschnitte
2.3.5(Operative) Projektablaufplanung
2.3.6Rollierende Planung
2.4Transferaufgaben Takt 2
2.4.1Ihr Projekt
2.4.2User Requirements
3Takt 3: Projektorganisation
3.1Projektaufbauorganisation
3.1.1Rollen im Projekt
3.1.2Projektgremien
3.1.3RACI-Matrix
3.1.4Lösungen
3.2Projekt-Vorgehensmodelle
3.2.1Klassische Vorgehensmodelle
3.2.2Agile Vorgehensmodelle
3.2.3Hybrides Vorgehen
3.3Projekttypisierung
3.3.1Typen von IT-Projekten
3.3.2Adaption PM-System
3.3.3Agilometer
3.3.4Fazit
3.4Transferaufgaben Takt 3
3.4.1Vorgehensmodell
3.4.2Projektorganisation
4Takt 4: Projektsteuerung
4.1Vertragsmanagement
4.1.1Vertragsarten
4.1.2Change Requests
4.1.3Claims
4.1.4Agiler Festpreisvertrag
4.1.5Relationaler Vertrag
4.2Qualitätsmanagement
4.2.1Qualitätssicherung
4.2.2Qualitätsplanung
4.2.3Abnahmen
4.3Risikomanagement
4.3.1Projektrisiken
4.3.2Der Regelkreis des Risikomanagements
4.3.3Normstrategien
4.3.4Lösungen
4.4Projektcontrolling
4.4.1Grundlagen
4.4.2Plan-Ist-Vergleich
4.4.3Der Statusbericht
4.4.4Fortschrittsfeststellung
4.4.5Earned Value Analyse
4.4.6Meilenstein-Trend-Analyse
4.4.7Open Issue Management
4.4.8Projekt-Kanban
4.4.9Critical Chain Project Management
4.5Transferaufgaben Takt 4
4.5.1Vertrag
4.5.2Risiken
5Takt 5: Das Projekt in der Organisation
5.1Lernen in und mit Projekten
5.1.1Einordnung
5.1.2Lessons Learned im Projekt
5.1.3Starfish-Methode
5.1.4Multiprojekt-Wissensmanagement
5.1.5Kommunikation
5.1.6Eskalation
5.1.7Projektmarketing
5.2Überleitung in den Betrieb
5.2.1Cut-over-Planung
5.2.2Betriebsübergabe
5.2.3Einführungskonzept
5.2.4Hypercare
5.3Projektabschluss
5.3.1Kundenzufriedenheit
5.3.2Abschlussbericht
5.3.3Nutzenrevision
5.3.4Auflösung des Projekts
5.4Management der Projektlandschaft ‒ speziell der IT
5.4.1Ausgangsbasis IT-Strategie
5.4.2Nutzen von Strategieprojekten
5.4.3Projektportfoliomanagement
5.4.4Nutzwertanalyse
5.4.5Prozessmodell PPM
5.4.6Überblick IT-PM-Software
5.4.7Einsatz von Künstlicher Intelligenz
5.5Transferaufgaben Takt 5
5.5.1Lessons Learned
5.5.2Lösungen
5.5.3Projektportfolio
5.6Zum Abschluss des Buches …
Quellen und weiterführende Literatur
Abbildungsverzeichnis
Stichwortverzeichnis
Hinweise
Alle Videos zum Buch finden Sie auf dem Youtube-Kanal des Autors:
https://youtube.com/playlist?list=PLfISeyo-_J8kcdquIJYw8kxUpWToVmq_W&si=nBi3Tl7oDIw8pHUy
Zudem werden als Zusatzmaterial zum Buch Tools bereitgestellt. Sie können unter folgendem Link aufgerufen werden:
https://files.narr.digital/9783381142613/tools.zip
Zusammenfassung
Das Buch „Projektmanagement für Führungskräfte – Ein Grundlagenkurs in 5 Takten“ vermittelt praxisnah und systematisch die wesentlichen Grundlagen des Projektmanagements, zugeschnitten auf die Bedürfnisse von Führungskräften. Der Aufbau in fünf klar gegliederte „Takte“ ermöglicht eine schrittweise, didaktisch durchdachte Einführung in das Thema – vom Projektstart bis zur strategischen Verankerung in der Organisation.
Im ersten Takt steht das Projekt-Setup im Vordergrund. Neben einer grundlegenden Einführung in Begriffe und Definitionen werden hier die Vorbereitung und das Umfeld eines Projekts analysiert, inklusive Stakeholder-Management und Umfeldanalyse. Ein zentrales Element ist die Entwicklung eines fundierten Projektauftrags mit klarer Zieldefinition und Erfolgsfaktoren. Themen wie das „erweiterte magische Dreieck“, Business Case-Betrachtungen sowie moderne Werkzeuge wie der Project Canvas runden diesen Einstieg ab. Ergänzend wird ein eigenes Projektmanagement-Framework (UPMF) vorgestellt, das als roter Faden durch das Buch dient.
Takt zwei widmet sich der detaillierten Projektplanung. Der Fokus liegt auf dem Requirements Management – von der Erhebung von Anforderungen bis hin zur Formulierung von User Stories und einer greifbaren Produktvision. Die Projektstrukturplanung wird anhand klassischer Methoden wie Arbeitspaketen und Projektstrukturplänen vermittelt, ergänzt durch praxisnahe Aspekte wie Aufwandsschätzung, Ablaufplanung, rollierende Planung und Meilensteinsetzung. Dabei werden moderne Konzepte wie das „atmende Scope“ und das Minimum Viable Product (MVP) integriert.
Der dritte Takt behandelt die Projektorganisation. Hier geht es um die Aufbauorganisation innerhalb des Projekts, Rollenverteilungen, Gremienstrukturen und Instrumente wie die RACI-Matrix. Besonders praxisrelevant ist die Gegenüberstellung klassischer, agiler und hybrider Vorgehensmodelle sowie die Adaption des PM-Systems an unterschiedliche Projekttypen. Unterstützt wird dies durch das sogenannte „Agilometer“, das den Reifegrad agiler Praktiken einschätzbar macht.
Im vierten Takt liegt der Fokus auf ausgewählten Steuerungsdisziplinen. Vertragsmanagement, Qualitäts- und Risikomanagement sowie Projektcontrolling werden systematisch aufbereitet. Wichtige Werkzeuge wie Earned Value Analyse, Meilenstein-Trendanalysen, Projekt-Kanban oder Critical Chain Project Management (CCPM) ermöglichen eine belastbare Projektsteuerung. Ergänzend werden moderne Vertragsformen wie agile Festpreisverträge oder relationale Verträge vorgestellt, die speziell in dynamischen Projektumfeldern an Bedeutung gewinnen.
Der fünfte und letzte Takt beleuchtet das Projekt in seiner organisationalen Einbettung. Themen wie Lernen aus Projekten, Wissensmanagement, Kommunikation, Eskalation und Projektmarketing stehen hier im Vordergrund. Der Übergang in den Betrieb wird detailliert betrachtet – inklusive Cut-over-Planung, Betriebsübergabe, Einführungskonzept und Hypercare-Phase. Der Projektabschluss wird nicht nur dokumentarisch, sondern auch im Hinblick auf Kundenzufriedenheit und Nutzenrevision behandelt. Abschließend wird der Blick auf das strategische Projektmanagement erweitert, etwa durch Projektportfoliomanagement, IT-Strategie und eine Übersicht relevanter PM-Softwarelösungen.
Jeder Takt schließt mit praxisorientierten Transferaufgaben ab, die Führungskräfte dabei unterstützen sollen, das Gelernte direkt auf ihre Projekte zu übertragen. Das Buch bietet damit nicht nur theoretisches Wissen, sondern eine anwendungsorientierte Grundlage für wirksames und modernes Projektmanagement im Führungskontext.
Schlüsselbegriffe: Projekt-Setup, Projektumfeld, Stakeholder-Management, Projektauftrag, Zieldefinition, Projekterfolg, Erfolgsfaktoren, PM-Framework, Projektplanung, Requirements Management, Projektstrukturplan, Aufwandsschätzungen, Ablaufplanung, Projektorganisation, klassische, agile und hybride Vorgehensmodelle, Projekttypisierung, Projektsteuerung, Vertrags-, Qualitäts- und Risikomanagement, Earned Value Analyse, Trendanalysen, Kanban und CCPM, Change Requests, Claims und Vertragsformen, Wissensmanagement, Projektkommunikation, Überleitung in den Betrieb, Nutzenrevision, Projektportfoliomanagement, IT-Strategie, PM-Software
Abstract
The book "Project Management for Executives – A Basic Course in 5 Acts" provides a practical and structured introduction to the essentials of project management, tailored specifically for executives. Organized into five clearly defined "movements," the book offers a step-by-step, didactic approach to project work—from initial setup to strategic integration within the organization.
The first act focuses on project setup. In addition to key definitions and terminology, this section covers project preparation and environmental analysis, including stakeholder management. A major element is the development of a solid project charter with clearly defined objectives and success factors. Topics such as the "extended magic triangle", business case considerations, and modern tools like the Project Canvas are also addressed. A proprietary project management framework (UPMF) is introduced as a guiding structure throughout the book.
The second act delves into detailed project planning. Central here is requirements management, covering the collection and formulation of user requirements, user stories, and a concrete product vision. Project structure planning is discussed through methods such as work breakdown structures and work packages, along with practical topics like effort estimation, scheduling, rolling wave planning, and milestone setting. Contemporary concepts such as the "breathing scope" and the Minimum Viable Product (MVP) are also incorporated.
The third act deals with project organization. This includes project organizational structure, role definitions, committee structures, and tools like the RACI matrix. Particularly useful for practice is the comparison between classical, agile, and hybrid project approaches, as well as the adaptation of the PM system to different project types. This section is supported by the "Agilometer", a tool to assess the maturity of agile practices.
The fourth act highlights selected disciplines of project control. It covers contract management, quality management, risk management, and project controlling in a structured manner. Important tools such as earned value analysis, milestone trend analysis, project Kanban, and Critical Chain Project Management (CCPM) provide a robust foundation for effective project control. Additionally, modern contract models—such as agile fixed-price and relational contracts—are introduced, especially relevant in dynamic project environments.
The fifth and final act looks at projects within the broader organizational context. Topics include organizational learning from projects, knowledge management, communication, escalation, and project marketing. Transitioning the project into operational use is explored in detail, including cut-over planning, operational handover, implementation strategies, and the hypercare phase. Project closure is addressed not only in terms of documentation but also customer satisfaction and benefits realization. The book concludes by expanding the perspective toward strategic project management, including project portfolio management, IT strategy, and an overview of relevant project management software solutions.
Each movement ends with practice-oriented transfer tasks, encouraging readers to immediately apply what they’ve learned to their own projects. As such, the book offers not just theoretical foundations, but a hands-on guide to effective and modern project management in an executive context.
Keywords: Project set-up, project environment, stakeholder management, project charter, goal definition, project success, success factors, PM framework, project planning, requirements management, work breakdown structure, effort estimation, scheduling, project organisation, classic, agile and hybrid process models, project classification, project control, contract, quality and risk management, Earned Value Analysis, trend analyses, Kanban and CCPM, change requests, claims and contract forms, knowledge management, project communication, transfer to operations, benefit audit, project portfolio management, IT strategy, PM software
1Takt 1: Projekt-Setup
In den ersten beiden Videos sehen Sie zum Auftakt die Begrüßung und den Überblick über Takt 1.
Video 1.0 (Einleitung), URL: https://youtu.be/xFt8Clq-1dg
Video 1.1 (Übersicht Takt 1), URL: https://youtu.be/cZts7SwX3NY
1.1Einleitung
Die betriebliche Wertschöpfung in Form von Projekten umfasst einen signifikanten und immer größer werdenden Anteil. So ermittelte die GPM Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement e.V. vor einigen Jahren (Erhebungsjahr 2022) in einer repräsentativen Studie einen Anteil in Höhe von 34,5% der wirtschaftlichen Gesamtleistung, was einem Volumen von 1.204 Mrd. Euro entspricht. Dieser Anteil wurde gemessen in Form des Inputs von Arbeitsleistung, da der Output aufgrund der Heterogenität der Leistungen – z.B. Organisationsprojekte oder Anlagenbauprojekte – nicht einheitlich messbar erscheint. Für den Wirtschaftsbereich der Finanz- & Versicherungsdienstleister ermittelte die GPM einen Anteil des Personaleinsatzes (gemessen in Arbeitszeit) in Höhe von 19,2%, für das Baugewerbe sogar von 55,0%.
Die Arbeitsform „Projekt“ ist also allgegenwärtig. Dabei werden z.B. im Finanzsektor überwiegend (interne) IT-Projekte (26% alle Projekte) sowie Organisations- bzw. HR-Projekte (20%) durchgeführt. Im Bau- bzw. produzierendem Gewerbe dominieren hingegen Kunden- und Auftragsprojekte (35% bzw. 24%). Im Handelssektor liegen die Marketing-/Vertriebsprojekte mit 22% gleichauf mit den IT-Projekten. Letztere spielen insgesamt mit 19% Anteil die zweitgrößte Rolle nach den Kunden- bzw. Auftragsprojekten (22%).1
Eine Universalmethodik ist nicht mehr für alle Projekte hilfreich. Die Klassifizierung von Projekten z.B. nach Projektgegenstand hilft, im Projektmanagement die richtigen Schwerpunkte zu setzen, um die verschiedenen Anforderungen handhaben zu können.2 Folgende Projektarten unterscheidet man typischerweise in Unternehmen:
(1) Intern: Organisations- / HR-Projekte
Projekte, zur Veränderung der Organisation, z.B.
•Prozessoptimierung
•Zertifizierung nach ISO 9000
•Einführung neues Tarifwerk
•Zentralisierung des Beschaffungswesens
(2) Intern: IT-Projekte
Projekte zur Entwicklung der IT im Unternehmen, z.B.
•Einführung ERP-System
•Entwicklung Fachanwendung
•Migration des Betriebssystems
(3) Intern: F & E- / Neuproduktionsentwicklungsprojekte
Projekte zur Entwicklung neuer Produkte oder Leistungen, z.B.
•Einführung einer neuen Karte
•Entwicklung eines neuen Geräts
•Entwicklung eines neuen Verfahrens
(4) Intern: Marketing-/ Vertriebsprojekte
Projekte, die unmittelbar den Markt betreffen, z.B.
•Durchführung einer Inhouse-Messe
•Durchführung einer Marketing-Kampagne
•Einführung eines neuen Vertriebskanals
(5) Intern: Infrastrukturprojekte
Projekte, die eine große materielle Investition bedeuten, z.B.
•Einführung von Terminals
•Bau einer Filiale
•Errichtung eines neuen Gebäudes
•Beschaffung von Hardware
(6) Extern: Kunden- / Auftragsprojekte
Projekte, deren Auftraggeber ein Projektkunde ist, z.B.
•Errichtung eines Leitstands für eine Organisation
•Bau einer Anlage
•Durchführung eines Beratungsprojekts
Welche Projektarten kommen in Ihrem Unternehmen vor?
Zur weiteren Differenzierung etwa von IT-Projekten kann der „Würfel“ in Abbildung 1 verwendet werden.3
ERP: Enterprise Resource Planning
EDV: Elektronische Datenverarbeitung
Abbildung 1: Differenzierung von IT-Projekten
In der Praxis lässt sich oftmals ein Projekt nicht eindeutig einer der o.g. Projektarten zuordnen, es enthält verschiedene Charakteristiken. Dies drückt sich dann meistens in verschiedenen artigen Teilprojekten aus. Weitere Differenzierungen, etwa nach Größe und Innovation besprechen wir im Verlaufe des Kurses.
Hinsichtlich der Erfolgsfaktoren zeigen diverse Studien, dass weiterhin Verbesserungspotenzial besteht. So zeigte bspwder CHAOS Report der Standish Group 2015:
•Nur 29% der IT-Projekte sind erfolgreich (im Sinne von Plantreue)!
•2% der erfolgreichen IT-Projekte sind Großprojekte − jedoch 62% Kleinprojekte.
•Der Projektgegenstand spielt eine große Rolle bei der Erfolgsquote (z.B. Einführung von Standard-Software oder Eigenentwicklung).
•Agile Vorgehensweisen sind ca. 3-mal so häufig erfolgreich wie das Wasserfallvorgehen.
Hieraus lässt sich auch gleich ein Leitmotiv für das Buch zum modernen Projektmanagement ableiten, das vor Ihnen liegt: Welche Herangehensweisen für IT-Projekte gibt es und wann sind welche Methoden wertschöpfend einzusetzen?
Bevor wir uns weiter mit der Ausführung von Projekten beschäftigen, sollen im Folgenden nun zunächst einmal einige grundlegende Definitionen besprochen werden.
1.2Definitionen
Sucht man nach einer verbindlichen Definition des Begriffs „Projekt“, so wird man nicht fündig. Zu viele Organisationen, Verbände und Autoren haben Projekte definiert, wobei im Detail unterschiedliche Formulierungen benutzt werden, die aber in der Regel eine gemeinsame Kernsubstanz haben. Für das vorliegende Modul soll folgende Definition eines Projekts gelten:
„Ein Projekt ist ein Vorhaben mit einem beschränkten Zeit- und Kostenrahmen zur Erbringung einer Reihe gewünschter Ergebnisse, die – unter Einhaltung bestimmter Qualitätsanforderungen – dazu dienen, die definierten Projektziele zu erreichen (angelehnt an PRINCE2).
Es ist somit eine für einen befristeten Zeitraum geschaffene Organisation, die mit dem Zweck eingerichtet wurde, bestimmte Ergebnisse beziehungsweise Produkte in Übereinstimmung mit einem übergeordneten Nutzenziel zu erbringen (angelehnt an IPMA ICB).
Ein Projekt ist im Wesentlichen durch die Einmaligkeit der Bedingungen in ihrer Gesamtheit gekennzeichnet (angelehnt an DIN 69 901).“
Damit sind auch gleich einmal einige wichtige Organisationen genannt, die sich mit der Standardisierung von Projektmanagement befassen:
Die International Project Management Association ist ein internationaler PM-Verband, der in Europa entstanden ist. Die deutsche Landesgesellschaft ist die GPM Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement.
Das Standardwerk ist die IPMA Competence Baseline, ICB, das Kompetenzen für erfolgreiches PM definiert, die auch zur Zertifizierung dienen.
Das Project Management Institute ist weltweit der größte PM-Verband und wurde in den USA gegründet. Das Chapter Germany vertritt das PMI in Deutschland.
Der PM BoK Guide, Project Management Body of Knowledge, ist das Standardwerk des PMI. Dieser hat einen starken Fokus auf Prozessen.
In Deutschland existiert mit der DIN 69 900 bzw. der 69 901er Reihe eine Sammlung von Normen zum PM. Das internationale Pendant ist die ISO 21 500.
Die Normen zum PM dienen z.B. vor allem zur einheitlichen Begriffsverwendung.
AXELOS ist das Unternehmen, dass mittelweile den britischen Standard PRINCE2 herausbringt. Dieser wurde ursprünglich für IT-Projekte von der britischen Regierung entwickelt.
Im Fokus stehen Grundprinzipien, Themen und Prozesse, die auch projektneutral eingesetzt werden können.
Wir kommen später darauf zurück.
Aus der Definition für Projekte ergibt sich unmittelbar deren typische Charakteristik, die sich mit typischen Merkmalen erfassen lässt:
Aus der Projektdefinition ergeben sich typische Charakteristiken von Projekten:
Zielsetzung –
üblicherweise ein eindeutig definiertes Endziel
Kompliziertheit –
organisatorische und technische Elemente aus mehreren Bereichen
Einmaligkeit –
keine exakte Wiederholung von Dagewesenem
Unsicherheit –
charakterisiert durch unvollständige Information und unbestimmte Entwicklungen
Befristung –
am Projektende werden die Aktivitäten geschlossen
Lebenszyklus –
ein Projekt hat unterschiedliche Phasen und ein definiertes Ende
Planung –
wirtschaftliche und fachliche Rahmenbedingungen, Disposition, Design
Abbildung 2: Charakteristik von Projekten
Handelt es sich um Projekte?
„In diesem Projekt sollen bis Mitte nächsten Jahres neue unternehmenseinheitliche IT-Arbeitsplätze eingeführt werden. Mit dem Projekt soll erreicht werden, dass alle Mitarbeiter bequem, einfach und sicher Daten, Informationen und Dokumente austauschen können.“
Projekt, denn Ziel und Zeit vorgegeben (andere Begrenzungen fehlen).
„In diesem Projekt geht es darum, zusätzliche Kunden zu gewinnen. Dafür werden wir die Mitarbeiter im Vertrieb schulen. Und unsere Produkte besser präsentieren.“
Kein Projekt, da keine Einmaligkeit der Bedingungen (Regelaktivität).
„Ziel des Projekts ist die Verbesserung der Mitarbeiterzufriedenheit. Dazu werden wir in den nächsten 2 Monaten eine Befragung durchführen. Aus den Ergebnissen werden wir konkrete Maßnahmen ableiten und diese in Unterprojekten umsetzen. Das Projekt wird dann mit einer weiteren Befragung der Mitarbeiter/innen nach einem Jahr abgeschlossen.“
Projekt, da Ziel und Zeit genau vorgegeben (beste Abgrenzung)
Analysieren Sie doch einmal ein Vorhaben, das aktuell bei Ihnen „auf dem Tisch liegt“ oder an dem Sie beteiligt sind. Wie viele der in der Checkliste enthaltenen Fragen können Sie mit „ja“ beantworten?
Checkliste [Projekt]
Eng verbunden mit der Definition und Charakteristik von Projekten ist die Definition von Projektmanagement:
„Projektmanagement (PM) ist die Anwendung von Wissen, Fertigkeiten, Werkzeugen und Methoden auf Projektvorgänge, um die Projektanforderungen zu erfüllen.
PM ist ein disziplinierter Prozess
- zur Identifikation, Koordination und kontinuierlichen Bündelung von Ressourcen (Personen, Material, Fähigkeiten etc.)
- zur Erfüllung von Projekt-/Vertragszielen innerhalb von
- Zeit-, Kosten-, Ressourcen- und Qualitätsbeschränkungen.“ (nach PMI)
Der Abschluss eines Projektes ist gleichzusetzen mit dem Erreichen des Projektziels. Dabei steht das Zusammenspiel zwischen Organisation, Mensch und Methoden und dem Projektumfeld im Vordergrund.
Abbildung 3: Einordnung Projektmanagement
Zu den unmittelbaren Aufgaben des PM gehören demzufolge allgemein gesprochen:
Abbildung 4: Aufgaben des Projektmanagements
Die Aufgaben des PM werden im Abschnitt zum Unified Project Management Framework, UPMF, systematisch aufgefächert.
Projektmanagement erfolgt durch entsprechende Prozesse, welche Eingangswerte (Inputs) erhalten und Ausgangswerte (Outputs) erzeugen. Das generelle Konzept, das der Interaktion zwischen den PM-Prozessen zugrunde liegt, ist der Deming-Kreis bzw. PDCA-Zyklus „Plan-Do-Check-Act“, d.h. „Planen – Ausführen – Prüfen - Handeln“.
Die verschiedenen PM-Frameworks definieren abweichende PM-Prozesse, in deren Synthese folgende 4 PM-Prozesse zu identifizieren sind:
Abbildung 5: Projektmanagement-Prozesse
Eng verbunden mit dem Begriff bzw. Konstrukt des Projekts sind die Begriffe Projektportfolio und Projektprogramm, die abschließend in diesem Abschnitt ebenfalls definiert werden sollen (nach DIN 69 909 sowie Seidl, 2011).
Definitionen im Multiprojektmanagement
Projektportfolio bezeichnet die Zusammenfassung aller geplanten, genehmigten und laufenden Projekte und Programme (ggf. auch weitere Projektportfolios) in einem abgegrenzten Verantwortungsbereich (Unternehmen, Organisation, Geschäftsbereich) zum Zweck der übergeordneten Planung und Steuerung.
Es kann nach verschiedenen Kriterien strukturiert werden, so z. B. nach Produktgruppen, Marktsegmenten, nach externen oder internen Projekten oder anderen Charakteristiken. Ein Projektportfolio ist zeitlich nicht befristet.
Das Projektportfolio orientiert sich an der übergeordneten Zielsetzung und initiiert Projekte und Programme. Begrenzte Ressourcen erfordern eine zielorientierte Auswahl und eine fortlaufende Priorisierung der Projekte und Programme.
Portfolio-Management ist die strategische Ausrichtung, Planung, Steuerung und Anpassung aller Projekte innerhalb einer Organisation.
Definition „Programm“
Ein Programm ist definiert als eine Menge zusammenhängender Projekte und organisatorischer Veränderungsprozesse, die mit dem Ziel aufgesetzt wurden, eine strategische Zielsetzung zu erreichen und einen erwarteten Nutzen für die Organisation zu erreichen.
Die Projekte eines Programms liefern jeweils autark verwendbare Ergebnisse, deren Gesamtnutzen aber erst im Zusammenwirken erzielt werden kann.
Ein Programm ist ein Multi-Projekt und weist typische Projektcharakteristika auf, wie zeitliche Befristung, definierte Zielsetzung, definiertes Budget sowie in besonderem Maße hohe fachliche und organisatorische Komplexität.
Programm-Management ist die Koordination und das Management voneinander inhaltlich abhängiger Projekte zur Sicherstellung der effizienten Durchführung dieser Projekte.“
Programme und Portfolien sind also Multiprojektlandschaften, die nach unterschiedlichen Kriterien gebildet werden und die ein differenziertes Management erfordern. Ein Projektportfolio kann Teilportfolien (z.B. die Menge aller IT-Projekte) enthalten, Programme (z.B. zur Digitalen Transformation der Organisation) sowie einzelne Projekte (z.B. die Migration auf ein neues Betriebssystem).
1.3Überblick Projektvorbereitung
Bevor ein Projekt gestartet wird, sind einige Dinge zu analysieren, zu klären, zu erarbeiten und festzulegen. Diese Elemente werden wir im Laufe des folgenden Modulabschnitts näher kennenlernen. Doch schauen wir zunächst mal auf die typischen Aktivitäten in der der Übersicht. Von vielen Begriffen werden Sie eine intuitive Vorstellung haben und haben vermutlich auch schon damit gearbeitet:
Projektziele definieren
Prüfung, ob Projekt vorliegt
Vorhandene Erfahrungen zu Prozessen, Prozeduren und vergangenen Projekten erfassen
Business Case erstellen, inkl. Wirtschaftlichkeitsbetrachtung
Projektbegründung & Annahmen dokumentieren
Auftraggeber und Projektmanager definieren
PM-Team & Kernteam benennen
Projektlösungsansatz auswählen
Machbarkeitsbewertung
Projektbeschreibung zusammenstellen
Projektauftrag erstellen
Beschreibung des Inhalts und Umfangs
Anforderungen an Lieferungen & Leistungen definieren
Unternehmenskultur und -systeme identifizieren
Identifikation der wichtigsten Stakeholder und ihrer Erwartungen
Projektumfeld- und Stakeholder-Analyse
Benötigte Hauptmeilensteine festlegen
Begrenzungen (Kosten, Zeit, Ressourcen …) dokumentieren
Projektcharakteristik analysieren und –strategie festlegen
(grobe) Aufwandsschätzung und Planung erstellen
Schauen Sie sich zur Erläuterung der Aktivitäten gerne das verfügbare Video an.
Video 1.2 (Projektvorbereitung), URL: https://youtu.be/cwXXi5FLjsI
Im Sinne einer kontinuierlichen Weiterentwicklung der Themen im Lebenszyklus eines Projekts, werden viele dieser Themen aber auch immer wieder aufgegriffen, überprüft, ggf. weiterentwickelt und detailliert.
1.4Das Projektumfeld
1.4.1Umfeldanalyse
Das Projektumfeld beeinflusst das Projekt und wird seinerseits vom Projekt beeinflusst, wie in Abbildung 6 dargestellt.
Es ist die Umgebung, in der das Projekt formuliert, bewertet und durchgeführt wird, die das Projekt direkt oder indirekt beeinflusst und die ggf. von dessen Auswirkungen betroffen ist.
Ziele der Projektumfeldanalyse ist die Identifikation und Bewertung der wichtigsten Einflussfaktoren auf das Projekt.
Abbildung 6: Das Projektumfeld
Die Projektumfeldfaktoren lassen sich wie folgt klassifizieren:
−internes Umfeld:
innerhalb der Unternehmensorganisation
−externes Umfeld:
außerhalb der Unternehmensorganisation
−Sachfaktoren:
natürliches Umfeld / technisches Umfeld / ökonomisches Umfeld
−Sozialfaktoren:
rechtlich-politisches Umfeld / soziokulturelles Umfeld
Die folgende Matrix ordnet typische Umfeldfaktoren nach dieser Klassifizierung ein:
intern
extern
•Betriebsvereinbarungen
•Gesetze
sachlich
•Richtlinien, Regelwerke
•Normen, Standards
•Geschäftsentwicklung
•Marktentwicklung
•Geschäftsführung
•Auftraggeber
sozial
•Sonderbeauftragte
•Mitarbeiter des AG
•Btrbl. Interessenvertretung
•Lieferanten
•Mitarbeiter
•Kunden
Abbildung 7: Klassifizierung der Projektumfeldfaktoren
Sachlich-interne Projektumfeldfaktoren umfassen z.B. die vorhandenen Richtlinien, die einzuhalten sind. Nicht zuletzt die sachlich-externen Projektumfeldfaktoren haben einen hohen Einfluss auf den Projekterfolg.
Für ein IT-Projekt ergibt sich daraus oftmals folgende konkrete Ausgestaltung (Abb. 8):4
Ordnen Sie die IT-projekttypischen Begriffe den Feldern zu.
Abbildung 8: Klassifizierung der Projektumfeldfaktoren (Template)
Passen diese Einflussfaktoren in das Umfeld Ihrer Projekte in Ihrem Unternehmen? Finden Sie ggf. weitere, die Sie in der Matrix verorten können?
Die wichtigsten sachlichen Projektumfeldfaktoren werden in einem Umfeldregister dargestellt:
Beispiel5
Sachlicher Projektumfeldfaktor
Beschreibung
Maßnahme
Datenschutzgesetz
Die gültigen Datenschutzrichtlinien sind einzuhalten
Schulung/Einweisung aller Projektmitarbeiter
Arbeitszeitregelungen
Nur max. 50 Überstunden möglich
Beachtung bei der Planung
Test in der Vorproduktionsumgebung
Vor der Produktivsetzung sind Tests in der Vorproduktivumgebung erforderlich
Frühzeitige inhaltliche du terminliche Abstimmung mit den Verantwortlichen
Abbildung 9: Umfeldregister (Beispiel)
Tragen Sie doch einmal 2…3 Faktoren aus Ihrem Umfeld in ein solches Register ein:
Sachlicher Projektumfeldfaktor
Beschreibung
Maßnahme
Abbildung 10: Umfeldregister (Template)
In der Umfeldanalyse werden insbesondere die „interessierten Parteien“, also die Stakeholder des Projektes betrachtet. Wenden wir ihnen uns einmal etwas detaillierter zu.
1.4.2Stakeholder-Management
1.4.2.1Begriff
Der Begriff „Stakeholder“ bezeichnet jemanden, der ein Interesse an einer Sache hat (engl.: „to have a stake in s.th.“). Stakeholder sind also im allgemeinen Personen oder Institutionen, die ein begründetes Interesse am Verlauf oder am Projekterfolg und am Nutzen für das Projektumfeld haben.
Es gibt Stakeholder, die positiv oder negativ zu dem Projekt eingestellt sind.
Bei der Stakeholder-Analyse geht es darum, die einzelnen Personen oder Personengruppen zu identifizieren und die Risiken und Chancen darzustellen und zu bewerten, die von diesen Personengruppen ausgehen.
Ausgehend von diesen Ergebnissen können Maßnahmen für eine Stakeholder-Politik abgeleitet werden. Projektbefürworter und -gegner werden ermittelt, ihr Einfluss gewertet und der nötige Maßnahmenkatalog erstellt.
Stakeholder können in externe und interne Stakeholder klassifiziert werden, z.B.:
interne Stakeholder
externe Stakeholder
•Vorstand
•Anteilseigner
•Mitarbeiter
•Betriebsrat
•Projektleitung/Projektgremium
•Abteilungsleiter
•…
•Lieferanten
•Kunden
•Behörden
•Vereine
•Verbände
•Gewerkschaften
•Anwohner
•Politik
•…
Wer sind die typischen Stakeholder für Ihre (IT-) Projekte?
Achtung: Es gibt ggf. auch Personen oder Personengruppen, die es als Erfolg oder Nutzen ansehen, das Projekt zum Scheitern zu bringen!
Stakeholder beeinflussen das Projekt! Folgende Beispiele verdeutlichen die Relevanz für eine Analyse der Stakeholder:
•Eine Umweltorganisation versucht mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln den Bau des projektierten Rechenzentrums „auf der freien Wiese“ zu verhindern.
•Der bisherige Marktführer und Wettbewerber xy wird versuchen, das aufstrebende Start-up mit Dumpingpreisen an der Inmarktbringung der neuen Produktlinie zu hindern.
•Das neue Bürogebäude soll auf einer ehemals historischen Stätte errichtet werden. Denkmalschützer und Bürgerinitiativen wollen dies verhindern.
•Ein Mitarbeiter wird durch die geplante Umstrukturierung der IT-Abteilung einige Rechte verlieren. z.B. wird er wird nicht mehr in der Nähe parken können (persönliche Rechte wiegen oft besonders schwer!).
•Durch den Bau des neuen Bürogebäudes werden einige Mitarbeiter weiter fahren müssen. Bei diesen Mitarbeitern sind auch einige Hauptabteilungsleiter, die dies nicht wollen.
Risiken, die von Stakeholdern ausgehen können:
interne Stakeholder
externe Stakeholder
•Emotionale Erwartungen und Einstellungen werden nicht offen ausgesprochen
•Projektwiderstände werden nur verdeckt ausgeübt
•Entscheidungsträger fehlen in wichtigen Sitzungen
•Unmotivierte und leistungsschwache Mitarbeiter werden in das Projekt „abkommandiert“
•Dienst nach Vorschrift
•Wertvolle Zeit wird in Sitzungen durch endlose Diskussionen über unwichtige Details vergeudet
•Gute Vorschläge werden zerredet
•…
•Die Bevölkerung wehrt sich mit Demonstrationen gegen das Abholzen der Bäume, um den nötigen Baugrund frei zu machen
•Der externe Auftraggeber verfügt nicht mehr über die nötige Kapitaldecke
•Die Behörden verlangen höhere Auflagen als erwartet
•…
1.4.2.2Stakeholder-Management-Prozess
Ziel des Stakeholder Managements ist es alle Stakeholder mit ihren Interessen, Einstellungen und Einflussmöglichkeiten zu kennen … und daraus geeignete Maßnahmen zur Akzeptanz des Projekts ableiten.
Stakeholder-Management heißt, Stakeholder zu …
Abbildung 11: Stakeholder-Management-Prozess
Folgende Aktivitäten/Aufgaben sind damit verbunden:
Ermittlung der Anforderungen und Erwartungen der Stakeholder.
Berücksichtigung dieser Anforderungen bei der Zielsetzung, Projektplanung und -durchführung.
Entwicklung von Strategien und Maßnahmen.
(Pro-)Aktive Betreuung der Projekt-Stakeholder, insbesondere der einflussstarken Entscheider.
Steuern und Überwachen der Stakeholder-Maßnahmen.
1.4.2.3Stakeholder-Identifikation
Die Stakeholder-Identifikation ist „der Prozess zur Ermittlung aller Personen und Organisationen, auf die sich das Projekt auswirkt, sowie die Dokumentation entsprechender Informationen bezüglich ihrer Interessen, Beteiligung und Auswirkung auf den Projekterfolg“ (nach PMI).
Vorgehen: Workshop durchführen mit folgenden Kernfragen:
–Welche Prozesse werden durch das Projekt wesentlich verändert?
–Welcher Personenkreis ist durch das Projekt betroffen?
–Wer muss bzw. sollte am Projekt beteiligt werden?
–Wer könnte das Projekt – mit welchen Erwartungen – unterstützen?
–Wer könnte Widerstände (Ängste, Befürchtungen) gegen das Projekt haben?
–Wer könnte noch Informationen für das Projekt liefern?
–Wer arbeitet an ähnlichen Themen?
Ergebnis ist eine Stakeholder-Liste.
1.4.2.4Stakeholder-Analyse
Die Analyse der Projektbeteiligten hinsichtlich deren Einfluss auf das Projekt und deren Einstellungen (positiv oder negativ) zum Projekt wird als Stakeholder-Analyse bezeichnet.
Vorgehen
–Ausgangsbasis: Stakeholder-Liste
–Analyse für jeden Stakeholder:
•Einstellung zum Projekt: positiv (+), neutral (o), negativ (-)
•Erwartungen/Unterstützung (+) bzw. Befürchtungen/Widerstände (-)
•Betroffenheit: hoch, mittel, gering
•Macht/Einfluss auf das Projekt: hoch, mittel, gering
Projektverantwortliche sollten sich dabei in die Situation der Stakeholder versetzen.
Ergebnis ist das Stakeholder-Register (Interessenmatrix):
Abbildung 12: Stakeholder-Register
Probleme bei der Stakeholder-Analyse
–Das Verhalten der Stakeholder oft nicht leicht vorhersehbar.
–Die Stakeholder-Analyse ist immer nur eine Momentaufnahme!
•Es können im Projektverlauf Stakeholder(gruppen) entstehen, an die bei Projektstart noch nicht absehbar waren.
•Es kann eine gewisse Dynamik in der Stakeholder-Landschaft geben.
Aus dem Stakeholder-Register lässt sich unmittelbar ein Stakeholder-Portfolio zur visuellen Darstellung der Analyse ableiten (siehe Abbildung 13).
Abbildung 13: Stakeholder-Portfolio
Das Register sowie das Portfolio wird im Regelfall nicht veröffentlicht, sondern verbleibt beim Projektmanager!
1.4.2.5Normstrategien
Das Stakeholder Management umfasst weiterhin die Strategie und die Maßnahmen, die für den individuellen Stakeholder vorgesehen sind. Mit Hilfe der Stakeholder-Analyse können typische Normstrategien zur Ableitung von Maßnahmen genutzt werden. Nach PMI sehen diese wie folgt aus:
Abbildung 14: Stakeholder Management-Strategie
Stakeholder und deren Interessen sind über den Projektverlauf nicht konstant und müssen daher kontinuierlich identifiziert/beobachtet werden!
Die Maßnahmen werden daher mit den Vokabeln „wöchentlich“, „ständig“, „regelmäßig“ etc. begleitet. Dies unterstreicht die Wichtigkeit des kontinuierlichen Kontakts, um die Stakeholder positiv zu beeinflussen, mögliche negative Einflüsse früh zu erkennen und gegensteuern zu können.
Maßnahmenplanung
Ziele der Maßnahmen sind die Verringerung von Widerständen (Ängste, Befürchtungen) bzw. die Verstärkung der Unterstützung. Dabei können grundsätzlich folgende Formen angewendet werden:
Partizipativ: Stakeholder als Partner behandeln
–Beteiligung im Lenkungsausschuss/Mitentscheidung
–Beteiligung Projekt/Mitarbeit
Diskursiv: Stakeholder informieren
–Information/Kommunikation
–Ausgleich der verschiedenen Stakeholder-Interessen durch Verhandlungen und Konfliktmanagement
Repressiv: Auf Stakeholder Druck ausüben
–ethisch i.A. nicht vertretbar!
Finden Sie eine repressive Form der Stakeholder-Beeinflussung, die gar nicht so selten vorkommt?
Ggf. sind Kombination der Strategien für einzelne Stakeholder angebracht.
Das Stakeholder-Register wird um Maßnahmen ergänzt:
Maßnahmen zur Verringerung der Widerstände
Maßnahmen zur Stärkung der Förderer
(z.B. Abbau von Ängsten und Befürchtungen)
•Win-Win-Situationen anstreben
•Pro-Kontra-Argumente herausarbeiten
•„Botschaften“ für Zielgruppen erarbeiten
•Vertrauensbasis schaffen
•ehrliche und klare Kommunikation
•evtl. Partizipation in der Projektarbeit
•…
•lückenlose Information der Förderer
•persönlichen Draht aufbauen
•Einbeziehung von Meinungsbildnern und Multiplikatoren
•…
Finden Sie mögliche Maßnahmen in der Stakeholder-Politik?
Sonst schauen Sie doch mal in folgenden Auszug eines vollständigen Stakeholder-Registers:6
Abbildung 15: Stakeholder-Register
Wie schon erwähnt, darf es nicht bei einer einmaligen Analyse der Stakeholder-Situation bleiben (auch wenn das auf jeden Fall bereits ein guter Schritt und besser als nichts ist). Der vollständige Stakeholder-Management-Prozess folgt der bekannten „Plan Do Check Act“-Systematik:
Abbildung 16: Der Stakeholder-Management-Prozess
Wichtige Controlling-Fragen sind dabei:
1.Gibt es neue Stakeholder?
2.Waren die durchgeführten Maßnahmen erfolgreich?
3.Haben sich bisherige Stakeholder-Positionen wesentlich verändert?
4.Welche neuen Maßnahmen sind zu veranlassen?
Im Rahmen der Projektvorbereitung wird das Stakeholder-Management natürlich noch nicht in Gänze durchgeführt. Vielmehr geht es zu diesem Zeitpunkt darum, die Stakeholder (erstmalig) zu identifizieren und zu analysieren und auf Basis dieser Erkenntnisse ggf. bereits in die Gestaltung des Projektauftrags und in frühe Kommunikationsmaßnahmen einzubeziehen. Im weiteren Verlauf des Projekts erfolgt dann der systematische Schluss des genannten Regelkreises durch Ausführung aller Maßnahmen und fortlaufendes Controlling. Gleichwohl ist im oftmals festzustellen, dass die Stakeholder-Situation nicht so volatil ist, dass es hier ständig einer Veränderung bedarf oder veränderter Erkenntnisse erscheinen.
Eine weitere wichtige Disziplin des Projektmanagements, mit der man auch bereits in der Projektvorbereitung beginnt, ist das Risikomanagement. Auch hier ist es angebracht, bereits in der Vorbereitungsphase die (grundsätzlichen, strategischen) Risiken zu identifizieren und entsprechen der Bewertung Konsequenzen, nicht zuletzt Maßnahmen zur Handhabung der Risiken, im Projekt-Design einzuplanen.
Die Praxis zeigt, dass das Management der Risiken eine zentrale Aufgabe insbesondere auch im Verlauf des Projekts ist, da sich die Risiken ändern und entwickeln. Daher gehen wir erst zu einem späteren Zeitpunkt im Verlauf des Moduls, dass sich ja grob am Lebenszyklus eines Projekts orientiert, detaillierter ein.
Schauen wir an dieser Stelle zunächst etwas genauer auf die Erfolgsfaktoren eines (IT-)Projektes.
1.4.3Lösungen
Handelt es sich um Projekte?
1.Projekt, denn Ziel und Zeit vorgegeben (andere Begrenzungen fehlen).
2.Kein Projekt, da keine Einmaligkeit der Bedingungen (Regelaktivität).
3.Projekt, da Ziel und Zeit genau vorgegeben (beste Abgrenzung)
Ordnen Sie die IT-Projekt-typischen Begriffe den Feldern zu.
intern
extern
•Arbeitszeitregelung
•Bundesdatenschutzgesetz
sachlich
•Richtlinien SW-Entwicklung
•PM-Handbuch
•Kundenspezifische Randbedingungen (z.B. Einsatz beim Kunden über Tests in der Vorproduktionsumgehung)
•Geschäftsführung
•Auftraggeber
sozial
•Entwicklungsabteilung
•Hardwarelieferant
•Datenschutzbeauftragter
•Nutzer des SW-Produktes
Abbildung 17: Projektumfeldanalyse (Beispiel IT-Projekt)
Finden Sie eine repressive Form der Stakeholder-Beeinflussung, die gar nicht so selten vorkommt?
Z.B. juristische Schritte wie Unterlassungsklage oder vertragliche Vereinbarungen wie Malus-Regelung.
1.5Projektauftrag
1.5.1Vom Antrag zum Auftrag
Das Vorgehen zur Initiierung eines Projektes sollte stets über einen formal genehmigten Projektantrag erfolgen. Andernfalls sind Konflikte vorprogrammiert, da bei informell gestarteten Projekten in der Regel die Auswirkungen, Abhängigkeiten, Ziele, Ressourcen etc. nicht klar bestimmt und auch gegenüber anderen Maßnahmen im Unternehmen nicht abgegrenzt sind. Im Idealfall wird aus dem Projektantrag gleichsam 1-zu-1 der Projektauftrag – in der Praxis gibt es typischerweise einen Prozess zur Feinjustierung des Projektauftrags, der mehr oder wenige umfangreich sein kann.
Folgenden Aktivitäten können für die Prozesse der Projektbeantragung und Projektbeauftragung identifiziert werden:
1) Projektbeantragung
Projektziele definieren
Projektumfeldanalyse mit Interessenmatrix
Aufbau der Projekt-Organisation:
Leiter, Team, Teilprojekte? Kernteam? Lenkungsausschuss?
Grobplanung erstellen:
Phasen und Meilensteine
Erforderliche Ressourcen Projekt-Budget
Aufwände/Nutzen, Wirtschaftlichkeit
grobe Terminplanung
Projektrisiken
Qualitätsplanung
Kommunikationsplanung
2) Projektbeauftragung
Ziele und Inhalte werden zwischen Auftraggeber (z.B. Vorstand oder Verantwortlicher eines Geschäftsbereichs) und Auftragnehmer (Projektleiter) abgestimmt.
Projektantrag geht zur Genehmigung an „Priorisierungsgremium“.
Nach Zustimmung zum Projektantrag und Freigabe der Mittel/Ressourcen wird dieser zum Projektauftrag.
Unterzeichnung durch Auftraggeber und Auftragnehmer (= Projektleiter).
Der Projektauftrag ist die vertragliche Basis des Projekts.
Der Prozess der Projektbeantragung umfasst im Rahmen der Projektvorbereitung das Verfassen eines Dokuments, mit dem ein Projekt (oder eine Projektphase) formell genehmigt wird und enthält die Dokumentation der Anfangsanforderungen, mit denen die Bedürfnisse und Erwartungen der Stakeholder − insbesondere Auftraggeber − erfüllt werden:
Abbildung 18: Prozess der Projektbeantragung
Der Ablauf von Kundenprojekten (extern) und internen Projekten ist dabei in gewisser Weise gleich. Natürlich sind die zu erstellenden Dokumente im Detail unterschiedlich – am Ende sollte jedoch immer ein formeller Projektauftrag stehen. Im Falle des externen Projektes hat dieser Vertragscharakter und es gelten die entsprechenden gesetzlichen Rahmenbedingungen, z.B. des BGB. Auch der interne Projektauftrag hat gewissermaßen Vertragscharakter, denn er definiert den Handlungsspielraum der Projektleitung und ist auch Verpflichtung für den Projektauftraggeber.