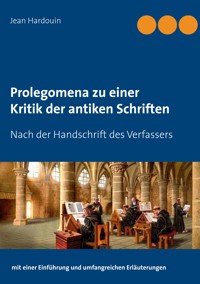
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Der französische Jesuit Jean Hardouin (1646-1729) hatte weit über seine Zeit hinaus den Ruf eines Universalgelehrten und war berühmt für sein ungeheuer vielseitiges Werk und eine schier überbordende Produktivität. Von seinen vielen provozierenden Äußerungen waren nur wenige so kühn wie die These, die sich wie ein roter Faden durch sein 1766 posthum veröffentlichtes Manuskript AD CENSURAM SCRIPTORUM VETERUM PROGEGOMENA (Vorrede zu einer Kritik der antiken Schriften) zieht. Er behauptete, dass ein Großteil der Werke der Antike - darunter sowohl die Schriften vieler griechischer und römischer Autoren als auch Texte der Kirchenväter - von humanistischen Gelehrten und in Kloster-Skriptorien zwischen dem 13 und 15. Jahrhundert gefälscht worden sei. Seine Fälschungshypothese löste eine Welle der Kritik und Empörung aus, die seine wissenschaftliche Reputation nachhaltig beschädigte und bis heute nachwirkt. Die einzige bisher verfügbare Übersetzung dieses lateinischen Textes war eine englische, die noch aus dem Jahr 1909 stammte. Die vorliegende Ausgabe ist die erste deutsche Übersetzung. Eine ausführliche Einführung und umfangreiche Erläuterungen helfen dem heutigen Leser, die im Buch erwähnten Namen, Fakten, Ereignisse und eingestreute Andeutungen, die sonst oft unverständlich bleiben würden, besser einzuordnen und zu verstehen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 531
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jean Hardouin (1646-1729)
INHALT
VORBEMERKUNG
EINFÜHRUNG: Jean Hardouin in seiner Zeit
VORWORT (zur englischen Ausgabe von 1909)
EINLEITUNG (zur englischen Ausgabe von 1909)
AN DEN LESER
I.
Die Echtheit der meisten antiken Schriften wird in Frage gestellt, deren Verfasser seien Atheisten. Hardouin erklärt, warum sie bisher der Zensur entgangen sind. Es sei notwendig, dass ein Jesuit diese Aufgabe übernimmt. Denn alle älteren religiösen Orden hätten Schriften als angebliche Belege gefälscht, allen voran die Benediktiner. Es wird kurz berichtet, wie er die Betrügereien in den Jahren 1690-1692 aufdeckte.
II.
Der Vorwurf des Atheismus gegen die frühen Kirchenschriftsteller wird wiederholt. In den ersten dreizehn Jahrhunderten sei der katholische Glaube in Ermangelung von Literatur allein durch die „viva vox“, das lebendige Wort, tradiert worden. Hardouin erläutert das Wesen dieser kirchlichen Tradition mit Bezug auf die Dreifaltigkeit und den Leib Christi. Die Gestalt der Religion bei den angeblichen Vätern sei reines Heidentum.
III.
Hier wird die Methode der klösterlichen Fälscher erläutert: die Notwendigkeit, eine große Anzahl von Büchern zur Stützung ihrer Lehren zu schreiben, verschiedene Arten von Büchern, darunter angeblich apokryphe Bücher. Das Interesse der Fälscher an der Akademie von Paris. Ihre Beherrschung des Lateinischen unterscheide sich von der des Plinius.
IV.
Der Heilige Stuhl urteile nicht über die Echtheit von Büchern, die Augustinus, Hieronymus und anderen zugeschrieben werden. Niemand dürfe es wagen, die Urheberschaft des Matthäusevangeliums gegen das Zeugnis der Kirche und des Heiligen Geistes in Frage zu stellen. Ähnliches gelte für die Schriften, die Petrus, Paulus, Lukas oder Markus zugeschrieben werden. Darstellung des Systems der Fälschungen, die unter den Namen der „erlauchten Männer“ veröffentlicht wurden. Versuch nachzuweisen, dass die Protestanten mehr Grund haben, die Entlarvung der Väter zu fürchten als die Katholiken, denn die mündliche Tradition sei gewichtiger als alle Schriften. Hardouin würde die Grundschriften der Kirche auf die Vulgata und einige wenige andere Autoritäten beschränken. Fortsetzung des Angriffs auf die Schriften des Augustinus als Quelle aller Häresie.
V.
In Analogie zu den Lehren von Rabbinern und Mönchen entsprechen den Propheten und Weisen die Väter und die Scholastiker. Die Lehren der Mönche werden lächerlich gemacht.
VI.
Weitere Hinweise auf die Verderbtheit der Schriften der Mönche. Hardouin hält starr an der Vulgata fest. Betrügereien in den griechischen Kodizes. Versuch, dem Einwand zu begegnen, dass die Echtheit der Vulgata nicht sicherer sei als die der benediktinischen Diplomata. Hardouin verteidigt dogmatisch die Bücher des Neuen Testaments und verurteilt jede allegorische Auslegung der Heiligen Schrift.
VII.
Stand der Archivalien um 1300 n. Chr.: kein Original einer griechischen Bibel blieb erhalten. Das Schisma der Griechen begann mit der ‚Klosterfraktion‘. Das Hervorgehen des Heiligen Geistes aus dem Vater sei allein ihre Erfindung, desgleichen die byzantinische Geschichte, die Fiktion der „Übertragung des Reiches” und dessen Gestaltung. Wann sind die Griechen vom römischen Ritus abgewichen? Der überwiegende Teil der griechischen Manuskripte finde sich in Frankreich und gerade nicht im Orient - dort, wohin sie nach Hardouins Ansicht nach von den Benediktinern verbracht wurden. Kritik des Stils der angeblichen griechischen Väter.
VIII.
Die Angriffe der ‚Mönchsfraktion‘ auf die Päpste. Die Fiktion des „Königreichs Italien“ und ihr Zweck. Das Kirchenzentrum in Rom sei bloß eine Legende, die durch eine Fülle von Münzfunden widerlegt wird. Die Theorie von Petrus und seinen Nachfolgern. Die Fabel von der Verteilung der Provinzen unter den Aposteln. Die Würde und Macht des Papstes gründet in der mündlichen Überlieferung. Die Mönche hätten sich bemüht, sein Primat zu kippen.
IX.
Hardouin behauptet, die katholische Tradition könne nicht irren, zumal die Katholiken unabhängig von allen Schriften seien. Er greift das Prinzip der schriftlichen Tradition an, wie es von den Sozinianern und anderen ‚Häretikern‘ vertreten wird. Erneute Verteidigung der „lebendigen“ und „ungeschriebenen“ Tradition.
X.
Das zweifache „Wort Gottes“, welche Bücher vom Heiligen Stuhl genehmigt werden. Hardouin bestreitet hartnäckig, dass die heiligen Sendschreiben durch seine Kritik gefährdet seien, denn ein guter Katholik würde sie bis aufs Blut verteidigen. Ganze Konzile seien erfunden worden. Die römisch-katholische als einzig wahre Kirche. Die Calvinisten hätten keine sichere Glaubensgrundlage. Der katholische Glaube sei in Bischöfen, Mönchen und Klerikern gediehen, die nichts geschrieben haben. Einzig die ‚Literatenmönche‘ seien Atheisten gewesen.
XI.
Verfälschung der Liturgie, des Breviers und des Messbuchs. Die Unterscheidung zwischen dem Empfangen und Rezitieren von etwas in der Kirche. In welchem Sinne gibt es „keine Fehler im Messkanon“?
XII.
Der Apostolische Stuhl wird die Schriften der Pseudo-Väter nicht als heilig anerkennen. Diese Schriften seien die Quelle aller Irrlehren. Versuch einer Erklärung, der Beschlüsse des Konzils von Trient über die Väter und über das zweite Konzil von Nizäa.
XIII.
Erneuter Versuch, die Dekrete des Trienter Konzils umzudeuten. Die wahren und die falschen Väter. Die chinesischen Theologen im Vergleich zu den Ketzern. Forsetzung der Diskussion über die Bedeutung der Beschlüsse des Konzils von Trient: Was ist mit dem „gemeinsamen Einvernehmen der Väter“ gemeint? Weiterer Angriff auf unechte Schriften von Augustinus und Thomas von Aquin.
XIV.
Frühe Kirchengeschichte als groß angelegtes Fälschungsvorhaben. Fiktive Päpste bei Pseudo-Augustinus. Die Kirchengeschichte der ersten zwölf Jahrhunderte sei eine einzige Erfindung, im Grunde allegorisch und dramatisch. Die verfälschte griechische und römische Geschichte sei das Ergebnis einer Gemeinschaftsarbeit. Man habe ungestraft jede Lüge schreiben können, es gab keine öffentlichen Verzeichnisse, keine Kritik, keinen Widerspruch. Fälschungen auf Bleiplatten, etc. Die Fälscher der Kirchengeschichte hätten auch griechische und römische Geschichte geschrieben, um jedem Verdacht zu entgehen. Es wird behauptet, dass moderne Lateiner genauso gut schreiben könnten wie die meisten der angeblich „klassischen“ Schriftsteller. Der Konsens der mönchischen Historiker untereinander sei der Beweis einer Verschwörung - und alle Variationen darauf angelegt, dass diese Verschwörung vertuscht wird.
XV.
Vor der Erfindung des Buchdrucks habe es keine wirklich katholischen Bücher gegeben, vor dem vierzehnten Jahrhundert auch keine Bibliotheken - und dass diese außer der Bibel und den Brevieren keine gefälschten Bücher enthalten hätten. Alle monastischen Bücher seien vordatiert worden. Bernard von Clairvaux sei als letzter der Väter eingeführt worden, mindestens 200 Jahre nach seinem Tod. Die erfundenen Manuskripte wurden von Ost nach West gebracht. Die Zeit, in der die griechischen und lateinischen Schriftsteller gefälscht wurden: die Wiederbelebung der Briefe. Einige Spuren der benediktinischen Fälscher würden Hinweise auf die Zeit geben, in der die Briefe gefälscht wurden. Die weitere Aufdeckung des Betrugssystems.
XVI.
Die Bibliotheken der Klöster, die vor der Zeit des Buchdrucks im vierzehnten Jahrhundert gegründet worden waren, seien Horte des Atheismus und der Ketzerei gewesen. Die griechischen Manuskripte wurden wahrscheinlich hauptsächlich in Frankreich geschrieben. Athanasius sei ein benediktinischer Autor. Die Hilfsmittel der Fälscher bei ihren Versuchen, ihren Schriften ein antikes Aussehen zu geben. Die hebräischen Manuskripte seien nicht sehr alt, sondern aus dem vierzehnten Jahrhundert. Nur wenige Büchern in der neuen Königlichen Bibliothek in Paris. Der Büchermangel in Konstantinopel steht im Widerspruch zu deren Zahl im Okzident nach 1453. Gefälschte Schriftarten und gefälschte Tinte.
XVII.
Die Verbindung zwischen Augustinus, Wyclif, Luther, Calvin und Jansen als Häretikern. Eine große Anzahl von Ketzereien in den Büchern aus Klosterbibliotheken seien Fiktionen: sie existieren nirgendwo. Erklärung des Zwecks ihrer Erfindung.
XVIII.
Das Leben der Heiligen und Märtyrer sei eindeutig legendenhaft. Erklärung, in welcher Absicht diese Legenden geschrieben wurden. Ihre Wirkung bei der Findung wahrer jesuitischer Märtyrer. Kirchengeschichten und das Leben von Heiligen - ein zeitgenössisches Phänomen bei der Entstehung der Romanik in Frankreich.
XIX.
Erneuter Angriff auf Augustinus als Lehrer des Atheismus. Die literarischen Verschwörer seien durchweg Nicht-Katholiken und würden unterschiedliche Auffassungen unter denselben Theologennamen vertreten. Die Pseudo-Väter seien die Quelle aller Irrlehren, deren gemeinsames Prinzip der Atheismus ist. Wer sich wie die Lutheraner und Calvinisten darauf berufe, stütze sich auf ein zerbrechliches Schilfrohr. Die katholische Lehre wird dargelegt. Der Glaube muss vom Hören kommen, nicht aus Büchern. Was die katholische Religion und Gemeinschaft ist.
XX.
Hardouin verteidigt seinen Misstrauensbeweis gegen die Bücher aus den Klostern, indem er aus Gallonio gegen Bellotti, den Benediktiner von Monte Cassino, zitiert.
INDEX
LITERATURVERZEICHNIS
VORBEMERKUNG
Die Prolegomena Jean Hardouins sind ein Zeitdokument, postum 37 Jahre nach seinem Tod gedruckt. Sie waren vermutlich vom Verfasser in dieser Form nie zur Veröffentlichung bestimmt. Die erste Drucklegung erfolgte nach einem Autograph Hardouins, das sich heute im British Museum in London befindet.
So sollte diese Schrift auch gelesen werden: als eine in manchen Teilen noch unfertig erscheinende Zusammenfassung von Vorbemerkungen und Randnotizen zum eigentlichen Hauptwerk über die antiken griechischen Schriften, das nie erschienen ist. Und als wäre die im Buch vertretene Hypothese, ein Großteil der uns bekannten antiken Literatur sei gefälscht, nicht schon Zündstoff genug, so greift der Verfasser mit vielen Bemerkungen und Schlussfolgerungen auch noch aktiv in die konfessionellen Auseinandersetzungen seiner Zeit ein. Das macht die Lektüre in unserer Zeit nicht einfacher, weil uns die stritttigen Themen der Glaubensfehden des 18. Jahrhunderts heute kaum noch bekannt sind.
Faksimile-Nachdrucke des lateinischen Textes werden aktuell von mehreren Verlagen angeboten. Eine englische Übersetzung von Edwin Johnson ist erstmals 1909 in Sydney erschienen, die nur typographisch veränderte Neuauflage hat in Deutschland der 2018 verstorbene Hermann Detering 2010 als Book on Demand in Norderstedt herausgegeben. Nachdrucke dieser Übersetzung sind aber auch von ausländischen Verlagen erhältlich.
Für die hier vorgelegte deutsche Erstübersetzung war die englische Ausgabe hilfreich, doch folgt sie im Zweifelsfall stets dem lateinischen Original, das Edwin Johnson nicht immer präzise und manchmal schlicht falsch wiedergibt. Aufgenommen in diese Ausgabe wurden allerdings Übersetzungen des Vorworts und der Einleitung der englischen Ausgabe.
Übernommen habe ich auch die von Johnson eingeführte kurze Inhaltsangabe über jedem Kapitel, wenn auch in leicht gestraffter Form. Um Fundstellen besser kennzeichnen zu können, sind die Absätze innerhalb jedes Kapitels durchnummeriert.
Im lateinischen Original sind auf den Seiten XI – XVIII nach dem Editorial des Druckers William Bowyer sog. Additamenta abgedruckt, längere und kürzere handschriftliche Zusätze und Bemerkungen, die Hardouin nachträglich eingefügt bzw. am Rand vermerkt hatte. Auch ein paar Streichungen sind darunter. Eine ganze Reihe dieser Zusätze waren in der englischen Ausgabe von 1909 an den entsprechenden Stellen in den Text übernommen worden, der Rest entfiel – jeweils ohne darauf hinzuweisen. In der vorliegenden Ausgabe sind alle Zusätze direkt am vorgesehenen Ort eingefügt, allerdings durch eckige Klammern und eine abweichende Schriftart kenntlich gemacht.
Alle im Buch vorhandenen Zitate habe ich auf ihre Richtigkeit überprüft, wobei sich herausstellte, dass Hardouin äußerst gewissenhaft arbeitete und seine Zitierweise nur an ganz wenigen Stellen unwesentlich von der Quelle abwich.
Ein umfangreicher Anmerkungsapparat erläutert Namen, Fakten, Ereignisse und Andeutungen, die Hardouin allenthalben einstreut und die für heutige Leser oft unverständlich bleiben würden.
EINFÜHRUNG: Jean Hardouin in seiner Zeit
„Ausgerüstet mit einem bewundernswürdigen Gedächtniß und einem seltenen Scharfsinn, verbunden mit einem Fleiß, der Sommer und Winter von Morgens vier Uhr bis in die späte Nacht anhielt, erwarb er sich in den gelehrten Sprachen und Alterthümern, der Geschichte und Numismatik, der Philosophie und Theologie, die umfassendsten Kenntnisse, und galt mit Recht für einen der gelehrtesten (…) Männer seiner Zeit. Wenn man der komplexen Persönlichkeit und dem immensen und ungeheuer vielseitigen Werk des französischen Jesuiten Jean Hardouin sowohl historisch als auch wissenschaftsgeschichtlich gerecht werden will, so sollte man sich vor vorschnellen Werturteilen oder gar Verächtlichmachungen hüten, wie das leider bis in jüngere Zeit hinein oft praktiziert wurde.“(Allgemeine Encyklopädie der Wissenschaften und Künste, 18181)
Quo doctior, eo perversior: ye gelerter, ye verkerter(Sebastian Franck, Paradoxa, 1534)
Um Werk und Wirkung dieses tiefgläubigen Gelehrten besser verstehen zu können, ist es erforderlich, dass wir zumindest ein Stück weit eintauchen in eine Zeit, in der das überlieferte historische und auch theologische Wissen brüchig wurde und mit immer radikalerer Kritik Schicht um Schicht abgetragen und seziert wurde. Eherne Gewissheiten des christlichen Glaubens gerieten auf den Prüfstand; und lange Zeit war keineswegs ausgemacht, welche der vielfältigen Richtungen und Fraktionen der „Gelehrtenrepublik“ (dazu später mehr!) sich durchsetzen würde oder wie die Frontlinien im Einzelnen verliefen. In diesem Zusammenhang ist es auch nicht unwichtig, sich mit Glauben und Überlieferung der katholischen Kirche des 15., 16. oder 17. Jahrhunderts zu beschäftigen.
In seinem Essay Past Belief erzählt der amerikanische Historiker Anthony Grafton eine Anekdote des jungen Humanisten und Buchdruckers Thomas Platter2, der einen katholischen Priester mit der Fangfrage, warum der Papst Oberhaupt der Kirche sei, aufs Glatteis führte. Denn der Priester antwortete erwartungsgemäß: Als Christus Petrus vor Rom getroffen und gefragt habe, wohin er gehe, habe Petrus geantwortet: ‚Nach Rom, um mich kreuzigen zu lassen.‘3 Worauf ihm Platter anhand des Römerbriefes bewies, dass Petrus – da in der Grußbotschaft des Paulus mit keinem Wort erwähnt – niemals in Rom gewesen sein könne. Auf die Frage, wo der Priester denn sein Wissen herhabe, habe dieser erwidert, seine Großmutter habe ihm die Geschichte erzählt. Platters Antwort war bissig: ‚So erkenne ich wirklich, dass deine Großmutter deine Bibel ist.‘ Ob sich das so zugetragen hat, wie es die Gebrüder Platter berichteten4, ist zweitrangig. Wichtiger hierbei ist die Tradition, auf die sich der Priester beruft. Und das ist nicht etwa das Neue Testament selbst, sondern es sind die apokryphen Petrus-Akten, ein Text aus dem zweiten, vielleicht sogar erst dritten Jahrhundert - und nicht einmal direkt, sondern indirekt, über die mündliche Tradierung. Der Humanist will wissen, ob die Überlieferungen mit den Belegen des heiligen Textes übereinstimmen, der als Autorität identifiziert und kritisch geprüft wird. Platter liest also den Brief des Paulus gegen den Strich. Er benutzt den Text nicht etwa, um die Lehren des Apostels, sondern um die Mitglieder der frühen Stadtkirche in Rom zu rekonstruieren, und lehnt die Mär von der Begegnung Christi mit Petrus ätzend ab.
„Der Priester gibt ein ererbtes Konglomerat von Lehren und Geschichten weiter - eine komplexe, überwucherte Masse, in der der Stein der ursprünglichen Texte unter dem klammernden, verflochtenen Efeu der Tradition verschwunden ist.“5
Bei seinem Versuch, die frühe Kirche neu zu erschaffen, das Fundament freizulegen, spitzt der junge Platter die Türme, Zinnen und windschiefen Dächer des kirchlichen Lehrgebäudes seiner Gegenwart karikaturenhaft zu: Er stellt die katholische Bereitschaft, sich auf Traditionen und Texte einzulassen, als Offenheit für Legenden und Aberglauben dar.
Platters Anekdote mag uns als Blaupause dienen, zumindest als eine Wegmarke innerhalb der Geschichte, wie Gelehrte der Renaissance und andere Akteure in Literatur und bildender Kunst dazu kamen, sich das frühe Christentum auf neue Weise vorzustellen. Denn dieses katholische Projekt beherrschte einen Großteil der römischen, ja der europäischen Wissenschaft und Kunst in den Jahren um und nach 1600 und hinterließ reiche Hinterlassenschaften an Texten, Bildern und Gebäuden, als alte Kirchen restauriert, als Katakomben und Klosterbibliotheken geöffnet und frühe Bräuche nicht nur Gegenstand von Debatten unter Gelehrten sondern auch der Darstellung in Malerei und Bildhauerei wurden.
Unsere Geschichte beginnt sogar noch früher, im April und Mai 1440, als Lorenzo Valla die Konstantinische Schenkung in Frage stellte - das Dokument, nach dem Konstantin aus Dankbarkeit gegenüber Papst Silvester I., der ihn von Lepra geheilt hatte, das weströmische Reich an die Kirche übertragen hatte. Gewappnet mit dem ganzen Arsenal der Rhetorik gelang es Valla zu zeigen, dass die Schenkungsurkunde vor Ungereimtheiten nur so wimmelte - insbesondere von sprachlichen. Er erfand Reden, die alle Beteiligten gehalten hätten, wenn Konstantin wirklich versucht hätte, die Hälfte seines Reiches zu verschenken, und bewies so, dass er viel überzeugendere Fälschungen hätte produzieren können, wenn er gewollt hätte.6 Valla beschränkte indes seine Kritik nicht auf die Schenkung, sonderte prangerte auch Gemälde mit falschen Geschichten über die Ursprünge des Christentums an, ebenso wie die Texte, die solche Ausschmückungen der Geschichte und der Evangelien rechtfertigten: „Diese Geschichten tragen mehr dazu bei, den Glauben zu stürzen, weil sie falsch sind, als ihn zu stärken, weil sie wundersam sind.“7
Man konnte bereits bei Valla die Konturen des skeptischen Projektes erahnen, das die gelehrte Welt in den kommenden mehr als zwei Jahrhunderten beschäftigen sollte. Ein Projekt, das das Zeitalter der Antiquare – später auch: des Skeptizismus - genannt wird und das die frühneuzeitliche Geschichtsschreibung, nicht nur der Kirchengeschichte, sowohl erschüttern als auch revolutionieren sollte.
„Diese neue Strömung“, schrieb der italienische Historiker Arnaldo Momigliano vor über 70 Jahren in einem wegweisenden Essay, „kam in Gelehrtengesellschaften auf und war nicht mehr auf die Universitäten beschränkt; sie wurde eher von gebildeten Amateuren getragen als von den zur Lehre Berufenen. Diese Leute zogen es vor, zu reisen statt Textkritik zu betreiben, und im Allgemeinen standen für sie Münzen, Statuen, Vasen und Inschriften eher im Vordergrund als die literarischen Texte. (…) Das Zeitalter der antiquarischen Forschung setzte Maßstäbe und warf Fragen zur historischen Methode auf, die auch heute kaum als überholt gelten dürfen.“8
Um die Spreu vom Weizen zu trennen, wurden Lehrbücher zu Anleitung und Methode der Interpretation und Kritik der Quellen verfasst, die von äußerst subtiler Text- und Handschriftenanalyse bis hin zu Kriterienkatalogen für die Bewertung historischer Artefakte reichten. Dabei ging man davon aus, dass Urkunden und andere offizielle Dokumente, Münzen, Inschriften und Statuen verlässlichere Belege seien als literarische Quellen. Und, was noch viel wichtiger war, man formulierte feste Regeln
für den Einsatz von Urkunden, Inschriften und Münzen in Hinblick auf ihre Echtheit und ihre Auslegung. Denn „das neue Interesse an nicht-literarischen Quellen brachte die Möglichkeit neuer Forschungen mit sich und lieferte zugleich die Techniken dazu.“9
In ihren Forschungsarbeiten zeichneten sich die Antiquare aus durch die Präferenz für die Originaldokumente, ihre Fähigkeit, selbst subtile Fälschungen aufzuspüren, ihre Geschicklichkeit beim Sammeln und Klassifizieren der Quellen und vor allem ihre grenzenlose Liebe zur Gelehrsamkeit. „Der Aufstieg des Antiquarismus verursachte eine seismische Verschiebung in der Praxis der frühneuzeitlichen Historiker.“10
Denn ihre Aktivitäten fielen in eine Zeit, in der Alte Geschichte in der Form von Kommentaren zu antiken Geschichtsschreibern unterrichtet wurde (so z.B. in Oxford oder Cambridge). Die Autorität der antiken Historiker war hier so groß, dass noch niemand ernsthaft daran dachte, sie ersetzen zu wollen. Deshalb schrieb man lediglich antiquitates und nicht etwa eine Römische (oder Griechische) Geschichte. Dessen ungeachtet zählten „die meisten Artes Historicae des 16. und 17. Jahrhunderts die Tätigkeit der Antiquare nicht zur historischen Arbeit. Wenn ein Autor das Wirken der Antiquare doch in Betracht zog, betonte er, daß sie unvollkommene Historiker seien und dazu beitrügen, Reste der Vergangenheit zu retten, die zu fragmentarisch seien, um Gegenstand der wahren Geschichte zu sein. Bacon unterschied in seinem Advancement of Learning (1605) zwischen Altertümern, Denkmälern und eigentlicher Geschichte, und Altertümer definierte er als »bis zur Unkenntlichkeit entstellte Geschichte oder Überbleibsel der Geschichte, die rein zufällig dem Schiffbruch der Zeit entgangen sind« (ll 2, 1).“11
Daher gab es im 16. und frühen 17. Jahrhundert für die nicht-klassische und nach-klassische Welt sowohl Antiquare als auch Historiker (die man
oft sowieso nicht voneinander unterscheiden konnte), aber für das klassische Altertum gab es nur Antiquare.12
Diese deutliche Differenzierung galt allerdings nur für die als kanonisch betrachtete Geschichte des klassischen Griechenlands und Roms. „Keine mittelalterliche Chronik konnte eine derartige Autorität beanspruchen, dass sie eine neue Darstellung der mittelalterlichen Geschichte hätte verhindern können.“13 Auch für die Geschichte Englands, Frankreichs, Deutschlands oder Spaniens, selbst Italiens, existierte nichts Vergleichbares. Bei der Erforschung konnte man sich daher nach Herzenslust aller Hilfsmittel bedienen, die Nachforschungen in Bibliotheken und Archiven bieten konnten.
Denn in jener Zeit „galt Geschichte zunächst einmal als Geschäft der Rhetorik, so dass die Darstellung der Vergangenheit vor allem den Ansprüchen und Standards dieser Disziplin zu folgen hatte.“14 Es gehört zu den bleibenden Verdiensten des Antiquarianismus, mit seiner entschiedene Hinwendung zu Archivdokumenten, Münzen und anderen Objekten die in Kommentaren zu antiken Geschichtsschreibern erstarrte Historiographie revolutioniert zu haben. Denn diese galten nun fortan, wenn nicht als entscheidende Grundlage, so doch zumindest als Korrektiv aller Historiographie. Die Benediktiner von St. Maur (Jean Mabillon, Bernard de Montfaucon) und die Bollandisten15 aus dem Jesuitenorden (Daniel Papebroch) hatten im letzten Viertel des 17. Jahrhunderts die Analyse solcher Quellentypen methodisiert und damit auf ein neues Niveau gehoben. Zunächst freilich blieb diese stark empirische Form der Geschichtsforschung ihrerseits nicht ohne Widerspruch. Rhetoriker und Philosophen spotteten über den Sammeleifer und die Detailverliebtheit der Antiquare.
Als Antwort auf den Jesuiten Papebroch16, der die Echtheit der königlichen Urkunden im frühmittelalterlichen Frankreich in Frage gestellt hatte, brachte der große Benediktinergelehrte Jean Mabillon 1681 einen sechsbändigen Folianten De re diplomatica heraus, in dem er nicht nur Hunderte Dokumente und Urkunden – aus eigenen Forschungsreisen und auch dem reichhaltigen Fundus der benediktinischen Archive – veröffentlichte, sondern zugleich auch die Methoden zur Validierung und Datierung solcher Dokumente mitlieferte. Er erörterte u.a. das Studium ihrer Handschrift, ihrer formulae (Ausfertigungsmuster von Urkunden), ihrer Siegel und zeigte auf diese Weise, wie Fälschungen aufgedeckt und die Echtheit anderer Urkunden bestätigt werden konnten.
Dies war nicht das erste Werk, das sich auf diese Weise mit mittelalterlichen Urkunden beschäftigte, aber es war bei weitem das systematischste und umfassendste. Als Mabillon auch noch einen Supplementband17 folgen ließ, zeigte sich sein Gegner Papebroch überzeugt, wie er in einem Brief an Mabillon respektvoll zugab, während sein Ordensbruder Barthélémy Germon stattdessen Mabillons Werk einer immanenten Kritik unterzog und mit mehreren Streitschriften eine Kontroverse entfachte18, die sich bis weit ins achtzehnte Jahrhundert fortsetzte.19
Obwohl in methodischer Hinsicht als Meilenstein geachtet und eifrig rezipiert, konnte auch Mabillons Werk nicht von der Kritik verschont bleiben, bestand doch die Gelehrtenrepublik zu einem nicht unwesentlichen Teil aus kirchlichen Würdenträgern, Mitgliedern religiöser Orden wie den Jesuiten oder Benediktinern, aus Reformatoren und Gegenreformatoren, die die eigenen Forschungsergebnisse immer zugleich auch als Munition im Glaubenskrieg einsetzten. Denn im 16. und 17. Jahrhundert war kaum etwas von größerer praktischer Bedeutung als Entscheidungen über Theologie und Liturgie. In einem Zeitalter des Glaubenskrieges ging es im wahrsten Sinne um Leben und Tod. Und mit der Zeit „verlagerte sich das Zentrum der theologischen Schwerkraft von der Theologie in das Feld der Kirchengeschichte“20 - das Feld, das die eine oder andere Charta liefern konnte, die jede konfessionelle Richtung für ihre Lehren und ihre Praktiken gleichermaßen zu besitzen beanspruchte. Zwischen Vergangenheit und Gegenwart existierte ein dialektisches Beziehungsgeflecht. Zeitgenössische Anliegen und Debatten spornten die Forschung an, die wiederum historische Informationen hervorbrachte, die hier und jetzt von Bedeutung waren und in die Auseinandersetzungen der Gegenwart jener Autoren eingebracht wurden. „Kein Wunder also, dass diejenigen, die dieses Feld beackerten, ihr Bestes taten, um wie die Militärs die neuen historischen Methoden zu beherrschen.“21
Hier wiederholte sich, Momigliano zufolge, unter anderen Vorzeichen ein altes Muster der kirchlichen Gelehrsamkeit. Er identifizierte eine tausendjährige Tradition der gelehrten Historiographie. Schon der frühchristliche Gelehrte und Bischof Eusebius22 habe als Historiker ein neues Genre geschaffen, als er eine Reihe von zusammenhängenden Werken verfasste: eine Chronik, die in tabellarischer Form die gesamte Geschichte als die Geschichte des Triumphes des Christentums darstellte; eine vor diesem Hintergrund erzählte Geschichte der Kirche23; und das Leben Konstantins (Vita Constantini), das der Geschichte Roms die gleiche Form und Dramatik gab.
In Anlehnung an den jüdischen Historiker Josephus verwandelte Eusebius die Geschichte in die Geschichte eines frommen Volkes, das von Ungläubigen verfolgt wurde. Und ebenso wie Josephus verlieh er seiner Geschichtserzählung Glaubwürdigkeit und Wirkung, indem er sie mit Originaldokumenten ausfütterte, die er vollständig zitierte.
Nach den großen Umwälzungen des dritten Jahrhunderts waren sowohl das Reich als auch die Kirche in die Hände neuer Eliten gefallen, die neue Ansprüche hatten. Das Christentum war Staatsreligion geworden.24 Die Spielregeln des gesellschaftlichen und gemeinschaftlichen Lebens wurden neu festgelegt. „Die Untergegangenen, sowohl die römischen Aristokraten als auch die christlichen Kleriker, hatten mehr oder weniger gewusst, was sie über die Gemeinschaften, denen sie dienten, und die Rituale und Institutionen, die sie weiterführten, wissen mussten. Die Geretteten wussten es nicht: aber die neue Geschichtsschreibung gab ihnen grundlegende Informationen. Gleichzeitig bot sie Glaubenssätze und Bräuche an, in Form der zahlreichen Dokumente, die sie wie Pflaumen in einem Pudding verstreuten.“25
Denn auch die Gebildeten unter den neu bekehrten Heiden wussten so gut wie nichts über das Christentum. So lernten sie eine neue Geschichte, weil sie eine neue Religion erwarben. Sie lernten sie als Universalgeschichte, denn die Christen waren entschlossen, die „Konstantinische Wende“ ein für alle Mal zu ihrem Vorteil zu nutzen und eine Rückkehr zu den Bedingungen der Inferiorität und der Verfolgung für die Kirche unmöglich zu machen. Deshalb mussten die christlichen Chronographen die Geschichte zusammenfassen, die von den Bekehrten nun als ihre eigene betrachtet werden sollte. Folglich transformierten sie die hellenistische Chronographie in eine christliche Wissenschaft und fügten die Bischofslisten der wichtigsten Bistümer an die Liste der Könige und Provinzialen der heidnischen Welt an. Sie präsentierten Geschichte in einer Weise, dass das Schema der Erlösung leicht zu erkennen war. Sie legten Kriterien der Orthodoxie durch das einfache Mittel der Einfügung von Bischofslisten fest, die die apostolische Nachfolge repräsentierten.26 Chronologie und Eschatologie gingen ineinander über.
So schuf Eusebius das Grundgerüst eines mächtigen Baus, an dem zahlreiche Nachfolger weiterwirkten, die ihn verstärkten und ausschmückten, um so eine nach römischen Vorbild organisierte christliche Kirche zu schaffen und sich dergestalt als universale Staatsreligion einer Weltmacht etablieren und würdig erweisen zu können. Dass diese Entwicklung keineswegs geradlinig und unter leidenschaftlichen und erbittert geführten theologischen Kontroversen der damaligen Gelehrten und Glaubensrichtungen ablief, kann man beispielsweise bei der amerikanischen Religionswissenschaftlerin Elaine Pagels nachlesen.27
Folgt man Momiglianos Argumentation, so nahmen schließlich im sechzehnten Jahrhundert, als die Reformation den Primat und die Hierarchie der römischen Kirche in Frage stellte, der Protestant Matthias Flacius28 und der Katholik Cesare Baronio29 diese auf Eusebius zurückgehenden Form der Geschichtsschreibung wieder auf, veränderten sie allerdings auf entscheidende Weise. Wie Eusebius schrieben beide Männer Kirchengeschichte im universellen Maßstab und beide reicherten ihr Werk mit Dokumenten an. Doch im Gegensatz zu Eusebius zeigten sie eine neue und in der Frühgeschichte unbekannte „Sorgfalt bei der minutiösen Analyse der Beweise“ so dass sich ihre Geschichtsschreibung gewissermaßen als die voll entfaltete und intellektuelle Variante der eusebianischen
Chronologie erwies. Hier sah Momigliano das zweite Novum dieses Narrativs: Kirchenhistoriker nutzten die Dokumente deshalb kritisch, weil sie in zeitgenössische Kontroversen eingebunden waren. So war es keineswegs ein Zufall, dass ausgerechnet ein Kirchenhistoriker wie Le Nain de Tillemont 30 die Methoden der politischen Geschichte revolutionierte, in dem er sozusagen die Seiten wechselte und eine sorgfältige Untersuchung der Belege auf eine Geschichte des Römischen Reiches anwandte. Daher „mögen wir uns wohl fragen“, schrieb Momigliano, „ob sich die moderne politische Geschichtsschreibung je von der Rhetorik und vom Pragmatismus zu Fußnoten und Anhängen gewandelt hätte, wenn das Beispiel der Kirchengeschichte gefehlt hatte.“31
Denn für die damaligen Historiker hatte das Suchen nach alten Dokumenten keine Priorität. Vor allem das 17. Jahrhundert war eine wichtige Phase bei der Ausbildung des kritischen Quellenstudiums, und die bereits erwähnten Bollandisten illustrieren exemplarisch den großen Beitrag der Jesuiten hierbei. Allerdings barg diese Transformation des Humanismus zu einer philologischen Textwissenschaft auch beträchtliche Gefahren, lag es doch nahe, nicht nur Heiligenlegenden und historische Quellen, sondern auch die Bibel selbst mit diesen Techniken zu analysieren. Zwar galt eine philologische Analyse der Heiligen Schrift auch für fromme Kirchenmänner wie die Jesuiten in begrenztem Rahmen als akzeptabel und sogar notwendig. Doch wo sollte man die Grenze setzen, da hinter der philologischen Textkritik oft die Gefahr eines mehr oder weniger umfassenden Skeptizismus lauerte, der dann auch tatsächlich Gestalt annahm. Denn der Philologie wohnte ein grundsätzliches Misstrauen gegenüber Texten und ihrer Verlässlichkeit inne, und der im Zuge der Recherchen aufkommende Pyrrhonismus32 bewies, dass sich diese Skepsis bis fast ins Unermessliche steigern ließ.
Was die späthumanistisch-christliche Gelehrtenwelt allerdings von der heutigen Wissenschaft unterscheidet, war die feste Überzeugung, dass es eine einheitliche und konsistente göttliche Wahrheit gab, die sich in allem und jedem manifestierte. Zwischen allem, was es gab, bestand deshalb ein Zusammenhang - Kulturen und Zivilisationen, Erkenntnisse und Tatsachen, wissenschaftliche Beobachtung und göttliche Offenbarung konnten einander nicht grundsätzlich widersprechen, sondern verwiesen vielmehr positiv aufeinander. So war etwa die Welt der späthumanistischen Jesuiten eine Welt, in der China und Ägypten, Europa und Amerika, in der Texte und Dinge, Natur und Kultur, Schöpfung und Schöpfer miteinander in Beziehung standen.33 Es mochte vielleicht auf den ersten Blick nicht zu verstehen sein, wie genau die einzelnen Erkenntnisse dann zu einem großen Ganzen zusammenpassten, zumal dann, wenn sich Widersprüche nicht auflösten, Teile nicht zu harmonieren schienen - doch dann war es gerade die Aufgabe der Gelehrten, diese Verbindungen trotzdem zu entschlüsseln und ein kohärentes, universales Weltbild zu schaffen.
Dieses länder- und kulturenübergreifende Verständnis der Welt und deren Erforschung fand sein Pendant in einer anderen Neuerung: Vernetzung und Teamarbeit. Schon ein Projekt wie die Acta Sanctorum konnte nicht als Werk eines Einzelnen gelingen, sondern war auf Helfer und Mitarbeiter, Sympathisanten und Unterstützer, Freunde und Kollegen angewiesen. Papebroch und ein Mitstreiter unternahmen in den Jahren 1660 bis 1662 eine lange Reise durch Deutschland und Italien, immer auf der Suche nach neuen, bisher unentdeckten Manuskripten. Was sie selbst nicht entdecken und sichten konnten, wurde Ihnen oft von Freunde innerhalb und außerhalb der Gesellschaft Jesu zur Verfügung gestellt. So entstanden Netzwerke von Gelehrten, und auch Daniel Papebroch war in ein solches konfessionsübergreifendes Netzwerk von Korrespondenten eingebunden, das in seinem Fall protestantische Gelehrte wie Gottfried Wilhelm Leibniz und den Frankfurter Orientalisten Hiob Ludolf34 genauso umfasste wie den katholischen Gelehrten Charles du Fresne, sieur du Cange.35 Projekte wie die Acta Sanctorum konnten nur funktionieren, wenn die Gemeinschaft von Forschern international zusammenarbeitete.
Trotz manchmal beinhart und unversöhnlich ausgetragener Kontroversen wäre dies alles nicht möglich gewesen ohne ein Länder und Konfessionen übergreifendes Netzwerk von Gelehrten, das uns heute als die République de lettres bekannt ist. Natürlich gab es auch hier Frontlinien, Grabenkämpfe und Heckenschützen, aber das Beziehungsgeflecht dieser Gelehrtenrepublik war komplex und die Genzen der jeweiligen Kontakt- und Einflussbereiche hielten sich weder an Landesgrenzen, noch waren sie stets durch Konfessions- oder Ordenszugehörigkeit definiert.
Mit dem Aufschwung der Wissenschaften in Europa seit der Renaissance entwickelten die Gelehrten ein neues Selbstbewusstsein, das unter ihnen über alle politischen und religiösen Schranken hinweg ein Zusammengehörigkeitsgefühl entstehen ließ. Seinen adäquaten Ausdruck fand dies in der sogenannten „Respublica litteraria“, später „République des Lettres“, die das Ideal eines universellen geistigen Gemeinwesens verkörperte und seit der Zeit des Erasmus (1469-1536) über drei Jahrhunderte Geltung behielt. Der Begriff der „Respublica litteraria“ ist bereits 1417 belegt36, fand aber erst seit dem 16.Jh. - in seiner lateinischen und dann auch in seiner französischen Form - Verbreitung im europäischen Raum. Bis in die Aufklärung bildete diese Gelehrtenrepublik, so die deutsche Bezeichnung, die Plattform für den freien Gedankenaustausch der Gelehrten, die damit ihre geistige Freiheit und Zusammenarbeit über die politischen und religiösen Gegensätze der realen Welt hinweg zu sichern suchten. Es war also keineswegs so, dass die République des lettres, wie Historiker lange Zeit unterstellten, lediglich als fiktives Gebilde zu verstehen war, handelte es sich doch um ein weitreichendes Geflecht von höchst realen Personen, die nicht nur ein gemeinsames Ethos miteinander verband. Hans Bots und Françoise Waquet haben materialreich gezeigt, dass die vom Widerspruch zwischen Utopie und Realität gekennzeichnete spannungsvolle Entwicklung der République des lettres bis zu ihrer Auflösung im ausgehenden 18.Jh. nicht nur existierte, sondern auch „eines der wichtigsten Phänomene in der Geistesgeschichte des neuzeitlichen Okzidents“37 dargestellt hat.
Wie Anthony Grafton es ausdrückt, stellten Briefe „die zerbrechlichen, aber lebenswichtigen Kanäle dar, die den intellektuellen Handel verbanden und belebten“ und „ein Kapillarsystem bildeten, entlang dessen Informationen vom päpstlichen Rom zu den calvinistischen Hochburgen im Norden und umgekehrt reisen konnten - solange beide Einwohner hatten, die kommunizieren wollten“.38 Ein besonderer Impuls für die Entwicklung des Phänomens ging von der geographischen Ausdehnung aus und von der neuen Gewichtung bestimmter Regionen durch die Gründung von Universitäten, Akademien, Bibliotheken, die berühmten Druckeroffizinen (vor allem in der Renaissance). Dadurch rückten auch ehemals periphere Gebiete mehr ins Zentrum. Das Wachstum der staatlichen und kommerziellen Postdienste während der Renaissance schuf nie dagewesene Möglichkeiten für die Kommunikation über große Entfernungen, die europäische Gelehrte schnell für ihre eigenen Zwecke ausnutzten. Ab dem 16. Jahrhundert galt der Briefwechsel als grundlegende Pflicht aller angehenden Mitglieder dieser Republik, und die von ihnen gebildeten brieflichen Netzwerke waren ein wesentlicher Faktor bei der Schaffung einer internationalen Gelehrtengemeinschaft, die keineswegs nur eine Domäne von Akademikern im heutigen Sprachgebrauch war. Da es kein Gremium gab, das über die Aufnahme entschied, kann die Frage nach den „critères d'entree dans cette communaute“39 nur anhand der subjektiv gefärbten Meinungen von Zeitgenossen untersucht werden. Auch wenn sich die Kriterien im Verlauf des historischen Prozesses veränderten, kann man festhalten, dass keineswegs nur Autoren wissenschaftlicher Werke Aufnahme in die République des lettres fanden, sondern auch andere, die nichts publiziert hatten, wenn sie nur über „Wissen“ verfügten, war dies doch „der Zement, der ihre Gemeinde verbindet“.40
Folianten, Streitschriften und Aufsatzsammlungen waren die Währung dieser literarischen Ökonomie, die von Verlegern und Buchhändlern in Florenz, London, Paris, Amsterdam, Leuwen, Neufchâtel und anderen strategischen Zentren gemanaged wurde, in denen es keine Zensurerlasse gab. Mehrbändige Textausgaben und anspruchsvolle Zeitschriften, die sich auf Zusammenfassungen und Rezensionen spezialisierten, brachten die literarischen Nachrichten von Krakau nach Cambridge und darüber hinaus. Ober- und unterhalb dieser öffentlichen Sphäre verband ein effizientes System privater Korrespondenz diese „communaute des savants“41, die auch Handwerker oder Techniker umfasste, und der hugenottische Flüchtlinge ebenso angehörten wie Mitglieder eines halben Dutzend katholischer Orden und sogar einige Juden. Das Lebenselement, ja, die Existenzweise dieser Gelehrtenrepublik war die Kommunikation. Folgerichtig konnten nur diejenigen dazu gezählt werden, die an dem System des Austauschs teilhatten, in dessen Rahmen über die Ländergrenzen hinweg literarische und gelehrte Nachrichten kursierten. Denn die „Bürger“ dieser „ersten egalitären Gesellschaft Europas“ (Anthony Grafton) hatten vor allem zwei Dinge gemeinsam:
Fast alle von Ihnen sprachen verständigten sich in den beiden gemeinsamen Sprachen - Latein, das von 1500 bis etwa 1650 die Sprache aller Gelehrten blieb und auch danach noch eine herausragende Rolle spielte, und Französisch, das es in den meisten Zeitschriften und fast allen Salons allmählich ablöste. Und: „Die Bürger der Republik waren die letzten Europäer, die plausibel behaupten konnten, sie seien die Herren ihrer gesamten Zivilisation.“42 Mit einem Wortspiel beschreibt Anthony Grafton dieses „strange imaginary land“: „Eine Möglichkeit, sich die Republik vorzustellen, ist also eine Art Pedantic Park: eine Welt der Wunder, viele davon von Menschenhand geschaffen, bewohnt von gelehrten Dinosauriern.“43
„Jeder, der in einer Pariser Abtei, einem Berliner Pfarrhaus oder einer Londoner Bibliothek mit dem richtigen Einführungsschreiben auftauchte, konnte sich darauf verlassen: er würde eingeladen werden, eine floride Unterschrift und eine angemessene Stimmung in Latein, Griechisch oder Hebräisch in das Album amicorum seines Gastgebers einzutragen, sich an einem morgendlichen Buchgespräch zu beteiligen und mit ihm andere humane und gelehrte Herren vorzustellen, deren Bibliotheken und Wunderkammern er seinerseits erkunden würde.“44
Für uns ist es heute selbstverständlich, dass Bildung etwas zu tun hat mit Spezialistentum. Ob Ingenieur oder Mathematiker, ob Mediziner, Philosoph oder Kritiker – für jeden bedeutet Erfolg etwas Bestimmtes: ein Problem genau zu definieren und es auf eine formale, endgültige Weise zu lösen. Nur andere Spezialisten, so glauben wir, können oder sollten uns sagen, ob solche Probleme gelöst sind. Doch Spezialisten und Fachleute gehören in unsere Welt, die Welt der Moderne, in eine Welt, in der jeder hochgebildete Mann oder jede hochgebildete Frau eine bestimmte Funktion hat und eine formale Lizenz zur Ausübung dieser Funktion erhalten hat. Zwar gab es auch im vormodernen Europa Spezialisten: Aber selbst diejenigen, die sich stolz als „Mathematiker“ oder „Juristen“ bezeichneten, übten ihre Künste in einem breiten Kontext aus.
Denn das ganze System der formalen Bildung war darauf ausgerichtet, Generalisten hervorzubringen. Jeder Gebildete wurde in der Schule zu einem Altphilologen. Die Spezialisten der althergebrachten höheren Fakultäten - Medizin, Jura und Theologie - haben ihre humanistische Bildung in diese Bereiche importiert und die Geisteswissenschaften verändert, indem sie medizinische, juristische und theologische Perspektiven in sie einbrachten. Selbst die begabtesten Mathematiker studierten Griechisch, Latein und Geschichte in der Schule und Logik und Philosophie an der Hochschule, bevor sie sich den Zahlen zuwandten.
„Heutzutage erinnern wir uns an Leibniz und Newton als Wissenschaftler, die großen Männer die das Kalkül und die moderne Physik schufen, und Leibniz auch als Philosoph. Obwohl die beiden Männer zu Recht stolz auf ihre außerordentlichen Leistungen auf diesen heute so zentral erscheinenden Gebieten waren, verfolgten sie ihre Interessen auch auf vielen benachbarten Gebieten. Leibniz war ein produktiver, kritischer Historiker und ein scharfsinniger Erforscher des Ursprungs und der Entwicklung der menschlichen Sprachen. Newton verbrachte Jahre seines Lebens damit, alchemistische Experimente durchzuführen, die Geschichte der antiken Welt aufzuarbeiten, den Tempel Salomons zu rekonstruieren und zu versuchen, die Prophezeiungen von Daniel und dem Buch der Offenbarung zu interpretieren. Tausende von Seiten eng beschriebener Notizen halten seine Bemühungen auf diesen verschiedenen Gebieten fest - jedes dieser Gebiete nahm er offenbar genauso ernst wie die anderen. Beide Männer schrieben Latein so leicht wie die modernen Sprachen und benutzten es oft - oder, in Leibniz‘ Fall, Französisch -, wenn sie Themen ansprachen, die für ein breites Publikum wichtig waren.“ 45
Diesen zeitgeschichtlichen Hintergrund müssen wir uns immer vergegenwärtigen, wenn es um Werk und Person Jean Hardouins geht. Hardouin mag ungewöhnlich gewesen sein, doch bedeutete das weder, dass er unwichtig war, noch, dass er von den intellektuellen Strömungen des späten siebzehnten und frühen achtzehnten Jahrhunderts isoliert war. Das Gegenteil war der Fall. Er war zeitlebens gut vernetzt, korrespondierte mit Freunden in ganz Europa und erreichte ein großes Publikum, indem er für die neuen französischsprachigen wissenschaftlichen Zeitschriften schrieb. Und auch er war auf das Wohlwollen von Fremden ebenso wie von Freunden angewiesen, um die in der internationalen Gelehrtengemeinschaft Hilfe und Unterstützung zu erhalten. So stellten etwa in seinem Auftrag mehrere seiner Mitbrüder Manuskripte von Plinius dem Älteren für die geplante Werkausgabe zusammen. Oder er erhielt Auszüge, Manuskripte wichtiger Aufsätze oder Kritiken, bevor diese überhaupt in Druck gingen. Und wie viele andere Mitglieder der Rèpublique des lettres war auch Hardouin durchaus in der Lage, die konfessionellen Grenzen zu ignorieren oder zu überschreiten, um einem anderen Gelehrten zu helfen. Als zum Beispiel in den Jahren 1715 und 1716 der junge protestantische Theologe Johann Jakob Wettstein46 aus Basel, in Paris an griechischen Manuskripten des Neuen Testaments arbeitete, verweigerte man ihm den Zugang zu einem sehr alten Kodex der vier Evangelien, der sich im Besitz der Gesellschaft Jesu befand. Daraufhin sprach Wettstein direkt mit Hardouin. Getreu den besten Idealen des gelehrten Weltbürgertums begegnete Hardouin dem jungen Protestanten mit großer Herzlichkeit und gewährte ihm freien Zugang zu den Schätzen der Jesuiten.47
Hardouins Biographie wies alle zeittypischen Merkmale überdurchschnittlichen Erfolgs auf. Nach seinen Studien und der Probation wurde der Jesuit Leiter des Kurses für positive Theologie am Pariser Collège Louis-le-Grand von 1683 bis 1718 und anschließend dessen Bibliothekar bis zu seinem Tod 1729. Sein philologisches Meisterstück legte er 1685 mit seiner fünfbändigen Ausgabe von Plinius’ Historia naturalis vor. Gerade mal fünf Jahre benötigte er für dieses epochale Werk, für das andere Gelehrte vermutlich die zehnfache Zeit gebraucht hätten. Hardouins Ausgabe erschien noch vierzig Jahre später in zweiter Auflage und galt im 18. Jahrhundert als Referenztext für diese Enzyklopädie.48 Doch nicht nur durch seine gewissenhafte Plinius-Ausgabe, auch als leidenschaftlicher Numismatiker galt Jean Hardouin unter seinesgleichen als einer der brillantesten Gelehrten seiner Zeit.
Zwischen 1687 und 1704 erstellte Hardouin, beauftragt von der Assemblée du clergé de France und finanziert aus der königlichen Kasse, eine Edition der Konzilsakten, die ebenfalls Maßstäbe setzt.49 Veröffentlicht wurde sie 1714-15 in der imposanten Form von elf Folianten mit einem Umfang von fast 22.000 Seiten. Dass sich die Herausgabe so stark verzögerte und diese erst nach Jahren in den Verkauf gelangte, lag an den scharfen öffentlichen Kontroversen zwischen den Konfessionen, bei denen sich Hardouin unmissverständlich auf die Seite Roms stellte. Daraufhin verbot das Parlement (Gericht) von Paris die Verbreitung des Werkes. Erst 10 Jahre später konnten die Konzilsakten veröffentlicht werden.
Als Kritiker war Hardouin ein engagierter Moderner, der sein Werk nach neusten Methoden der Philologie erstellte. Statt, wie seit Jahrhunderten üblich, Kommentar auf Kommentar zu häufen, bis der zu explizierende Text fast aus dem Blickfeld verschwand, beschnitt Hardouin rücksichtslos den überflüssigen Apparat, den frühere Herausgeber bewahrt hatten: „Es schien nutzlos“, schrieb er, „die Vorworte der Herausgeber der uns vorliegenden Räte zu drucken. Sie beschränken sich im Grunde darauf, die Räte zu loben, als ob nicht jeder wüsste, dass sie heilig sind; oder sie loben ihre eigene harte Arbeit und sorgfältige Sorgfalt, als ob nicht jeder bereitwillig zugäbe, dass er dafür höchstes Lob verdient.“50 Gleichfalls schloss er alle Dokumente aus, die nicht formell zu den Aufzeichnungen der Konzile gehören. Anstelle dieser Fremdmaterialien lieferte er eine beträchtliche Anzahl von Lesevarianten, wobei er sich manchmal auf frühere Arbeiten stützte, aber auch ausgiebig Manuskripte aus Paris verwendete, von denen er diejenigen in der eigenen Bibliothek der Jesuiten den seiner Meinung nach im Grunde ähnlichen in den Sammlungen des Königs und Colbert vorzog.51
Beinahe zahllose weitere Arbeiten auf Latein oder Französisch, ganz zu schweigen von einer Fülle bis dato unveröffentlichter Manuskripte, zeugen von Hardouins schier übermenschlicher Produktivität. Nur ein kleiner Teil seiner Arbeiten ist in einem 1709 publizierten Band von Opera selecta52 versammelt – einem Folioband von annähernd tausend Seiten, in dem, neben dogmatischen und kontroverstheologischen Studien, ausführliche chronologische sowie numismatische Abhandlungen die Bandbreite von Hardouins philologisch-antiquarischen Forschungen belegen. Mit einer lateinischsprachigen Chronik des Alten Testaments mischte er sich ebenso in die zeitgenössische Diskussion eine wie 1716 mit einer französischen Monographie zu Homers Ilias und zur Charakteristik der homerischen Götterwelt53. Postum folgen zwei weitere gewichtige Foliobände mit Opera varia54 und einem Kommentar zum Neuen Testament.55 Unzählige kleinere und umfangreichere Beiträge, nicht zuletzt in dem von ihm auch mitredigierten Hausorgan des gelehrten französischen Jesuitentums, dem Journal de Trévoux56, zeugen ebenso von außerordentlicher Belesenheit und breitgestreuten Interessen wie von einem hohen Maß an Vertrautheit mit den historischen und zeitgenössischen Themen der Gelehrtenwelt, in der er zeitlebens aufgrund seines stupenden Wissens zwar oft umstritten, aber dennoch hochgeachtet war.57„Er konnte sich mit Recht rühmen, das ‚Land des Altertums‘ in allen Richtungen bereist zu haben (Brief zur Verteidigung des Heiligen Chrysostomus). Selbst Spötter können sich einer gewissen Bewunderung für den Scharfsinn und die extreme philologische Präzision, mit denen er seine Thesen untermauert, nicht entziehen.“58
Hardouin begann zu einem Zeitpunkt zu schreiben, als der Skeptizismus in der Pariser Gelehrtengemeinschaft neue Höhen erreichte. Er beteiligte sich an einem relativ weit verbreiteten intellektuellen Unterfangen der Jahrhundertwende, nämlich dem Streben nach philosophischer und historischer Gewissheit inmitten dessen, was der französische Historiker Paul Hazard als „Krise des europäischen Geistes“ bezeichnet hat.59 Hardouin nahm die Herausforderung des Skeptizismus ernst und widmete sich sowohl der Aneignung als auch der Reaktion darauf zur Verteidigung der-Kirche – gut gerüstet mit dem damals modernsten philologischen Methodenarsenal, dass er ausgezeichnet einzusetzen wusste. Wäre dies alles gewesen, so hätten wir es mit einer vielleicht nicht einzigartigen, aber doch immerhin höchst bemerkenswerten Gelehrtenexistenz am Übergang vom 17. zum 18. Jahrhundert zu tun; mit einem Polyhistor von Staunen erregender Vielfalt der Kenntnisse und Interessen und einer über Jahrzehnte andauernden schier überbordenden Produktivität, den man mit Blick auf die Forschungsgebiete und deren methodische Erschließung in der Avantgarde der antiquarisch-philologischen Forschung der Zeit verorten muss. Es gibt jedoch noch ein paar weitere und um vieles spektakulärere Seiten in diesem „schier unermesslichen Papieroutput“.60 Denn Hardouin war ebenso berühmt wie berüchtigt, weil er Auseinandersetzungen nicht aus dem Weg ging und oft polarisierte. Er schien überhaupt kein Problem damit zu haben, seine Ansichten auch dann zu vertreten, wenn kaum jemand sie zu teilen oder vielleicht auch nur nachzuvollziehen imstande war. Ja, er war sogar stolz darauf! „Wie! Glauben Sie etwa, ich wäre mein ganzes Leben lang morgens um vier Uhr aufgestanden“, soll er entgegnet haben, als ihn ein Ordensbruder auf das ihm zugetragene Missfallen angesichts seiner spektakulären Thesen ansprach, „um nur zu sagen, was andere bereits vor mir gesagt haben?“61
Und damit war es ihm Ernst, denn glaubt man der in den Prolegomena zugespitzten Darstellung, so war es ihm gelungen, ein beispielloses Komplott aufzudecken, dass sich zwischen dem 13. und 15. Jahrhundert abgespielt haben soll: einer großangelegten Fälschung nahezu aller uns bekannten Schriften der sog. Antike, einschließlich vieler Kirchenväter. Nun war zwar der radikale Zweifel an antiken Schriften, auch denen etwa des Kirchenvaters Augustinus, durchaus noch im Rahmen der konfessionellen Auseinandersetzungen im 17. Jahrhundert62, hatte doch längst „der nicht nur theologische Streit zumal der Jesuiten gegen die sich auf eine augustinische Tradition berufenden Jansenisten gleichsam als Kollateralschaden die
Autorität des Kirchenvaters in Mitleidenschaft gezogen“.63 Was Hardouins radikalen Ansatz in den Augen der Wissenschaftshistoriker indes davon unterschied und ihm den Verdacht einer „monströsen“ Verschwörungstheorie („système Hardouin“, „l’Hardouinisme“) eintrug, waren vor allem zwei Elemente:
Erstens richteten sich seine Mutmaßungen „nicht gegen den Gebrauch, also die strittigen Rezeptionsgepflogenheiten im Umgang mit der patristischen Autorität, sondern gegen diese selbst.“64 Und zweitens reichte es ihm nicht aus, nur die Autorität des Kirchenvaters Augustinus zu demontieren. Er wollte vielmehr den Nachweis führen, „dass alle für antik gehaltenen Schriften - mit Ausnahmen der Bücher, die von der Kirche als heilig und kanonisch angesehen werden, und sechs profanen Autoren, vier lateinischen und zwei griechischen - von einer verbrecherischen Clique angefertigt und den Textzeugen, auf die sie sich beziehen, untergeschoben wurden.“65
„Diesen ‚Verdacht gegen die Überlieferung‘ kann man deshalb durchaus als – wenn auch reichlich spitzfindigen – Versuch sehen, dem Subversionspotential der philologischen Bibelkritik die Grundlage zu entziehen.“66 Hardouin versuchte „gleichermaßen, die zeitgenössischen Vertreter sowie die philosophische Symptomatik der
(Krypto-)Häresie zu entlarven67 und deren jeweiliges überlieferungsgestütztes Legitimationssystem außer Kraft zu setzen.“68
Eine solche Radikalkritik bedurfte allerdings eines tragfähigen Fundaments, um nicht Gefahr zu laufen, sich selbst dem Zweifel auszusetzen. Hier nahm Hardouin den Standpunkt der katholischen Orthodoxie ein: Der wahre Glaube gründet allein und felsenfest in der traditio viva der Kirche. Auch dann, wenn es keinen schriftlichen Kanon, keine traditio scripta gäbe, so fände sich diese lebendige Tradition in der Messe, den Sakramenten und der apostolischen Nachfolge: „superest una traditio non scripta, sed vivæ vocis“.69
In seinem 2017 erschienenen Buch über das philologisch-antiquarische Wissen im frühen 18. Jahrhundert weist Stephan Kammer allerdings darauf hin: „Mit dem geläufigen Gegensatz von ‚Schriftlichkeit‘ und ‚Mündlichkeit‘, wie er in neueren Debatten zu den Kulturtechniken der Überlieferung seine Verwendung findet, wird man diese Opposition allerdings nicht verwechseln dürfen.“70 Denn als gewissenhafter Philologe wusste Hardouin sehr wohl, dass der Skeptizismus ein zweischneidiges Schwert war, doch er verstand es meisterhaft, dieses sicher zu führen. Wie viele Historiker der damaligen Zeit versuchte er, den Herausforderungen des Skeptizismus zu begegnen, indem er sein historisches Wissen auf Quellen außerhalb des traditionellen Kanons der klassischen Texte gründete. Deshalb hielt er eine antiquarische Prüfung und Beweisführung keineswegs für überflüssig, denn auch für ihn galt die zeitgenössische skeptische Maxime, dass jegliche Überlieferung durch Handschriften oder Bücher auf Pergament oder Papier immer unter dem Verdacht der Korrumpierbarkeit stand, galt sie doch als anfällig für Fälschung, Verstümmelung und Entstellung.
Hier kommen Vergleiche mit anderen bedeutungstragenden Objekten und Artefakten wie Münzen oder Inschriften ins Spiel. „Material, Prägung und Inschriften können zum Objekt vergleichender Kritik werden. Das ist für diplomatische Dokumente strukturell so wenig möglich wie für andere Schriftstücke, die unter den Bedingungen handschriftlicher Überlieferung entstanden sind. Hardouins Anspruch, wahre Geschichte „sacrorum codicum, nummorumque, & marmorum auctoritate“ zu schreiben, bewegt sich somit spätestens an dieser Stelle voll und ganz in den Bahnen, die von den epistemologischen Grundüberzeugungen der Antiquare vorgegeben werden.“71 Natürlich wusste auch Hardouin, dass Münzen nicht immer die vollständige Geschichte abbildeten, nicht einmal chronologisch exakt, und so machte er sich daran, einen kritischen Apparat zu schaffen, der ihm helfen sollte, Gewissheit über die Texte zu erlangen. Hardouins System beruhte auf einigen wenigen festen Grundsätzen.72
Erstens, wie oben ausgeführt: Wenn Informationen in einem Text durch Originalmaterial, wie z.B. Münzen, erhärtet wurden, dann konnten sie als gültig betrachtet werden. Daraus folgte, dass Texten, die durch andere Texte, deren Legitimität bereits nachgewiesen war (im Allgemeinen durch Bezugnahme auf numismatisches Material), als gültig bestätigt wurden, ebenfalls vertraut werden konnte. Das Fehlen numismatischer oder anderer Arten von erhärtenden Beweisen für eine Textquelle ließ jedoch sofort Zweifel an der Zuverlässigkeit der fraglichen Quelle aufkommen.
Zweitens bestand er darauf, Textquellen, wie Münzen, wörtlich zu lesen. Der Forscher sollte sich einem historischen Dokument immer so nähern, wie es geschrieben worden war, und nicht mit einer metaphorischen oder allegorischen Linse. Jede Allegorie war für Hardouin ein Zeichen von Manipulation - ein Hinweis darauf, dass ein Leser die Bedeutung eines Textes geändert hat, um ihn an ein vorher festgelegtes, teleologisches Ende anzupassen.
Drittens forderte er, jeden Text zu verwerfen, der interne Inkonsistenzen oder historische Anachronismen enthält. Wie auch andere Antiquare seiner Zeit reagierte er besonders empfindlich auf sprachliche Anachronismen, und als talentierter Philologe stützte er einen Großteil seiner Kritik auf die Latinität der Autoren und darauf, ob sie dem Stil und dem Lexikon der Zeit entsprachen, aus der sie angeblich stammten. Mithilfe dieses Instrumentariums machte sich Hardouin daran, Geschichte zu schreiben, die seiner Meinung nach in ihrer Gültigkeit gesichert werden konnte.
Ein Musterbeispiel seines kritischen Ansatzes war seine Chronologia Veteris Testamenti (Chronologie des Alten Testaments, 1697). Wie viele seiner Zeitgenossen nahm er die Schöpfungsgeschichte wörtlich und versuchte sogar, mithilfe numismatischer Forschungsergebnisse und durch wörtliche Lektüre des lateinischen Textes der Vulgata die korrekte Abfolge der Ereignisse des Alten Testaments abzuleiten. Dabei stellte er fest, dass viele der Texte, auf die sich frühere Historiker bei ihren Konstruktionen der Vergangenheit gestützt hatten, seinen „Lackmus-Test der Legitimität“ (Watkins) nicht bestanden. Demnach konnte ein Text nicht plausibel sein, wenn er weder durch Belege aus dem Originalmaterial gestützt werden konnte, noch bei wörtlicher Lesung in sich konsistent blieb. Nur sehr wenige historische Texte hielten seinen strengen Kritikmaßstäben stand, und daher konnten ihre Inhalte nicht als zuverlässig angesehen werden.
Die Gründlichkeit und Kompromisslosigkeit dieses außergewöhnlichen Jesuiten rief nicht nur seine konfessionellen Gegner auf den Plan, die sich in zahlreichen z.T. sehr umfangreichen Gegenkritiken eloquent und fachlich versiert bemühten, seine Argumente zu entkräften oder ihm Fehler nachzuweisen. Da er selbstbewusst und unerschrocken war und die Teilhabe an zeitgenössischen Disputen seine Forschungstätigkeit eher noch beflügelte73, geriet Hardouin auch im eigenen Orden zwischen die Fronten. Zwar hatte man ihn lange Zeit als überragenden Gelehrten nach Kräften gefördert, doch erkannten die Oberen der Jesuitenprovinz Frankreichs die Gefahr, dass einer der ihren die Gültigkeit von Schriften in Frage stellen könnte, die weithin als authentisch und autoritativ anerkannt waren. So „degradierte“ man Hardouin 1691 vom Professor für Schrift zum Bibliothekar am Collège Louis-le-Grand, was allerdings seiner Produktivität keinen Abbruch tat.74 Er machte sich mächtige Feinde, als er z.B. selbst den katholischen Erzbischof von Cambray, Francois de Fénelon, 1697 in einem Brief der Häresie bezichtigte.75
Besonders in einer Zeit, in der die Jesuiten auch von Seiten des Staates großem Druck ausgesetzt waren, mochte man sich keinen Provokateur in den eigenen Reihen leisten. 1706 leitete Michel Le Tellier (1643-1719), der bald darauf selbst General der französischen Provinz der Gesellschaft Jesu wurde, auf Geheiß des amtierenden Generaloberen Michelangelo Tamburini (1648-1730) formelle Untersuchungen zu Hardouin und seinem System ein.76 Hardouins Werk bedrohte das intellektuelle Ansehen der Jesuiten, und so versuchten seine Vorgesetzten und nahezu ein Dutzend weiterer Mitbrüder in diversen Schriften und Briefen, ihn ins Abseits zu stellen und zum Schweigen zu bringen. Hardouin antwortete auf diesen Generalangriff, indem er 1709 seine Opera selecta (Ausgewählte Werke) veröffentlichen ließ, eine Anthologie von Schriften, die viele seiner bis dahin umstrittensten Werke enthielt. Diese Veröffentlichung zwang die Jesuitenoberen Frankreichs, eine Angelegenheit, die zuvor eine interne Disziplinarmaßnahme gewesen war, in den Bereich der öffentlichen Debatte zu verlagern. Noch im selben Jahr distanzierte sich die Gesellschaft Jesu nicht nur coram publico von seinen Ansichten, sie erklärte zudem, die Opera selecta enthalte Werke, „von denen wir wünschen, dass sie nie das Tageslicht erblickt hätten“.77 In beispielloser Offenheit schilderte die damalige Führung der Jesuiten die Bemühungen des Ordens, Hardouins Schriften zu unterdrücken und ihre Versuche, alle Exemplare seiner umstrittensten Büchern, die man finden konnte, zu beschlagnahmen. Hardouin wurde gezwungen, seine Ansichten öffentlich zu widerrufen – und auch diesen Widerruf, in dem er konstatierte, dass auch er „das, was sie [die Erklärung] verurteilt“, verurteile, fügten sie nach ihrer „Erklärung“ bei.
Die Führung der Gesellschaft Jesu sah sich in Zugzwang, denn 1707 hatte der Bibliothekar des preußischen Königs, der Benediktiner Mathurin Veyssière de La Croze eine Kritik der von ihm attestierten Verschwörungstheorie Hardouins veröffentlicht, die er als „systême le plus monstrueux & le plus chimerique que l’esprit de l’homme soit capable de produire“ bezeichnete.78 Hardouin griff ihn daraufhin scharf an, verdächtigte La Croze des Sozianismus und entgegnete, dieser habe ihm die angeblichen Belege nur untergeschoben.79 Bereits ein Jahr später ließ „der erste und akribischste Kritiker“ Hardouins (Kammer) dieser Schrift eine weit umfangreichere folgen, eine ebenso von Gelehrsamkeit sprühende wie durchtriebene Widerlegung eines „Systems“, dass es in dieser Form wahrscheinlich nie gegeben hat.80 Erstmals hier verdichtete ein Kritiker Hardouins dessen gesamte Schriften zu einem konzisen und in sich geschlossenen Wahnsystem, nach dem alles antike Schrifttum einschließlich der Kirchenväter von einer Fälscherbande unter Führung eines gewissen Severus Archontius während der Renaissancezeit fabriziert worden sei. La Croze übertrieb, vereinfachte und verkehrte Zitate ins Gegenteil. Zugleich versuchte er, das Hardouin unterstellte Verdachtsgebäude dadurch zum Einsturz zu bringen, dass er dessen Befunde seinerseits einer philologischen Kritik unterwarf und sie als haltlos denunzierte. Dabei scheute er sich nicht, sogar von Hardouin selbst entlarvte Fälschungen als das übliche Vorgehen der Jesuiten zu ‚demaskieren‘ und diesem zu unterstellen, sein ganzes Werk sei nur darauf ausgerichtet, nach den Intentionen des Ordens einen Feldzug gegen Gelehrsamkeit und Vernunft zu führen. Seine ‚Indizienkette‘ führt ihn zur Schlussfolgerung: „Dieses System wurde in einer Gesellschaft geboren, die immer auf ihre Interessen achtet, die politischste & fleißigste der Welt, in der alle Dinge auf diese Weise geregelt werden,...dass er dort keine Schritte unternimmt, die nicht seinem Zweck dienen.“ Denn die „Jesuiten lieben die Literatur nicht wirklich: sie versuchen nur, die Colleges und Universitäten zu übernehmen, um die Gelehrsamkeit und das Studium der heiligen und profanen Altertümer noch sicherer zu zerstören.“81
Im Grunde lancierte La Croze hier – übrigens sehr erfolgreich - selbst eine eigene „Verschwörungstheorie über einen Verschwörungstheoretiker“.82 Denn sein verschwörungstheoretischer Coup wollte im ‚System Hardouin‘ „genau diejenigen Strategien entlarven, mit denen sich die Jesuiten ihre eigene Version der Kirchengeschichte zurechtgebastelt haben“.83
Die Nachbeben dieser beiden Schriften sind noch bis ins 20. Jahrhundert zu spüren, denn im Laufe der Zeit wurde Hardouin immer weniger gelesen, dafür aber umso mehr als Verrückter, Paranoiker und extremer Verschwörungstheoretiker gebrandmarkt, dessen stupendes Wissen gepaart mit einem grenzenlosen Skeptizismus zu einem hermetischen Wahngebilde geführt habe, dem er selbst nicht mehr entrinnen konnte und mit dem man sich deshalb nicht beschäftigen müsse – außer als mahnendes Beispiel für eine fehlgeleitete Forschung.84
Die postume Veröffentlichung der Prolegomena hat sicher zu diesem Zerrbild des „système Hardouin“ beigetragen. 1737 wurden Hardouins Manuskripte und Aufzeichnungen, die angeblich 22.601 Seiten umfassten, von Kardinal Fleury in der königlichen Bibliothek deponiert, offenbar war der Nachlass aber nicht mehr vollständig. Denn Paul Vaillant (1715-1802) war es gelungen, noch ein weiteres Konvolut aufzutreiben. Er war ein angesehener und international tätiger Londoner Verleger, der dieses Autograph möglicherweise vom Herausgeber der Opera varia Hardouins, Thoulier d’Olivet85 gekauft hat 86 – eventuell nur als Konvolut ungeordneter Blätter, für das Thoulier d’Olivet keine rechte Verwendung hatte und das er auch nicht für veröffentlichungsreif hielt. Wann genau dies geschehen ist und warum der einer französischen Hugenottenfamilie entstammende Vaillant sie überhaupt veröffentlicht hat, immerhin 37 Jahre nach Hardouins Tod, wird sich vermutlich nicht vollständig klären lassen. Der Zeitpunkt der Veröffentlichung und ein Hinweis im Vorwort lassen allerdings vermuten, dass der Pariser Prozess gegen die Jesuiten im Jahre 1764, der die bis dahin geheimen Constitutiones des Ordens aufdeckte sowie der von Ludwig XV. geforderte Treueeid auf die Krone87 hier durchaus eine Rolle gespielt haben können.88 Fest steht nur: „Es handelt sich um eine Nachlasspublikation, deren genauer Textstatus und Kontext nur durch archivalische Detektivarbeit zu klären wäre, da eine umfassende Darstellung zu Hardouin oder zum ‚System Hardouin‘ nicht vorliegt. Ersichtlich aber ist bereits aus dem Titel, dass es sich bei den mit Sicherheit nicht von gelehrten Gefolgsleuten des Jesuiten publizierten Aufzeichnungen nicht um einen monographisch strukturierten Text handelt; der Band versammelt in loser Form thematisch gruppierte Einzelnotate.“89
Vaillant verpflichtete jedenfalls 1765 den Drucker William Bowyer und rang ihm zugleich noch ein lateinisches Vorwort mit einer kritischen Würdigung Hardouins ab. Da Bowyer sich anscheinend damit überfordert sah, wandte er sich seinerseits an ein eher randständiges, aber durchaus geachtetes Mitglied der Gelehrtenrepublik, den Londoner Theologen und Sammler seltener Manuskripte, César de Missy90, der daraufhin einen Probedruck des Manuskriptes durchsah und mit dem Original abglich. Er machte Bowyer auf Transkriptionsfehler und andere Ungenauigkeiten im Druck aufmerksam, die dieser für die Veröffentlichung noch änderte, und auf eine Reihe handschriftlicher Zusätze (und weniger Streichungen), von denen er manche ausführlich kommentierte. Diese Zusätze wurde von Bowyer nach seiner Einleitung als „Additamenta“ auf den Seiten XI-XVIII für den Druck übernommen, aber nicht direkt in den Text eingefügt. In einem ausführlichen Brief machte de Missy seinen Freund Bowyer zudem mit dem Hardouinschen Werks und den Grundzügen der zeitgenössischen Auseinandersetzung mit Hardouins Schriften vertraut, wobei er diesen ausdrücklich nicht in Bausch und Bogen verdammte, aber die Argumente von Hardouins Gegnern ausführlich darstellte. Dabei hätte sich die Veröffentlichung einer solchen Trophäe geradezu als Steilvorlage für einen frühneuzeitlichen Protestanten angeboten, um die katholische Kirche und noch mehr die Jesuiten für ihre Extravaganzen zu verspotten.92 Auch Bowyer belässt es, hier de Missy folgend, eher bei dem wenn auch ob der Ironie vergifteten Lob, die Prolegomena seien „delightful for their novelty“, bewenden.
Erste Seite des Autographs der Prolegomena in Hardouins gestochener Handschrift 91
Es war de Missy, der vorgeschlagen hatte, den Buchtitel der Veröffentlichung mit dem Zusatz zu versehen: „Juxta Autographum“ („nach der eigenhändigen Niederschrift des Verfassers“).93 So ganz wohl war ihm bei der Sache nicht, weil er nicht sicher war, mit welcher Art Handschrift er es zu tun hatte. Eine mehrfach durchgestrichene Notiz auf der rechten oberen Ecke der ersten Manuskriptseite rekonstruierte er als „Autographi | sive primi- | genii exem- | plaris paginae“. Er schloss daraus, dass es sich bei dieser und den Folgeseiten um die Abschrift eines (nicht mehr vorhandenen?) Autographs gehandelt haben könnte. Denn ihm war aufgefallen, dass es außer der Paginierung rechts oben noch eine zweite Paginierung am äußeren Rand des Textes gab, die mit der ersteren nicht identisch war. So wären dann aus ursprünglich wohl 97 Seiten in der vorliegenden Handschrift 92 geworden. Es hätte also möglich sein können, dass ein Teil fehlt. Oder die Seiten waren einfach nur platzsparender beschrieben worden. Zumindest warf diese Differenz in der Paginierung Fragen auf. Da er aber nun einmal versprochen habe, Bowyer bei der Vorbereitung des Drucks zu unterstützen, wollte er der Veröffentlichung nicht im Wege stehen.
Weniger bekannt ist, dass Vaillant fast zeitgleich mit den Prolegomena 1766 diesen Brief de Missys und sämtliche seiner Anmerkungen zu den Prolegomena ebenfalls von William Bowyer drucken ließ und veröffentlichte. Der seit 2018 als Faksimile-Nachdruck wieder verfügbare Quartband von 123 Seiten bot dem interessierten Leser eine Kurzfassung der polemischen Kritik La Crozes, mit dem de Missy in früheren Jahren persönlich bekannt gewesen war, sowie eine vollständige und kommentierte Liste der Additamenta, die Bowyer abgedruckt hat94. Allerdings verlor sich de Missy bei seinen zum Teil sehr ausführlichen und kenntnisreichen Kommentaren manchmal in Details von hebräischen und griechischen Sprachvarianten. Da er Hardouins Schriften nicht nur vermittelt über dessen Gegner kannte, sondern, wie aus anderen seiner eigenen Arbeiten bekannt, auch selbst gelesen hatte, referierte er zwar weitgehend das Für und Wider zu Hardouins Werk, mochte sich aber einer Verurteilung Hardouins nicht so recht anschließen, wenn es dessen „größtes Verbrechen“ gewesen sei, dass dieser sich in ein Hirngespinst verrannt habe.95 Im Grunde sah der überaus penible Philologe de Missy in Hardouin einen ernst zu nehmenden Forscher und – mehr noch! – einen verwandten Geist, so dass er dessen Werk nicht verurteilen mochte. Stattdessen demonstrierte er augenzwinkernd Bowyer auf nicht weniger als 36 Druckseiten seiner Epistola Hardouins methodischen Ansatz, indem er mit wohlgesetzten Argumenten den antiken Komödiendichter Titus Maccius Plautus (ca. 254-184 v. Chr.) einschließlich seiner Theaterstücke als mittelalterliche Erfindung aus einem auf Fälschungen spezialisierten italienischen Kloster ‚entlarvte‘.96





























