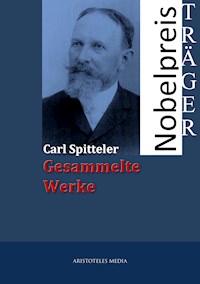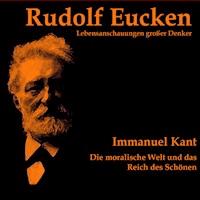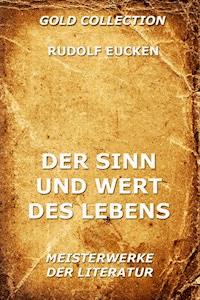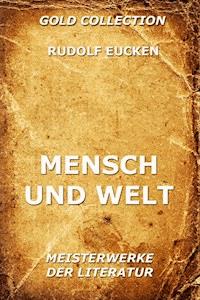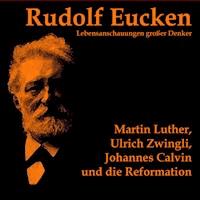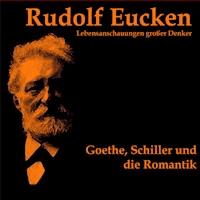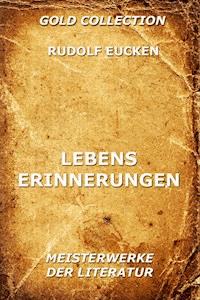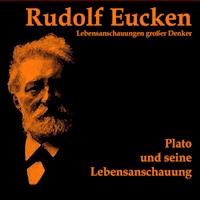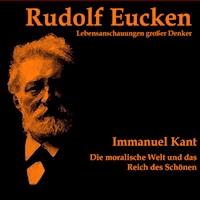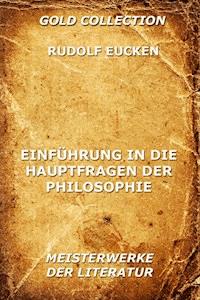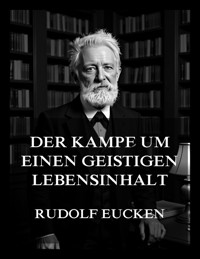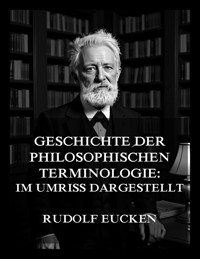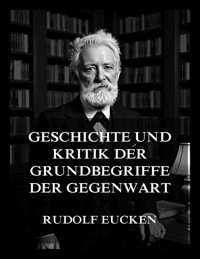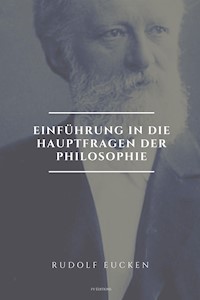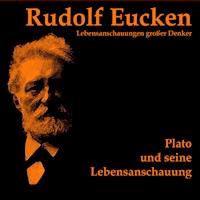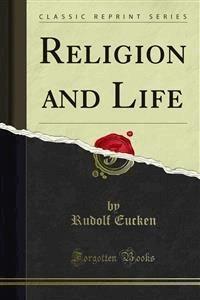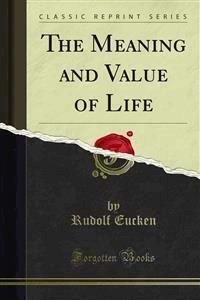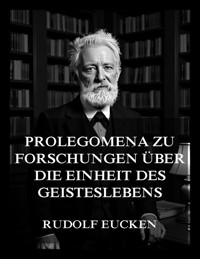
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Ein einheitlicher Zusammenhang des Lebens und mit ihm eine ausgeprägte Gestalt aller besonderen Aufgaben, woran gerade bei der gegenwärtigen Zersplitterung der Kultur so viel liegt, läßt sich nicht durch Reflexion gewinnen; er muss in der Natur des Geistes angelegt und aus derselben auch in geschichtlicher Entwicklung genügend bezeugt sein, damit ihn das Denken weiter führen und in einen Begriff fassen könne. Ohne eine enge Berührung mit dem, was in der geschichtlichen Lebensentfaltung der Menschheit tatsächlich vorliegt, wird die Philosophie niemals von bloßen Möglichkeiten zu einer Notwendigkeit fortschreiten können. Auch in der Neuzeit fehlt es nicht an einheitlichen Zusammenhängen, aber dieselben geraten unter sich in Widerspruch, und sie genügen weder einzeln noch zusammen den Kräften, welche die geschichtliche Bewegung tatsächlich erweckt hat, den Aufgaben, welche sie eben jetzt stellt. Der Verfasser hat sich das Ziel gesetzt, einen weiteren Zusammenhang aus den scheinbar zerstreuten Daten herauszuarbeiten und damit eine neue Behandlung der Hauptfragen des Denkens und des Lebens zu gewinnen. Die Methode seiner Forschungen ist in den "Prolegomena", das Resultat derselben in dem größeren Werk "Die Einheit u. s. w." niedergelegt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 192
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Prolegomena zu Forschungen über die Einheit des Geisteslebens
RUDOLF EUCKEN
Prolegomena zu Forschungen über die Einheit des Geisteslebens, Rudolf Eucken
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN: 9783988682482
Quelle: https://www.google.de/books/edition/Prolegomena_zu_Forschungen_%C3%BCber_die_Ein/4vpUAAAAMAAJ?hl=de&gbpv=1&dq=Prolegomena+zu+Forschungen+%C3%BCber+die+Einheit+des+Geisteslebens&printsec=frontcover, Verlag Veit & Comp., Leipzig, 1885.
www.jazzybee-verlag.de
INHALT:
Vorwort.1
I. Bezeichnung des Vorhabens.3
II. Rechtfertigung des Problems aus der Zeitlage.7
III. Entwicklung des Problems.22
IV. Darlegung des eigenen Verfahrens.41
V. Erwägungen und Aussichten.90
Vorwort.
Die vorliegende Untersuchung bildete ihrer Anlage nach einen einleitenden, vornehmlich methodologischen Abschnitt eines umfassenden Werkes, als Teil dieses Ganzen sollte sie erscheinen. Später aber hielten wir es für jenes Werk wie für die behandelten Probleme nützlicher, diesen Teil für sich voranzuschicken. Für das Werk, weil eine solche Orientierung den Zugang erleichtern, vielleicht auch sonst versagtes Interesse gewinnen könnte. Für die Probleme, weil eine selbständige Behandlung der methodologischen Fragen dieselben klarer heraustreten lässt und ihre leitenden Gedanken nicht zu eng mit der Besonderheit unserer Ausführung verflicht.
Aber wo sich ein Teil wie ein Ganzes gibt, sind Verwicklungen unvermeidlich. Die Erörterung muss hier durchgängig mehr behaupten als sie erweisen kann, gerade an den Wendepunkten hat sie auf die kommende Untersuchung zu vertrösten. Auch die Darstellung mag Mühe haben, zwischen dem zu viel und zu wenig die rechte Mitte zu finden. So wenig solche Missstände zu beschönigen sind, die Vorteile gesonderter Betrachtung schienen sie nicht zu überwiegen. Bei allem, was in Ausstand bleibt, ist ein gewisser Zusammenhang auch der Vorbereitung nicht ausgeschlossen. Der Entwurf muss auf die Ausführung rechnen, aber er braucht darum für sich nicht bloßes Bruchstück zu sein.
So viel zur Ökonomie, nun einiges zum Inhalt. Wir versuchen eigene Wege zu gehen; in den Schein eigensinniger Absonderung mögen wir umso eher geraten, als wir nicht selten Kunstausdrücke eigentümlich bestimmen, ja neu bilden. Aber dass Ziele und Richtungen, wo nicht dem Streben, so doch dem Bedarf der Zeit entsprechen, suchen wir an geeigneter Stelle darzutun; in der Ausführung einen eigenen Pfad zu gehen, das ist unerlässlich in einer Zeit, wo die Auflösung aller Systeme keine gemeinsame Heeresstraße gelassen hat. Die Wahl eigener Ausdrücke aber begründet sich durch die große Verschliffenheit der umlaufenden Termini; wenn überhaupt noch einen gemeinsamen, so geben sie keinesfalls einen präzisen Sinn. Misslich wie das Aufstellen neuer Bezeichnungen ist, es ist besser einige Mühe an Klarheit zu verwenden, als sich ohne Mühe der Unklarheit zu ergeben.
Der Sachverhalt endlich muss sich nach Kräften selber wehren. Wer neues sucht und nicht im Zuge der Zeitoberfläche sucht, wird unmittelbar weit eher Widerspruch als Zustimmung erwarten. Aber darum mag er doch der Aufnahme seines Strebens gewisse Vorteile wünschen. Er mag wünschen Unbefangenheit der Stimmung, dass nicht alles, was fremd, von vorn herein als feindlich gelte; wünschen eine Würdigung aus dem Zusammenhang des Ganzen, dass nicht ein Hängen an sicherlich anzutreffenden Fehlern und Lücken im Einzelnen ein Gesamtbild gar nicht aufkommen lasse; wünschen endlich das Vertrauen, dass nicht da, wo die Darstellung abbricht, auch das Denken abbrach, dass im besonderen Einwendungen, die jedem bei erstem Befassen kommen, auch dem, der länger bei der Sache verweilte, nicht unerwogen geblieben sind. Mag das alles mehr Sache der Billigkeit als der Gunst sein, auf philosophischem Gebiet ist es selten und schwer genug, um als Gunst geschätzt zu werden.
I. Bezeichnung des Vorhabens.
Der Gegenstand unserer Untersuchung teilt mit manchen philosophischen Aufgaben das Geschick, sich die Geltung eines echten Problems erst erstreiten zu müssen. Was uns beschäftigt, die Einheit des Geisteslebens, erscheint leicht der flüchtigen Ansicht zu selbstverständlich, um ernste Arbeit zu fordern, ausharrendem Nachdenken aber zu verworren, um ernste Arbeit zu lohnen. Dass in Wahrheit ein Problem vorliege, welches zugleich notwendig und möglich, das hat die Wissenschaft erst zu erhärten. Sicher erhärten aber kann sie das nur durch das Ganze der Leistung; zu Beginn mag sie ihr Recht nicht sowohl erweisen als behaupten, ihre Aufgabe mehr in Begriffen abgrenzen als durch die Tat versichern.
Auf die Einheit des Geisteslebens geht unser Anliegen. Das Recht, ja der Zwang, sich darum irgend zu kümmern, begründet sich unweigerlich in der Natur eines bewussttätigen Wesens. Unzählige Erscheinungen treffen innerhalb des Bewusstseins zusammen und verweben sich in mannigfache Beziehungen; wollte der denkende Mensch sich mit der Vielheit begnügen, der handelnde müsste auf Einheit bestehen. Denn sofern er nicht blindem Trieb, sondern klarer Überlegung folgt, muss er vergleichen und wählen, verwerfen und entscheiden, dabei aber drängt sich ihm die ganze Mannigfaltigkeit des Lebens auf einen Punkt zusammen, die Güter und Aufgaben müssen sich gegeneinander abstufen, ein letzter Zweck, eine allumfassende Wertschätzung sich anbahnen. Irgendwelche Einheit des Zieles muss der Mensch ergreifen, will er nicht als Spiel wechselnder Antriebe bald hierher bald dorthin geworfen werden. Und Einheit bleibt Einheit, auch wenn sie versteckt, wenn sie nicht aus verschleiertem Tatverhalte zu lichtem Begriff gehoben ist.
Aber in solche Lösung des praktischen Lebens fließt alle Zufälligkeit jeweiliger Zeit und Lebenslage ein. Je nach vorkommenden Umständen verlegt wechselndes Erfordernis der Umgebung, schwankende Neigung des Innern, bald auch ein Gemenge beider den Zielpunkt bald hierher bald dorthin. Was der Einzelne jetzt innehat, das befriedigt ihn nicht für die Folge, und was ihn bleibend einnähme, hätte keine Gewähr, den andern und dem Ganzen gleiches zu bedeuten. Soll das Problem als gemeinsames behandelt werden, so ist es über Lust und Lage der Einzelnen hinauszuheben. Das aber kann schwerlich anders geschehen, als indem sich das Geistesleben von der individuellen Art des Erfassens und Erfahrens emanzipiert und mit seinem Gehalt selbständig auf den Plan tritt. Damit gewinnt unser Problem den Sinn, ob der Umkreis des Geschehens seinen Gehalt zu einem Ganzen, zu einem einzigen Gesamtgeschehen zusammennehme, ob eine durchgehende Kraft die Fülle der Erscheinungen beseele, ob wir irgend geistiges Wirken in seine Gründe verfolgen können, ohne uns auf eine tragende und belebende Einheit gewiesen zu sehen. Gibt es einen einheitlichen Charakter des Geisteslebens und bezeugt sich dieser in fortwährender Tat?
In fortwährender Tat, das vermerken wir, um unser Ziel von einem scheinbar verwandten deutlich abzugrenzen. Auch bloße Überlegung kann die Lebenserscheinungen zu irgendwelchem Zusammenhange verknüpfen; überschwer ist es nicht, die ganze Mannigfaltigkeit derselben um einen Punkt zu gruppieren, sie mittelst einer Formel so zurechtzulegen, dass sie leidlich wie ein Ganzes aussehen. Aber Aussehen ist nicht Wirklichkeit. Die Einheit, welche derart von dem draußenstehenden Beobachter den Dingen angetragen und aufgeklebt würde, möchte kaum den Sachverhalt ändern, neue Einsichten und Aufgaben erschließen. Solcher Einigung durch bloße Reflexion setzen wir die Einigung durch die Tat entgegen, als das worauf es uns ankommt. Was wir fragen ist dieses, ob der Fülle der Erscheinungen eine umfassende Einheit innewohne, ob vom Grunde her ein Gesamtgeschehen ausgeprägter Art wirke, ob dasselbe alles einzelne trage, treibe und einer Gemeinsamkeit des Sinnes zuführe. Um eine derartige natürliche Einigung von einer ersonnenen Verknüpfung abzuheben, wollen wir sie mit einer besonderen Bezeichnung versehen. Wir wählen dafür den Ausdruck Inbegriff und sprechen also von einem Inbegriff des Geisteslebens, um einen sowohl über das Befinden der Individuen als über reflektierende Betrachtung hinausgehenden natürlichen Zusammenhalt des Geschehens zu fixieren. Ob dieser Begriff zu Recht bestehe, das haben die Tatsachen zu entscheiden; mit bloß möglichen Begriffen versuchsweise vorzugehen, ist ein anerkanntes Recht wissenschaftlicher Forschung.
Die Bedeutung des Problems leidet keinen Zweifel. Ob ein Inbegriff des Geisteslebens vorhanden sei und wie er sich herausstelle, –– beides wird sich in Einem entscheiden ––, die Frage greift zu tief in Erkennen und Leben ein, als dass man sie nicht mit aller Energie. verfolgen sollte. Würden wir uns über prinzipielle Stellung und Schätzung des geistigen Seins je einigen, woher eher sollte es erfolgen als vom Inbegriff des Geschehens. An dem Gehalt solchen Inbegriffs hängt z. B. die Frage, ob sich das Geistesleben gegenüber der Natur als ein selbständiges oder gar überlegenes behaupten kann, ob sich das Leben von einer animalen, sinnlich gebundenen Stufe zu einer mentalen, innergeistigen erhebt. Denn wie Geist und Natur zueinanderstehen, das entscheiden weder direkte Beobachtungen, mögen sie sich bis ins Endlose häufen, noch Erörterungen über die Allgemeinbegriffe von Stoff und Geist, von Körper und Seele, von welchen sich der Streit über Monismus und Dualismus, Materialismus und Spiritualismus zu nähren pflegt, jener Streit, der wie ein ermüdendes Glockengeläute die wissenschaftliche Arbeit zu begleiten nicht aufhören will. Vielmehr gab den Ausschlag stets die Überzeugung von dem, was im Ganzen der Geisteswelt in Leben und Tat geschieht. Epikur und Lamettrie rissen Individuen und Zeit fort, nicht weil ihre Gründe an sich unwiderstehlich waren, sondern ihre Gründe waren unwiderstehlich, weil in ihnen der Geistesgehalt seinen gedanklichen Ausdruck fand, der Leben und Gesichtskreis jener Menschen und Epochen erfüllte.
Aber auch alle Ansicht der besonderen Gebiete müsste sich vom Inbegriff her erheblich umgestalten. Denn wenn alles besondere Tun im Grunde sich einem Gesamtprozess gliedmäßig einfügte, so würde ein jedes vom Ganzen her eine durchgreifende Determination erhalten, es würde ohne diese Determination eine Beschaffenheit tragen, die vom Inbegriff her unvollendet, ja leer erscheinen müsste. Wo ein Gesamtleben waltet, da müsste sich im Einzelnen das Ganze bekunden, dasselbe richten, begrenzen, erfüllen, da müsste es z. B. wunderlich vorkommen, der Kunst nachzugehen, ohne Aufklärung über ihre Stellung im Lebenswerk zu verlangen, verwunderlich auch, für Macht und Recht der Staatsidee zu streiten, ohne die Aufgabe des Staates in dem System der Zwecke zu ergründen. Existierte also ein allgestaltender Inbegriff, so müsste alle besondere Tätigkeit von dem ersten Befund auf eine höhere Stufe gehoben werden, ein charakterleeres Dasein müsste Punkt für Punkt zu einem charaktervollen aufstreben.
Was sich dabei aber im Ganzen und Einzelnen an Gewinn ergibt, das ist nicht bloß dem Erkennen, sondern dem Leben gewonnen,Sollte die Forschung dem Menschen ein Gesamtbild seines Wesens bringen, das er wenn nicht als Abbild so als Urbild seines Wesens anerkennen muss, sollte sie es ihm zu anschaulicher Gegenwart nähern, ohne dadurch mächtigen Einfluss auf den Lebenslauf selber zu üben? Worauf anders beruht denn alle Hoffnung geistigen Fortschreitens als darauf, dass, was zum ideellen Bestande menschlicher Natur gehört, was aber als gebundene Kraft zunächst schlummert, in Verwirklichung tritt, sobald es uns anschaulich, überzeugend, bewältigend vorgehalten wird. Was sonst Erziehung und Bildung an Wegen ersinnen mag, es wird unnütz, ja irreleitend, will es anderes sein als Mittel, uns an jenen springenden Punkt selbständiger Ergreifung zu führen. Schwerlich aber könnte vorgreifendes Denken solche Aneignung irgendwo kräftiger hervortreiben, als bei dem Problem des Inbegriffs, bei der Ergründung eines Gesamtbildes, das aus der Tiefe menschlichen Wesens alle Mannigfaltigkeit des Daseins umfassen möchte.
So eröffnen sich weite Aussichten. Aber der Antrieb zur Frage ist nicht schon eine Gewähr bejahender Antwort. Jene Aussichten könnten wie trügende Vorspieglungen wirken, wenn sie vergessen machten, dass wir uns zunächst nur auf dem Gebiet von Möglichkeiten bewegen. Was die Sache empfiehlt, empfiehlt nur unter Voraussetzung ihrer Wirklichkeit; diese Wirklichkeit aber will als eine Tatsache nicht durch allgemeine Erwägungen nahegelegt, sondern direkt erwiesen sein, als allumfassende innere Tatsache aber kann sie nicht mit dem Finger aufgezeigt, sondern muss durch Denkarbeit, voraussichtlich verwickelte Denkarbeit ermittelt werden.
Aber ist es nicht misslich, eine weitaussehende Untersuchung ohne irgendwelche Gewissheit des Erfolges aufzunehmen?
Es wäre misslich und unratsam, wenn die Sache zu denen gehörte, die wir tun und auch lassen könnten. Aber zu denen gehört sie eben nicht, sondern zu den anderen, denen sich der Mensch auf einer gewissen Entwicklungshöhe schlechterdings nicht entziehen kann. Wen die Verwandlung traumhafter in wache Lebensführung zu denkender Überlegung alles Erfahrenen geführt hat, der kann nicht bloß, er muss das Problem einer inneren Einheit des geistigen Daseins aufnehmen, er muss es zu Ende verfolgen, unbekümmert um die Gefahr einer verneinenden Antwort. Wie alle Fragen, die unserem Leben eine durchgreifende Umwälzung ansagen, nicht erst aus der Erwägung wahrscheinlichen Erfolges ihre Triebkraft schöpfen, so ist auch in unserem Fall der beste Ratgeber die Notwendigkeit.
II. Rechtfertigung des Problems aus der Zeitlage.
Ein anderes ist das Dasein eines Problems, ein anderes seine Anerkennung. Eine Frage mag von jeher den Menschen angehen; damit er sie beachte, achte und dem Mittelpunkt seiner Arbeit verknüpfe, müssen sich oft besondere, nicht eben einfache Bedingungen erfüllen. So auch bei unserem Gegenstande. - Einem Inbegriff des Geisteslebens nachzuforschen liegt der Wissenschaft minder ob in Zeiten, wo bei einfacherer geschichtlicher Lage eine reiche geistige Natur in ihrem eigenen Bestande gewisse Ziele allumfassender Art angelegt findet, wie das im klassischen Altertum der Fall war. Die Spannung wächst, wenn zunehmende Verwicklung andersartige, ja einander widerstehende Gedankenwelten auf einen Boden zusammenführt; dass aber das bloße Dasein von Gegensätzen und harten Gegensätzen noch keine Unruhe und Bewegung zu wecken braucht, das zeigt das Mittelalter. Steigen aber Gegensätze, deren Widerstreit sich weder vergleichen noch entscheiden lässt, ins Bewusstsein, reizt und treibt das eine das andere bis zum Kampf ums Dasein, so ist die Zeit unbefangener Zusammenfügung unwiederbringlich vorbei. Soll nun nicht auf Ganzheit des Lebens verzichtet werden, so ist sie durch eigenes Mühen zu erringen; bei diesem Kampfe aber wird die Wissenschaft naturgemäß in die erste Linie treten. Das ist ohne Zweifel die Lage der Neuzeit.
Einen raschen Überblick der ihre Arbeit durchwirkenden Gegensätze kann unsere Untersuchung nicht ablehnen. So wenig Entzweiung und Verwirrung in den Meinungen und Interessen der Individuen sie berührt: was das Handeln der Menschheit spaltet und die eine Seite wider die andere ins Feld ruft, das darf sie nicht gleichgültig lassen. Denn dem Versuch eines Inbegriffs wird jedes Stück derartiger Gegensätze ein Einwand und ein Problem; die Gegensätze zusammenfassen aber heißt einen Umriss der Lage entwerfen, deren Widerstand die Lebenseinheit zu überwinden hat.
Es scheinen uns nämlich die Gegensätze dem Wirken der Neuzeit nicht hier und da anzuhängen, sondern es völlig zu durchwachsen. Mögen wir das Vermögen des Handelnden gegenüber der Lebensaufgabe, mögen wir Zielrichtung und Verlauf des Handelns, mögen wir endlich sein Ergebnis für die menschliche Persönlichkeit betrachten, mögen wir also Anfang, Mitte oder Ende erwägen, überall begegnet uns hartes Zerwürfnis.
Die Frage nach dem Können des Menschen lässt sich zwiefach verstehen. Was gegebenes Wollen für gegebene Ziele aufzubieten vermag, das gehört auf eine Seite, wieweit es beim Menschen, d. h. in der freien Entscheidung des Menschen steht, Ziel und Willen von sich her zu bestimmen, auf die andere. Dort wird ermessen ein Geschehen zwischen festen Punkten, hier die Beschaffenheit der Punkte selbst; dort ließe sich bei freierer Verwendung gebräuchlicher Ausdrücke von einer technischen, hier von einer ethischen Seite des Lebens reden.
Nun ist es wohl keine Übertreibung, zu behaupten, dass Bewusstsein und Tat der Neuzeit das technische Vermögen ebenso hebt wie das ethische herabsetzt.
Natur und Lebenslage bewusstem Gedanken zu unterwerfen, durch Befreiung hilfreicher Kräfte und Ersinnen dienlicher Mittel die Machtgrenze der Menschheit ins All stetig vorzurücken, das ist unbestrittene Stärke der Neuzeit. Die augenfällige Beherrschung der Natur darf nicht vergessen machen, dass auch über sich selbst und die eigene Lage die Menschheit in erhöhter Weise verfügt und waltet. Sie tut das vornehmlich durch den modernen Staat, der die sonst zerstreuten Anlagen der Einzelnen gewaltig konzentriert und durch Gliederung der Sonderkräfte die Macht des Ganzen unermesslich steigert, der immer weitere Gebiete zwecktätigem Wollen unterwirft und den Menschengeist Probleme anzugreifen ermutigt, die vordem schlechterdings unzugänglich waren. So ist in Natur und Menschenleben tatsächlich eine Überfülle starrer Massen bewegt, ungefüger Widerstände gebrochen. Wohl ist das Vermögen nicht ohne Schranke, aber die besondere Schranke hat es nur jetzt, nur diesen Augenblick. Der Augenblick ist aber nur ein Punkt fortlaufender Entwicklung, und die Entwicklung hat keine Grenze. In stilltätiger Sammlung geht rastlos die Arbeit weiter und entringt aufsteigend zum Größten und eindringend ins Kleinste blinder Naturgewalt und träger Lebensschleppung fortwährend Boden. Wenn vieles, was gestern unangreifbar schien, heute leicht bewältigt wird, und wenn jeder Erfolg mit Erhöhung der Kraft neue Erfolge verheißt, warum irgendwelche Aussicht endgültig verhängen, warum die Grenze jetziger Lage für eine Schranke der Natur ausgeben?
Was aber in diesem Prozess gewonnen, das scheint freier Verfügung gewonnen. Es steht beim Menschen, die erworbenen Machtmittel zu verwenden und nicht zu verwenden, innerhalb seines Lebenskreises sie hierher oder dorthin zu richten. Sein Denken schaltet soweit frei mit den Dingen; in männlichem Kraftbewusstsein nimmt es den Kampf mit den Weltmächten auf. Was der Mensch dienend erwarb, Erkennen der Gesetze, macht ihn zum Herrn des Alls. So dünkt das Wachstum der Macht zugleich ein Wachstum der Freiheit.
Ein anderes Bild zeigt die Seite der Ethik. Der vorwaltenden Überzeugung ist der Mensch in Bestand und Entwicklung seines Inneren Teil, verschwindender Teil, eines unübersehbaren Naturzusammenhanges, ein Stift der großen Weltmaschine, in Wesen, Wollen und Wirken durch die Summe von Voraussetzungen und Umgebungen vollständig bedingt. Aus den Verkettungen des Alls wird er und lebt er, will er und denkt er. Wenn die seelische Beschaffenheit, aus der alle gemeinsam und jeder für sich den Lebensprozess führen, ebenso von Natur gegeben ist, wie die Richtung des Strebens, so bleibt eigener Initiative und freiem Gestalten kein Spielraum. Es ist nicht sowohl ein eigenes als ein zugewiesenes Dasein, das der Mensch führt. Denn unser ist es ja nur in dem Sinne, dass das Bewusstsein durch unabweisbare Notwendigkeit gehalten ist, einen Ausschnitt des Alllebens mit Empfindung zu begleiten, eine übertragene Rolle wie eigenes Wirken zu geben. Ob uns diese Rolle zusagt oder nicht, ob Überlegung und Urteil ihren Inhalt billigen oder missbilligen, das greift nicht in das Geschehen, das unablenkbar seine Bahn weiterverfolgt.
Die hier angelegten Konflikte möchten freilich nicht zu voller Herbigkeit ausbrechen, wenn uns der Inhalt des Weltprozesses als vernunfterfüllt gesichert wäre. Aber das eben ist nicht der Fall. Die Wissenschaft scheint weit genug zu reichen, uns die allumschließende Notwendigkeit des Ganzen zu zeigen, aber nicht so weit, uns eines geistigen Sinnes derselben zu versichern. Es ist eine dunkle, unzugängliche Macht, die unser Geschick trägt, eine Macht, die unserem Innern allezeit fern und fremd bleibt, wenn anders das Welträtsel sein Geheimnis wahrt. Damit aber gerät alle prinzipielle Überzeugung ins Ungewisse. Ob das Handeln der Verwirklichung irgendeines Zieles, eines wertvollen Zieles dient, oder ob wir zwecklos einher treiben, das bleibt endgültig auf zweifelnde Erwägung gestellt. Nicht nur einer Notwendigkeit, einer verschlossenen und versiegelten Notwendigkeit bliebe das menschliche Dasein unterworfen.
In solche Lage als eine Schranke seiner Natur sich zu finden und technische Leistung als Vollersatz ethischer Selbständigkeit zu erachten, vermöchte der Mensch nur, wenn er des Gedankens an einen letzten Zweck völlig entraten und sich in die der Betätigung anhangende Krafterweisung vergessen könnte, wenn er zu leben vermöchte, bloß um sein Leben zu führen. Das aber kann er nicht, und weil er es nicht kann, so führt die Differenz zwischen technischem und ethischem Handeln zu einem schweren Zusammenstoß.
Er kann es aber nicht, weil die Erhebung von instinktiver zu denkender Lebensführung nicht möglich ist, ohne dass sich das Tun unter die Herrschaft von Zwecken stellt; Einzelzwecke aber drängen mit Notwendigkeit zu umfassenden Zielen, die gesamte Zwecktätigkeit zur Idee eines höchsten Gutes. Abschließendes Gut aber wird auch der äußerste Ertrag der Technik nie sein, denn die Macht über die Dinge, welche sie ergab, ist doch eben ein bloßes Vermögen, das seine Richtung erst von anderweit aufzubringendem Ziel erwartet, und dessen Wert für unser Wohlergehen sich letzthin an dem Wert dessen misst, dem es dient.
Bleibt also dieses letzte unzugänglich, so wird auch das andere nach seinem Verhalten zu unserem Glück in die Erschütterung hineingezogen.
Das Technische, als Teil zwecktätigen Lebens, hat selber eine ethische Seite und muss deswegen die letzten Probleme teilen. Als harter Missstand muss nunmehr empfunden werden, dass der Mensch über reichste Mittel verfügt, gewaltigste Kräfte bewegen mag, und nicht sagen kann, wofür, nicht weiß, ob zu eigenem Glücke; dass er, nach außen hin Quell emsigsten Schaffens, ohne allen Einfluss auf das bleibt, was in ihm lebt und schafft. Sofern er also Technisches und Ethisches in Ein Bewusstsein begreift, muss er einen Widerspruch daran erleben, dort so viel und hier so wenig zu vermögen, sich dort als freischaltenden Herrn, hier aber als willenlosen Diener zu finden.
Die nähere Beschaffenheit von Ziel und Verlauf des Tuns kam bisher nicht in Frage. Einiger Aufmerksamkeit würde sich auch hier bald ein Widerspruch kundgeben, der Widerspruch, dass theoretisches und praktisches Schaffen nicht nur auseinander, sondern bis zum Kampf gegeneinander gehen, Wissen und Handeln andere Bahnen verfolgen. Die moderne Wissenschaft, voran die Naturwissenschaft, hat Eigenart und Stärke darin, die Welt der Erfahrung, die sie als ihren einzigen Vorwurf achtet, auf kleinste Kräfte zurückzuführen und die gegebene verwickelte Lage aus diesen kleinsten Kräften zu begreifen. Die Wirklichkeit geht ihr auf in die Gesamtheit dessen, was direkt oder indirekt dem unmittelbaren Eindruck gegenwärtigt werden kann. Deshalb braucht sie sich nicht dem ersten Eindruck zu unterwerfen, aber wenn sie denselben überschreitet, die Kausalverkettung mit dem Ausgang gibt sie ebenso wenig auf, wie die Forderung, dass auch das Endergebnis dahin zurückkehre, dass es sich irgendwie sinnlich darstelle. Sie schließt ein geistiges Sein nicht aus, lässt es vielmehr in der geschichtlichen Wirklichkeit eine der Natur fast ebenbürtige Weltgestaltung gewinnen, aber über die unmittelbar zugängliche Existenz erhebt sie es nicht und will es daher keineswegs von der Verknüpfung mit dem Sinnlichen und Sichtbaren ablösen. So wenig dieser wissenschaftliche Begriff von der Wirklichkeit als einem Sinnesgeistigen mit dem rohsinnlichen Weltbild des Materialismus zusammenfällt, eine Selbständigkeit des Geistes, eine sich aus dem Naturprozess heraushebende geistige Welt hat hier keine Stätte.
Dieser Wirklichkeit gegenüber erkennt die Forschung ihre eigene Aufgabe darin, das erste Bild verworrener und abgeleiteter Eindrücke in ein System lebendiger Kräfte umzusetzen; solche Kräfte aber sucht sie allein in dem Elementaren, Kleinsten, Verschwindenden. Auflösung der Gegebenheit in derartige Elemente, Ermittlung der Elementargesetze, Aufbau des vorliegenden Weltstandes mittelst allmählicher Zusammenfügung der Kleinkräfte, das sind die Hauptstufen ihres Verfahrens. Ein Ganzes im Sinne innerer Zusammengehörigkeit (unitas essentiae) erlaubt sie ebenso wenig, wie ein Allgemeines in anderer Bedeutung, als des einer größeren oder geringeren Anzahl von Erscheinungen Gemeinsamen, eines Allen gemeinen. In Hinsicht auf das menschliche Tun besagt diese der wissenschaftlichen Arbeit innewohnende Überzeugung, dass alle unsere Ziele und Güter innerhalb der einen sinnesgeistigen Welt liegen, sowie dass alle Kräfte und Triebfedern, wenn auch nicht im Anschein, so doch in Wahrheit individueller Natur sind. Wo es überhaupt für ein Ganzes keinen Platz gibt, da ist auch kein Platz für Hingebung an das Ganze, es wäre bare Torheit, eine solche, wo nicht zu fordern, so doch zu empfehlen; wo eine rein geistige Welt als Phantom gilt, können nicht rein geistige, bloß innere Güter als wirklich und gar als wertvoll gelten. Ja, etwa dahingehende Strebungen verdienten nicht die Duldung harmloser Phantasien, sondern die Zerstörung irreleitender Trugbilder, denn sie müssten echtem Beginnen Interesse und Kraft entziehen. Wenn aber alles, was sich behaupten will, seine Bewähr innerhalb des Erfahrungskreises zu erbringen hat, was anderes könnte über Recht und Unrecht entscheiden, als die Leistungen für den Prozess, der Nutzertrag des einen für das andere? Was immer auftritt, wird sich nicht als an sich wertvoll, sondern als nützlich, nicht als dauernd gültig, sondern als augenblicklich passend einführen. Damit stürzt die Form des Ideals und mit ihr sinken alle besonderen Ideale als unklare Gebilde verworrenen Denkens, als Restbestände überholter Entwicklungsstufen.
Aber ist damit die Sache zu Ende? Ohne allen Einspruch zu Ende? Für das Individuum vielleicht, für die Gesamtheit nimmermehr. Wie? Eine Zeit, welche das menschliche Geschick so lebhaft als gemeinsames empfindet, welche das Gefühl der Sympathie so allseitig und durchgreifend in Tat verwandelt wie keine frühere, eine Zeit, welche in dem nationalen Kulturstaate eine den Einzelnen immer gewaltiger an sich ziehende und beherrschende Zusammengehör geschaffen, eine Zeit, welche die Werke der Vernunftarbeit, als Wissenschaft, Erziehung, soziale Ordnung, wie Ganzheiten fasst und wie Sache des Ganzen führt, eine solche Zeit sollte nicht fortwährend den Einzelnen inneren Zusammenhängen einfügen und überlegenen Ordnungen unterwerfen, nicht das menschliche Handeln auf übersinnliche Ziele richten, sie sollte endgültig und allsinnig den Idealen entsagt haben? Um solchen Verzicht durchzuführen, müsste sie doch mehr abtun, als sie abtun will und abtun kann. Ist ihr die Menschheit nichts anderes als eine Summe sich gegeneinander behauptender Sonderexistenzen, sie müsste alle innere Zusammengehörigkeit, nicht nur eines Vernunftreiches, sondern der Menschheit, nicht nur der Menschheit, sondern auch eines Volkstums aufgeben, sie müsste aufhören, vom Einzelnen im Namen des Ganzen irgendetwas zu fordern, sie müsste Begriffe wie Gesetz und Pflicht aus ihrem Gedankenkreise streichen, sie müsste alles Interesse des einen für den andern, alles Mitleid, alle Liebe auf gröberen oder feineren Eigennutz zurückführen. Das will sie nicht, und wenn sie es wollte, sie kann es nicht.
In der Entfaltung des Kulturlebens zersprengen auch die Ziele und Güter den Rahmen, in den jene von der Theorie anhebende Richtung sie begrenzen wollte. Mag die Pflege sinnesgeistigen Daseins den Einzelnen einnehmen, der Menschheit nicht nur, auch einem lebenskräftigen Kulturvolke heben sich Güter über jenen Begriff der Wirklichkeit hinaus. Oder geht nationale Ehre, geht die Rechtsordnung eines Volkes nach Wert und Maß in Leistungen für das sinnlich-geistige Dasein auf, so dass es sich gegen irgendwelche Vorteile wie im Tausch umsetzen ließe? Was würde aus der Wissenschaft, wenn die Idee einer den subjektiven Zuständen überlegenen Wahrheit und der Selbstwert solcher Wahrheit verschwände? Ja, eben die Gegner der Ideale werden durch die Art des Kampfes Zeugen für die Ideale. Denn wenn sie die Zerstörung einer idealen Welt als einen Segen für die Menschheit verkünden, wenn sie eine neue Ordnung der Dinge als an sich wahr und unbedingt schätzbar, ja wie ein Heiliges vertreten, und oft ohne Rücksicht auf ihr Eigenwohl mit überzeugter Hingebung des Innern, mit stürmischem Aufgebot aller Kraft vertreten, so erkennt entweder ihre Tat an, was ihr Begriff bekämpft, oder die Worte haben den üblichen Sinn verloren. So bleibt es dabei: im praktischen Handeln der Neuzeit wirkt eine andere