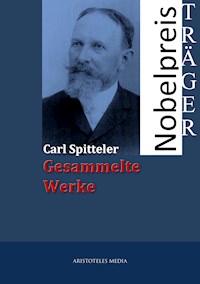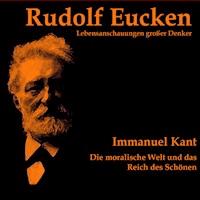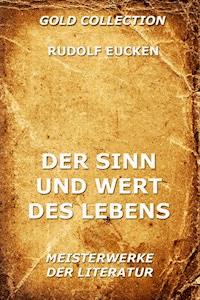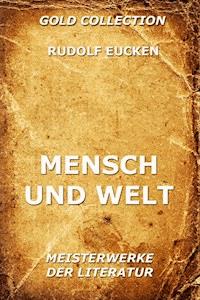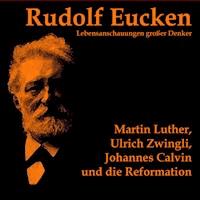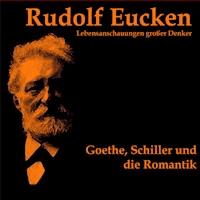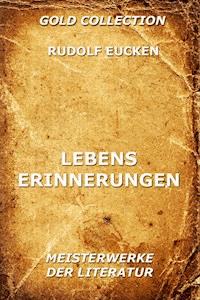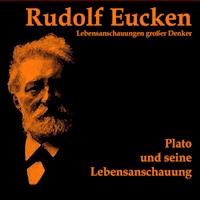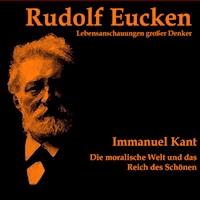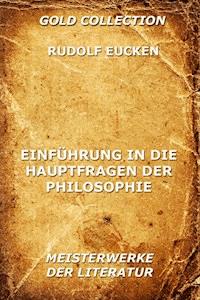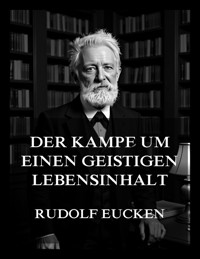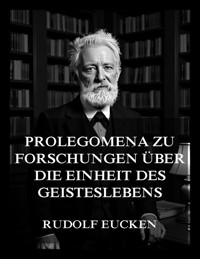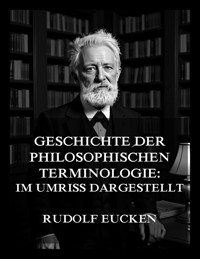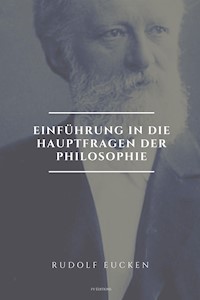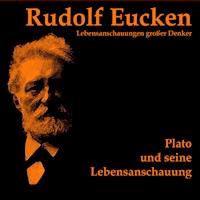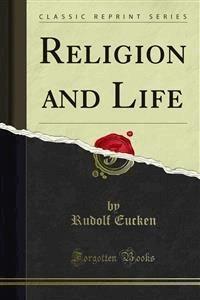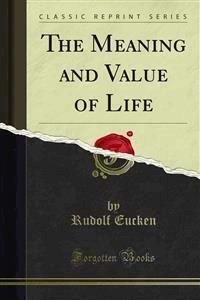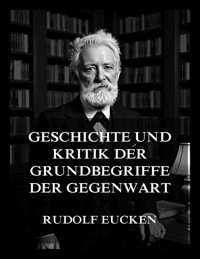
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der deutsche Nobelpreisträger hat es sich in diesem Werk zur Aufgabe gestellt, zur Würdigung und Kritik des Geisteslebens der Gegenwart beizutragen. Die leitenden Begriffe bieten dafür einen geeigneten Ansatzpunkt, weil in ihnen die Eigentümlichkeit von Denken und Streben zu einem greifbaren Ausdruck gelangt: eine zusammenfassende Geschichte der Begriffe muss für die genetische Begreifung der Gegenwart Einsichten eröffnen, eine sich daran schliessende Kritik der Begriffe muss zu einer Kritik der Gegenwart selbst werden. Demgemäss werden hier die für Bildung und Wissenschaft wichtigsten Begriffe, z. B. Erfahrung, Gesetz, Kultur, Humanität, Idealismus und Realismus u. a. historisch-kritisch erörtert und zwar in der Weise, dass durch ihre genetische Entwicklung sowohl ihr eigener Inhalt wie ihr Zusammenhalt mit den bewegenden Mächten der Vergangenheit und Gegenwart möglichst klar hervortritt. Im Laufe der Erörterung schliessen sich die einzelnen Züge immer mehr zu einem Gesamtbild zusammen und lassen den Stand und die Lösungsversuche der wissenschaftlichen und philosophischen Aufgaben deutlich erkennen. So will das Buch nicht nur eine historische Darstellung, sondern einen Beitrag zu einer vertiefenden Aufklärung über Inhalt und Eigenart des gesamten geistigen Lebens der Gegenwart bieten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 433
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Geschichte und Kritik der Grundbegriffe der Gegenwart
RUDOLF EUCKEN
Geschichte und Kritik der Grundbegriffe der Gegenwart, Rudolf Eucken
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN: 9783988682406
www.jazzybee-verlag.de
INHALT:
Vorwort zur zweiten Auflage.1
Einleitung. Die Begriffe ein Spiegel der Zeit.3
Subjektiv - Objektiv. 21
Erfahrung.47
A priori – a posteriori75
Entwicklung.79
Monismus –– Dualismus. 101
Mechanisch – organisch.116
Gesetz.130
Individualität - Gesellschaft - Sozialismus.140
Utilitarismus.160
Idealismus – Realismus – Naturalismus.172
Freiheit des Willens.192
Persönlichkeit und Charakter.196
Theoretisch – praktisch.208
Immanenz – Transzendenz.215
Schlusswort.231
Vorwort zur zweiten Auflage.
Die erste, im Jahr 1878 erschienene Auflage ist meines Wissens fast überall freundlich aufgenommen, manchem hochgeschätzten Gelehrten bin ich für ein tätiges Eintreten zu Dank verpflichtet, vornehmlich den amerikanischen Freunden, deren lebhaftes Interesse eine englische Übersetzung veranlasste.
Die neue Auflage ist vollständig umgearbeitet, bei Festhaltung des allgemeinen Gedankens ist in Inhalt und Form kaum etwas unverändert geblieben. Es erstrecken sich aber die sachlichen Änderungen namentlich nach drei Richtungen. Erstens sind die geschichtlichen Angaben strenger auf das beschränkt, wasunmittelbar zum Verständnis der Gegenwart erforderlich schien; zweitens ist der Tatbestand der Gegenwart schärfer und klarer herauszuarbeiten gesucht; drittens habe ich mit meiner eigenen Überzeugung eine entschiedenere Stellung genommen und auch den Leser für ein bestimmtes Urteil über die Zeit zu gewinnen gesucht. Ich wollte aber nicht eine subjektive Beleuchtung aus bloß individueller Reflexion geben, sondern das Streben ging dahin, möglichst zum Kernbestande des Geisteslebens vorzudringen, wie ihn die weltgeschichtliche Arbeit darstellt, und von hier aus, also nach ursprünglicheren und gewisseren Tatsachen, die Zeit zu messen. So ist das Ganze von dem Geschichtlichen ins Philosophische verschoben; hier aber möchte es nicht eine weit ausgesponnene Reflexion entwickeln, sondern festen Tatsachen und Ideen dienen.
Das Buch macht, besonders in der neuen Fassung, durchaus nicht den Anspruch, objektiv im Sinne farbloser Neutralität zu sein, es ist nicht sine ira etstudio geschrieben. Vielmehr erfüllt den Verfasser eine aufrichtige Entrüstung über all das Kleine, Nichtige, Scheinhafte, das sich gerade bei den zentralen Fragen der geistigen Existenz heute so aufspreizt und die Menschheit um ihre Seele und ihr Glück betrügen möchte; zugleich aber erfüllt ihn ein eifriger Wunsch, ein klein wenig zur Befreiung von jenem drückenden Alp beizutragen. Dass aber der Gegenstand, eine Darlegung und Kritik der Grundbegriffe, an sich wohl geeignet ist, sowohl zu einer genaueren Erkenntnis als zu einer selbständigen Beurteilung der Zeit zu führen, dass er dem selbstgewissen Dogmatismus entgegenarbeiten und für die Eröffnung weiterer Horizonte wirken kann, das ist dem allgemeinen Gedanken nach ohne weiteres klar, das wird näher aber im einleitenden Abschnitt zur Erörterung kommen.
Zur Ausführung sei bemerkt, dass die Auswahl der einzelnen Begriffe sicherlich manchen Bedenken und Zweifeln ausgesetzt ist. Warum gerade diese, warum nicht andere? Ich habe nach bester Überzeugung solche Begriffe auszuwählen gesucht, von denen jeder einzelne charakteristisch für die Zeit schien und an seiner Stelle einen Einblick in ihre Denkweise eröffnete, deren Verbindung aber ein leidliches Gesamtbild der geistigen Art der Zeit in Aussicht stellte. Mehreres, was anfänglich mit in den Plan aufgenommen war, ward schließlich fallen gelassen, ein zu weites Ausspinnen konnte gerade einer solchen Sache nur schaden. Und schließlich schien es mir hier weniger wichtig, möglichst viele Einzelheiten nebeneinander auszubreiten, als von einer begrenzten Anzahl wesentlicher Probleme auf ein Bild des Ganzen zu kommen und zu diesem Ganzen aus einer zusammenhängenden eigenen Überzeugung Stellung zu nehmen.
Diese Konzentration auf das Ganze mag auch der Anordnung der einzelnen Abschnitte zu Gute kommen und ihre unvermeidlichen Mängel einigermaßen ausgleichen. Unvermeidlich insofern, als hier zerlegt und nacheinander vorgeführt werden muss, was in Wahrheit einem zusammenhängenden Gedankengewebe angehört und sich hier gegenseitig ergänzt. Die Reihenfolge aber ist die, dass die mehr formalen Begriffe allgemeiner Art beginnen, die vom All und der Natur folgen, die Untersuchung sich dann dem menschlichen Leben zuwendet, es nach verschiedenen Richtungen beleuchtet und endlich beim religiösen Problem ihren Abschluss findet. Das hat den Nachteil, dass die Fragen voranstehen, welche scheinbar zurückliegen und am meisten begriffliche Arbeit fordern. Aber einmal habe ich auch hier rasch einen Übergang zu lebendigen Problemen der Zeit zu finden gesucht, und dann entsteht durchaus kein Schaden, wenn eine nähere Beschäftigung von einem anderen Punkte aufgenommen wird, der dem unmittelbaren Interesse näher liegt. Denn es hängen die einzelnen Abschnitte weniger voneinander ab, als von dem Ganzen, dem sie alle dienen. Dieses Ganze vornehmlich im Auge zu halten, darum möchte ich am meisten einen wohlwollenden Leser gebeten haben.
Möge denn das Buch neben den Gegnern, die es erwartet, auch Freunde finden.
Jena, im Herbst 1892.
Einleitung. Die Begriffe ein Spiegel der Zeit.
Den großen Gegensatz von Schicksal und Freiheit empfindet der moderne Mensch vornehmlich an dem Verhältnis zu seiner Zeit. Ihm gilt die Zeit mit ihrer Art als sein Schicksal. Sie umfängt ihn mit überlegener Macht vom ersten Punkt seines Werdens, sie bildet ihn mit stillem Zwange zu dem was im Ergebnis ein Werk eigener Arbeit und freier Wahl dünkt, sie hält ihn auch da in ihrem Bann, wo sein Bewusstsein sich von ihr losreißt und leidenschaftlich gegen sie kehrt. Denn auch dieser Kampf liegt schließlich innerhalb der Zeit, aus ihren Bedürfnissen ist er erwachsen, mit ihren Mitteln wird er geführt. So können wir unsrer Zeit nicht entfliehen, ihr entspringt alles Streben und zu ihr muss es zurückkehren.
Aber zugleich verhält der moderne Mensch sich viel zu reflektierend und kritisch zur Zeit, um ein bloßes Stück von ihr zu werden. Er kann sich unmöglich willen- und gedankenlos von dem forttreiben lassen, was ihn gerade berührt, nicht ohne Urteil und Wahl annehmen, was sich gerade bietet. Für ihn heißt es den Kern der Zeit, ja die Zeit selbst erst zu suchen. Denn so wenig alles, was je geschehen ist, zur Geschichte gehört, ebenso wenig gehört alle bunte Fülle um uns zur Zeit. Wie aber die Zeit finden, wie sie aus der Unermesslichkeit der einzelnen Vorgänge herausfinden? Dazu gibt sich die Zeit mit ihrem Inhalt nicht als eines neben anderem, sondern als das Ganze, nicht als eine bloße Tatsache, sondern als Wahrheit, als volle und letzte Wahrheit. Was sie bringt, soll alle fördern und allen gefallen. Wie aber lässt sich ein solcher Anspruch irgend begründen, ohne dass wir uns aus der Zeit hinaus in eine zeitlose Betrachtung der Dinge versetzen, und dieses wiederum fordert die Entfaltung eines ursprünglichen, in sich selbst gegründeten Lebensprozesses. Dort aber angelangt müssen wir erkennen, dass alles geistige Schaffen eine Überlegenheit gegen die Zeit hat und den Menschen von ihrem Druck befreit, ja dass es einen unablässigen Kampf gegen alles führt, was an den Dingen der bloßen Zeit angehört.
So können wir auf die Freiheit nicht verzichten und zugleich die Notwendigkeit nicht leugnen: es ergibt sich ein zunächst ungeklärtes Doppelverhältnis des Menschen zur Zeit. Wie immer aber solche Verwickelung sich löse, willkommen muss uns alles sein, was diese zwiefache Beziehung zu deutlicherem Ausdruck bringt, was uns zugleich in den Tatbestand der Zeit einführt und unsere Selbständigkeit ihr gegenüber stärkt.
Einen eigentümlichen Weg in die Zeit hinein und über die Zeit hinaus bieten aber die Begriffe, in denen sich das allgemeine Denken und Leben einer Zeit bewegt. Das allgemeine sagen wir. Denn nicht die Begriffe sind gemeint, welche die einzelnen Wissenschaften für ihre besonderen Zwecke schaffen, sondern die, welche das gemeinsame Kulturleben für das Ganze des menschlichen Tuns und Befindens entwickelt.
Den Individuen sind diese Begriffe zunächst gegenwärtig in zahlreichen Ausdrücken, die ihnen aus der Umgebung zufließen und willige Aufnahme finden. Man müsste außerhalb der Zeitbewegung stehen, um nicht täglich Ausdrücke zu verwenden, wie Entwicklung, Anpassung, Kampf ums Dasein, Milieu, Gesellschaft, Bewusstsein, Erfahrung, subjektiv objektiv u. s. w. Nichts scheint gleichgültiger, nichts unverbindlicher als solche Ausdrücke, solche Wörter. Aber es sind keineswegs bloße Wörter. Das Wort hat einen Hintergrund, es ist ein Niederschlag der Gedankenarbeit, die Erscheinung eines Begriffes, und der Inhalt dieses Begriffes wirkt aus ihm. Mag bei Aufnahme des Wortes der Einzelne gewöhnlich mehr einen dunklen Gesamteindruck als eine deutliche Vorstellung empfangen: soweit das eigene Denken in Fluss gerät, findet es in den Ausdrücken und Begriffen leichteste Bahnen bereit, wie selbstverständlich lenkt es in sie ein, und vollzieht doch mit diesem Einlenken eine Anerkennung von Zielen, die keineswegs selbstverständlich sind; unvermerkt hat es ein Handgeld genommen, das ins Unabsehbare verpflichtet. Denn in Wahrheit sind die Begriffe, die hinter den Ausdrücken stehen, nicht gleichgültige Werkzeuge, nicht bloße Umschreibungen eines Tatbestandes. Sie geben eigentümliche Zusammenfassungen und stellen die Dinge in eigentümliche Beleuchtungen. Sie können nicht gewisses als Hauptsache erklären, ohne anderes zur Nebensache herabzusetzen, sie wirken damit zu einer Abstufung und Gruppierung des Gedankenkreises. Sie bezeichnen Aufgaben und Angriffspunkte, sie scheinen bloß zu fragen und erteilen durch die Art der Frage zugleich eine Antwort. Sie verleihen dem, was sie fixieren, eine unvergleichlich größere Macht und leichtere Wirksamkeit, als es in der Zerstreuung besaß. Sind nicht in Begriffen, wie soziale Frage, Wille zum Leben, Kampf ums Dasein u. s. w. alte Erfahrungen durch die Verbindung zu ungeahnter Macht und Eindringlichkeit gelangt? Kurz in den Begriffen stecken Behauptungen und Theorien, Ziele und Wegweisungen. Man muss z. B. bei dem Lieblingsausdruck der Gegenwart "Milieu" über dem Wort den Begriff ganz vergessen, um nicht zu empfinden, dass er eine eigentümliche, vielleicht recht angreifbare Bestimmung des Verhältnisses von Individuum und gesellschaftlicher Umgebung enthält. Vollziehen wir nicht durch den alltäglichen Gebrauch von "Standpunkt" und "Gesichtspunkt" eine recht problematische Anerkennung eines gleichen Rechtes jeder beliebigen Individualität? Lässt sich so viel wie heute von "Wert" und "Werturteil" reden, ohne den eigenen Gehalt der Dinge vor der Wirkung auf das empfindende und schätzende Subjekt zurückzustellen?
Von solchen Begriffen findet sich aber das ganze Dasein des Kulturmenschen in dichtem Netz umsponnen. Mögen wir uns selbst zu verstehen suchen, mögen wir das Verhältnis zu unseren Mitmenschen ordnen, mögen wir über Welt und letzte Dinge grübeln, immer bringt uns die Zeit in den Begriffen ein eigentümliches Bild entgegen, immer zieht sie uns durch sie unvermerkt in ihre Bahnen, immer steht unsere Arbeit unter dem bestimmenden Einfluss verborgener Voraussetzungen, fertiger Urteile. Im einzelnen Falle scheint und ist das unerheblich, im Gesamtergebnis aber berührt es die Grundbedingungen unserer geistigen Existenz, dass uns die Zeit einen ausgebildeten Gedankenkreis, ein fertiges Schema von Welt und Leben zuführt und mit unmerklichem Zwange aufdringt. Wo wir selbst zu denken meinen, denkt die Zeit in uns als bloßen Werkzeugen ihres Strebens. Die Begriffe aber sind die Fangarme, mit denen sie uns in ihren Machtbereich zieht und zu ihren Diensten zwingt. Die Sozialwissenschaft hat überzeugend gelehrt, dass wir moralisch an den Stand der gesellschaftlichen Umgebung gebunden sind; dass wir es auch intellektuell sind, zeigt nicht minder anschaulich die Begriffsforschung.
Aber nun und nimmer wäre die überwältigende Eindringlichkeit der Zeitbegriffe zu erklären, wenn es sich dabei um rein intellektuelle Prozesse handelte. In Wahrheit legt die Zeit in die Begriffe ihre Liebe und ihren Hass hinein, sie spricht aus ihnen zu uns in mächtigem Affekt. Was sie bejaht, das gibt sie als unbestreitbar, unvergleichlich wertvoll und schlechthin vernünftig; was sie verneint, als kaum denkbar, verwerflich und töricht. Sie empfiehlt oder verdammt; sie behandelt von vornherein als ausgemacht, was nur mit Mühe, wenn überhaupt, zu beweisen wäre; was ihr hingegen nicht selbstverständlich, das gilt leicht als unsinnig. Mit Adleraugen bemerkt sie auch das Kleinste, was in der Richtung ihres Strebens liegt, für das andere ist sie blind, und sei es in aufdringlicher Nähe. Was nach jener Richtung wirkt, erscheint von Haus aus als hochbedeutsam, es wird gefeiert in seinen Vorzügen, entschuldigt in seinen Fehlern, zum mindesten beschäftigt es die Gedanken als "interessant“. Am anderen hingegen sucht der Blick nur die Fehler, hier scheint alles Unternehmen ohne weiteres als unerheblich und der Beachtung unwert. So die höchste Unbill eines ebenso summarischen wie parteiischen Verfahrens, ein doppeltes Maß und doppeltes Gewicht, nicht anders als bei dogmatischen Glaubenskämpfen. Und in der Tat aus einem ähnlichen Grunde. Denn auch die Zeit glaubt an sich selbst, nur an sich selbst, und aus solchem Glauben kann sie nichts dulden, was ihr widerspricht. Die Zeit bejaht in dem Ganzen aller jener Behauptungen nichts anderes als ihr eigenes Schaffen und Streben, den Hauptzug ihrer Arbeit, ihre eigentümliche geistige Substanz. Es ist in Wahrheit ein Kampf ums Dasein, und aus der Art eines solchen Kampfes wird vollbegreiflich alle jene Leidenschaft der Affekte, alle Selbstverständlichkeit der Begriffe, der tyrannische Druck auf die Individuen. Nie können wir verstehen, weshalb heute gerade diesen Begriffen die Macht gegeben, den anderen aber genommen ist, ohne eine Anerkennung der Tatsache, dass hinter den Begriffen die Erfahrungen und die Ideen stehen, welche der Arbeit der Zeit gerade diesen Charakter geben.
Bei solcher Aufnahme in weitere Zusammenhänge wahren die Begriffe jedoch eine eigentümliche Bedeutung. In ihnen erfolgt ein Eingehen der Bestrebungen auf den nähern Inhalt der Wirklichkeit, mittels ihrer suchen sich die leitenden Ideen der gegenständlichen Welt zu bemächtigen und in volle Arbeit umzusetzen; hier eben ist der Punkt, wo das unsichtbare und oft sich selbst verborgene Ringen und Schaffen zu einem sichtbaren Ausdruck kommt und aller weiteren Gestaltung feste Bahnen vorschreibt. Was bei diesem ersten Punkt gewonnen oder verfehlt wird, das ist kaum je wieder aufzuheben. Dass aber das Streben an dieser Stelle, wo es sich zuerst fassen lässt, sofort zur Rechenschaft angehalten werde, ist umso notwendiger, als eben in der Wendung zum Begriff das Zeitstreben seinen Anspruch auf volle und ausschließliche Wahrheit mit besonderem Nachdruck erhebt. Denn der Begriff mit seiner Richtung auf den Gegenstand, seinem Versuch, eine objektive Wahrheit festzulegen, kann nun und nimmer sich und seinen Inhalt zu einer vorübergehenden Erscheinung oder einer subjektiven Ansicht herabsetzen lassen; was er bringt, das soll für alle und für immer gelten. So erreicht in der Entwicklung zu einer Welt der Begriffe der Anspruch des Zeitlebens seinen höchsten Gipfel.
Aber dieser Höhepunkt wird zugleich ein Wendepunkt, mit ihm kommt das Drama an seine Peripetie. Gerade jenes Bestehen der Begriffe auf einer allgemeingültigen Wahrheit, jenes Ergreifen des Gegenstandes, es versetzt hinaus über alles Meinen und Gefallen der Zeit, es vollzieht eine Berufung von der Zeit an eine Wahrheit der Dinge und verwandelt damit die ganze Art des Lebensprozesses wie auch die Stellung des Menschen. Seine Vernunft erwacht und erweist eine überzeitliche Art, es erhellt, dass sie wohl vom Strom der Zeit eine Strecke mit fortgerissen werden, nicht aber in ihm untergehen kann; die innere Selbständigkeit, jenes Erbteil ihrer Natur, kann sie wohl zeitweilig außer Übung lassen, aber auch jeden Augenblick wieder aufnehmen. Alsdann aber wird sie der Zeit gegenüber zum Richter und vermag an ihr Wahres und Falsches zu scheiden. Bei solcher Wendung erhält der Mensch einen starken Gegenhalt gegen alle jene Mächte, die auf ihn eindrangen; eine neue, ursprünglichere, wir möchten sagen: eigenere Art von Leben und Arbeit geht auf, ganze Welten stoßen in ihm zusammen, und es entbrennt ein heißer, in seinen einzelnen Phasen oft recht unsicherer Kampf. Aber die innere Überlegenheit über die Zeit kann nicht wieder verloren gehen und ebenso wenig jene Vertiefung des Lebensprozesses. Die Begriffe aber, zunächst ein Hauptmachtmittel der Zeit, werden auf dem neuen Boden ein Weg zur Befreiung von der Zeit.
Solche Verknüpfung der Begriffe mit den letzten Problemen des Geisteslebens macht eine ausführliche Erörterung der Vorteile überflüssig, welche die Entwerfung eines Bildes der Zeit von ihren Hauptbegriffen her bietet. Diese Begriffe geben sichere Anhaltspunkte, sie verkünden unwidersprechlich, nach welchen Richtungen eine Befestigung der Zeitarbeit, eine Summierung der Einzelleistungen erfolgt. Aber zugleich weisen sie in das Innere des Zeitlebens mit all den unausgesprochenen Voraussetzungen und Grundtrieben, die lange vor der bewussten Überlegung dem Denken und Streben eine Bahn vorzeichnen. Namentlich aber sind die Begriffe geeignet, aus allen Wirren und Gegensätzen einen gemeinsamen Bestand der Zeit herauszuheben. Wir streiten oft hart über die Ergebnisse und verwenden dieselben Begriffe. Wir entzweien uns auch wohl über den Begriff selbst, z. B. den der Entwicklung, behaupten aber vor dem Zwiespalt einen gemeinsamen Grundstock. Selbst wo der eine einen Begriff völlig verwirft, etwa solche wie Metaphysik, Philosophie der Geschichte u. s. w., der andere dafür eintritt, müsste man flüchtig beobachten, um nicht bald zu gewahren, dass auch der Freund den Begriff verändert, insbesondere abschwächt, dass Freund und Feind gegen frühere Zeiten zusammenhalten. Nirgends ein Kampf ohne Berührung und eine Berührung ohne irgendwelche Gemeinschaft.
Das gilt auch für den Hauptgegensatz, der alle Zeitarbeit durchdringt, für die Hauptlinie, die alle einzelnen nur scheinbar zerstreuten Gefechte verbindet. Keine Zeit ausgeprägter Art ohne solche Unterordnung aller Mannigfaltigkeit unter ein großes Entweder oder. Die Analyse der Begriffe kann zunächst diese Hauptlinie des Zusammenstoßes aus dem Wirrwarr der alltäglichen Ansicht herausheben. Weiter aber wird sie in und über dem Kampf eine Gemeinschaft von Überzeugungen und Vorstellungsbildern aufweisen und somit dartun, dass wir in aller Entzweiung Kinder Einer Zeit bleiben und gleichen Bedingungen der Arbeit unterliegen. Solche Aufdeckung eines inneren Zusammenhanges der Zeit könnte nur einem blassen Synkretismus in ein einförmiges Bild der Zeit ausarten. In Wahrheit beharrt die Mannigfaltigkeit, und es beharren die Gegensätze, sie mögen sich sogar jetzt schärfer ausnehmen als zuvor. Aber gewonnen ist, dass alle Vielheit sich Einem Getriebe einfügt und selbst der Kampf von ihm umspannt wird. Je mehr die Begriffsforschung große Hauptlinien festlegt und einen Trieb zur Gestaltung in das anfängliche Chaos bringt, desto mehr lässt sich die Zeit als ein Ganzes überblicken, desto mehr die Zeit aus der Zeit heraussehen.
Die Ermittlung der Besonderheit der Zeit bringt uns aber zugleich in ein freieres Verhältnis zur Zeit. Die genaue Umgrenzung des Bildes vollzieht unmittelbar eine Zerstörung jener dumpfen Selbstverständlichkeit, mit der die Zeit den Menschen zunächst umfängt. Wer deutlich weiß, wo und wie er abhängig ist, befindet sich schon auf bestem Wege zur Freiheit.
Alle diese Aufgaben aber finden eine wichtige, ja fast unentbehrliche Hilfe an der Geschichte der Begriffe. Dass die Begriffe nicht Kinder des Augenblicks sind, sondern in der Vergangenheit wurzeln, ja dass sie ein von der Gesamtheit der Geschichte erarbeitetes Kapital übermitteln, das beweisen schon die Ausdrücke mit ihrer bunten, den verschiedensten Zeiten und Völkern entlehnten Gewandung. Die Arbeit von Jahrtausenden lebt im alltäglichen Sprachgebrauch wieder auf, auch sonst vergessene Zeiten bleiben hier in Wirkung. Von der mittelalterlichen Scholastik kann man recht gering denken, nicht aber darauf verzichten, bei jeder wissenschaftlichen Untersuchung, ja in jeder gebildeten Unterhaltung Ausdrücke zu verwenden, welche ihre mühsame Arbeit festgelegt hat, Ausdrücke z. B. wie subjektiv objektiv, ideal real, quantitativ qualitativ, immanent transzendent, a priori - a posteriori, Individualität, Maxime, Motiv u. s. w.
Die Geschichte der einzelnen Ausdrücke wird für unsere Aufgabe nicht oft, aber doch bisweilen von Nutzen sein. Wenn die Hauptphasen der geschichtlichen Bewegung eines Wortes noch im heutigen Sprachgebrauch fortleben, so kann der Rückblick auf die Geschichte zur Scheidung und Klärung dienen. Die mannigfache Verzweigung z. B., welche heute die Ausdrücke "Idee" und "ideal" haben, ist nicht wohl verständlich ohne eine Erinnerung daran, dass Idee bei Plato ein aller Zerstreuung und Bewegung des Stoffes überlegenes urbildliches Sein, bei Descartes (nach dem Vorgang älterer französischer Schriftsteller) subjektive Vorstellung, bei Kant einen "notwendigen Vernunftbegriff, dem kein kongruierender Gegenstand in den Sinnen gegeben werden kann", bedeutete. In anderen Fällen können merkwürdige Schicksale des Wortes Probleme im Begriff selbst verraten. Ganz gleichgültig wird z. B. auch für die Behandlung der Begriffe "subjektiv“ und "objektiv" die Tatsache nicht sein, dass die Wörter in den letzten zwei Jahrhunderten ihre Bedeutung einfach umgetauscht haben. Seit Duns Scotus († 1308) aus ihnen feste Termini schuf, bis zum Beginn des 18. Jahrhunderts bezeichnete "subjektiv" was dem Substrat, dem Gegenstand angehört, also nach heutigem Sprachgebrauch das Objektive an den Dingen; "objektiv" hingegen das im Entgegenstellen (objicere) der Dinge, in der bloßen Vorstellung Befindliche, also das Subjektive. Erst im 18. Jahrhundert ist die Umkehrung vor sich gegangen, wie sich unten näher zeigen wird.
Aber die Geschichte der Wörter ist nicht die der Begriffe. Der Begriff kann unverändert bleiben bei einem Wechsel der Ausdrücke, er kann in Wirkung stehen, ohne sich an ein festes Wort zu binden. Die Erlebnisse eines Begriffes lassen schon tiefer in die Gedankenbewegung blicken. Unter welchen Bedingungen und Umgebungen ein Begriff aufkam, wann und wie er in den Vordergrund der Arbeit rückte, welche Hauptphasen er bis zur Gegenwart durchlief, das alles kann anregend und aufhellend wirken. Von einer Geschichte des Begriffes kann nicht wohl die Rede sein, sofern nicht ein Hauptelement, ein leitender Grundgedanke von allem Wandel unberührt bleibt. Dieses Feste von den im Verlauf der Zeit wechselnden Elementen scharf abzuheben und damit das Ganze sowohl durchsichtiger als beweglicher zu machen, das dürfte ein Hauptergebnis der Zurückverfolgung der Begriffe in ihre Geschichte sein. Leicht verschmilzt uns sonst das Besondere der heutigen Fassung mit dem allgemeinen Gedanken, z. B. der soziale Utilitarismus, der uns heute beschäftigt, wird zum Utilitarismus überhaupt, während die Geschichte auch einen religiösen Utilitarismus, z. B. bei den lateinischen Kirchenvätern, sowie einen politischen, z. B. in der Renaissance, aufweist.
Bei einer Zusammenfassung größerer Reihen wirft die Geschichte der Begriffe Licht auf das Verhältnis der eigenen Zeit zu den früheren Epochen. Sie zeigt unsere Schuld an die Vergangenheit, sie zeigt aber auch, wo wir dieser selbständig entgegentreten. Wo wir Begriffe mit besonderem Nachdruck betonen, erwehren und entledigen wir uns gewöhnlich des Einflusses der Tradition. So widersteht unsere Zeit der spekulativ-ästhetischen Epoche in Begriffen wie Tatsache, Erfahrung, real, kritisch u. s. w., der Aufklärung in Monismus, Gesellschaft und der Abweisung aller Teleologie, der Scholastik in Entwicklung, Immanenz, mechanischer Naturerklärung u. s. w. Die Hauptrichtungen der geistigen Bewegung erhalten hier bis in die einzelnen Angriffspunkte eine geschichtliche Beziehung. Auch verrät der Affekt, den die Zeit dabei aufbietet, dass die anderen Epochen ihr nicht ganz erstorben sind, sondern ihre Gedanken auch heute noch beschäftigen, ja aufregen. Wir ersehen, was von der Vergangenheit der Gegenwart mehr ist als bloße Vergangenheit. Das Mittelalter ist in diesem Sinne noch heute lebendig, das Altertum nicht mehr.
Aber mit allem, was hier zu gewinnen ist, bleibt uns die Vergangenheit etwas Äußeres und steht der eignen Arbeit fremd gegenüber. Nur eine Weiterführung und Vertiefung der gesamten Behandlung kann das ändern. Die Geschichte der Begriffe könnte sich mit dem eignen Streben nach Wahrheit nie verbinden, zeigte sie uns nur ein Vorbeiziehen wechselnder Meinungen, eine Sammlung individueller Deutungen der Wirklichkeit. Dass sie in Wahrheit mehr enthält, bekundet schon die elementare Gewalt, mit der die großen Wandlungen der Begriffe die Menschen fortreißen und den Geist der Arbeit verändern. Wenn sich im Lauf der Geschichte in Grundbegriffen wie Seele, Innerlichkeit, Glück, subjektiv objektiv u. s. w. durchgreifende Verschiebungen vollziehen, und zwar für das Ganze des Kulturlebens, erklärt sich das bloß daraus, dass besonders geweckte Individuen glückliche Einfälle hatten und damit Anklang fanden? Oder weist es nicht vielmehr darauf hin, dass das Ringen und Mühen der einzelnen ein Mittel und Werkzeug war zur Entwicklung einer tiefergegründeten Geisteswelt, und dass die Wandlungen der Begriffe Weiterbildungen und Vertiefungen des geistigen Lebensprozesses selbst anzeigen und festlegen? Spiegelt aber die Geschichte der Begriffe das allmähliche Erwachsen einer geistigen Wirklichkeit auf dem Boden der Menschheit, so erhalten ihre Hauptergebnisse eine mehr als vorübergehende Bedeutung. Denn was sich einmal als ein Element jener geistigen Wirklichkeit bewährt hat, das bleibt von innen her ein Faktor aller weiteren Bewegung; mag es sich dem Bewusstsein der Menschen und Zeiten noch so verdunkeln, es erhält sich in Wirkung, wo immer die weltgeschichtliche Arbeit aufgenommen und fortgeführt wird. Mit der Einführung in die unser geistiges Dasein begründenden Zusammenhänge vermag die Geschichte der Begriffe uns zum Inhalt der Zeiten in ein innerlicheres und fruchtbareres Verhältnis zu bringen, sie entdeckt hinter den erstorbenen Formen unvergängliche Kräfte, sie vermag uns aus der flüchtigen Gegenwart des bloßen Augenblickes in eine überzeitliche Gegenwart gemeinsamen geistigen Schaffens zu erheben.
Von daher erwächst aber notwendig eine kritische Behandlung des unmittelbaren Befundes der eignen Zeit. Jener Stand der weltgeschichtlichen Arbeit wird ein Maßstab dafür, wie weit die besondere Zeit ihre Aufgabe erfüllt oder wenigstens erkennt. Die weltgeschichtliche Arbeit umfängt uns freilich nicht wie die äußere Natur als eine gegebene Wirklichkeit. Aber sie spricht zu uns aus den Werken der Menschheit, aus Kunst und Literatur, aus Recht und Religion, sie spricht, wennschon leiser, auch aus der seelischen Innerlichkeit des Einzelnen. Aber solche unsichtbare Gegenwart ist auch eine Gegenwart, ja schließlich eine mächtigere als die des sinnlichen Eindruckes. Nur das von der Leistung der Zeit wird in die Tiefe und für die Dauer wirken, was den Forderungen jenes weltgeschichtlichen Standes entspricht oder doch entgegenkommt; was hingegen widerspricht, mag noch so sehr den Tag aufregen und die Menschen beschäftigen, innerlich bleibt es machtlos und verweht schließlich ohne Spur. So erhebt sich hinter der sichtbaren Zeit eine unsichtbare und wird zu ihrem Richter, ihrem Gewissen. Die tiefe Unzufriedenheit, das Missbehagen, die innere Verstimmung, die auf gewissen Zeiten bei aller Tatfülle lasten, sie entspringen dem dunklen Empfinden eines weiten Abstandes zwischen dem, was innerlich notwendig ist, und dem, was tatsächlich geschieht, ja eines vollen Widerspruches zwischen dem wahren Bedürfnis der Zeit und dem, was das Tagestreiben dafür ausruft.
Muss die Begriffsforschung mit allen Kräften jenem wahren Bedürfnis der Zeit zur Anerkennung verhelfen, so kann sie solche Aufgabe nicht nur im allgemeinen Überblick, sondern auch von einzelnen Hauptpunkten aus angreifen. Jeder einzelne Hauptbegriff kann und muss sich darauf prüfen lassen, ob die Fassung der Gegenwart jener weltgeschichtlichen Entwicklung entspricht, ob sie die in diesen steckenden Erfahrungen und Ideen in sich aufnimmt, oder ob sie untergeschichtlich dahinter zurückbleibt. Dieses ist gerade heute oft der Fall. So begnügt sich der Hauptstrom der Gegenwart mit einem Begriff des Glückes, für den die schweren Erschütterungen der Menschheit beim Übergange von der alten zur neuen Welt und das gewaltige Aufstreben der Neuzeit mit ihrem wissenschaftlichen Höhepunkt in Spinoza und Kant verloren scheinen. Den Begriff der Tatsache nimmt die Zeit oft so handgreiflich, als sei die tiefe Kluft zwischen Denken und Sein, zwischen dem Subjekt und der Welt, wie sie sich einem Descartes auftat und einem Kant noch erweiterte, plötzlich überwunden und ein naiver Unschuldszustand wieder hergestellt. Hier und sonst muss die Begriffsforschung in ihrer Wendung zur Geschichte dazu mitwirken, das Streben der Zeit auf die Höhe der weltgeschichtlichen Arbeit zu führen. Wie sich aber ein Kern der Geschichte nicht einmal suchen lässt ohne eine unmittelbare Gedankenarbeit und ein selbständiges Urteil über den Wert der Dinge, so kann die Vertiefung in die Geschichte ihrerseits dazu beitragen, die Vernunftarbeit mit ihrer zeitlosen Art zum Befund der Wirklichkeit in engere Beziehung zu setzen. Je mehr sich beide Seiten der Aufgabe verbinden, desto unmittelbarer wird die Begriffsforschung der Klärung der letzten Überzeugungen Dienste leisten.
Alle solche Anregungen, sich mit den Begriffen näher zu befassen, wachsen zu einer dringlichen Aufforderung mit der Wendung zu unserer eigenen Zeit. Hier gilt es unser eigenes geistiges Befinden: welchen Inhalt und welche Richtung empfängt unser Denken durch die Begriffe der Zeit, und wie weit dürfen wir uns gefallen lassen, was sie damit zuführt? Augenscheinlich übt das Zeitalter der Tagesblätter und der Maschinen einen besonders starken Druck auf die Individuen; die Massenhaftigkeit seiner Einflüsse erstickt von vornherein die eigene Regung, keine andere Epoche hat so sehr die Menschen zu bloßen Rädern eines großen Getriebes gemacht als die unsere. Bei den Begriffen selbst aber durchkreuzen sich förderliche Antriebe und schwere Hemmungen. Eine unermessliche Fülle neuer Erfahrungen hat mit den alten Formen auch die alten Begriffe zersprengt. Neue Gedankenmassen streben auf und schaffen sich Raum, von anderer Seite wird Widerstand geleistet, der ganze Umkreis des Daseins gerät in Unruhe und Bewegung. Dabei ein waches Bewusstsein, eine geschäftige Reflexion: man will formulieren, was man ergreift, den Ideen bequeme Handhaben bereiten. Kein Wunder, dass heute so viel über Begriffe verhandelt und gestritten wird! Aber zugleich ein rasches Abschleifen der Begriffe durch das Umlaufen in einem viel größeren Kreise, ein hastiges Hinwegeilen über die Mittel und Wege der Arbeit zu fertigen Ergebnissen, ein Zurücktreten, ja Verschwinden der allgemeinen Fragen des menschlichen Seins vor den Spezialproblemen der einzelnen Gebiete. Infolgedessen viel Unklarheit und Unreife in den allgemeinen Begriffen, die uns hier angeben. Gerade die Begriffe, in welche die Zeit ihren Affekt hineinlegt, bleiben inhaltlich meist in ungewissem Dämmerlicht. Wie viele von denen, die sich heute für "Kultur", "Entwicklung", "Charakter und Charakterbildung" erwärmen, machen auch nur den Versuch, vom Wort zum Begriff vorzudringen? Ferner sehen wir die Begriffsbildung oft widerstandslos von einzelnen Gedankenmassen fortgerissen, deren Kraft und deren Recht einem besonderen Gebiet angehört. So werden z. B. heute die Begriffe der mechanischen Entwicklungslehre, Begriffe wie Selbsterhaltung, Kampf ums Dasein, Anpassung, Vererbung u. s. w. ohne weiteres nach allen Richtungen ausgedehnt. Solche Nachgiebigkeit gegen besondere Impulse führt die Begriffe aber leicht unter entgegengesetzte Einflüsse und in widersprechende Fassungen. Das "Ideale" gilt als Illusion in der Weltanschauung, als Gut und Notwendigkeit für das Handeln; die Gesellschaft ist uns von der Natur her eine bloße Zusammenfügung einzelner Elemente, von den praktischen Aufgaben her ein Organismus, dem die Einzelnen als dienstbare Glieder verpflichtet sind; Freiheit wird im Weltall und auch für das Innere der Seele ebenso entschieden abgelehnt, wie für das staatliche und wirtschaftliche Leben behauptet. Sollte zwischen dem einen und dem anderen gar kein Zusammenhang bestehen? Alles in allem ein großer Mangel innerer Durchbildung, ein weites Zurückbleiben der formellen Verarbeitung hinter den Forderungen des zuströmenden Stoffes. Auch ein schroffer Kontrast zwischen den hochentwickelten Begriffssystemen der Spezialgebiete und solchem unfertigen Stande der Begriffe des allgemeinen Lebens.
Aber alle diese Mängel verhindern nicht, dass in den Begriffen der Gegenwart die Hauptrichtungen ihres Strebens zu deutlichem Ausdruck kommen, dass sie hier sowohl ihr Vermögen an den Dingen erweisen als auch einer Kritik zugänglich werden. Vor allem wird an den Begriffen sichtbar die unserer Zeit eigentümliche Gestaltung des Hauptgegensatzes, wie ihn jede kräftig bewegte Zeit, jede aber in besonderer Weise enthält. Es ist belangreich für alles Tun und Streben, dass heute dieser Gegensatz höchst allgemeiner Art ist; kämpfen doch augenscheinlich durch die ganze Weite und Breite der Existenz Gedankenrichtungen, für die hier der Kürze halber die Schlagwörter des Realismus und des Idealismus dienen mögen. Dort ein Aufgehen des Menschen mit seinem ganzen Denken und Handeln in eine gegebene, uns unmittelbar umfangende Wirklichkeit, der Mensch auch in seinem gesellschaftlichen Leben ein Stück einer weiteren Natur. Hier die Entwicklung der Hauptwirklichkeit aus ursprünglicher Tätigkeit des Geistes, ein Versuch, in diese Wirklichkeit alles übrige Dasein hineinzuziehen oder doch es ihr unterzuordnen.
Dieser Gegensatz ist uralt, aber dass er jetzt in eine völlig neue Phase getreten ist, zeigen gerade die Kämpfe an den Begriffen. Früher beschränkte sich die realistische Bewegung auf große Hauptzüge und fand ihre Aufgabe mehr in der Opposition gegen den Idealismus als in eigenem positiven Schaffen. Heute ist dieses zur Hauptsache geworden; der Realismus will sich die Wirklichkeit in ihrer ganzen Ausdehnung unterwerfen und sowohl nach der theoretischen als nach der praktischen Seite hin mit strenger Ausschließlichkeit alle Bedürfnisse befriedigen, für die sonst der Idealismus unentbehrlich schien. Er könnte solches Unternehmen nicht wohl angreifen, wäre nicht die unmittelbare Wirklichkeit durch die Erschließung weiter Gruppen, ja ganzer Reiche von Tatsachen, sowie die Entwicklung großer lebensumspannender Aufgaben dem Menschen unvergleichlich bedeutsamer geworden. Aber diese tatsächliche Leistung überschreitet der Anspruch des Naturalismus weit, indem er seine Ziele als alleingültig und seinen Daseinsraum als allumfassend erklärt. Um diesen Anspruch durchzusetzen, muss er die Naturbegriffe zu Weltbegriffen erweitern und nicht nur das Gesamtbild des Seins, sondern auch das Seelenleben seinen Maßen einfügen. Bei solchem Unternehmen aber stößt er aufs härteste zusammen mit dem Idealismus, der sich von der Geschichte her im Besitz befindet und diesen Besitz natürlich verteidigt; auf der ganzen Linie entbrennt ein heißer Kampf um Sein oder Nichtsein.
Es rückt aber dabei die neuaufstrebende Macht nicht in einer, sondern in zwei Gedankenmassen vor, einer von weiterer und einer von engerer Fassung. Einmal ist es das im Gesamteindruck erwachsende, unbestimmtere Bild der sinnlichen Wirklichkeit, dessen Anschaulichkeit der Naturalismus dem Idealismus entgegenhält; sodann aber konzentriert er sich zu einem präziseren Weltbilde gemäß den Vorstellungen der mechanischen Naturlehre mit ihren Massen und Bewegungen. Beides mag sich oft gegeneinander verwickeln, bei der Gesamtwirkung geht es unzweifelhaft Hand in Hand. Gerade die Verschmelzung einer weiterangelegten, mit scheinbarer Selbstverständlichkeit auftretenden Anschauung und der Zuspitzung zu einer bestimmteren Behauptung gibt dem Ganzen jene elementare Gewalt, mit der es auch heute noch gegen alle Widerstände unaufhaltsam vordringt.
Es wirkt aber die vereinte Macht beider auf die Begriffswelt sowohl unmittelbar als mittelbar. Jenes geschieht, wenn Begriffe oder Begriffsfassungen aus der sichtbaren Welt, besonders aber dem seelenlosen Naturgeschehen, nach allen Seiten vordringen und die ganze Wirklichkeit umspannen. So gilt z. B. die Natur als gleichbedeutend mit dem All und Wirklichsein scheint nichts anderes als Draußenvorhandensein. Begriffe wie Gegenstand, Tatsache, Gesetz, Entwicklung u. s. w. erhalten überall die besondere Fassung, welche sich an der Natur bewährt hat. Dabei dient oft der bildliche Ausdruck als eine Brücke von der Außenwelt zur Seele. Von einem Mechanismus der Seele sprach man zunächst in bloßem Bilde, aber das Bild hat nicht selten das Denken überwältigt und die Begriffe in den Vorstellungskreis des Naturalismus gezogen. Umgekehrt erscheinen Begriffe als endgültig abgetan, weil die sinnliche Wirklichkeit für sie keinen Platz hat. Die Ablehnung der Metaphysik, der Zweckbetrachtung u. s. w. erklärt sich zum guten Teil daraus; ferner auch dieses, wie geradezu ein intellektueller Makel den trifft, der irgendwelchen Begriff des Übernatürlichen wagt, auch wenn er ihn nicht als Anhänger eines Thomas von Aquino, sondern als Freund eines Spinoza oder Kant wagen sollte.
Je genauer wir die heutige Fassung der einzelnen Begriffe ansehen, desto mehr wird sich von solchem Einfluss des Naturalismus finden. Aber jener dürfte trotzdem überwogen werden von dem indirekten Einfluss, womit uns der Naturalismus umklammert, indem er uns das der Arbeit am sinnlichen Dasein entsprungene Gesamtbild von Welt und Leben mit seinen großen Richtlinien als das einzige und abschließende aufdrängt, und zwar unvermerkt aufdrängt. Hier umstrickt uns ein enggeflochtenes Gedankengewebe von innen her, und wir mögen uns oft auch da immer weiter darin verfangen, wo unser Bewusstsein völlig entgegengesetzte Richtungen einschlägt. Wenn es z. B. überall aussieht, als ob eine in der Hauptsache fertige Welt, eine "gegebene" Welt neben dem Menschen liege und sich ihm von draußen her mitteile, wenn in möglichst vielfacher Berührung und enger Verflechtung mit jener Welt der Kern des Lebens besteht, und dabei das was vom Gegenstande kommt, weit mächtiger und wichtiger dünkt als das, was der Mensch mit seinem Geist aufbringt, wenn überall die Leistung als die Hauptsache und die Kraftentwicklung als das höchste Gut erscheint, wenn ferner der ganze Lebensprozess in der einen Fläche des unmittelbaren Bewusstseins verlaufen und was sich hier darbietet, die letzte Erklärung enthalten soll, wenn das Seelenleben als eine bloße Nebenwelt behandelt und die ihm eigentümlichen Größen vom Gesamtbild des Alls sorgfältig ferngehalten werden, ist in dem allen und es wäre noch viel der Art anzuführen nicht unverkennbar der Einfluss der besonderen Vorstellung von der Wirklichkeit, welche die mechanische Naturlehre entwickelt und unablässig in ihrer Arbeit betätigt? Und erhellt nicht zugleich, dass damit die ganze Begriffsbildung von innen her aufs mächtigste gepackt und zu ihr selbst unbewussten Zielen hingelenkt wird? In Wahrheit entfaltet nach dieser Richtung vornehmlich die Zeit ihre Affekte und den Anspruch auf Selbstverständlichkeit wie wir sie oben schilderten. Auch wo wir uns auf dem Boden der Zeit entzweien und in feindliche Lager spalten, da besteht oft die Differenz in nichts anderem, als dass hier der Naturalismus unmittelbarer und offener, dort vermittelter und versteckter seinen Einfluss übt. Die kritische Begriffsforschung hat das nicht nur genauer ins Einzelne zu verfolgen, sie muss auch ermitteln, was von dem Realgehalt unserer Arbeit dem Naturalismus solche Macht verleiht; sie muss weiter prüfen, ob diese Leistung der Zeit den Forderungen sowohl des weltgeschichtlichen Standes von Leben und Arbeit als der vernünftigen Natur des Menschen entspricht.
Eine Kritik des Naturalismus auf dem eigenen Boden der Zeit übt der Idealismus mit seiner Verfechtung einer selbständigen Geisteswelt und seinem Streben, aus ihrem näheren Befund der ganzen Wirklichkeit einen Inhalt und Sinn zu geben. Aber dass dies Streben seine Kraft mehr aus den Ergebnissen der Vergangenheit als aus den Leistungen der Gegenwart zieht, das bekunden eben die Begriffe; nicht minder zeigen sie, dass die geschichtlichen Mächte weit weniger in dem Besonderen ihrer Art, als in einzelnen höchst allgemeinen Umrissen und Anregungen fortwirken. Das gilt gleichermaßen von den überkommenen drei Hauptformen des Idealismus: dem ethisch-religiösen innerer Umwandlung, dem ästhetischen künstlerischer Bildung und dem intellektuellen reiner Denkarbeit. Aus der ethisch-religiösen Lebensrichtung erhalten sich Begriffe wie Gesinnung, Gewissen, Charakter, Pflicht, an sich Gutes u. s. w., Begriffe, die der Naturalismus nur mit jämmerlicher Künstelei auf seinen eigenen Boden verpflanzen kann; es behauptet sich ferner gegenüber aller flachen Geistreichheit eines "Immoralismus" eine moralische Wertschätzung der Dinge mit sicherer Überlegenheit. Die ästhetische Lebensanschauung wirkt fort in Begriffen wie Bildung (harmonische Bildung), Kultur u. s. w., ferner aber in einer durchgehenden Schätzung von Ordnung, Form und Gestalt. Auch die Anhänger der mechanischen Naturlehre ergänzen und beleben oft dadurch ihr Weltbild. "Entwicklung" würde sich nicht mit solchem Wohllaut den Zeitgenossen einschmeicheln, klänge nicht darin die ältere Fassung des Begriffes nach mit ihrer Vorstellung eines ebenmäßigen Fortschreitens und einer sicheren Formgebung aus der Kraft und nach dem Gesetz eines Ganzen.
Den Intellektualismus mit seiner Umsetzung aller Wirklichkeit in einen welterzeugenden Denkprozess verrät nicht nur die beharrliche Neigung, Intellekt und Geist, intellektuelle und geistige Bildung, Gesamtinhalt und Begriff der Dinge einander gleichzusetzen, auf seiner Hinaushebung der Denkarbeit über die bloß seelischen Zustände ruhen auch unverlierbare Begriffe wie die der sachlichen Wahrheit, der sachlichen Notwendigkeit, der objektiven Vernunft u. s. w. Besonders stark aber ist sein Einfluss auf die Form unserer Arbeit. Hier liegen die stärksten Wurzeln des Strebens, alle Mannigfaltigkeit des Wirklichen auf Begriffe, ja auf Prinzipien zu bringen, und diese Prinzipien gegeneinander ins Feld zu führen. Was mehr gibt heute in Staat und Gesellschaft, in Wissenschaft, Kunst und Religion dem Kampf seine Schärfe und seine Leidenschaft als der Zusammenstoß solcher Prinzipien? Auch der Naturalismus kann sich zu Weltbegriffen nur entwickeln mit Hilfe jenes intellektuellen Faktors, selbst die Leugnung aller Prinzipien kleidet sich heute als Opportunismus in das Gewand eines Prinzipes. So ist die Zeit von der Geschichte her nicht arm an Bewegungen, welche dem Naturalismus widerstehen und ihn auch von innen her zersetzen. Aber nicht nur sind diese Bewegungen untereinander unausgeglichen, keine von ihnen erreicht auf dem Boden der Zeit eine zusammenhängende positive Wirkung; die vereinzelten Gegenströmungen aber mögen dem Naturalismus manchen Abbruch tun, überwinden können sie ihn nicht.
Kein Wunder, wenn sich in der Zeit ein Streben entwickelt nach einem Idealismus neuer und eigener Art, einer universelleren Form des Idealismus, die zugleich imstande sei, die durch die realistische Bewegung erschlossenen Tatsachen und Wahrheiten zu würdigen und sich anzueignen. Das Ziel dieses Strebens scheint unanfechtbar und die hervorragende Bedeutung einzelner Leistungen nach dieser Richtung sei unverkannt. Aber das Durchschnittsniveau dieser Bewegung erscheint eben in den Begriffen als unzulänglich gegenüber den Forderungen der Sache. Die Hauptbegriffe haben oft eine höchst abstrakte Fassung ohne alle zwingende und bindende Kraft. Es ist wenig gewonnen, wenn so vieldeutige Größen, wie Geist, Vernunft, Moral, Zweck u. s. w., mit aller Mühe aufrecht gehalten werden.
Ferner sind oft die den Begriffen innewohnenden Behauptungen so abgeschwächt, dass freilich der Widerspruch mit der Tagesmeinung verringert, aber zugleich auch alle charakteristische Art und Wirkung preisgegeben wird. Die Anhänger der Metaphysik verstehen diesen Begriff oft so bescheiden, dass mit jener der übrigen Erkenntnis nur eine nachträgliche hypothetische Betrachtungsweise hinzugefügt, nicht eine wesentliche Erhöhung des Ganzen aus ursprünglichem Vermögen erzielt wird. Nicht minder schwebt der Begriff der Religion in der Luft, wenn sie ein bloß subjektives Gefühl des Unendlichen bedeuten soll. Bei solcher Abschwächung aber wird die Position erst recht unhaltbar, denn nun erlischt alles Zwingende innerer Notwendigkeit, nun wird das Ganze auf eine entgegenkommende zufällige Stimmung angewiesen. Das Wenige, das dann noch bleibt, wird leicht erst recht ein Zuviel. Einer ähnlichen Mattheit des Idealismus entspringen Versuche, große und in Wahrheit unversöhnliche Gegensätze durch ein Ineinanderschieben der Begriffe auszugleichen. So hören wir viel von induktiver Philosophie, von einem Realidealismus, von immanenter oder gar natürlicher Religion sprechen; alles vergebliche Versuche, dem großen Entweder-Oder auszuweichen, das einmal durch das menschliche Dasein geht. Überhaupt gewahren wir hier die Neigung, die Schärfe der Probleme abzustumpfen, als Erscheinung festzuhalten, was im Wesen aufgegeben wird, die Konsequenzen anzunehmen, die Prinzipien aber zu verwerfen. Lauter Zeichen der Einschüchterung des Idealismus durch die Zeit, ein Bekenntnis seines Unglaubens an sich selbst. Den Idealismus stellt einmal seine eigene Natur in einen Widerspruch wie zu der Durchschnittslage, so auch zu der verschliffenen Durchschnittsmeinung. Den Versuch, sie durch eine gefällige Anpassung und schüchterne Rechtfertigung sich geneigter zu machen, bezahlt er zu teuer mit dem Verzicht auf alles, was an ihm kräftig und wertvoll ist. In diesen Dingen kann das größere leichter sein als das kleinere. Hier gilt es Mut und Kraft ursprünglichen Schaffens; wir müssen sie wiederfinden und werden sie finden, aber vielleicht werden wir sie erst in der Not, am Rande des Abgrundes wiederfinden.
So bleibt es dabei, dass dem Naturalismus im Zeitbewusstsein kein geschlossener Gedankenbau idealistischer Art entgegenwirkt. Aber er findet hier einen anderen vollgewachsenen Gegner, den freilich niemand dem Idealismus zurechnen kann, der aber unverkennbar mit einer seiner Hauptformen, dem Intellektualismus, eng zusammenhängt. Wir meinen den Subjektivismus, jene freie Entfaltung des Individuums, die es von allen geschlossenen Gedankenmassen emanzipiert, es der Welt gegenüberstellt und dabei fordert, dass sich dem Einzelnen alle Wirklichkeit darstelle, von ihm aus aller Lebensinhalt entwickele. Zugleich verlegt sich das Dasein des Einzelnen ganz in sein unmittelbares Vorstellen und Empfinden. Im Besonderen ist es die Vorstellung, die sich zwischen den Menschen und die Sache schiebt, mit ihrem Weiterspiegeln den Gegenstand immer wieder in ein Bild verwandelt und schließlich alle Wirklichkeit in lauter Phänomene, in bloße Schattenbilder zu verflüchtigen droht. Bei der endlosen Mannigfaltigkeit der Einzelnen und ihrer Lagen spalten sich dabei die Wege nach allen Richtungen, es entwickelt sich nebeneinander eine bunte kaleidoskopisch wechselnde Fülle von Ansichten, und wenn nun eine jede über den bloßen Punkt hinaus gelten will, so muss notwendig ein unablässiger Streit jedes gegen alle und aller gegen jeden entbrennen. In diesem Streit aber leicht ein gegenseitiges Sichüberbieten, ein Haschen nach Auffallendem, Frappierendem, Paradoxem, ein immer weiteres Zurückweichen einer objektiven Natur der Dinge, ein Erlöschen des Gefühls für das Gesunde und Wahre, eine Steigerung des Paradoxen zum Perversen, kurz ein unaufhörliches Sinken bis zur vollen Auflösung.
Den mannigfachen Stufen dieses Auflösungsprozesses entsprechen aber Abstufungen in der Gestaltung der Begriffe. Zunächst zeigt das gesamte Kulturleben eine stärkere Entwicklung von Begriffen, welche die subjektive Seite des Lebensprozesses, die Beziehung des Geschehens darauf deutlich hervorkehren. Nur daraus erklärt sich die Vorliebe für Begriffe wie Erscheinung, Wert, Erkenntnistheorie, kritisch, Optimismus Pessimismus u. s. w., nur daraus die unaufhörliche Sorge um eine rechte Abgrenzung von Subjektivem und Objektivem, nur daraus das Streben, die geistigen Grundprozesse, z. B. der Kunst, der Moral, der Religion, samt ihren Begriffen vom Subjekt her, "psychologisch", abzuleiten.
Schärfer zugespitzt erscheint dieser subjektivistische Zug in der Betonung der Verschiedenheit der einzelnen Menschen und des gleichen Rechtes aller. Die Richtung der Zeit dahin lässt uns alltäglich Begriffe wie Standpunkt, Gesichtspunkt, Ansicht u. s. w. verwenden. Auch nötigt sie uns Modernen, selbst die wohl erwogensten Lehren und Begriffe nicht sowohl als Erzeugnisse eines uns mit überlegener Notwendigkeit umfangenden Denkprozesses, sondern als subjektive Versuche eines grübelnden und tastenden Verstandes zu geben. Wir können einmal beim Schaffen nicht von uns selbst absehen, mit aller Mühe das Subjekt nicht loswerden. Wie groß ist hier der Unterschied zwischen den Systemen eines Kant oder Hegel mit ihren bezwingenden und zusammenhaltenden Ideen und dem eines Lotze, das uns in allem reinen Streben zur Sache und aller zähen Energie des Denkens keinen Augenblick vergessen lässt, dass wir die Ansicht eines Individuums, eines höchst geistvollen Individuums, aber eines Individuums vernehmen.
Mit solcher Subjektivität heutigen Verfahrens ist freilich auch gegeben eine erstaunliche Beweglichkeit in der Behandlung der Begriffe, ein unerschöpfliches Vermögen, verschiedene Seiten an ihnen hervorzukehren und sie in immer neue Beziehungen zu setzen, kurz alle Vorteile einer hochentwickelten freischwebenden Reflexion. Aber je mehr solche Reflexion die Sache aus dem Auge verliert, desto mehr verläuft die Freiheit in Willkür, desto mehr löst sich die Gemeinschaft geistigen Schaffens in lauter Sekten auf, desto wehrloser müssen die Begriffe allem Wechsel von Lage und Laune folgen, desto unwiderstehlicher wird die Versuchung, ihren natürlichen und einfachen Sinn gerade umzukehren. Ja, ein solches Überwuchern subjektiver Willkür muss schließlich alle Begriffe als geschlossene und gemeinsame Gedankengebilde von innen her zerstören und den Menschen wieder auf die wechselnde und schwankende Vorstellung zurückwerfen. So ein voller Rückfall in die Sophistik, wenn auch unter der Verbrämung schönklingender Namen. Das alles aber neben strengster wissenschaftlicher und technischer Arbeit auf den Spezialgebieten.
Dieser Subjektivismus verschlingt sich in unserer Zeit mit dem Naturalismus in wunderlichster Weise, aus gleichzeitiger Anziehung und Abstoßung erwächst eine schier unauflösliche Verwickelung. Subjektivismus und Naturalismus gehen ein gutes Stück Weges Hand in Hand. Beide sind einig in der Ablehnung eines substantiellen Idealismus, beide verlegen den ganzen Lebensprozess in die eine Fläche des unmittelbaren Bewusstseins, beide spalten die Wirklichkeit in lauter einzelne Elemente. Wenn ferner dem Naturalismus alles Geistesleben eine bloße Begleiterscheinung des Naturprozesses ist, so kann er es inhaltlich kaum anders verstehen als ein bloßes Vorstellen, ein Abspiegeln dessen, was draußen in Wirklichkeit geschieht. Die Gleichsetzung von Seele und Bewusstsein, die Voranstellung des Begriffes "Erscheinung" bei Natur und Seele u. a. m. bezeugen deutlich solche innere Übereinstimmung.
Aber gerade diese Übereinstimmung macht umso unerträglicher den Widerspruch, den hier alle nähere Ausführung hervortreibt. Beider Ausgangspunkt und beider Gedankenrichtung steht sich völlig entgegen, und es wird damit der Inhalt der Wirklichkeit hier und dort grundverschieden. Dort die Natur das Feste, alles Umfassende, alles Erzeugende, hier die Vorstellung das einzig Gewisse und für uns nichts wirklich, was nicht in ihr enthalten; dort die Seele ein Niederschlag des Naturprozesses, hier die Natur eine bloße Erscheinung im Seelenleben. Dort das Gegenständliche, hier das Zuständliche voran; dort eine ungeheure Schwere des Reiches der Massen, hier eine flatterhafte Leichtigkeit des Reiches luftiger Gedanken. Eine gegenseitige Verständigung ist dabei völlig ausgeschlossen, da jedwedes das Ganze sein will und es zu sein wollen muss, alsdann aber das andere eine Bedeutung erhält, die es schlechterdings nicht annehmen kann. Trotzdem vollzieht die Zeit eine gewisse Ausgleichung der unversöhnlichen Gegner: beim Stofflichen folgt sie dem Bilde der Natur mit seinem Reichtum und seiner Anschaulichkeit, in der Form des Lebens aber herrscht der Subjektivismus mit seiner Unmittelbarkeit und seiner Beweglichkeit. Aber so geraten wir nicht nur unter den Einfluss widerstreitender Gedankenmassen, werden bald hierher bald dorthin gezogen und müssen bekämpfen, was wir nicht entbehren können, sondern auch jede einzelne der Seiten erfährt die schwerste Beeinträchtigung. Den Naturalismus macht die alles durchdringende und zersetzende Reflexion matt und greisenhaft, er verliert für das geistige Schaffen eben die stürmische Jugendkraft, welche den Haupttitel seines Rechtes bildet; der bewegliche Gedanke aber wird gelähmt und zu Boden gedrückt, soll ihm ausschließlich der Naturprozess seinen Inhalt geben.
So trägt das Zeitleben in dem Eigensten seiner Art einen zerstörenden Widerspruch; unmöglich kann es bei sich selbst zur Ruhe kommen. Auch der Idealismus als Zeiterscheinung führt über solche Lage nicht hinaus, sowohl wegen seiner inneren Spaltung als wegen des Mangels an kräftiger Ausprägung. Wenn also heute die Zeit das Individuum mittels der Begriffe an sich zieht, so versetzt sie es damit nicht in sichere Bahnen und ruhige Arbeit, sondern sie führt es in die ärgste Verwickelung, die unerträglich werden muss, sobald ein klares Bewusstsein darüber aufgeht.
Für ein Streben darüber hinaus kann es aber offenbar bei einem so widersprechenden und verworrenen Stande unmöglich genügen, hier und da herumzubessern, dies und jenes zu verschieben, sondern das Ganze wird zum Problem; eine durchgreifende Erneuerung unseres intellektuellen Daseins und damit auch unseres Begriffsstandes (d. h. des Standes der allgemeinen Begriffe, von denen allein hier die Rede ist) erweist sich als ein dringendes Bedürfnis, eine unabweisbare Forderung.
Näheres von unseren Überzeugungen hinsichtlich dieser Dinge zu entwickeln, ist Sache der Untersuchung selbst, nicht der Einleitung. Nur eins noch sei hier bemerkt. Jenes der Zeit besonders charakteristische Vordringen des Naturalismus stützt sich sicherlich auf große Erfahrungen und enthält fruchtbare Keime zur Weiterbildung des gesamten Lebens. Aber der letzte Sinn dessen was hier aufstrebt, seine wahre geistige Bedeutung ergibt sich nicht im unmittelbaren Eindruck und von draußen her, nur ein es von innen her umfassender und aufhellender Lebensprozess kann darüber entscheiden. Ein solches überlegenes Tun aber, das die Arbeit der einzelnen Gebiete in sich aufnähme und ihren Ergebnissen ein ursprüngliches Schaffen aus dem Ganzen entgegensetzte, fehlt der Gegenwart. Jener Siegeszug des Naturalismus zeigt, dass das Gegenständliche, so sehr es in der geistigen Arbeit wurzelt, sich von ihr abgelöst hat und ihr, wie in sich selbst gegründet, fremd entgegentritt. Die Werke und Geschöpfe haben sich losgerissen von der schaffenden Kraft, sie werden ihr gegenüber riesengroß und wenden sich mit titanenhaftem Trotz gegen sie, sie wollen sie schließlich ganz erdrücken. Aber je weiter diese Bewegung fortschreitet, desto stärker muss zur Empfindung kommen, dass jene Werke des Geistes doch nur aus übertragener Kraft leben; diese Kraft muss sich mit wachsender Entfremdung vom mütterlichen Boden immer weiter von ihnen zurückziehen, und so wird ihr Inhalt immer mehr verblassen, das menschliche Dasein in aller Aufregung immer leerer werden. Umso mehr aber drängt es zugleich nach einer Konzentration und Neuentfaltung des Geisteslebens, damit seine lebendige Einheit den Werken gewachsen werde, es sich gegenüber der Zerstreuung als ein Ganzes behaupte und das Entfremdete, soweit es nicht endgültig verfeindet, wieder zu sich zurückziehe. Wenn für eine so ungeheure, vom nächsten Zeitanblick geradezu unmögliche Aufgabe die Wissenschaft nur mit und neben anderen Mächten arbeiten kann, so hat hier die Begriffsforschung erst recht eine bescheidene Rolle. Dass sie aber bei rechter Behandlung doch einiges beizutragen vermag, das sollte diese Einleitung zeigen. So sei denn das Werk in gutem Glauben ergriffen und alle Kraft dafür aufgeboten, dass die Leistung nicht zu weit hinter den Forderungen der Sache zurückbleibe.
Subjektiv - Objektiv
Aus der Geschichte der Ausdrücke subjektiv - objektiv ist namentlich bemerkenswert eine völlige Umkehrung der Bedeutung im Laufe der letzten Jahrhunderte. Bei Duns Scotus († 1308), der sie zuerst als feste Termini einander gegenüber stellte "hieß subjectivum dasjenige, was sich auf das Subjekt der Urteile, also auf die konkreten Gegenstände des Denkens bezieht; hingegen objectivum jenes, was im bloßen obicere, d. h. im Vorstelligmachen, liegt und hiermit auf Rechnung des Vorstellenden fällt" (s. Prantl, Geschichte der Logik im Abendlande III, 208). In diesem Sinne überlebten die Ausdrücke den Verfall der Scholastik und erscheinen so, freilich nur selten, noch zu Beginn des 18. Jahrhunderts, z. B. bei Bayle, Leibniz, Berkeley. Die Umkehrung erfolgte beim Übergang in die deutsche Sprache und zwar innerhalb der Wolffischen Schule; sie war vorbereitet durch eine Verschiebung der Begriffe dahin, dass bei "Subjekt" vor allem an die vorstellende Seele (s. z. B. Leibniz 645b [Erdm.]: subjectum ou l'âme même) gedacht wurde, während die Objekte sich vom Denken ablösen und ihm wie selbständig gegenübertreten. Aber auch in der neuen Bedeutung blieben die Ausdrücke zunächst auf die Schule beschränkt, wie z. B. ihre Verwendung im Streit zwischen Lessing und Götze zeigt; in den allgemeinen Sprachgebrauch brachte sie erst die Kantische Philosophie, zunächst bei uns Deutschen, alsdann bei den anderen Kulturvölkern.
Durch solche Wandlung der Bedeutung erhielt sich aber der begriffliche Gegensatz, sowie die ihn begründende Anschauung vom Verhältnis des Menschen zur Welt. Draußen, so scheint es, liegen die Dinge, der Mensch tritt heran und will sie in seiner Vorstellung nachbilden. Was er dabei aufbringt, bildet die subjektive, die eigne Beschaffenheit der Dinge dagegen die objektive Seite des Prozesses. Die Absicht der Erkenntnisarbeit ist natürlich, beides zur vollen Deckung zu bringen. Leicht verschärft sich aber die Spaltung dahin, dass "subjektiv" die bloß auf den Menschen beschränkte Vorstellung unter Abbruch aller Beziehungen zu den Dingen, und weiter noch, dass es die Sondermeinung des Einzelnen im Gegensatz zu einer allgemeinen Überzeugung bezeichnet. "Subjektiv" wird also zu "bloßsubjektiv" und schließlich zu "partikular". In neuer Wendung aber wächst der Gegensatz über das Denken hinaus und ergreift das Ganze des Lebens. Wo z. B. die Arbeit der Menschheit große Zusammenhänge entwickelt, da bildet sich in unserem eigenen Kreis ein Gegensatz zwischen dem, was uns in festen Einrichtungen umfängt, und was der Einzelne dabei empfindet, denkt und tut. So sprechen wir von subjektivem und objektivem Recht, von subjektiver und objektiver Religion. Die höchste Spannung erreicht aber die Sache mit der Aufwerfung der Frage, wie viel Realität, welche Gültigkeit dem menschlichen Lebensprozess überhaupt zukomme. Das Problem der Wahrheit erfasst unser ganzes Sein, überall der Gegensatz einer echten, im Element der Wahrheit befindlichen, und einer unechten, in Meinung und Wahn befangenen Lebensführung. Allerdings kann diese Frage zunächst töricht scheinen. Was brauchen wir uns dessen noch irgend versichern zu lassen, was wir bei uns selbst besitzen, und wie könnten wir auch unseren eigenen Kreis verlassen, uns auf einen fremden Standort versetzen und von hier aus messen, wie viel das Eigene bedeutet? Aber dem Unmöglichen muss sich doch wohl irgendein Sinn und vielleicht auch ein Weg abgewinnen lassen. Wenigstens zieht sich die Sorge um dies Problem durch die ganze Geschichte, und gerade die Höhepunkte geistigen Schaffens erschöpfen ihre beste Kraft in eigentümlichen Versuchen der Lösung. Es scheint einmal unser Leben nicht bei sich selbst geschlossen und befriedigt, vielmehr für sein eigenes Wohl angewiesen auf ein weiteres Sein, auf eine Wahrheit der Dinge, eine Unermesslichkeit des Alls. Nicht bloß von außen scheint uns dies All zu umgeben, sondern innerlich unserem Wesen verwachsen. Soll sich aber solche Anschauung irgend klären und entwickeln, so muss der Grundprozess des Lebens sich anders darstellen als in der alltäglichen Meinung, die Frage der Wahrheit unseres Tuns tritt in einen unlösbaren Zusammenhang mit der Fassung jenes Prozesses, und so hat auch die weltgeschichtliche Arbeit stets beides in Einem behandelt. Ein rascher Blick auf die Hauptphasen dieser Arbeit ist unerlässlich auch für uns, da sie alle in ihren Wirkungen bis in die Gegenwart fortleben. Den Hauptabschnitt bildet dabei der Gegensatz antiker und moderner Denkart; innerhalb der Neuzeit scheidet sich die Zeit vor und nach Kant.
Das Streben der sokratischen Schule hatte zum Hauptziel, wider die Sophistik die Festigkeit der geistigen Prozesse und Aufgaben, ihre Überlegenheit gegen die wechselnden Meinungen der Individuen zu behaupten. Solche Festigkeit schien aber einem Plato nur erreichbar, wenn unser Dasein überwölbt wird von einer großen Welt unvergänglichen Wesens, in sich ruhender Wahrheit; was unser eignes Sein an Idealität besitzt, das empfängt es aus dem Zusammenhange mit jener Welt. Diesen Zusammenhang aufrecht zu erhalten und mit aller Kraft zu entwickeln, das wird damit zur Seele des Lebens; an der Übereinstimmung mit jenem Reich des an sich Guten und Wahren hängt alle Wahrheit und aller Wert unseres Tuns; das Menschliche hat sein Maß an dem Kosmischen, die Hauptbewegung des Lebens geht von der Welt zum Menschen, von der Sache zur Vorstellung und Empfindung. Dabei können Denker wie Plato und Aristoteles nicht umhin, die Frage aufzuwerfen, wie denn ein solcher Verkehr zwischen dem All und uns überhaupt möglich sei. Die Antwort lautet aber dahin, dass der Mensch von Haus aus dem All innerlich verwandt sei. In seinem eigenen Wesen ist eben das vorhanden oder doch angelegt, was die große Welt an ihn heranbringt; nur weil das Auge von der Art der Sonne ist, kann es die Sonne schauen, sinnlich und geistig. So ist das Aneignen jener Welt zugleich ein Entwickeln unserer eigenen Natur, in der Berührung liegt recht eigentlich die Höhe des Lebens; je unmittelbarer und inniger diese Berührung, desto gehaltvoller und freudiger wird das Dasein, desto mehr ist die seelische Tiefe in ihm erschlossen. So das Preisen der Anschauung als dessen, was uns gänzlich mit den Dingen einigt, ein sehnsüchtiges Verlangen nach der Wahrheit und Weite des Alls als dem, was allererst unserem Dasein Ewigkeit und Glückseligkeit mitteilt. Diese Gestaltung des Lebensprozesses zu einem geistigen Verkehr zwischen Mensch und Welt entspricht der Denkart einer Zeit, welche die Natur noch seelischer und die Seele naturhafter fasste; sie konnte sich nicht entwickeln, ohne dass menschliche Größen unbegrenzt in das All einströmten, es künstlerisch belebten, aber zugleich auch der Wissenschaft verschlossen. Das große All ward ein Spiegelbild menschlichen Tuns; es war später eine Riesenarbeit, das hier um die ganze Wirklichkeit gesponnene Netz menschlicher Begriffe wiederaufzulösen. Aber den engen Zusammenhang dieses Verfahrens mit einem die Welt kräftig erfassenden und zu edler Schönheit gestaltenden Schaffen, wie es die Griechen auszeichnet, wird niemand verkennen.
Dass solches Ineinanderleben von Mensch und Welt der seelischen Innerlichkeit des ausgehenden Altertums und des beginnenden Christentums nicht mehr entsprach, ist ebenso gewiss, als dass die gewaltigen Wandlungen damals einen angemessenen wissenschaftlichen Ausdruck nicht gefunden haben. So konnte sich die antike Grundanschauung durch alle Erschütterungen behaupten. Sie zeigt ihre Macht in der Gestaltung der altchristlichen Gedankenwelt, namentlich auch bei der Dogmenbildung, sie hat in den Schulen des Mittelalters eine vollere Herrschaft geübt und sich zäher in den Stoff hineingearbeitet als je zuvor.
Hingegen wird die Auflösung jener Zusammenschiebung von Subjekt und Objekt, von Mensch und Welt die Aufgabe, woran die Neuzeit ihr eigenes Wesen gefunden hat. Nichts ist für sie charakteristischer als das Streben nach deutlicher Auseinandersetzung von beiden. Und zwar entspinnt sich dieser Prozess von beiden Seiten des Gegensatzes. Bei der Natur wird die Hineintragung menschlicher Begriffe als eine Entstellung empfunden und bekämpft. Es kommt zum Bewusstsein, dass wir bisher die Dinge durch den dichten Schleier unserer Vorstellungen und Interessen gesehen und daher uneigentlich, bildlich, wie in kindlichem Spiel erfasst haben. Nun sollen sie sich in ihren eigenen Beständen und Zusammenhängen enthüllen, der Mensch aber mit männlicher Klarheit die objektive Ordnung der Welt erkennen und anerkennen. Der vollen Autonomie, welche die Natur verlangt und erhält, entspricht die strengste Entfernung alles Bloßmenschlichen aus den Dingen. So in besonders beredter Ausführung Baco von Verulam.