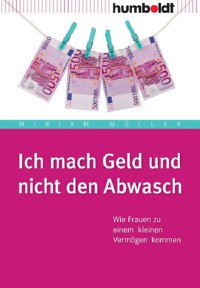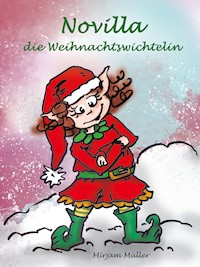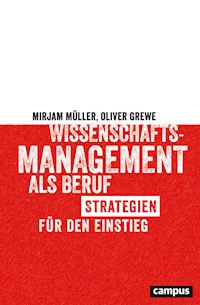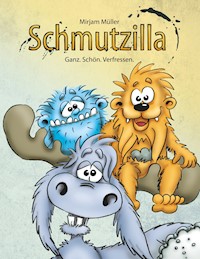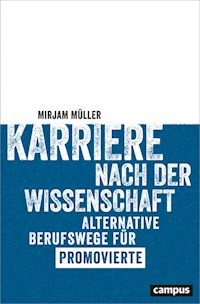Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Campus Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Karriere in der Wissenschaft fortzusetzen ist der Wunsch vieler Promovierender und Postdocs. Doch Professuren und andere wissenschaftliche Dauerstellen sind rar. Welche Anforderungen müssen erfüllt werden, welches implizite Wissen wird vorausgesetzt und wie kann eine Karrierestrategie aufgebaut werden? Mirjam Müller erklärt Hintergründe und benennt Erfolgsfaktoren der entscheidenden Phase zwischen Promotion und Professur. Für jeden Teilbereich des akademischen Portfolios zeigt sie, welche konkreten Schritte erforderlich sind und wie das eigene Profil schlüssig präsentiert werden kann. Neben den Leistungsanforderungen werden auch die Rahmenbedingungen am Arbeitsplatz Wissenschaft beleuchtet: Welche Stellenoptionen und Berufsziele bietet er? Wie lassen sich Wissenschaft und Familie vereinbaren? Wie können Zeitmanagement und erste Führungsaufgaben gelingen? Der vollständig überarbeitete Ratgeber zeigt Strategien für die Karriereplanung auf, ermöglicht eine persönliche Bilanz und dient als Entscheidungshilfe für eine Karriere in der Wissenschaft.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 348
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mirjam Müller
Promotion – Postdoc – Professur
Karriereplanung in der Wissenschaft
Campus Verlag
Frankfurt / New York
Über das Buch
Die Karriere in der Wissenschaft fortzusetzen ist der Wunsch vieler Promovierender und Postdocs. Doch Professuren und andere wissenschaftliche Dauerstellen sind rar. Welche Anforderungen müssen erfüllt werden, welches implizite Wissen wird vorausgesetzt und wie kann eine Karrierestrategie aufgebaut werden?Mirjam Müller erklärt Hintergründe und benennt Erfolgsfaktoren der entscheidenden Phase zwischen Promotion und Professur. Für jeden Teilbereich des akademischen Portfolios zeigt sie, welche konkreten Schritte erforderlich sind und wie das eigene Profil schlüssig präsentiert werden kann. Neben den Leistungsanforderungen werden auch die Rahmenbedingungen am Arbeitsplatz Wissenschaft beleuchtet: Welche Stellenoptionen und Berufsziele bietet er? Wie lassen sich Wissenschaft und Familie vereinbaren? Wie können Zeitmanagement und erste Führungsaufgaben gelingen? Der vollständig überarbeitete Ratgeber zeigt Strategien für die Karriereplanung auf, ermöglicht eine persönliche Bilanz und dient als Entscheidungshilfe für eine Karriere in der Wissenschaft.
Vita
Mirjam Müller arbeitet als Personalentwicklerin an der Universität Konstanz. Berufliche Stationen führten die Historikerin von einem Wirtschaftsunternehmen ins Wissenschaftsmanagement. Als Wissenschaftscoach hat sie zahlreiche Postdocs auf dem Weg zu ihrer ersten Professur und in Berufsfelder außerhalb der Wissenschaft begleitet.
Übersicht
Cover
Titel
Über das Buch
Vita
Inhalt
Impressum
Inhalt
Vorwort
1.
Einführung: Karrieren in der Wissenschaft
Karrierechancen und -risiken
Karrieretypen in der Wissenschaft
Aufbau und Angebote des Ratgebers
2.
Die Postdoc-Phase im Überblick
Heterogenität der Postdoc-Phase
Die R2-Phase
Die R3-Phase
Wahl des wissenschaftlichen Umfelds
Rollenwechsel: Der Start in die Postdoc-Phase
3.
Das akademische Portfolio
3.1
Forschungsprofil
3.2
Publikationen
3.3
Habilitation oder Äquivalent
3.4
Drittmitteleinwerbung
3.5
Preise und Auszeichnungen
3.6
Vorträge
3.7
Netzwerke und Mentor*innen
3.8
Internationale Kooperationen
3.9
Tätigkeit als Gutachter*in
3.10
Engagement in Fachgesellschaften
3.11
Lehre
3.12
Wissenstransfer
3.13
Praxiserfahrung
3.14
Führung und Betreuung
3.15
Gremientätigkeit
3.16
Organisation und Management
3.17
Das akademische Portfolio im Überblick
4.
Rahmenbedingungen der akademischen Karriere
4.1
Stellen- und Stipendienvarianten
Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in auf einer Haushaltsstelle (R2/R3)
Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in in einem Drittmittelprojekt (R2/R3)
Eigene Stelle (R2/R3)
Postdoc-Stipendium (R2)
Habilitationsstipendium (R3)
Postdoc-Fellowship (R2)
Juniorprofessur/W1-Tenure-Track-Professur (R3)
Nachwuchsgruppenleitung (R3)
Akademische Rätin/Akademischer Rat (R2/R3)
Heisenberg-Programm (R3)
Vertretungsprofessur (R3)
Privatdozentur/Außerplanmäßige Professur (R3)
Lehrkraft für besondere Aufgaben (R2/R3)
Senior Researcher und andere neue Stellenvarianten (R3)
4.2
Beschäftigungsbedingungen
Eingruppierung/Besoldung/Stipendienhöhe
Sozialversicherung
Arbeitszeit
Befristungsregelungen
Berufliche Mobilität
4.3
Stellenausschreibungen und Bewerbung
Wissenschaftliche Stellen und Fellowships
Junior- und W1-Tenure-Track-Professuren
Stellen aus selbst eingeworbenen Drittmitteln und Stipendien
Mit Eigeninitiative Stellen finden
Bewerbungsrelevante Unterlagen aktuell halten
Entscheidung über Bewerbungen
4.4
Berufsziele in der Wissenschaft
4.5
Vereinbarkeit von Wissenschaft und Familie
5.
Strategien für die akademische Karriere
5.1
Netzwerken
5.2
Schreiben
5.3
Sichtbarkeit
5.4
Zeitmanagement und Balance
Wichtiges erkennen und Prioritäten setzen
Alle Rollen einplanen
Die persönliche Leistungskurve einbeziehen
Zeit sparen durch Feedback
Work-Life-Balance
Selbstkritik mit Achtsamkeit begegnen
Tipps und Tricks
5.5
Karriereplanung
1.
Erreichtes reflektieren
2.
Feedback einholen
3.
Karrierewissen ergänzen
4.
Fähigkeiten, Werte und Ziele reflektieren
5.
Eine Entscheidung treffen
6.
Strategisch planen
7.
Ressourcen nutzen
5.6
Alternative Karriereszenarien
Hürden und Chancen
Berufliche Alternativen identifizieren
Netzwerke nutzen
Sich außerhalb der Wissenschaft bewerben
6.
Schlusswort: Entscheidung für die Wissenschaft?
Anhang
Ausschreibungen für wissenschaftliche Stellen und Stipendien
Fachübergreifende Stellenportale
Datenbanken zur Stipendiensuche
Fachspezifische Mailinglisten und Stellenportale
Ausschreibungsdienst für Professuren
Stellen- und Stipendienvarianten für Postdocs
Walter Benjamin-Programm [D]
Eigene Stelle
Postdoc-Stipendien
Habilitationsstipendien und -programme
Fellowships in interdisziplinären Kollegs
Nachwuchsgruppenleitungen
Heisenberg-Programm [D]
Internationale Mobilität
Datenbanken für internationale Mobilität
Programme für internationale Mobilität
Netzwerke im Ausland
Forschungsförderung
[D][A][CH] Beratung zur Forschungsförderung
Datenbanken zur Forschungsförderung
[D][A][CH] Europäische Kommission
[D] Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)
[D] Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)
[D] VolkswagenStiftung
[D] Fritz Thyssen Stiftung
[A] Österreichischer Wissenschaftsfonds FWF
[A] Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft FFG
[CH] Schweizerischer Nationalfonds (SNF)
Preise und Auszeichnungen
Datenbanken und Übersichten zu Wissenschaftspreisen
Preise für Postdocs (Beispiele)
Netzwerke
Fachgesellschaften
Akademien der Wissenschaften
Junge Akademien der Wissenschaften
Institutes for Advanced Study
Soziale Netzwerke und Online-Plattformen für die Wissenschaft
Drittmittelförderung für Netzwerke
Interessenvertretungen
Frauenförderung
[D][A][CH] Frauenförderung von Forschungsinstitutionen
[D][A][CH] Dual-Career-Angebote
[D][A][CH] /femconsult
[D] Förderung der Erstberufung exzellenter Wissenschaftlerinnen (W2/W3)
[D] Fraunhofer TALENTA
[D] Zia – Visible Women in Science and Humanities
[A] FWF-ASTRA-Preise
[CH] Flexibility Grant
[CH] Gleichstellungsbeitrag
Mentoring
[D][A] Forum Mentoring
[A] Mentoringprogramm der ÖAW
[CH] Réseau romand de mentoring pour femmes
Weiterbildung
[D][A][CH] Weiterbildungsangebote von Forschungseinrichtungen
[D] Deutscher Hochschulverband (DHV)
[D] German Scholars Organization (GSO)
[D] Helmholtz-Akademie für Führungskräfte
[D] Helmholtz Career Development Centers for Researchers
[D] Leibniz-Akademie für Führungskräfte
[D] Zentrum für Wissenschaftsmanagement (ZWM)
[A] LBG Career Center
Wissenschaftscoaching
[D][A][CH] Coaching-Angebote von Forschungseinrichtungen
[D][A][CH] Coachingnetz Wissenschaft
[D] Deutscher Hochschulverband (DHV)
[D] German Scholars Organization (GSO)
[A] LBG Career Center
Kompetenzmodelle und Career Planner
Kompetenzmodelle für die Wissenschaft
Individual Career Planner
Internetressourcen
[D][A][CH] EURAXESS
[D] academics
[D] Deutscher Bildungsserver
[D] DHV-Karriere-Newsletter PLUS
[D] doktorandenforum.de
[D] Forschung & Lehre
[D] Infocenter des Deutschen Hochschulverbands
[D] Karriereportal der DUZ – Deutsche Universitätszeitung
[D] Young Scientist Newsletter
Literaturempfehlungen
Ratgeber für die Promotion
Ratgeber für die Postdoc-Phase
Ratgeber für Berufungsverfahren
Ratgeber zu Bewerbungen auf Professuren an Hochschulen für angewandte Wissenschaften
Ratgeber für die Professur
Forschung
Publizieren
Vorträge
Drittmitteleinwerbung
Lehre
Führung
Organisation und Management
Wissenschaftskommunikation
Wissenschaftliche Netzwerke
Zeitmanagement und Balance
Vereinbarkeit von Wissenschaft und Familie
Alternative Karrierewege
Literatur
Anmerkungen
Vorlagen für Ihre Reflexion
Mein akademisches Portfolio
Rating meines akademischen Portfolios
Rückwärtsplanung
Vorwort
Ich arbeite seit mehr als 20 Jahren in der akademischen Karriereförderung und über 15 Jahre als Wissenschaftscoachin. Zu Beginn fragte ich meinen Chef, der als Mitglied einer Hochschulleitung für die Förderung von Promovierenden und Postdocs zuständig war, nach den Regeln einer akademischen Karriere. Zu meiner Verwunderung antwortete er etwas vage, dass diese nicht ganz eindeutig und größtenteils nicht schriftlich fixiert seien. Als ich ihn aber fragte, was er seiner Tochter für ihre akademische Karriere raten würde, hatte er sofort eine sehr präzise Anleitung parat. Diese Szene war für mich ein Schlüsselerlebnis. Seither beschäftigt mich in meiner Arbeit die Frage, nach welchen informellen Regeln akademische Karrieren verlaufen und welche Strategien sich daraus für Promovierende und Postdocs ableiten.
Das Wissen zur akademischen Karriere für alle transparenter zu machen und Promovierende sowie Postdocs dazu zu ermutigen, ihre Karriereplanung aktiv anzugehen, war meine Motivation für die 2014 erschienene erste Auflage des vorliegenden Buches. Seitdem hat sich die Unterstützung für akademische Karrieren verbessert: Alle Wissenschaftseinrichtungen engagieren sich in der Personalentwicklung und bieten Beratung rund um Karrierethemen an. Auch bei den Rahmenbedingungen gab es Impulse und Diskussionen, wie das Tenure-Track-Programm, die Kampagne #IchbinHanna, die Evaluation des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes, Pläne zu seiner Novellierung und zu Dauerstellenkonzepten. Die Regeln und Bedingungen von akademischen Karrieren sind jedoch nur wenig transparenter geworden. Zeit also für eine grundlegende Aktualisierung des Ratgebers trotz der nach wie vor dynamischen Zeiten.
Im Entstehungsprozess des Buches und seiner Überarbeitungen standen mir zahlreiche Promovierende, Postdocs und Professor*innen mit ihrem fachspezifischen Wissen und ihren persönlichen Erfahrungen mit akademischen Karrieren zur Seite. Mit Mitgliedern von Hochschulleitungen, Verantwortlichen aus Forschungsförderung, Hochschulpolitik und Interessenvertretungen konnte ich aktuelle Entwicklungen und praktische Umsetzungen diskutieren. Mein besonderer inhaltlicher Dank gilt meinem langjährigen Chef an der Humboldt-Universität zu Berlin, Prof. Dr. Hans Jürgen Prömel (später Gründungspräsident der TU Nürnberg), der mir als Erster die formellen und informellen Regeln einer wissenschaftlichen Karriere aus der Perspektive eines Professors und Mitglieds einer Hochschulleitung nahegebracht hat. Seine Tochter, damals Studentin, ist heute tatsächlich Professorin – auch wenn sie einige der Ratschläge ihres Vaters für sich angepasst hat. Weitere Mitglieder von Hochschulleitungen, mit denen ich an der Universität Konstanz zu strategischen Fragen der akademischen Karriereförderung zusammengearbeitet habe, haben meinen Blick auf Wissenschaftskarrieren geschärft. Stellvertretend sei Prof. Dr. Ulrich Rüdiger (jetzt Präsident der RWTH Aachen), Prof. Dr. Malte Drescher (jetzt Präsident der RPTU Kaiserslautern-Landau) und Prof. Dr. Isabell Otto gedankt.
Treibende Kraft für mein Lernen zu den Herausforderungen von akademischen Karrieren für Promovierende und Postdocs sowie ihren drängendsten Fragen waren meine Coachees sowie die Teilnehmer*innen meiner Workshops und Vorträge. Sie haben mir die vielen individuellen Varianten und Umstände einer akademischen Karriere bewusst gemacht und verdeutlicht, dass erst ausreichende Informationen eine gute Entscheidung ermöglichen. Danken möchte ich nicht zuletzt meinen Kolleg*innen an der Universität Konstanz, im Coachingnetz Wissenschaft e. V. und in den Netzwerken für Personalentwicklung und Karriereförderung für die Reflexion von Karrierefragen, das Teilen von Wissen sowie Feedback zu verschiedenen Versionen des Buches. Dem Campus Verlag gilt mein herzlicher Dank für die langjährige vertrauensvolle Zusammenarbeit.
1.Einführung: Karrieren in der Wissenschaft
Es gibt viele gute Gründe, eine akademische Karriere anzustreben. Neugier und Wissensdurst zu folgen, Unbekanntes zu erforschen und offene Fragen zu beantworten, kann begeistern, intellektuell herausfordern und Sinn stiften. Das wissenschaftliche Arbeiten ist im Vergleich zu vielen anderen Berufen in Bezug auf Themen, Methoden und Zeiteinteilung sehr selbstbestimmt. Inspirierenden Wettbewerb und Anerkennung bietet die internationale Fachcommunity. Trotz wachsender Wissenschaftsskepsis genießt der Beruf »Hochschulprofessor*in« laut Forsa-Umfrage von 2023 bei 63 Prozent aller Deutschen hohes Ansehen.1 Kein Wunder also, dass Professor*innen mehrheitlich beruflich (sehr) zufrieden sind.2
Karrierechancen und -risiken
Für die Promotions- und Postdoc-Phase bietet das deutsche Wissenschaftssystem zahlreiche Finanzierungsoptionen, sei es eine aus Grundmitteln der Forschungseinrichtung finanzierte Stelle, eine Drittmittelstelle oder ein Stipendium. So ist beispielsweise die Anzahl wissenschaftlicher und künstlerischer Mitarbeitender an Hochschulen von 2012 bis 2022 von 167.722 auf 212.320 gestiegen.3 In den vergangenen zweieinhalb Jahrzehnten wurden durch die Einführung von Nachwuchsgruppenleitungen (Emmy Noether-Programm 1999), Juniorprofessuren (2002), Tenure-Track-Professuren (verstärkt seit 2017) und jüngst Dauerstellenkonzepten neue Karrierewege geschaffen. So gibt es vor allem nach der Promotion eine Vielzahl verschiedener Stellen- und Stipendienvarianten.
Aufgrund des gewachsenen Stellenangebots bleibt eine größere Anzahl von Wissenschaftler*innen nach der Promotion an Hochschulen und Forschungsinstituten, mit ihren wissenschaftlichen Fähigkeiten, Ideen und dem Wunsch, ihr Leben lang forschen zu können. Während unter Promovierenden 50 Prozent eine Tätigkeit in der Wissenschaft anstreben, sind es bei Postdocs 84 Prozent.4 Jedoch zeigt die Statistik, dass nur etwa 5 Prozent aller Promovierten in Deutschland eine Professur erhalten.5 Selbst von den Personen, die zehn Jahre nach der Promotion noch in der Wissenschaft beschäftigt sind, bekommt rechnerisch nur jede*r Vierte oder Fünfte eine Professur.6 Auf eine Professur berufen zu werden, ist also eher die Ausnahme als die Regel. Als Alternative werden derzeit Dauerstellenkonzepte diskutiert und implementiert, die jedoch, soweit absehbar, nicht in großem Umfang zur Verfügung stehen werden. Daher bleibt das Karriererisiko in der Wissenschaft hoch.
Die Beschäftigungsunsicherheit kann gerade in einer Lebensphase, in der familiäre Beziehungen Zeit und Kontinuität benötigen, eine große Belastung darstellen. Das ist einer der Gründe, warum der Frauenanteil in der Wissenschaft auf jeder Qualifizierungsstufe weiter abnimmt. Während der Frauenanteil bei den Studienabschlüssen 2022 bei 53 Prozent lag, sank der Anteil bei den Promotionsabschlüssen auf 46 und bei den Habilitationen auf 37 Prozent.7 Bei Juniorprofessuren waren 2022 immerhin 49 Prozent mit Frauen besetzt, bei W2-, W3- und vergleichbaren Professuren lediglich 27 Prozent.8 Zudem üben die hohen quantitativen und qualitativen Anforderungen an Publikationen und Drittmitteleinwerbung vor allem auf Postdocs Druck aus.9 Auch die geforderte berufliche Mobilität, befristete Arbeitsverträge sowie die genannten unsicheren beruflichen Perspektiven gehören zu den Schattenseiten des akademischen Karrierewegs. All diese Aspekte fanden 2021 durch die Kampagne #IchbinHanna10 und die Diskussionen um die Novelle des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes (WissZeitVG)11 in der deutschen Öffentlichkeit große Beachtung. Obwohl die Schwierigkeiten also bekannt sind und viele Lösungsansätze vorgeschlagen wurden, werden sie das deutsche Wissenschaftssystem voraussichtlich weitere Jahre prägen.
Angesichts der genannten Umstände ist es nicht verwunderlich, dass akademische Karrieren als nicht planbar gelten. Viele Professor*innen schreiben ihre eigene Berufung dem Glück zu und halten den Erfolg in Berufungsverfahren allgemein für abhängig von Zufall oder Gelegenheit.12 Dies rekurriert auf das Freiwerden von Professuren im richtigen Zeitfenster und die inhaltliche und persönliche Passung zur konkreten Ausschreibung.13 Hinzu kommt, dass neben dem meritokratischen Prinzip (»Bestenauslese«) auch Netzwerke, äußere Faktoren und interne Machtkonstellationen in die Personalauswahl hineinspielen. Daher gibt es in der Tat kein Rezept, das die Berufung auf eine Professur garantiert. Aber es gibt Qualifikationsanforderungen und Qualitätsindikatoren, die Grundlage für eine erfolgreiche Bewerbung sind. Diese variieren zwischen einzelnen Disziplinen. Professor*innen eines Fachs sind sich – etwa in einer Berufungskommission – jedoch überwiegend einig, was die Indikatoren für wissenschaftliche Qualität sind und wie diese für die Bewerbung auf eine Professur nachgewiesen werden sollten.
Diese und andere Regeln sind für viele Promovierende und Postdocs jedoch nicht transparent. Die traditionelle Vermittlung wissenschaftlicher Konventionen durch erfahrene Wissenschaftler*innen an ihre Schüler*innen ist spätestens seit der Öffnung des deutschen Universitätssystems ab den 1960er Jahren und den Reformen der akademischen Karriereförderung ab den 1990er Jahren nicht mehr ausreichend: Wissenschaftler*innen in frühen Karrierephasen profitieren heute von einer größeren wissenschaftlichen Unabhängigkeit, zugleich ist durch die gewachsene Anzahl an Studierenden, Promovierenden und Postdocs, aber auch durch vermehrte Verwaltungs- und Evaluationsaufgaben keine intensive Betreuung in der Breite möglich. In der Regel haben nur diejenigen, die fördernde Vorgesetzte und Mentor*innen haben, ausreichend Zugang zum notwendigen Karrierewissen.
Karrieretypen in der Wissenschaft
Wie gehen promovierte Wissenschaftler*innen mit diesen Karrierebedingungen um? Funken et al. beschreiben drei Karrieretypen, die sich nach ihrer Einschätzung der eigenen Karrierechancen und ihrer Aufstiegsorientierung unterscheiden:14
Die »Hoffnungsvollen« blicken optimistisch in die Zukunft. Der Konkurrenzdruck in der Wissenschaft ist ihnen bewusst und sie hadern damit. Aber sie begreifen sich als aktive Gestalter*innen ihres eigenen Lebens und sind aufstiegsorientiert, streben also eine Professur an. Früh haben sie sich für die akademische Karriere entschieden und betreiben aktive Karriereplanung. Sie haben Auslandsaufenthalte und Ortswechsel absolviert und sich eine Reputation aufgebaut. Sie zeigen Leidenschaft für die wissenschaftliche Arbeit, eine hohe Wettbewerbsorientierung sowie ein hohes Selbstbewusstsein. Nicht zuletzt verfügen sie sowohl über Mentor*innen als auch über Unterstützung in ihrer Partner*innenschaft.
Die »Fatalist*innen« fühlen sich dem Wissenschaftssystem ausgeliefert, eine aktive Gestaltung der Karriere erscheint ihnen schwer möglich, die Aufstiegsorientierung zur Professur hin mangels wissenschaftlicher Alternativen erzwungen. Sie haben geringes Selbstbewusstsein und glauben nicht an ihren Erfolg. Eine Abgrenzung gegen Unsicherheit und Druck scheint ihnen unmöglich. Dadurch ist ihre Arbeit zeitlich entgrenzt und belastet sie stark. Sie sind weniger in Netzwerke eingebunden, erfahren kaum Förderung und haben Betreuungskonstellationen teilweise konflikthaft erlebt. Auch private »Stabilisator*innen« fehlen ihnen.
Die »Spielverweiger*innen« lehnen die Regeln des Wissenschaftssystems ab. Sie streben eine unbefristete wissenschaftliche Mitarbeitendenstelle an oder haben diese bereits inne. Teilweise haben sie noch die Absicht, sich weiter zu qualifizieren, eine Professur oder der langfristige Verbleib in der Wissenschaft erscheinen ihnen jedoch nicht möglich. Sie sind stark intrinsisch motiviert, die wissenschaftliche Arbeit empfinden sie als sinnstiftend. Sie betreiben keine aktive Karriereplanung, sehen eigene Defizite in Leistung und Passung, haben wenige oder hauptsächlich emeritierte Förder*innen. Private »Stabilisator*innen« fehlen.
Im Wissenschaftscoaching begegnen mir diese drei Karrieretypen oft in der fortgeschrittenen Postdoc-Phase.15 Ihre Karrierechancen fallen in der Wissenschaft erfahrungsgemäß unterschiedlich aus. Einen weiteren Typus treffe ich vor allem in der frühen Postdoc-Phase häufig:
Die »Orientierungslosen« lassen sich hauptsächlich von ihrer Motivation für Forschung und Lehre sowie von Gelegenheiten leiten. Nach der Promotion wurde ihnen eine weitere wissenschaftliche Stelle angeboten und teilweise über die Jahre mehrfach verlängert. Oder sie haben das Wissenschaftssystem gewechselt und sind erst seit Kurzem in Deutschland. Sie haben Freude an der wissenschaftlichen Arbeit und die momentanen Arbeitsumstände erscheinen ihnen meist erträglich. Die nächsten Qualifizierungsschritte, wie Projekte, Vorträge und Publikationen, sind ihr Ziel, mittel- bis langfristige Perspektiven können nur grob umrissen werden. Hierfür fehlt es auch an Karrierewissen, wie detaillierteren Informationen zu Qualifikationsanforderungen und Rahmenbedingungen, nicht zuletzt, weil sie nur über ein begrenztes wissenschaftliches Netzwerk verfügen.
Vielleicht finden Sie sich in einem oder mehreren dieser Karrieretypen wieder. Die Zugehörigkeit zu einem der Typen (und möglichen weiteren)16 muss nicht statisch sein. Durch veränderte Umstände, wie den Antritt einer neuen Stelle in anderem Arbeitsumfeld, erfolgreiche oder gescheiterte Drittmittelanträge, die Geburt eines Kindes, oder durch eine veränderte Karrierestrategie können sich die Einschätzung der eigenen Karrierechancen und auch die Aufstiegsorientierung wandeln.17 Im Wissenschaftscoaching geht es mir darum, mit Wissenschaftler*innen individuelle Strategien für die aktive Karriereplanung zu entwickeln, aber auch Wissenslücken zur akademischen Karriere zu schließen. So kann für »Hoffnungsvolle« im Coaching das Thema Zeitmanagement und Balance wichtig sein, für »Fatalist*innen« die Aspekte Netzwerken, Sicherheit und Sichtbarkeit, für »Spielverweiger*innen« die Themen Bilanz, Karriereplanung und alternative Karriereszenarien, für »Orientierungslose« können spezifisches Karrierewissen und Karriereplanung wichtige Impulse bringen.
Aufbau und Angebote des Ratgebers
Dieses Buch möchte Ihr Wissen zur akademischen Karriere in strukturierter und kompakter Form ergänzen und Ihnen aus der Coaching-Praxis eine Handreichung für Ihre individuelle Reflexion und strategische Karriereplanung geben. Damit sollen Ihre Handlungsoptionen erweitert werden, sodass Sie im komplexen und von vielen äußeren Faktoren abhängigen Karrieresystem Wissenschaft navigieren und passende Entscheidungen für Ihren Karriereweg treffen können. Im Fokus steht die Postdoc-Phase, in der entscheidende Weichen für eine akademische Karriere gestellt werden.
Kapitel 2 gibt einen Überblick über die Postdoc-Phase, indem die Heterogenität dieser Karrierephase und ihre Teilabschnitte erläutert werden. Zudem finden Sie Hinweise, wie Sie ein unterstützendes Umfeld wählen und gut in die Postdoc-Phase starten.
In Kapitel 3 geht es um Ihr wissenschaftliches Qualifizierungsprofil, das akademische Portfolio. In den Unterkapiteln werden seine 16 Teilbereiche vorgestellt und gezeigt, welche Erwartungen damit innerhalb des Wissenschaftssystems verbunden sind, wie Sie die Qualifikation in Ihrem Wissenschaftsalltag erwerben können und welche Prioritäten Sie dabei für eine akademische Karriere setzen sollten.
Kapitel 4 widmet sich den Rahmenbedingungen einer akademischen Karriere. In den Unterkapiteln werden Stellen- und Stipendienvarianten, Beschäftigungsbedingungen und Bewerbungsfragen, wissenschaftliche Berufsziele sowie die Vereinbarkeit von Wissenschaft und Familie erläutert.
In Kapitel 5 geht es um Strategien für Ihre akademische Karriere, die häufig im Wissenschaftscoaching adressiert werden. Zuerst werden dafür Netzwerken, Schreiben, Sichtbarkeit und Zeitmanagement näher betrachtet. Danach werden sieben Schritte für die strategische Karriereplanung vorgeschlagen und Möglichkeiten zur Erkundung alternativer Karriereszenarien aufgezeigt.
Kapitel 6 schließt mit der Frage nach der Attraktivität der Berufsziele Professur und Dauerstelle für Ihre Entscheidung über eine akademische Karriere.
Dargestellt sind Prinzipien, die für die Mehrzahl der Disziplinen gelten. An einigen Stellen wird auf Besonderheiten einzelner Fächer oder Fächergruppen hingewiesen. Der Schwerpunkt liegt auf Forschungseinrichtungen18 in Deutschland. Viele der Ausführungen sind jedoch grundsätzlich auf den gesamten deutschsprachigen Raum übertragbar.
Im Anhang finden Sie weiterführende Informationen, beispielsweise zu Stellenbörsen und Netzwerken, zu Forschungsförderung und Preisen, zu Weiterbildung und Coaching. Zusätzlich zum deutschen Wissenschaftssystem sind dort auch die entsprechenden Informationen für Österreich und die Schweiz zusammengestellt. Für die weiterführende Lektüre zu einzelnen Aspekten der akademischen Karriere werden Literaturempfehlungen gegeben.
Die Inhalte des Buches sind auf Grundlage der Fragen zusammengestellt worden, die mir in meiner Arbeit mit Postdocs am häufigsten begegnen. Sie können die Kapitel in der vorgestellten Reihenfolge lesen oder bei den Themen starten, die Sie besonders interessieren. Querverweise stellen Bezüge zwischen den Kapiteln her, wo dies zum Verständnis oder zur Vertiefung des jeweiligen Themas beiträgt.
Zusätzlich zum vermittelten Wissen können Sie den Karriereratgeber auch als Arbeitsbuch nutzen, um bisher Erreichtes zu bilanzieren, die nächsten Karriereschritte zu konkretisieren und Ihr akademisches Portfolio schlüssig nach außen zu präsentieren. Dafür finden Sie am Ende jedes Unterkapitels in Kapitel 3 Impulse zur Darstellung im wissenschaftlichen Lebenslauf, zur Positionsbestimmung sowie für Schritte für die nächsten drei Jahre.
Darstellung im wissenschaftlichen Lebenslauf
Hinweise, wie die Qualifikationen in einem wissenschaftlichen Lebenslauf am besten dargestellt werden, finden Sie im Abschnitt »Darstellung im wissenschaftlichen Lebenslauf«. Bei Bewerbungen in der Wissenschaft kommt Ihrem Lebenslauf eine zentrale Rolle zu. Im Verlauf der Postdoc-Phase sollten Sie dort immer mehr karriererelevante Rubriken aufführen können.
Positionsbestimmung
Gelegenheit, Ihre bisherige Leistung auf dem im Unterkapitel vorgestellten Gebiet zu bilanzieren, finden Sie im Abschnitt »Positionsbestimmung«. Diese hilft Ihnen, den eigenen Wissens- und Qualifikationsstand zu reflektieren und eine Planungsgrundlage für nächste Schritte zu schaffen.
Schritte für die nächsten drei Jahre
Nach der Bilanz des Erreichten kann der Blick nach vorn gerichtet werden. Planen Sie nun, wie Sie Ihr Profil vervollständigen können. In die Planungsboxen können Sie konkrete nächste Schritte für die kommenden drei Jahre eintragen und festlegen, wann Sie diese umsetzen wollen.
Reflexionsfragen
Am Ende der Kapitel 4, 5 und 6 finden Sie Reflexionsfragen. Sie helfen Ihnen, Ihre bisherige Erfahrung zu bilanzieren, Handlungsoptionen zu identifizieren und Ihre Prioritäten zu klären. Dies kann Sie dabei unterstützen, wichtige Karriereentscheidungen fundiert und passend zu Ihrer individuellen Situation zu treffen.
Beispiele aus dem Coaching
Beispiele aus dem Coaching beschreiben typische Herausforderungen für Postdocs und zeigen, wie meine Coachees sie in ihrer individuellen Situation gelöst haben. Selbstverständlich sind alle persönlichen Angaben anonymisiert und lassen keine Rückschlüsse auf reelle Personen zu.
Intrinsische Motivation, Leidenschaft für Ihre wissenschaftlichen Themen und Durchhaltevermögen gehören zu den Grundvoraussetzungen für eine akademische Karriere.19 Karrierewissen und strategische Karriereplanung sind jedoch spätestens in der Postdoc-Phase unabdingbare Werkzeuge. Sie können das Navigieren im unsicheren akademischen Karrieresetting erleichtern und Ihre Chancen im hoch kompetitiven deutschen Wissenschaftssystem erhöhen. Sie sich anzueignen ist Teil Ihrer Eigenverantwortung für Ihren Berufsweg. Nicht zuletzt schaffen Karrierewissen und Karriereplanung eine Grundlage für Ihre Auseinandersetzung, ob Sie sich nach den Regeln des deutschen Wissenschaftssystems richten wollen und welche Entscheidungen Sie für Ihren weiteren Berufsweg treffen.
Ich wünsche Ihnen eine erkenntnisreiche Lektüre!
2.Die Postdoc-Phase im Überblick
In der Postdoc-Phase werden viele wichtige Weichen für eine weitere akademische Karriere gestellt. Sie hat einen doppelten Charakter: Zum einen tragen Postdocs mit ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit, die auf der Promotion und mehrjähriger wissenschaftlicher Arbeitserfahrung aufbaut, maßgeblich zu Forschung und Lehre in ihren Fächern bei. Zum anderen gilt die Postdocs-Phase im deutschen Wissenschaftssystem als weitere Qualifizierungsphase. Implizit wird erwartet, dass Postdocs sich für die Berufung auf eine Professur oder für andere wissenschaftliche Dauerstellen und Führungspositionen weiterqualifizieren. Während die Promotion für zahlreiche Berufsfelder von Vorteil ist, ist die weitere wissenschaftliche Tätigkeit in der Regel nur für Berufsziele in der Wissenschaft karriererelevant.
Heterogenität der Postdoc-Phase
Noch stärker als die Promotion ist die Postdoc-Phase höchst heterogen.20 Dies fängt bereits bei der Bezeichnung an. Während sich der Begriff »Postdocs« in den meisten Naturwissenschaften traditionell auf die ersten zwei bis vier Jahre nach der Promotion bezieht, wird er in jüngerer Vergangenheit häufig fachübergreifend als umfassende Bezeichnung für promovierte Wissenschaftler*innen mit weiterer wissenschaftlicher Qualifizierungsabsicht und Befristung verwendet.21 Unter diesen Oberbegriff können unterschiedliche Finanzierungsarten und Stellenvarianten gefasst werden, wie wissenschaftliche Mitarbeitendenstellen, Nachwuchsgruppenleitungen, Junior- und Tenure-Track-Professuren, Positionen als Akademische*r Rät*in, Postdoc-Stipendien, Vertretungsprofessuren sowie weitere Stellenkategorien verschiedener Bundesländer (siehe Kapitel 4.1).
Das Wissenschaftszeitvertragsgesetz (WissZeitVG) sieht in seiner derzeitigen Fassung für die Qualifizierung für eine Professur oder wissenschaftliche Dauerstelle nach der Promotion sechs Jahre vor (in der Medizin neun Jahre) (siehe Kapitel 4.2). Nach der Neufassung des Gesetzes könnten dies in Zukunft nur noch vier Jahre sein. Vergleicht man das durchschnittliche Promotionsalter mit dem durchschnittlichen Erstberufungsalter für W2- und W3-Professuren, so liegen rund zwölf Jahre dazwischen.22 Innerhalb dieser Zeitspanne können mehrere Phasen unterschieden werden: Das Modell der Europäischen Kommission, das immer häufiger auch von Forschungseinrichtungen verwendet wird, unterteilt die Karrierephase in zwei Profile: Mit »Recognized Researcher« (R2) werden Promovierte bezeichnet, die noch nicht vollständig unabhängig sind. Daran anschließend werden Forschende zu »Established Researchers« (R3), die ein gewisses Maß an Unabhängigkeit entwickelt haben.23 Das Statistische Bundesamt differenziert drei Phasen: eine »Übergangs- und Orientierungsphase« von ein bis zwei Jahren, eine wissenschaftliche »Qualifizierungsphase« von bis zu sechs Jahren sowie eine »Bewerbungsphase« von etwa zwei Jahren.24 Beide Modelle gehen also davon aus, dass im Karriereabschnitt zwischen Promotion und Professur unterschiedliche Phasen durchlaufen werden, die mit einem Zuwachs an Aufgaben, Verantwortlichkeiten und auch Freiheitsgraden als unabhängige*r Forschende*r einhergehen.
Die R2-Phase
In den ersten zwei bis vier Jahren nach der Promotion (R2-Phase) geht es darum, Unabhängigkeit von den Betreuer*innen der Promotion und immer mehr Eigenständigkeit in der Forschung zu gewinnen. Für eine akademische Karriere im deutschsprachigen Raum gilt es, ein neues Forschungsthema zu wählen, das erkennbar von der Doktorarbeit abgegrenzt ist (siehe Kapitel 3.1). Damit gewinnen Sie die für eine Professur geforderte ausreichende Breite innerhalb Ihres Fachs und richten sich auf eine Habilitation oder habilitationsäquivalente Leistungen aus (siehe Kapitel 3.3). Mit dem neuen Thema machen Sie sich durch Vorträge und Publikationen in Ihrer Fachcommunity bekannt und knüpfen neue fachliche Netzwerke im In- und Ausland. Sie werben kleinere eigene Drittmittelförderungen ein und lassen möglicherweise Ihre Doktorarbeit für einen Preis vorschlagen. Sie erwerben oder erweitern Ihre Lehrerfahrung und finden unter Ihren Vorgesetzten oder Promotionsbetreuenden Mentor*innen. Im Team kommen Ihnen verantwortungsvollere Aufgaben zu, die Sie in eine Sandwich-Position zwischen Promovierenden und Vorgesetzten bringen.
Zu den Anforderungen an akademische Karrieren gehören auch Ortswechsel und Auslandsaufenthalte, für einige Stellen ist dies Voraussetzung (siehe Kapitel 4.2). Als Wissenschaftler*in sollen Sie sich in unterschiedlichen Forschungskontexten bewährt, verschiedene Ansätze und Methoden kennen gelernt und tragfähige fachliche Netzwerke geknüpft haben. Es ist daher empfehlenswert, für die frühe Postdoc-Phase die Forschungseinrichtung innerhalb Deutschlands zu wechseln oder ins Ausland zu gehen (siehe Kapitel 3.8).
In der R2-Phase müssen bereits wichtige Weichen für die langfristige akademische Karriere gestellt werden, gleichzeitig dient diese Phase häufig auch der Orientierung: Zum einen gilt es, sich als immer selbstständigere*r Wissenschaftler*in im akademischen System zu etablieren, zum anderen findet nach Abschluss der Promotion und im Ankommen in der neuen Rolle häufig eine Reflexion statt, ob der akademische Karriereweg tatsächlich dem Berufswunsch entspricht. 75 Prozent der Promovierten verlassen in den ersten vier Jahren nach der Promotion die Wissenschaft.25 Es ist zu erwarten, dass eine Verkürzung der Postdoc-Phase im Wissenschaftszeitvertragsgesetz oder der Umbau der Stellenstruktur hin zu weiteren Dauer- oder Tenure-Track-Stellen die R2-Phase noch stärker zu einer Entscheidungsphase werden lässt und der dort wahrgenommene Leistungsdruck steigt.
Die R3-Phase
In der darauffolgenden R3-Phase sind Sie nach der Nomenklatur der Europäischen Kommission etablierte*r oder anerkannte*r Forschende*r und haben einen Grad an Unabhängigkeit erreicht. Auch im deutschen Wissenschaftssystem ist dieser Karriereabschnitt von einer größeren Eigenständigkeit in der Forschung und höheren Verantwortlichkeit in Organisation und Management gekennzeichnet, er wird aber dennoch als Qualifizierungsphase gesehen. Im Mittelpunkt stehen die Habilitation oder andere habilitationsäquivalente Leistungen. Zusätzlich geht es darum, immer mehr derjenigen Kompetenzen zu erwerben, die für eine Professur erforderlich sind, also Studierende und Promovierende zu betreuen, größere Drittmittel eigenständig einzuwerben, Projekte zu leiten und eine eigene Arbeitsgruppe aufzubauen. Ziel ist es, ein individuelles Profil als Wissenschaftler*in zu entwickeln und mit diesem in der Fachcommunity sichtbar zu sein. Gegen Ende der R3-Phase können Sie sich auf Lebenszeitprofessuren bewerben, die in Deutschland nach ihrer Besoldungsgruppe als W2- und W3-Professuren bezeichnet werden.
Die R2- und die R3- Phase findet sich in den meisten Fächern wieder, auch wenn damit teilweise unterschiedliche Qualifikationsanforderungen für die Berufbarkeit auf eine Professur verbunden sind. Während in einigen Geisteswissenschaften eine vertiefte, längerfristige Arbeit an Quellen erforderlich ist, die in eine Habilitation oder ein zweites Buch mündet, stehen in den meisten Naturwissenschaften der Aufbau einer eigenen Arbeitsgruppe und die Akquise von Drittmitteln im Mittelpunkt.26 Für jeden dieser beiden Karriereabschnitte der Postdoc-Phase gibt es verschiedene Stellen- und Stipendienvarianten, die ausführlicher in Kapitel 4.1 beschrieben werden.
Wahl des wissenschaftlichen Umfelds
Die Wahl des wissenschaftlichen Umfelds ist in der Postdoc-Phase karriereentscheidend. Eine namhafte Institution und angesehene Vorgesetzte gelten als Zeichen, dass Ihre Forschung hochwertig ist. Auch die Wahrscheinlichkeit, dass Sie dort anregende Impulse für Ihre Forschung bekommen, kann an einem Ort, an dem die Besten Ihres Fachs forschen, höher sein. In einer größeren Forschungsinstitution bieten sich mehr Möglichkeiten zur Vernetzung. Dies kann sich positiv auf Ihre Publikationsbilanz niederschlagen. Schauen Sie bei einem Stellenangebot daher neben den formalen Aspekten auch auf die Qualität der Forschung der Arbeitsgruppe oder Institution, die Aktualität ihrer Forschungsmethoden und ihr Ansehen in der Fachcommunity. Diese Indikatoren lassen sich in der Regel leicht auf der Webseite der Arbeitsgruppe durch einen Blick auf Publikationen oder Drittmitteleinwerbungen in Erfahrung bringen. Auch der Grad an Unabhängigkeit, den die Forschungseinrichtung Postdocs gewährt, Maßnahmen der Karriereförderung und das Angebot interner Forschungsfonds können Auswahlkriterien für die Wahl des wissenschaftlichen Umfelds sein.
Ebenso wichtig für Ihre Karriere ist es, sich Arbeitsklima und Unterstützung in der potenziellen neuen Arbeitsgruppe anzuschauen. Sind die Vorgesetzten dafür bekannt, ihre Promovierenden und Postdocs zu fördern? Sind sie gut vernetzt und binden sie ihre Mitarbeitenden in nationale und internationale Netzwerke ein? Werden Sie dort Gelegenheit zur Entwicklung haben und möglicherweise Mentor*innen gewinnen, die mit Ihnen über Ihre Karriereentwicklung sprechen und weitere Perspektiven eröffnen (siehe Kapitel 3.7)? Herrschen in der Arbeitsgruppe innovative, interdisziplinäre und teamorientierte Arbeitsbedingungen, die nachweislich positiv zu Arbeitsleistung und Kompetenzerwerb beitragen?27 Dies können Sie besser einschätzen, wenn Sie sich in Ihren Netzwerken umhören. Auch hier lohnt sich der Blick auf die Webseite der Arbeitsgruppe: Sehen Sie sich die Erfolge früherer oder derzeitiger Mitarbeitender an, zum Beispiel hinsichtlich ihrer Präsenz auf Konferenzen, erfolgreicher Promotions- und Habilitationsabschlüsse oder der Berufung auf Professuren.
Rollenwechsel: Der Start in die Postdoc-Phase
Nachdem die Endphase der Promotion weitgehend von der Ausrichtung auf ein Hauptprojekt geprägt war, kommen in der Postdoc-Phase weitere, zum Teil neue Aufgaben, Projekte und Verantwortlichkeiten hinzu.28 Möglicherweise übernehmen Sie vermehrt Betreuungsaufgaben und befinden sich zwischen Vorgesetzten, Promovierenden und Studierenden in einer Sandwich-Position, in der Sie einerseits bereits Führungsaufgaben übernehmen, andererseits aber an die Weisung Ihrer Vorgesetzten gebunden sind. Vielleicht haben Sie national oder international die Hochschule gewechselt und müssen sich in eine neue Forschungsinstitution und eine neue Arbeitsgruppe mit neuen Vorgesetzten und Kolleg*innen einfinden. Der Wechsel von der Promotion zur Postdoc-Phase ist daher mehr als der Antritt einer neuen Stelle, sondern bedeutet den Übergang in eine neue Karrierephase und das Einnehmen einer neuen Rolle. Viele Postdocs spüren zu Beginn eine Verunsicherung und Überforderung. Dies liegt – wie bei jedem wesentlichen Karriereschritt – in der Natur der Sache, wird aber selten adressiert.
Es ist ratsam, sich mit der neuen Rolle auseinanderzusetzen. Wer sind Sie jetzt? Was brauchen Sie, um Ihre Rolle gut ausfüllen zu können? Welche Aufgaben wollen Sie nicht mehr übernehmen? Wie erkennen andere Ihre neue Rolle? Erkunden Sie die Kultur der neuen Arbeitsgruppe. Welche Regeln und Umgangsformen gelten? Was ist anders, als Sie es bisher kannten? Was ist genauso oder zumindest ähnlich? Wie wollen Sie sich einbringen?
Planen Sie in jeder Woche ausreichend große Blöcke für Ihre Forschung ein, also die Arbeit an Projekten und insbesondere für das Schreiben. Legen Sie die Blöcke in die Tageszeit, in der Sie sich am besten konzentrieren können, schalten Sie Störfaktoren wie Internet, E-Mail und Telefon aus (siehe Kapitel 5.2 und 5.4). Machen Sie gute Lehre. Aber setzen Sie sich dafür ein begrenztes Zeitbudget. Prüfen Sie, für welche wiederkehrenden Fragen, etwa nach Anforderungen für Hausarbeiten, Sie Standardantworten vorbereiten können. Stellen Sie klare Regeln für Rückfragen und Sprechstunden auf, sodass Zeit für Ihre Forschung bleibt (siehe Kapitel 3.11).
Eignen Sie sich strategisches Karrierewissen an (siehe Kapitel 5.5). Was sind die Qualifikationsanforderungen in Ihrem Feld für die weitere akademische Karriere? Wie sollten Sie Themen und Publikationsorgane wählen? Was für ein Netzwerk brauchen Sie? Was sind die gesetzlichen Rahmenbedingungen? Wer sind Ansprechpersonen an Ihrer Institution?
Nicht zuletzt: Seien Sie freundlich gegenüber sich selbst. Erlauben Sie sich einen Lernprozess: Sie müssen nicht alles gleich perfekt machen. Verdeutlichen Sie sich, was Sie als Postdoc schon erreicht haben. Überlegen Sie, wie Sie bisher Übergänge gemeistert haben und was sie daraus mitnehmen können. Sorgen Sie für privaten Ausgleich und Pausen und geben Sie sich Zeit für das Ankommen in der neuen Rolle.
3.Das akademische Portfolio
Auswahlkommissionen in der Wissenschaft beurteilen Kandidat*innen anhand ihrer wissenschaftlichen Leistung sowie der fachlichen und persönlichen Passung. Anders als bei Bewerbungen auf wissenschaftliche Stellen in der Promotions- und Postdoc-Phase, bei denen es häufig um methodische und thematische Vorkenntnisse für ein Forschungsprojekt geht, erwarten Berufungskommissionen, dass Kandidat*innen bereits das breite Tätigkeitsprofil einer Professur in Forschung, Lehre und Management möglichst von Beginn an abdecken können.29 Als Nachweis Ihres Könnens gilt, dass Sie bereits Erfahrung mit den entsprechenden Aufgaben gesammelt haben, idealerweise in einem renommierten Kontext.
Aus diesen Anforderungen ergibt sich ein akademisches Portfolio mit 16 Teilbereichen. Während der Promotion oder zu Beginn der Postdoc-Phase können Sie naturgemäß erst wenige Teilbereiche abdecken. Entsprechend ist es Ziel der Postdoc-Phase, nach und nach Erfahrungen in allen 16 Kategorien des akademischen Portfolios zu sammeln. Auch für die Bewerbung auf andere Dauerstellen scheint dies aus heutiger Sicht relevant. Beachten Sie dabei aber, dass einige Teilbereiche aus Sicht von Berufungs- und anderen Auswahlkommissionen deutlich wichtiger sind als andere (siehe Kapitel 3.17). Setzen Sie daher entsprechende Prioritäten.
Abbildung 1: Das akademische Portfolio
In den folgenden Unterkapiteln werden die einzelnen Teilbereiche eines akademischen Portfolios vorgestellt. Zu Beginn wird erklärt, welche Bedeutung dem jeweiligen Teilbereich für Berufungsverfahren und eine akademische Karriere im Allgemeinen zukommt. Am Ende der Unterkapitel können Sie Ihre bisherige Leistung darin bilanzieren und nächste Schritte planen. In Kapitel 3.17 werden das akademische Portfolio und die Prioritäten von Auswahlkommissionen im Überblick betrachtet. Dort finden Sie Anregungen für die Zusammenführung Ihrer persönlichen Bilanz.
3.1Forschungsprofil
In der Postdoc-Phase geht es darum, ein individuelles Forschungsprofil zu entwickeln und sich damit in der Fachcommunity zu etablieren. War die Promotion die erste eigenständige Forschungsleistung, so gilt es nun, diese Eigenständigkeit in weiteren Arbeiten fortzusetzen und wissenschaftliche Unabhängigkeit von den Betreuer*innen der Promotion und anderen Vorgesetzten zu gewinnen. Ihre Forschungsleistung und ein innovatives, zur Institution passendes Forschungsprofil stellen bei Berufungsverfahren wichtige Auswahlkriterien dar.
In den ersten ein bis zwei Jahren nach der Promotion ist es noch üblich, Ergebnisse aus dem Dissertationsprojekt zu publizieren. Gleichzeitig sollte jedoch das Thema des zweiten Buches, der Habilitationsschrift oder der habilitationsäquivalenten Leistungen ausgewählt und begonnen werden. Orientieren Sie sich, an welchen Forschungseinrichtungen in Deutschland und international Ihr geplantes Forschungsgebiet führend vertreten ist. Einen Überblick können Sie durch einschlägige Publikationen, auf Konferenzen, in Gesprächen mit Ihren Mentor*innen oder im Portal »GERiT« der DFG erhalten. Das Portal ermöglicht es, in einer fein strukturierten Systematik fachlich einschlägige Institute zu recherchieren.
Finden Sie heraus, welche Schulen oder fachlichen Ansätze in Ihrer Fachcommunity existieren und ob diese in einem inhaltlichen Disput stehen. Machen Sie sich bewusst, wie sich Ihr geplanter Forschungsansatz zu diesen Schulen oder Ansätzen stellt und wo Sie Ihre wissenschaftliche Heimat sehen. Vermutlich ist es nicht möglich, gegensätzliche Schulen gleichermaßen zu bedienen. Entsprechend wird auch die Resonanz der Fachcommunity auf Ihre Arbeit geteilt ausfallen. Auch Erfolgschancen bei der Bewerbung auf eine Professur können gerade in den Geistes- und Sozialwissenschaften vom Kräfteverhältnis der an der jeweiligen Universität vertretenen Ansätze abhängen.
Beachten Sie bei der Wahl Ihres zweiten großen Forschungsthemas folgende Aspekte:
Komplementarität: Für eine akademische Karriere im deutschsprachigen Raum gilt der Grundsatz, dass der Forschungsschwerpunkt der Postdoc-Phase komplementär zum Promotionsthema angelegt sein muss, damit Sie die notwendige fachliche Breite vertreten können. Die Abgrenzung zum Promotionsthema bedeutet in jedem Fach Unterschiedliches: Ist die Promotion auf einem empirischen Ansatz begründet, sollte das zweite große Forschungsthema theoretisch fundiert werden. Behandelt die Promotion ein literarisches Genre in der einen Sprache, sollte das Habilitationsprojekt sich meist auf Literatur einer anderen Sprache der Sprachfamilie stützen. Ist die Promotion in der einen Epoche verankert, sollte das zweite Buch einen Fokus auf eine weitere Epoche legen. War der Doktorarbeit eine bestimmte wissenschaftliche Methode zugrunde gelegt, sollten für habilitationsäquivalente Leistungen eine andere genutzt oder die bisherige Technik erweitert und auf einen anderen Themenbereich angewendet werden. Es ist ratsam, mit erfahrenen Kolleg*innen Ihres Fachs zu diskutieren, ob das von Ihnen angedachte Thema ausreichend komplementär angelegt ist und sich zudem strategisch für ein attraktives Forschungsprofil eignet.
Aktualität: Weiteres Kriterium für die Themenwahl sollte die Aktualität der Forschungsfrage sein. Mit einem Thema, zu dem seit mehreren Jahren nichts Substanzielles mehr publiziert wurde, können Sie in der Regel in der Fachcommunity keine Anerkennung finden. Es sei denn, Sie sind in der Lage, durch einen innovativen Blick auf das bekannte Thema oder die Verknüpfung mit einem aktuellen Ansatz relevantes Neues zu schaffen. Ebenso scheint sinnvoll, abzuschätzen, ob sich Ihr potenzielles Thema in einem Forschungszweig befindet, der auch noch in den nächsten fünf bis zehn Jahren Potenzial hat. Zugegebenermaßen ist eine Prognose für die Zukunft nicht immer akkurat, da neue Durchbrüche und Trends das Feld beeinflussen können. Sichern Sie sich hinsichtlich der Aktualität durch Diskussionen mit Fachleuten ab, auf deren Urteil Sie vertrauen.
Innovation: Neben der Aktualität, der Relevanz Ihrer Fragestellung und der methodischen Fundierung Ihrer Herangehensweise sollte Ihr Postdoc-Forschungsvorhaben durch seinen innovativen Charakter überzeugen. Idealerweise sollte es nicht nur neue Erkenntnisse liefern, sondern auch einen Beitrag zur Weiterentwicklung des Forschungsgebiets leisten. Hoch anerkannt ist es, wenn es Ihnen gelingt, mit Ihrer Forschung ein Thema oder einen Ansatz zu etablieren, die von der Fachcommunity aufgegriffen werden.
Fachliche Einschlägigkeit: Die großen Forschungsfragen unserer Zeit lassen sich häufig nur durch eine fächerübergreifende Zusammenarbeit beantworten. Gerade die innovativsten Forschungsansätze befinden sich oft an den Grenzen der Disziplinen. Interdisziplinäre Forschungserfahrung gilt daher bei der Besetzung von Professuren als Pluspunkt und wird zunehmend in Stellenausschreibungen explizit gefordert. Die Professuren selbst sind jedoch im deutschsprachigen Raum fast immer disziplinär ausgeschrieben, ebenso findet die Begutachtung von Drittmittelprojekten häufig vor einem disziplinären Hintergrund statt. Um bei der Bewerbung erfolgreich zu sein, müssen Sie daher eine einschlägige disziplinäre Ausbildung und Forschungserfahrung nachweisen. Wenn Sie Ihr Fach zwischen Studium und Habilitation wechseln, ist es wichtig, dass Sie sich in der neuen Fachcommunity vernetzen und Ihre Ergebnisse in den Zeitschriften und auf den Konferenzen dieses Fachs präsentieren. Darüberhinausgehende interdisziplinäre Erfahrung wird Ihnen positiv angerechnet. Verorten Sie sich klar in einem Fach und kooperieren Sie von diesem Ausgangspunkt aus mit Forschenden anderer Disziplinen. Oder wenden Sie Methoden anderer Disziplinen an und beziehen Sie deren Ergebnisse auf Ihre Herkunftsdisziplin.
Leidenschaft: Nicht zuletzt sollten Sie bei der Wahl Ihres Forschungsthemas Ihren Interessen und Ihrer Begeisterung folgen. Sie werden sechs Jahre und länger mit diesem Thema verbringen, und vermutlich werden Sie nur das nötige Durchhaltevermögen aufbringen, die Unwägbarkeiten aushalten und die zeitlichen Opfer bringen, wenn das Thema Sie wirklich fasziniert. Aller Erfahrung nach werden Sie andere nur dann für Ihre Forschungsergebnisse begeistern können und die Fachcommunity für sich gewinnen, wenn Sie selbst Begeisterung dafür verspüren. Es lohnt sich, hier dem inneren Weg von Interesse, Spaß und Faszination zu folgen und diesen mit den eben skizzierten strategischen Überlegungen zu kombinieren.
Diese Ratschläge zur Wahl des Forschungsthemas für die Postdoc-Phase sollen kein Plädoyer für den wissenschaftlichen Mainstream sein. Sie sollen Sie vielmehr zu einer klugen Reflexion der Forschungsszene Ihres Fachs ermutigen, so dass Sie vor deren Hintergrund zu einer realistischen Einschätzung und strategischen Positionierung Ihrer Forschung gelangen. Auf dem Weg zu Ihrer ersten Professur und darüber hinaus braucht Ihre Forschung Unterstützer*innen in Ihrem Fach, die Ihre Ergebnisse für wissenschaftlich relevant halten (siehe Kapitel 3.7). Haben Sie für Ihren Forschungsansatz keine Befürworter*innen in der Fachcommunity, ist fraglich, ob eine Weiterverfolgung sich lohnt (siehe Kapitel 5.5).
Beschäftigen Sie sich frühzeitig damit, auf welche Professuren Sie sich in Zukunft bewerben wollen. Für eine Professur in Deutschland sollte Ihr Profil einschlägig für die Denomination von Lehrstühlen in Ihrem Fach sein. In vielen Fächern gibt es einen Kanon, der sich über Jahrzehnte kaum verändert. Es kann hilfreich sein, eine mittelfristige Marktanalyse Ihres Fachs im Hinblick auf freiwerdende Professuren zu unternehmen und diese bei der Gestaltung Ihres Forschungsprofils einzubeziehen.30 Auch nach der Wahl Ihres zweiten großen Forschungsthemas sollten Sie Ihr Profil im Blick behalten, etwa bei der Zu- oder Absage von Publikationen oder Konferenzbeiträgen, die außerhalb Ihrer Kerngebiete liegen, bei der Wahl neuer Stellen oder der Beantragung von Drittmitteln. Fragen Sie sich, ob diese Aktivitäten Ihr Forschungsprofil stärken und attraktiver machen.
In Berufungsverfahren werden Sie häufig aufgefordert, ein Forschungsprofil oder Forschungskonzept einzureichen.31 Auch vor der Bewerbung auf eine Professur kann es hilfreich sein, sich Zeit zu nehmen, um das eigene Forschungsprofil zu verschriftlichen. Stellen Sie dafür die drei Schwerpunkte, an denen Sie gearbeitet haben, also Promotion, Habilitation oder Äquivalent sowie ein Seitenthema, in Stichpunkten oder einem halbseitigen Text dar. Überlegen Sie sich für die Schwerpunkte attraktive Überschriften, die anschlussfähig an aktuelle Forschungsfelder oder Hauptströmungen in der Forschung sind und zugleich Ihre Alleinstellungsmerkmale herausarbeiten. Die Erstellung eines schriftlichen Forschungsprofils erfordert Zeit und Muße, hilft Ihnen jedoch, sich mit Ihrem individuellen Profil prägnant zu präsentieren (siehe Kapitel 5.3) und gegebenenfalls Teile des Profils strategisch zu erweitern.
Wichtiges Thema für die Forschung ist derzeit der öffentliche Zugang zu wissenschaftlichen Veröffentlichungen, Forschungsdaten, Metadaten, Bildungsressourcen, Software, Quellcode und Hardware. Mit Open Science sollen Transparenz, Reproduzierbarkeit, Wiederverwendbarkeit und offene Kommunikation erhöht werden. Damit sollen bessere Qualitätssicherung und Nutzbarkeit durch andere sowie mehr Diversität und Inklusion in der Wissenschaft erzielt werden.32 Lassen Sie sich durch Fachleute in Ihrer Forschungseinrichtung beraten, wo es für Sie sinnvoll ist, sich an Open Access (siehe Kapitel 3.2), Open Data, Open Source, Open Methodology, Open Educational Resources oder Open Peer-Review zu beteiligen.
Die deutschen Forschungseinrichtungen haben sich der Einhaltung der »Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis«33 der DFG verpflichtet und entsprechende Regeln für ihre jeweilige Institution verabschiedet. Während Ihrer Forschungstätigkeit sollte es selbstverständlich sein, dass Sie diese Regeln befolgen. Sollten Sie bei Ihrer Forschungstätigkeit in Situationen geraten, in denen Ihre wissenschaftliche Arbeit von anderen unredlich behandelt wird oder Sie mit Machtmissbrauch konfrontiert sind, können Sie sich an die Ombudsperson Ihrer Forschungsinstitution wenden. Ihre Aufgabe ist die unparteiische Vermittlung in Konfliktfällen. Sie ist verpflichtet, alle Anfragen grundsätzlich neutral, fair und strikt vertraulich zu behandeln.34 Einige Forschungseinrichtungen haben zusätzlich für Machtmissbrauch zuständige Stellen. Lassen Sie sich von einer kollegialen Vertrauensperson unterstützen, die Sie gegebenenfalls zu Gesprächen begleitet, und holen Sie sich notfalls professionelle Hilfe.
Darstellung im wissenschaftlichen Lebenslauf
In Ihrem Lebenslauf wird Ihr Forschungsprofil in Ihrem Publikationsverzeichnis, Ihrem wissenschaftlichen Werdegang sowie dem Verzeichnis eingeworbener Drittmittel sichtbar. Zudem können Sie Ihre Forschungsschwerpunkte zu Beginn Ihres Lebenslaufs in Stichworten auflisten. Passen Sie die Begriffe an die jeweilige Ausschreibung an.
Im Anschreiben und im immer häufiger geforderten Forschungskonzept haben Sie Gelegenheit, die einzelnen Facetten Ihrer bisherigen wissenschaftlichen Tätigkeit als individuelles und attraktives Forschungsprofil zusammenzufassen.
Für das Forschungskonzept stellen Sie Ihre bisherigen Forschungsprojekte sowie Ihre zukünftigen Vorhaben für die Professur als drei bis vier Schwerpunkte dar. Achten Sie darauf, dass die Schwerpunkte klar voneinander abgrenzbar sind und sich möglichst komplementär ergänzen. Wählen Sie prägnante Überschriften für die Schwerpunkte, die sich klar in Forschungsfelder Ihres Fachs einordnen lassen.