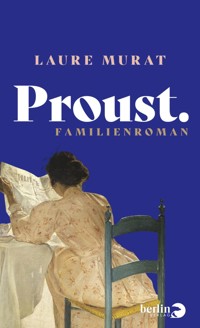
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: eBook Berlin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wie die Literatur einen mit dem Leben aussöhnen kann. »Seit meiner Kindheit hatte ich über Prousts Figuren und all ihre Vorbilder reden hören. Aber erst die Lektüre erlaubte mir, die Wirklichkeit in einem anderen Licht zu lesen. Prousts enorme Überlegenheit über die Aristokratie, die so eingebildete, ungebildete, gesellschaftliche Klasse aus der ich stammte, hat mich überaus beeindruckt: Die Menschen, die mich umgaben, waren, streng genommen, Prousts Gestalten. Und – noch besser – es war ihnen nicht einmal bewusst.« Ein Buch über die emanzipatorische Kraft der Literatur, die auch eine Kraft des Trostes und der Aussöhnung mit dem Leben ist. »Ein literarisches Juwel, das man jedem in die Hand drücken möchte.« Madame Figaro
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.berlinverlag.de
Aus dem Französischen von Jürgen Ritte
© Éditions Robert Laffont S. A. S., Paris 2023
Titel der französischen Originalausgabe: »Proust, roman familial«, Éditions Robert Laffont, Paris 2023
© der deutschsprachigen Ausgabe 2025:
Berlin Verlag in der Piper Verlag GmbH Berlin/München
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Covergestaltung: zero-media.net, München
Covermotiv: Bridgeman Images
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Zitat
Widmung
Der Teufel steckt im Detail
Das Obelix-Syndrom
Tanz des Nichts über der Leere
Die Fiktion der Herkunft
Die undurchdringlichen Stimmen der Vergangenheit
»Dieser kleine Journalist, den ich ans Tischende setzte …«
Die andere Seite
Tante Oriane und Onkel Basin
Die Resublimation
Ein Ball
Der Herzogin rote Schuhe
»Wieviel Poesie doch im Snobismus stecken kann«
Ein langer Albtraum
Die Universalität des minoritären Subjekts
Proust im Bordell
Venedig, Wege und Holzweg
Die Wirklichkeit – unauffindbar und wiedergefunden
Proust in Los Angeles
Requiem für eine Burg
Das eine ist der Tod des anderen
Auf der Suche nach der verlorenen Zeit oder Über den Trost
Bemerkung zur deutschen Übersetzung
Danksagung
Anmerkungen
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Zitat
Wir alle stehen vor dem Romancier wie Sklaven vor dem Kaiser: mit einem Wort kann er uns freilassen. […] Durch ihn sind wir Napoleon, Savonarola, ein Bauer, mehr noch – eine Existenz, die wir vielleicht nie kennengelernt hätten – wir selbst.
Marcel Proust, [Die Macht des Romanciers], ca. 1899
Widmung
für Céline
Der Teufel steckt im Detail
Ich habe Jahre gebraucht, um etwas ganz Einfaches zu begreifen. Es fiel mir eines Tages wie Schuppen von den Augen, als ich in einer Episode von Downton Abbey die Szene sah, in der der Majordomus vor dem für die Abendgäste gedeckten Tisch steht und einen Zollstock zückt, um den Abstand zwischen Messer und Gabel zu messen und sich zu vergewissern, dass er auch zwischen allen Gedecken derselbe ist.
Diese lachhafte, mit sakramentaler Feierlichkeit vorgenommene Handlung hat in mir eine ganz eigenartige Neugier geweckt, deren Grund ich mir in diesem Augenblick noch weniger zu erklären wusste als deren Intensität. Warum hielt ich mich, vor einem Fernsehbildschirm in Los Angeles liegend, wo ich neuntausend Kilometer entfernt vom Alten Kontinent und so weit weg von der Belle Époque lebe, mit einem so belanglosen, fast schon übersehbaren Detail auf, das keinerlei Bedeutung für die Handlung hatte? Ich spürte vage, dass hinter diesem so absurden wie sorgfältigen Messen ein Zeichen aus ferner Vergangenheit steckte, aus der Kindheit. Aber was meinte es? Die Geste beschwor nichts Genaues herauf, keine konkrete Erinnerung. Und doch hat sie schließlich in ihrer Einfachheit und ihrer Bescheidenheit eine ganze Welt aus den Randregionen meines Gedächtnisses wieder auferstehen lassen, ein archaisches Bild, indem sie mir auf einfachste Weise vor Augen führte, dass das Milieu, in dem ich aufgewachsen bin, gänzlich und buchstäblich von seinem Bild abhängt, von seiner äußeren Erscheinung: Die Aristokratie ist eine Welt reiner Formen. Je länger ich nachdachte, desto besser verstand ich, dass diese winzige Szene die Metapher war für das Prinzip, auf dessen Grundlage sich eine ganze Kaste im Gleichgewicht hielt, ähnlich wie eine Pyramide, die auf ihrer Spitze ruht. Das war für mich keine Offenbarung, nicht einmal eine Entdeckung, sondern eher die klare Formulierung eines vergrabenen, unausgesprochenen Wissens.
Was diese Szene besagte, das war, in einem weiteren Sinne, die stumme Macht des Codes. Die Sitten und Gebräuche der Aristokratie beruhen im Wesentlichen, wie in jedem Milieu, auf stillschweigenden Codes. Ihre Besonderheit liegt darin, dass sie sich auf die Zeit berufen, die lange Zeit der Geschichte, in der sich ein unvordenkliches Wissen um die Kunst des gesellschaftlichen Auftretens vorgezeichnet, aufgezeichnet und akkumuliert hat. Sich auf das Recht der älteren Abstammung zu berufen heißt nicht nur, dass man sich jeder Legitimation enthebt, sondern auch, dass man sich die Herrschaft über die Erzählung sichert. Kein Rädchen dieser großen gesellschaftlichen Maschinerie darf sichtbar sein. Kein Mensch bemerkt die gleichen Abstände zwischen den Tellern und Bestecken, sie sind unsichtbar wie die Existenz des Majordomus, der hinter den Kulissen arbeitet. Genau das ist es. Die Unsichtbarkeit begründet die Illusion einer perfekten Welt, eines permanenten und wirklichkeitsfernen Mirakels; sie ist deren stumme Voraussetzung, ihr Grundpfeiler.
Was mich fesselte, das war die Lust an einer dem bloßen Auge nicht sichtbaren Ästhetik. Was ich an diesem Dekor und dieser Aufmerksamkeit für nutzlose Dinge wiedererkannte, das war, ob ich es wollte oder nicht, ein Teil dessen, was ich bin.
Das Obelix-Syndrom
Gleich am nächsten Tag fand meine televisionäre Epiphanie einen Widerhall in einem Text, an dem ich gerade arbeitete: Ich schrieb an der Einleitung zu einem geplanten Sammelband mit meinen Artikeln über Marcel Proust. Das war ein altes Projekt, vor dessen Schwierigkeiten und Implikationen ich zurückschreckte, sodass ich es immer wieder aufschob: Ich wollte zeigen, inwiefern Prousts Analyse der Aristokratie, die mein Ursprungsmilieu besser ausleuchtet als die Erfahrung von innen heraus, wider alle Erwartung das beste Instrument für die Befreiung aus gesellschaftlicher Entfremdung darstellt.
Dieses Vorhaben zwang mich zu einem Umweg über die Welt meiner Kindheit, die Nachfahre jener Gesellschaft ist, die in der Suche nach der verlorenen Zeit beschrieben wird. Eine Welt aus Menschen mit Adelstiteln, aus Dienern und Gouvernanten, aus Privilegien, aus Hierarchien und Überfluss, auf die zurückzukommen ich keine Lust verspürte. Zunächst, weil mich die Vorstellung störte, mich der chronologischen Ordnung einer Familiensaga unterwerfen zu müssen, zumal ich keinerlei Hang zur Autobiographie verspürte und auch nicht die Kompetenz dazu hatte. Dann auch aus Furcht, nicht den richtigen Ton zu treffen, in die eine oder die andere Richtung zu übertreiben. Ich hatte Angst, nicht den richtigen Abstand zu haben, um eine schon weit entlegene Epoche und, in Gestalt des Adels, einen anachronistischen Stamm wiederauferstehen zu lassen, der in Frankreich, zwischen Feindseligkeit und Faszination, die hartnäckigsten Phantasmen weckt. Kurz, ich fürchtete, in meiner unvermeidlichen Parteilichkeit einer Familie wiederzubegegnen, mit der ich dreißig Jahre zuvor gebrochen hatte, und sah darüber hinaus das Risiko kommen, mehr oder weniger bewusst zu karikieren, das Risiko von innerer Zensur und von abgelagerten Diskursen.
Zu diesen Zweifeln gesellte sich eine unvermeidliche, der Aristokratie eigene Falle, insbesondere für den, der aus ihr stammt: Sobald man von ihr spricht, wirkt es so, als bildete man sich etwas auf sie ein. Als ob Adelstitel und Namen mit von und zu, kaum dass sie ausgesprochen sind und durch die Umgebung schweben, die Arroganz und die Eitelkeit einer ganzen Klasse versprühten. Aber ich leite keine Ansprüche, und im Übrigen auch keinen Verzicht, von einem Personenstand ab, den der Zufall der Geburt mir verliehen hat. Und ich empfinde angesichts meines Stammbaums weder Stolz noch Scham, und das aus dem einfachen Grunde, dass ich in meiner ganz offensichtlich gesellschaftlich determinierten Existenz weder an das ius sanguis glaube noch an die Fatalität eines als Bestimmung begriffenen Erbes. Meine Bestimmung, man hat es mir oft genug gesagt, war es, zu heiraten und Kinder zu bekommen. Ich habe keine Kinder, ich bin nicht verheiratet, ich lebe mit einer Frau zusammen, ich bin Universitätsprofessorin in den Vereinigten Staaten, ich wähle links, und ich bin Feministin. Für das Milieu, aus dem ich stamme, habe ich mich damit des Delikts der Ämterhäufung gleich mehrfach schuldig gemacht.
Das marginale Detail in Downton Abbey hat etwas ausgelöst und eine Bresche in die Mauer geschlagen, die mich daran hinderte, über meine familiäre Vergangenheit zu sprechen. Es wies mir eine Eingangstür, gab mir, genauer gesagt, einen Maßstab an die Hand, indem es mein Projekt um eine zentrale Frage herum neu ordnete: die Form. Ich hatte das Motiv, das mir gefehlt hatte. Es sicherte die Verbindung zwischen mondäner Ästhetik und Proust’scher Stilistik. Die Einleitung blähte sich, wurde zu lang, schob sich schließlich an die Stelle des ganzen Rests. Ich räumte die Artikel einen nach dem anderen wieder weg und stürzte mich in ein neues Buch, dessen Thema sich in einem Satz zusammenfassen ließ: der emanzipatorischen Macht der Literatur auf Grundlage einer »situativen Lektüre«[1] die Referenz zu erweisen. Oder: wie eine englische Serie meine französischen Projekte in meinem amerikanischen Leben erschüttert hat.
Die gewieftesten Proustianer haben sich alle die Frage gestellt, die der Erste unter ihnen, Jean-Yves Tadié, so formuliert: »Worin liegt der universelle Ruhm Marcel Prousts begründet, der ihn zum größten Schriftsteller des 20. Jahrhunderts macht?«[2] Wie gelingt es Proust, mit mikroskopischen Wechselfällen und Zerwürfnissen in der hohen Pariser Gesellschaft seine Leser von Japan bis Alaska, von Russland bis Argentinien und durch alle sozialen Schichten hindurch in seinen Bann zu ziehen? Und wie kommt es, dass, wer auch immer sich auf die lange Reise der Recherche einlässt, sich verwundert darin wiedererkennt, sich selbst, Seite für Seite? Denn über das Ich des Erzählers, der Hauptfigur, gibt Proust uns in diesem »Roman, der unablässig denkt«[3] – über die Zeit, das Ich, die Künste, das Schreiben, die Eifersucht, die Phänomenologie –, uns selbst zurück.
Meine, sagen wir, gesellschaftlich orientierte Lektüre ist nicht besser als irgendeine andere. Doch hat sie, so wie jede andere Lektüre, ihre Eigenheit. Ich nenne sie das Obelix-Syndrom. Was würde passieren, wenn Obelix von dem Zaubertrank kostete, in den er als Kind gefallen ist und der ihm aus diesem Grunde verwehrt wird? Ich überschreite natürlich kein Verbot, indem ich die Recherche lese. Aber ich tauche ins Bad der Ursprünge. Dieser Weg zurück über die Fiktion an die Quellen einer Realität hat konkrete Auswirkungen. Davon erzählt dieses Buch.
Mit dem Wort Aristokratie wird oft das Wort Prestige assoziiert. Damit soll kein Werturteil gesprochen, sondern eine Kategorie oder Wahrnehmung genannt sein. Persönlich ziehe ich das Proustige vor. »Ich habe dieses einfache Wort gebildet, um auf das Prestige anzuspielen, das von Marcel Proust herrührt und das sich manch einer nach dem Tod von Marcel Proust aneignen wollte«, schreibt Nicolas Ragonneau,[4] bevor er, als guter Lexikograph, seine Definition mit einem Beispiel illustriert: »Maurice Sachs, der in Amerika Vorträge über die Suche nach der verlorenen Zeit hielt, hatte sehr wohl das Proustige gewittert, das davon ausging.« Ist diese Klarstellung nötig? Ich eigne mir Prousts Prestige in keiner Weise an, weil er die Welt beschrieben hätte, in der ich geboren bin, sondern ich lobe seine Zauberkraft, die mich aus ihr herausgeführt hat.
Tanz des Nichts über der Leere
An meine Kindheit habe ich nur wenige genaue Erinnerungen, es sind vor allem Empfindungen, die mir geblieben sind. Und diejenige, die alle anderen überdeckt, ist die des Einvernehmlichen, des Unausgesprochenen, eines herrisch einverständigen Schweigens. Es ist eine Atmosphäre, in der das, was man nicht sagt, und das, was man nicht sehen kann, mehr Gewicht haben als die seltenen, stets maßvollen, in Szene gesetzten Worte und Gesten. Die Grundregeln der Höflichkeit erlernt man schnell. Nimm die Ellenbogen vom Tisch, sag der Dame Guten Tag, lauf nicht mit den Händen in den Taschen herum, bedanke dich bei dem Herrn. Es sind überall dieselben. Aber der ganze Rest, den man zuweilen als »Savoir-vivre« bezeichnet, der ist sehr viel subtiler, und man braucht länger, um ihn zu begreifen. Es gibt kein Handbuch, keine Anleitungen, nicht einmal ein Geheimwissen. Alles beruht auf der Beobachtung von Szenarien, die so sehr konstruiert sind, dass sie natürlich wirken, und bei denen einzig das formale Gelingen zählt, der Effekt. Schon in frühester Kindheit hatte ich mir, gleichermaßen unbewusst wie eingeflüstert, angewöhnt, die stummen Indizien aufzuspüren und zu deuten, die in Gesellschaft alles im Gleichgewicht halten. Niemand hat es mir beigebracht oder erklärt, auch wenn alle Welt erwartete, dass ich sie bemerke und memoriere. Fragt man die Tiere, wie sie es geschafft haben, die Gesetze des Dschungels zu erlernen? Es gilt, ein Gespür dafür zu entwickeln, wie eine Stimmung entsteht oder vergeht, sich in der Kunst zu üben, eine Unterhaltung wieder in Gang zu bringen oder mit einem Wort das Thema zu wechseln. Dieses stumme Lernen, das darin besteht, zuzuhören und zuzuschauen, in Gesichtern zu lesen und Stimmungen zu wittern, ohne Vorgaben nachzuahmen und zu wiederholen, hat ganz tief in mir eine Überzeugung geprägt, die vielleicht die Grundlage jedweder Erziehung ist: Was wirklich weitergegeben wird, lässt sich nicht lehren.
Und das gilt vielleicht in übersteigerter Weise für den Adel. Alles spielt sich ausnahmslos zwischen den Zeilen ab, wie man in einem Leben, wo nach den ungeschriebenen Regeln einer mentalen Orthopädie jede Anstrengung verbannt, jede Leidenschaft verborgen, aller Schmerz verschwiegen wird, die unterschwelligen Zeichen des Erlöschens erfasst, belauert, abfängt. Man redet niemals über sich, man macht kein Aufhebens, man vermeidet strittige, weil »tödliche« Themen, und es ist undenkbar, in der Öffentlichkeit irgendein Gefühl zu zeigen. Qual und Entzücken, Schmerz und Erregung, Begeisterung und Melancholie sind eine Frage der Klasse. »Man heult nicht wie ein Dienstmädchen«, pflegte meine Urgroßmutter zu sagen, die vor lauter Abscheu vor Gefühlsausbrüchen darauf bestanden hatte, nach dem Tod eines ihrer Söhne, der am Vorabend seines zwanzigsten Geburtstags im Jahre 1916 als Freiwilliger für Frankreich gefallen war, einen Ball zu geben. Eine Karikatur, aber dieses finstere Beispiel könnte fast schon in den Rang eines Prinzips erhoben werden: das der Notwendigkeit, jede Gefühlsregung, bis hin zur intimsten Katastrophe, in eine Stilübung umzumünzen.
Eine Welt, in der alles sich hält und in der jeder sich hält. Haltung bewahren, (auf) seinen Rang halten, das ist das Schlüsselwort, das Maß aller Dinge, das auf eine Sprache angewandt wird, von der man zuvorderst Haltung erwartet, in etwa so, wie erwartet wird, dass man sein Pferd im Zaum halten kann. Haltung zu bewahren, den Horizont unwandelbarer Rituale fest im Blick, hat einen wesentlichen Vorteil: Man braucht nicht zu denken. Sich schlecht zu halten, ob im konkreten oder im übertragenen Sinne, grenzt schon an ein Sakrileg. Wie oft habe ich nicht diesem Ordnungsruf gehorcht, der nur eines finsteren Blickes bedurfte, der jeden Kommentar überflüssig machte: »Haltung!« Was so viel hieß wie: Halt dich gerade und bleib auf deinem Platz. Wie ein gut gedeckter Tisch, auf den man nicht seine Ellenbogen neben das abstandsgleich gedeckte Besteck stützt. Diese Körpertechnik der Pose verlangt unterschwellig nach etwas mehr als nur der Haltung: Sie verlangt nach Zurückhaltung, wenn nicht gar Verhaltung, die bis zur Weigerung führen kann, sich mit der Außenwelt zu mischen. Es ist eine Mechanik des Benehmens, deren Praxis auf Verdrängung beruht.
Die so primordiale, tief wurzelnde Vorstellung von dem, was Stil ist, geht umstandslos damit einher, dass auf die Sprache ein geradezu manischer Wert gelegt wird. Die Stimmlagen, eine leicht theatralische, zugleich energische und leichtfüßige, spielerische und klare Phrasierung des Satzrhythmus, ein schon an Prahlerei grenzender Tonfall verraten auf Anhieb den Aristokraten. Diese etwas nervöse Musikalität, bestehend aus sorgsam kontrollierten Beschleunigungen und retardierenden Momenten, die auf sicherem Kurs zur Pointe führen, gehört zum Bonmot und zur Kunst der Konversation, bei der es nicht geraten ist, Dinge zu vertiefen. Nichts wirkt deplatzierter, als eine Idee auszuwalzen oder sich auf eine halbwegs durchdachte Reflexion zu versteifen. »Gleitet, Ihr Sterblichen, lastet nicht.«[5] Aristokraten halten sich für literarisch, weil sie gut, das heißt (mehr oder weniger) fehlerfrei reden, selbst wenn sie nichts zu sagen haben, und zeigen ihren unfehlbaren Geschmack für Malerei, wenn sie vor Porträts in Pastellfarben ins Schwärmen geraten, die so wahrhaftig im Ausdruck sind. Sie verehren unterschiedslos und aus demselben Grund Saint-Simon und Winterhalter: Insgeheim versprechen ihnen der immense Stilist – auf unvergesslichen Seiten, deren geradezu ausschließlicher Gegenstand sie selbst sind – und der pompöse Maler – in Farben, die ihrer Größe schmeicheln – die Unsterblichkeit. Die Suche nach der verlorenen Zeit wird mit der Zeit ebenfalls zu einer solchen Spiegelfalle werden. Mit dem Ruhm wird Proust, der gestern noch ein gerade einmal zugelassener Journalist war, zu demjenigen, der es zu nichts gebracht hätte, wenn sich nicht die Adeligen so liebenswerterweise bereit erklärt hätten, zur Quelle seiner Inspiration zu werden.
Dennoch: Wie ein Bild aus dem Jahrhundert Ludwigs XIV., das man aus einem Museum für Historienmalerei abgehängt hätte und von dem einzig der Firnis geblieben wäre, jener Firnis, der sich hält und mit der Zeit härter wird, so kaschiert auch die so selbstbeherrschte Welt des Adels nur schlecht eine Wirklichkeit, die sich unter ihrer schillernden Oberfläche abzeichnet. Und diese Wirklichkeit ist die Leere. Die Aristokratie, das Reich des reinen Bedeutens und der gegenstandslosen Performanz, ist eine Welt der leeren Formen. Das ist, gänzlich entblößt, ihre »Seele«, wie im Französischen die Kammer einer Kanone oder eines Gewehrs heißt, in der man das Geschoss lagert – »nur Gewehre haben eine Seele«,[6] so Camus’ ironische Bemerkung.
Die übersteigerte, geradezu exzessive Form des Protokolls und der Gebräuche nimmt nicht nur die abgrundtiefe Leere des Inhalts in sich auf. Der wirkliche Sinn der aristokratischen Stilistik besteht darin, »die anderen« von der Legitimität einer ungebrochenen Macht zu überzeugen, als ob die Französische Revolution niemals stattgefunden hätte, und das Unrecht des Privilegs zu rechtfertigen. Privilegium oder privata lex, das private Gesetz, die einer Elite zugestandene rechtliche Ausnahmestellung in einem System, in dem die Geburt Fundament der Ungleichheit ist. Nur dass diese Elite, die im Ersten Weltkrieg untergegangen ist – und das ist eines der wichtigsten Themen der Suche nach der verlorenen Zeit –, heute nichts mehr zu bieten hat außer obsoleten Titeln und verblassender Glorie. Ohne das Geld, das die Aufrechterhaltung des ererbten Besitzes und einen aufwendigen Lebensstil erlaubt, ist die Aristokratie nichts. Ein Nichts, das über der Leere tanzt.
Meine ambivalente Haltung gegenüber der aristokratischen Erziehung situiert sich an dieser Schnittstelle, zwischen einem Gegenstand der Angst (die Leere) und einem Gegenstand der Freude (der Tanz). Denn wie wollte man nicht auch empfänglich sein für die ganz eigene Wendung der großen Manieren, die auserlesene Grazie, die jeder Geste zugrunde liegt? Die aristokratische Choreographie, die alles umfasst und diktiert – Handlungen und Gedanken, Verhalten und Sprache, belanglose Unterhaltungen und moralische Entscheidungen –, hüllt das Leben in eine zuweilen so verführerische Ästhetik, dass man sie für begründet halten könnte. Aber die Eitelkeit des Hoflebens in Versailles hat nach und nach ein Ideal korrumpiert, das in seinen Anfängen auf dem Wert der Ehre beruhte und die Gesetze der Etikette, des Schicklichen und des Angemessenen verstärkte. Sodass Mme de Boigne, als sie im 19. Jahrhundert das Verschwinden der aristokratischen Codes beklagte, auch »jenen Formen« nachtrauerte, »die der Unmoral den Firnis der Grazie verliehen«.[7] Von da an wird sich die Kluft nur noch weiten, sodass Proust über Mme de Marsantes, die Schwester des Duc de Guermantes, schreiben kann: »Durch Atavismus war ihre Seele erfüllt mit der Frivolität der Höflinge, mit allem, was diese an Oberflächlichem und Steifem an sich haben.«[8]
Ich glaube, dass ich schon früh besonders empfänglich für diese formale, rhythmische Kraft war, die um einen herum eine Welt ohne Brüche und augenscheinliche Anstrengungen errichtet, in der die Kunst der unsichtbaren Übergänge bis zum Tode gepflegt wird, in der die Achtung aufs Metrum, das Maß, die Kadenz, die musikalische Überleitung, garantiert. Wenn ich auch weiß, was dieses Dekor verschleiert, so muss ich doch die Vorzüge dieses auf Harmonie bedachten Ethos’ anerkennen, dem darum zu tun ist, das Leben liebenswerter und flüssiger zu gestalten und in das Geheimnis der Mobilität durch Räume, die untereinander in keinerlei Beziehung stehen, einzuweihen und es zu lüften
Im Tanz der Aristokratie und in jenem art de vivre, in dieser Lebenskunst, die es wörtlich zu nehmen gilt, hat Proust einen unerschöpflichen Gegenstand des Nachdenkens gefunden. Wahrscheinlich, weil er eine Zeit lang an die schöpferische Kraft des Adels geglaubt hat, an dessen Fähigkeit, eine Welt zu errichten und einen Stil zu erfinden. Definiert er nicht die wesentliche Qualität, die die »absolute Schönheit« mancher literarischer Werke ausmacht, als eine »Art Überblendung, eine Art transparenter Einheit, in der sich alle Dinge […] nebeneinander ordnen […], vom selben Licht durchleuchtet sind, das eine im anderen gesehen wird, ohne dass ein Wort außen vor bliebe, das sich dieser Assimilation verweigert hätte […]. Ich vermute, dass es das ist, was man den Firnis der Meister nennt.«[9] Über diese einhüllende Qualität, die alles, Bilder und Wörter, in ein und dieselbe »verzauberte Atmosphäre« taucht, verfügt Proust mehr als jeder andere. Die Beschreibung von Carpaccios Legende der heiligen Ursula, die er dem Maler Elstir in den Mund legt, ist vielleicht die Passage, die mich am meisten in Im Schatten junger Mädchenblüte berührt:
Die Schiffe hatten eine kräftige, sozusagen eine architekturale Bauweise und wirkten amphibienhaft, als habe sich hier und da ein kleineres Venedig inmitten des größeren aufgebaut, wenn sie, mit fliegenden Brücken am Ufer festgemacht, mit karmesinroter Seide und persischen Teppichen belegt und mit den Frauen in kirschrotem Brokat oder grünem Damast an Bord, ganz nahe vor den mit vielfarbigem Marmor eingelegten Balkonen lagen, über die andere Frauen sich zum Schauen niederbeugten in ihren Kleidern mit schwarzen, weißgeschlitzten Ärmeln, die mit Perlenschnüren zusammengehalten und mit Spitzen besetzt waren. Man wußte nicht mehr, wo das Land aufhörte und wo das Wasser begann, was noch Palast war und was bereits Schiff, Karavelle, Galeasse oder der Bucentaurus selbst.[10]
Vom Meer bis zum Land, vom Satin bis zum Brokat, von den Teppichen bis zum Marmor, Proust packt die Elemente, die Stoffe, die Menschen und die Architektur in einen einzigen Satz. Vom Schiff bis zum Balkon ist diese Welt aus schillernden Stoffen, aus bunten Steinen und Frauen, die dank »fliegender« Brücken einander begegnen – womit er die Luft zur verbindenden Brücke zwischen Wasser und Erde macht –, vor allem eine Welt ohne Brüche. Ich kenne keine adäquatere Sicht eines durch die aristokratische Lebenskunst erstrebten Gleichgewichts als diese Szene. Und doch.
Während der aristokratische Firnis vor allem die Rolle des Fixiermittels einer im Verschwinden begriffenen Welt spielt, verkörpert der Firnis der Meister, von dem Proust spricht, in gewisser Weise das Gegenteil, denn er wird mit einer »Überblendung« assoziiert, das heißt mit einer Art Bildauflösung, die ins Gleiten geraten kann. Überblendung: Begriff und Praxis finden sich schon bei Georges Méliès in der Frühzeit des Kinos. Was aber leistet diese Kunst des Übergangs durch Überlagerung von Bildern anderes als die Materialisierung eines Raumwechsels oder des Verfließens der Zeit – vom flash-back zur Projektion in die Zukunft? Und was ist Auf der Suche nach der verlorenen Zeit, wenn nicht das große Buch einer Berufung, das mit dem Aufbruch in Richtung Schöpfung endet und eine Aristokratie ohne Werk am Kai zurücklässt?
Die Fiktion der Herkunft
Ähnlich wie ein Amputierter, der sein verlorenes Glied noch lange nach der Operation spürt, lebte die familiäre Welt meiner Kindheit noch fest im unerschütterlichen Glauben an ihre gesellschaftliche Überlegenheit. Etymologisch meint Aristokratie die »Macht der Besten«. Zuzugeben, dass der Adel sein Prestige verloren habe und nicht mehr die Elite stelle, hätte bedeutet, sich dem Unausdenkbaren zu beugen: dem Eingeständnis, deklassiert zu sein. Es reichte also nicht, sich zu halten, es mussten nunmehr um jeden Preis eine Welt, ein Dekor, eine Daseinsform aufrechterhalten werden, die den zeitgenössischen Realitäten fremd gegenüberstanden und keinen Bezug mehr zum Jahrhundert hatten.
Der Untergang der Aristokratie seit der Französischen Revolution ist von rekordverdächtiger Länge gewesen. Obwohl sie mit Beginn der Dritten Republik hätte erlöschen sollen, bemühte sie sich mit aller Kraft, ihren Lebensstil und die damit einhergehende mondäne Pantomime, diese Artefakte, die die Gesellschaft von einem zeitlosen Wohlstand überzeugen sollen, aufrechtzuerhalten. Ihr Überleben verdankt alles der Ästhetik – denn es ist eine – der Manieren und der Mondänität. Und wenn der aristokratische Auftritt zu Zeiten Prousts sichtbarer, handfester ist als in der Epoche eines Saint-Simon, dann genau deshalb, weil in der Zwischenzeit die Bourgeoisie aus Finanzwirtschaft und Industrie dem Adel das Heft aus der Hand genommen hat und dieser den Verlust kompensiert, indem er in einem endlosen Schwanengesang die Komödie der Macht übertreibt. Was ich ein halbes Jahrhundert nach Prousts Tod erlebt habe, war das ausklingende Echo jener Belle Époque, die ferne Erinnerung an eine Obsession mit Formalitäten, die nicht verschwinden durfte, weil sie die Fiktion unserer Größe am Leben erhielt.
Die Illusion hing an einem Faden, einem goldenen Faden: dem Vermögen. Reiche Heiraten zu beiden Seiten meiner Familie garantierten allen Mitgliedern das luxuriöse Leben von Privatiers, die sich auf die Erträge beträchtlicher Finanzwerte und den guten Willen der Aktienkurse verlassen konnten. Niemand arbeitete, und alle fanden das normal. Es fällt mir heute schwer, das zu glauben, während ich diesen Satz niederschreibe. Und doch ist es das, was ich erlebt habe.
Reicht schon dieses professionelle Müßiggängertum, die Welt meiner Kindheit in die Nähe jener Gesellschaft zu rücken, die Proust beschrieben hat? Oder ist das eine Überinterpretation, eine Übertreibung meinerseits, die ich den Familienroman vom Proust’schen Fresko abpause? Wie konnte ich, die ich wenige Monate vor dem Mai 68 geboren bin, auch nur das Geringste von den Strukturen jener Welt noch mitbekommen, die mit dem Krieg von 1914 untergegangen sein soll? Ich sage »sein soll«, denn diese Zeitlichkeit hat zuletzt einige Nuancierungen erfahren. Alice Bravard hat in ihrem Buch Le Grand Monde parisien sehr schön das Überdauern des aristokratischen Modells in Frankreich nachgewiesen, insbesondere anhand der seit 1890 erscheinenden Gesellschaftsseiten in den Tageszeitungen Le Gaulois und Le Figaro, die sich nicht bis zum Ersten Weltkrieg gehalten haben, sondern bis zum Zweiten.[11] Obgleich durch den »Großen Krieg« dezimiert und durch den Börsenkrach von 1929 ruiniert, legt die Aristokratie, die 1932 das Hilfswerk des französischen Adels gründet, die »Association d’entraide de la noblesse française« (ANF), einen hartnäckigen Widerstandsgeist an den Tag. Und dient weiterhin in landläufiger Vorstellung als Vorbild, wie es das ambivalente und melancholische Adieu an den »Geist der Aristokratie«, »ihr Ehrempfinden und ihren Opfermut« in dem Film La Grande Illusion (1937) nahezulegen scheint.[12]
Mein Vater ist 1925 geboren, meine Mutter 1939. Etwas zu spät, um noch die »Große Welt« kennengelernt zu haben, wie Proust sie erlebt hat, aber noch früh genug, um eine überlieferte, erzählte Erinnerung an sie zu haben. Sie sind sich im Januar 1960 auf einer mondänen Abendgesellschaft begegnet. Fünf Monate später waren sie verheiratet. Marcel Proust hätte der Hochzeit beiwohnen können. Er wäre damals achtundachtzig Jahre alt gewesen.
Im Jahre 1960 schafften es Verbindungen in der Aristokratie immer noch auf die Titelseiten der Zeitungen, die man noch nicht people magazines nannte. Die Hochzeit meiner Eltern, die den Bund der ältesten Tochter des Duc de Luynes mit dem Prince Napoléon Murat, dem Ururgroßneffen des Empereurs, besiegelte, brachte es auf einige dicke Schlagzeilen. Alle Zutaten waren vereint. Das Mädchen aus guter Familie ehelichte im Château de Luynes einen Märchenprinzen, der ansonsten als ein »Original« galt, hatte er doch die ersten Filme Louis Malles finanziert. Der Erzbischof von Tours, der die Messe zelebrieren sollte, hatte sich zunächst gar geweigert, die Verbindung zu segnen, bevor er dann doch nachgab, denn die Kirche betrachtete meinen Vater als einen »Pornographen« seit dem Skandal um den Film Die Liebenden, in dem Jeanne Moreau nackt in einer Badewanne lag … aus der nur ihr Kopf herausragte. Der Zoom auf ihre Hand, die sich als Zeichen für den Orgasmus krampfartig schließt, hatte bei allen Tugendvereinen, die sich darüber ereiferten, dass ein Ehebruch eine Lusterfahrung sein könnte, für Empörung gesorgt. Der Film, der in Venedig mit dem Spezialpreis der Jury ausgezeichnet wurde, war in Frankreich von der Zensur bedroht, in Großbritannien wurde er verboten. In den Vereinigten Staaten hatte er eine Reihe von Prozessen zur Folge, was den Supreme Court im Jahre 1964 dazu bewog, »Pornographie« im Film zu definieren – Die Liebenden fiel schließlich nicht in diese Kategorie.
Alle Artikel, die ich finden konnte, zeigen dasselbe Abziehbildchen: die Feier einer »so familiären wie volkstümlichen«[13] Zeremonie, die Teilnahme des ganzen Dorfes und die Aufzählung aller zum mittäglichen Mahl geladenen Gäste, deren Namen (Montesquiou, Brissac, La Rochefoucauld, Montebello usw.) auch in der Recherche stehen könnten. Am meisten aber frappiert das Beharren auf folgendem Punkt: So prestigeträchtig die Verbindung »zweier großer Namen in der Geschichte Frankreichs« auch sein mochte, sie ist doch geprägt von den so unterschiedlichen Mentalitäten des Ancien-Régime-Adels einerseits, in dem sich das Feudalzeitalter inkarniert, und andererseits der Noblesse d’Empire, dem napoleonischen Adel, der jüngeren Datums ist.
Der Erbe der Kriegsherren des alten Frankreichs habe seine Tochter dem Abkömmling des »Kleinen Gefreiten« gegeben, titelt das Wochenblatt Noir et Blanc[14] und mokiert sich über die fehlenden Lilien in der Kirche, dem Emblem der alten Monarchie, angeblich, um die Bonapartisten nicht zu brüskieren. Bei anderen wirft das auffällige Fernbleiben des Comte und der Comtesse de Paris, der Anwärter auf den französischen Königsthron, Fragen auf: Haben sie sich geweigert, diese Allianz mit einem Nachfahren Napoleons mit ihrer Gegenwart zu beehren? Das alles entbehrt jeder Grundlage (der Pfarrer war gegen Lilien allergisch, und die königliche Familie ist seit dem 17. Jahrhundert mit den Luynes verbunden), doch sagen diese Kommentare einiges darüber aus, wie sehr die Mentalitäten noch von gesellschaftlichem Hierarchiedenken geprägt sind. Legte nicht sogar ein Journalist Wert auf die Feststellung, dass beim Mittagessen, zu dem sich gut hundert Privilegierte einfanden, »Louis Malle der einzige Bürgerliche« ist?[15] Wegen solcher Bemerkungen greife ich auf die vielsagende Oberflächlichkeit dieser Archive zurück: um eine Zeit zu verstehen, in der man es noch in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts für wichtig hielt, zwischen zweierlei Adel und zwischen Aristokratie und Bürgertum zu unterscheiden – während unsere Zeit, trotz aller Adelstitel unter den Gästen, nur für den Filmregisseur Augen gehabt hätte.





























