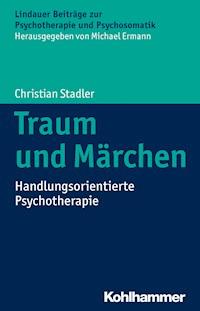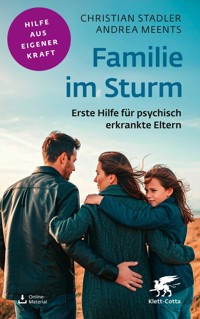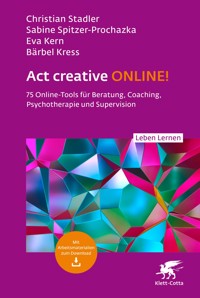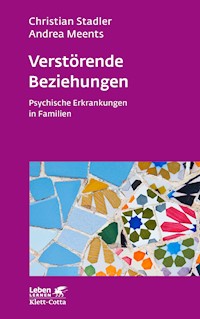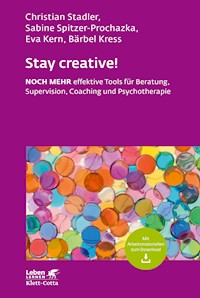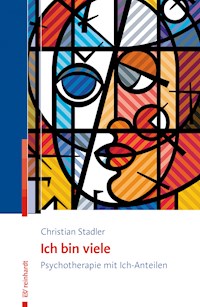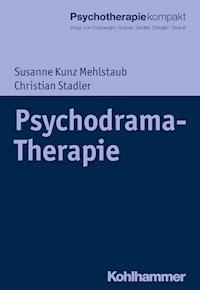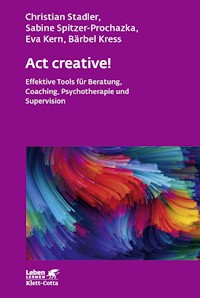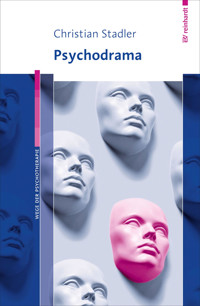
23,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ernst Reinhardt Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Wege der Psychotherapie
- Sprache: Deutsch
Was ist Psychodrama? Diese handlungs- und erlebnisorientierte Psychotherapie nach Jacob Levy Moreno verbindet Gespräch, Handeln und szenisches Darstellen von Erleben und Verhalten miteinander. Im psychodramatischen Rollenspiel können Klienten ihre persönliche Thematik bearbeiten, sich aus starren Rollenstrukturen befreien, problematische zwischenmenschliche Beziehungen klären und destruktive Rollenmuster verändern. Der Autor führt in die Kernbereiche des Psychodramas ein und zeigt eine Bandbreite verschiedener Arbeitsformen des Verfahrens auf, illustriert anhand zahlreicher Beispiele. Hilfreiche Psychodrama-Tools wie der "Magic Shop" liefern Ideen, wie man Klienten beim Erweitern ihres aktiven Rollenrepertoires unterstützen und kreative Prozesse anstoßen kann
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 317
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
WEGE DER PSYCHOTHERAPIE
Dipl. Psych. Christian Stadler, Dachau, Psychologischer Psychotherapeut (TFP), Psychodrama-Therapeut (DFP, IAGP), Fort- und Weiterbildungsleiter sowie Supervisor am Moreno-Institut (Edenkoben) und in eigener Praxis als Psychotherapeut und Supervisor tätig.
Für Claudia
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.
ISBN 978–3-497–02436–0 (Print)
ISBN 978–3-497–60167–7 (PDF E-Book)
ISBN 978–3–497–61707–4 (EPUB E-Book)
© 2014 by Ernst Reinhardt, GmbH & Co KG, Verlag, München
Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne schriftliche Zustimmung der Ernst Reinhardt GmbH & Co KG, München, unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen in andere Sprachen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Printed in Germany
Reihenkonzeption Umschlag: Oliver Linke, Hohenschäftlarn
Covermotiv: © Aamon – Fotolia.com
Satz: FELSBERG Satz & Layout, Göttingen
Ernst Reinhardt Verlag, Kemnatenstr. 46, D-80639 München
Net: www.reinhardt-verlag.de E-Mail: [email protected]
Inhalt
1
Einführung
2
Geschichte
Morenos Anfänge von Psychodrama und Soziometrie in Österreich
Spiel und Theater
Soziometrie und die Einbeziehung der Systeme
Soziometrie, Gruppentherapie und Psychodrama: Morenos Durchbruch in den USA
Aktuelle Entwicklungen
Monodrama
Soziodrama
Störungsorientierung
3
Theorie
Das Menschen- und Weltbild
Das soziale Netzwerk als Diagnostik: Messung, Analyse und Intervention
Die Rollentheorie: Grundlage der Entwicklungspsychologie, Sozialpsychologie und Psychotherapie
Die Kreativitätstheorie
Ressource und Lösung im Psychodrama
4
Das therapeutische Vorgehen
Die Instrumente des Psychodramas
Protagonist
Bühne
Therapeut
Gruppe
Mitspieler
Psychodramatische Arrangements und ihre Abläufe
Psychodrama mit definierter Handlung (Protagonistenspiel Typ A)
Psychodrama mit Stegreif-Handlung (Protagonistenspiel Typ B)
Soziodrama (Gruppenspiel)
Spezielle Gruppen-Arrangements
Die Psychodrama-Techniken
Szenenaufbau
Doppeln
Rollenspiel in der eigenen Rolle
Spiegeln
Veränderungen im zeitlichen Ablauf
Maximierung
Rollenwechsel, Rollenspiel in der Rolle eines anderen, Rollenfeedback
Rollentausch
Szenenwechsel
Der therapeutische Prozess
Fallbeispiele
Handpuppen- und Stühlearbeit im verhaltensorientierten Einzelsetting
Vom kulturellen zum sozialen Atom: Externalisierung entwertender Introjekte und Arbeit mit dem inneren Kind
Probehandeln, Rollentausch und Szenenwechsel
Stühlearbeit im Einzelsetting bei einer Angst-Patientin
Amplifikation und szenische Inszenierung eines Gegenübertragungsbildes
Das Paar im Monodrama-Setting
5
Evaluation
6
Ausblick
Glossar
Literatur zur Vertiefung
Zitierte Literatur
Anhang
Regeln des Psychodramas nach Moreno
Krügers Kreismodell der Störungsorientierung im Psychodrama
Stundendokumentation für TherapeutInnen (SDB-Psychodrama)
Sozialer Netzwerk-Fragebogen
Über den Autor – Danksagungen
Register
1Einführung
„Psychodrama kann als diejenige Methode bezeichnet werden, welche die Wahrheit der Seele durch Handeln ergründet“, so Moreno (2008, 77), der Gründervater der triadischen Methode Psychodrama, Soziometrie, Rollenspiel, welche meist verkürzt nur Psychodrama genannt wird. Psychodrama bedeutet wörtlich die handelnde Darstellung inneren Erlebens. Das Psychodrama ist eine der Säulen, auf denen die humanistische Psychotherapie ruht, der in den letzten Jahren in Deutschland wieder mehr Aufmerksamkeit zuteil wird (Eberwein 2009; Kriz 2011). Bei der humanistischen Psychotherapie geht es „um die Förderung von Selbstregulations- und Organisationsprozessen auf körperlichen, psychischen und sozialen Prozessebenen […], die auf diese Weise wieder an die jeweiligen Entwicklungsaufgaben der biopsychosozialen Umwelt re-adaptierbar werden; wobei aber der zentrale Fokus die Sinnorientierung, Selbstdefinition und Intentionalität des Subjekts ist.“ (Kriz 2011, 335)
Die Psychodrama-Therapie ist eine humanistische Psychotherapieform, denn es ist die handelnde und szenische, subjektiv organisierte Darstellung des inneren Erlebens einer oder mehrerer Personen unter Einbeziehung deren sozialer und ökologischer Bedingungen, mit dem Ziel, in der hic-et-nunc-Situation mithilfe der therapeutischen Beziehung die Selbststeuerungs- und -heilungskräfte des Patienten1 zu aktivieren (vgl. Stadler / Kern 2010, 13).
Der Gesichtspunkt der handelnden und szenischen Darstellung ist zum Markenzeichen aller erlebnisorientierten Verfahren, aber besonders der Psychodramatherapie geworden; hierin unterscheidet diese Therapieform sich am stärksten von den übrigen Verfahren und Methoden, die sich hauptsächlich der sprachlichen Darstellung von psychischen Sachverhalten bedienen, oder gleich gänzlich andere Zugangswege gewählt haben, wie z. B. die Körpertherapie oder die Kunst- und die Musiktherapie.
Daneben gibt es jedoch noch eine Reihe anderer Merkmale, die im Psychodrama eine herausragende Position einnehmen: die Surplus-Realität, die Szene, die Rolle, die Handlung, das Konzept von Kreativität und Spontaneität zur Beschreibung von Veränderung, die Soziometrie sowie die Gruppe im weitesten Sinn; zu den beiden letzten Punkten gehören Begriffe wie Begegnung und Telebeziehung. Auf alle diese Begriffe wird in den folgenden Kapiteln ausführlicher eingegangen, sie sollen jedoch schon an dieser Stelle kurz definitorisch vorgestellt werden, um das Lesen des Textes zu erleichtern.
Wenn die oben genannte knappe Psychodrama-Definition, „Psychodramatherapie ist die handelnde und szenische, subjektiv organisierte Darstellung des inneren Erlebens einer oder mehrerer Personen unter Einbeziehung deren sozialer und ökologischer Bedingungen“, um einige plakative Schlagworte erweitert und in Alltagssprache übersetzt wird, könnte das Vorgehen in der Psychodramatherapie auch folgendermaßen umschrieben werden:
Psychodrama ist Handeln, nicht nur Reden.
Psychodrama dient der Förderung der Selbstheilungskräfte.
Im Psychodrama werden innere Wahrheiten auf einer Bühne, einer Surplus-Realität, in Szene gesetzt.
Das psychodramatische Spiel(en) fördert die Kreativität.
Der Mensch kann nur in seinen Rollen und unter Einbeziehung seines sozialen Umfeldes verstanden werden.
In authentischen Begegnungen mit anderen Menschen kann ein „wahres zweites Mal“ oder ein „neues erstes Mal“ einer Situation entstehen.
Das szenische Handeln hilft, sein Leben adäquater, authentischer, besser, heiler oder symptomfreier zu gestalten.
Tabelle 1: Begriffsdefinitionen Psychodrama
Surplus-Realität
Im Psychodrama wird in einer veränderten Zusatzrealität, der Surplus-Realität, auf einer Art Bühne eine Szene gezeigt. Den Rollenspielern ist dabei bewusst, dass sie sich im Hier und Jetzt dieser Darstellung verhalten „als ob“, sie also eine erlebte Realität zeigen und sich nicht in ihrer Alltagswirklichkeit befinden.
Szene
eine abgeschlossene Handlungssequenz eines oder mehrerer Personen mit einem definierten Ort und einer definierten Zeit, welche mithilfe von Rollenspielern dargestellt werden kann
Rollen
verschiedene Handlungs-, Verhaltens- und Erlebensmuster einer Person, welche identifiziert werden können und die Persönlichkeit in ihrer Gesamtheit konstituieren
Handlung
Der Zugang zu den inneren Wirklichkeiten der Menschen wird handelnd erschlossen, nicht ausschließlich sprechend. Patienten zeigen wie sie handeln.
Kreativität
schöpferische Urkraft des Kosmos und des Menschen (auch: Selbstheilungskräfte), welche durch das Psychodrama gefördert wird
Spontaneität
Dieses Konzept ist eng verbunden mit der Kreativität. Der Schwerpunkt liegt dabei auf situationsangemessenem und blockadefreiem Handeln. Der Psychodrama-Begriff Spontaneität unterscheidet sich damit von dem umgangssprachlichen Gebrauch im Sinne von neu, aus sich heraus, unreflektiert. Untersuchungen zur psychodramatischen Spontaneität finden sich bei Kipper (2011).
Soziometrie
„Soziometrie“ setzt sich zusammen aus Sozius, der Gefährte, Mitmensch, und metrein, messen (oder lat.: Metrum, das Maß) und bedeutet Messung, Darstellung, Analyse und Intervention zwischenmenschlicher Beziehungen (vgl. ausführlicher Stadler 2013b).
Begegnung
Unter Begegnung wird im Psychodrama ein existentielles Sich-in-Beziehung-setzen verstanden, welches über eine bloße Beziehung hinausgeht. Sie ist mit Begriffen von Authentizität und gegenseitiger Einfühlung verbunden.
Telebeziehung
Die von Moreno so benannte Telebeziehung ist das Zusammenspiel elementarer Kräfte zwischen Menschen, die sich aus bewussten wie unbewussten Anteilen im Sinne von Anziehung und Abstoßung konstituieren. Die Telebeziehung geht damit über das Konzept von Übertragung und Gegenübertragung hinaus.
1Im Text wurde entsprechend der Buchreihe in der Regel die männliche Schreibform gewählt, soweit nicht in Beispielen von konkreten Menschen die Rede ist. Die männliche Form steht als Chiffre für Männer und Frauen und soll nicht den Eindruck erwecken, dass Frauen nicht gemeint sind.
2Geschichte
Morenos Anfänge von Psychodrama und Soziometrie in Österreich
Um das Psychodrama in seiner Komplexität zu verstehen, ist es von Bedeutung, die Wurzeln des Verfahrens und damit auch seines Begründers in seiner Zeit kennen zu lernen. Der Arzt Jakob Levi Moreno wurde am 18. Mai 1889 in Bukarest geboren und starb in Beacon im Bundesstaat New York am 14. Mai 1974. Seine prägendste frühe Zeit war in und um Wien, wohin seine Familie aus Rumänien übersiedelte. Ausführlich mit der Biografie Morenos haben sich Marineau (1989), Wildhaber (2006), Hutter / Schwehm (2009, 71–79), Blattert (2013) und Scherr (2013) beschäftigt.
Jakob Levi Moreno
Moreno wuchs als Kind im Umfeld sephardischer Juden zunächst in Bukarest auf. Seine Eltern übersiedelten zusammen mit ihm und seinen drei jüngeren Geschwistern vermutlich aus wirtschaftlichen Gründen nach Wien, als Moreno etwa sechs Jahre alt war. Dort kamen zwei weitere Geschwister zur Welt. Das Familienleben ist von großer Unruhe gekennzeichnet, es gibt viele Umzüge, und der Flüchtlingsstatus sowie die Hürden der fremden Sprache machen der Familie zu schaffen. Als Moreno 15 Jahre alt ist, zieht die Familie nach Berlin. Moreno kehrt nach kurzer Zeit alleine nach Wien zurück, lebt dort bei einer Familie und erteilt deren Töchtern Nachhilfeunterricht. Zwei Jahre später lassen sich seine Eltern scheiden, die Mutter kommt mit den Kindern nach Wien, der Vater geht zurück in seine Heimat, nach Istanbul. Besonders den Vater vermisst Moreno sehr. Er bricht die Schule ab, macht einen externen Schulabschluss und beginnt 1910, Medizin zu studieren. Er beendet das Studium 1917 und promoviert im selben Jahr. Bereits während des Studiums ist seine soziale Haltung deutlich, die von religiösen Motiven getragen ist. So gründete er z. B. zusammen mit Freunden eine Selbsthilfegruppe für Prostituierte (1913), unterstützte Flüchtlinge in einem Haus der Begegnung (1914). Wien wie andere Orte der 10er und 20er Jahre des letzten Jahrhunderts war geprägt von starken Strömungen, denen Moreno an der Universität ausgesetzt war (Sozialismus, Kommunismus, Nationalsozialismus). Er fühlte sich zu den Existentialisten hingezogen, die sein späteres Werk prägen sollten. Das Prinzip Begegnung in Verbindung mit seinem Konzept der Nächstenliebe kennzeichnete sein Wiener Leben. Moreno hatte bereits in jungen Jahren zu schreiben begonnen und gab ab 1914 eine eigene Schriftenreihe heraus, die er „Einladung zu einer Begegnung“ nannte; sein Schreibstil zu dieser Zeit war expressionistisch geprägt. Zu Beginn des 1.Weltkrieges meldete er sich freiwillig zum Kriegsdienst, wurde aber nicht genommen, da es Unklarheiten bezüglich seiner Staatsbürgerschaft gab. Er wurde 1915, also noch während seines Studiums in Mitterndorf, einem Flüchtlingslager für Tiroler Bauern in der Nähe von Wien, eingesetzt, ab 1917 auch als regulärer Arzt. 1918 gründete Moreno den „Daimon“, eine „Zeitschrift für existentielle Philosophie“, in der so bekannte Autoren wie E. A. Rheinhardt, Jakob Wassermann, Franz Werfel, Max Brod und Ernst Bloch schrieben. Ab 1919 wurde sie in „Der neue Daimon“ umbenannt, zu deren Gründern auch Alfred Adler, Albert Ehrenstein und Franz Werfel gehörten. Im Herbst 1919 lässt sich Moreno als Gemeindearzt in Bad Vöslau nieder und beginnt hier erstmals, auch psychotherapeutisch zu arbeiten. So ließ er z. B. einen suizidalen Patienten seinen Suizid spielen, wodurch dieser sich von seiner Suizidalität distanzieren konnte. Dieses Nachspielen von Konflikten und Problemlagen war der Grundstein für seine spätere Bühnenarbeit. Auch bezog er Familienmitglieder in die Behandlung von Individuen ein, was als Beginn seiner systemischen und soziometrischen Sicht betrachtet werden kann. Ab 1921 beginnt sich Moreno auch mit Bühnenhandeln und Theater intensiver zu beschäftigen; 1922 gründet er in Wien das Stegreiftheater. Die politische und gesellschaftliche Lage im Wien der 20er Jahre führten schließlich dazu, dass Moreno im Jahr 1925 Österreich in Richtung New York verlässt.
Moreno war stark beeinflusst von den philosophischen und theologischen Traditionen seiner Familie und seines Umfeldes (Hutter 2002; Tomaschek-Habrina 2004). Er kann in seinen Adoleszenzjahren, also den österreichischen Zeiten, vor allem als Sozialrevolutionär bezeichnet werden: Nach seinem Studium war er Sozialmediziner, welcher die modernen soziologischen und systembezogenen Forschungsansätze seiner Zeit, die zu seiner Grundhaltung passten, adaptierte und weiterentwickelte (Buer 1999; 2010; Dollase 1976; 2013; Moreno 1974). So gab es bei Moreno und demzufolge auch im Verfahren Psychodrama immer schon zwei Aspekte, die sich ergänzten: den Aspekt der therapeutischen Heilung, der Psychodramatherapie, und den Aspekt der Gruppe und ihrer zwischenmenschlichen Beziehungen, also der Soziometrie. Auch wenn das Psychodrama heute therapeutisch überwiegend im Einzelsetting angewandt wird, sind die Gesellschaft, die Gemeinschaft, die Gruppe, das System immer im therapeutischen Prozess präsent. Versuche, diese beiden Aspekte zu trennen, verkürzen das Verfahren auf ein technizistisches Vorgehen, was letztlich zu Einbußen bei der therapeutischen Wirkkraft führen würde. Røine vergleicht dieses Zusammenspiel von Einzelnem und der Gruppe mit dem Jazz, bei dem Solist und Gruppe wechselseitig interagieren (Røine 1997, 32). Nicht zuletzt müssen auch Morenos schriftstellerische und herausgeberische Tätigkeit (siehe Exkurs Jakob Levi Moreno), seine Begeisterung für das Spiel und seine Nähe zum Theater Erwähnung finden, die ihn in seinem (therapeutischen) Handeln prägten.
Spiel und Theater
Die psychodramatische Idee der Bühne für die szenische Darstellung menschlicher Schicksale, Lebensläufe und allgemeiner Fragestellungen kommt aus einer spezifischen Mischung von Spiel und dem Umfeld des Theaters. Anders aber als das Theater seiner Zeit plädierte Moreno für die Darstellung authentischer eigener Erlebnisse oder Themen, nicht festgeschriebener Handlungsplots.
„Die Zuschauer waren meine Mitwirkenden. Die Menschen im Publikum waren wie Tausende unbewusste Bühnenautoren. Das Stück war die Situation, in die sie durch die historischen Ereignisse hineingeworfen worden waren, in der jeder von ihnen einen wirklichen Part spielen musste. […] Wenn es mir gelänge, das Publikum in Akteure zu verwandeln, in Akteure ihres eigenen kollektiven Dramas, des kollektiven Dramas sozialer Konflikte, in das sie in der Tat täglich verwickelt waren, dann würde meine Kühnheit belohnt werden.“ (Moreno 1995, 80)
Moreno hat erkannt, dass das Stegreifspiel eine befreiende und problemlösende Wirkung auf die Spieler hat, ja dass selbst die Zuschauer davon im Sinne einer Katharsis profitieren konnten. Die Grundidee des Spielens rührt aber nicht erst aus dem Einfluss des Theaters, sondern vielmehr aus einer früheren Lebensphase Morenos: Nicht nur, dass er als Kind selbst bereits gerne in Rollen spielte, er konnte auch später andere zum (Rollen-)Spiel animieren. In seiner Biografie beschreibt Moreno Beispiele dafür, wie er selbst mit Begeisterung Rollen spielte (vgl. Das Gott-Spiel Moreno in: Hutter / Schwehm 2009, 50 f.), und wie er später als Wiener Student Kinder im Park dazu brachte, ein von ihm erfundenes Märchen zu spielen oder ihre eigenen Erlebnisse nachzuspielen (vgl. J. L. Moreno 1995).
„Ich wurde Freund der Kinder, ihr ständiger Begleiter. Sie liebten den Mann ohne Hut, ohne Herkunft, der nur da war, mit seiner zu ihnen sprechend schweigenden Gegenwart. […] Ich war ihr Ratgeber, Lehrer und Wanderstock. Ich ruhte auf dem Ast eines Baumes und erzählte ihnen Märchen vom König, den Kinder suchen müssen […]“ (Moreno zit. nach Hutter / Schwehm 2009, 52)
„Ich fand im Gott-Spielen der Kinder eine tiefe Bedeutung. Als Student pflegte ich durch die Gärten Wiens zu gehen, Kinder um mich zu scharen und Gruppen für Stegreifspiele zu bilden. […] Ich wollte den Kindern die Fähigkeit zum Kampf gegen soziale Stereotypen, gegen Roboter für Spontaneität und Kreativität geben. In meiner Arbeit mit den Kindern kristallisiert sich meine Theorie der Spontaneität und Kreativität heraus.“ (Moreno zit. nach Hutter / Schwehm 2009, 53)
Das Gott-Spielen und die Position des Regisseurs sind wesentliche Aspekte der psychodramatherapeutischen Philosophie geworden. Der Mensch ist Schöpfer und Regisseur in seinem eigenen Leben. Moreno spricht von einem ICH-Gott, von der Kreativität als der schöpferischen Kraft, die jedem Menschen innewohnt. Diese Kreativität ist der Motor der Selbstheilung und wird durch das Spiel(en) aktiviert. In diesem frühen Spiel der Kinder wählen sie Rollen, um sich Verhaltensweisen experimentell zu erschließen und sie gegebenenfalls ins das eigene Rollenrepertoire zu übernehmen (siehe Rollentheorie): „Ich wäre jetzt der Vater und mache uns etwas zu essen …“. Die Rollen sind in der folgenden Theoriebildung bei Moreno essentieller Bestandteil seiner Persönlichkeitspsychologie: Menschen erleben sich in Rollen und können auch so deskriptiv verstanden werden. Dies bezieht sich nicht ausschließlich auf soziale Rollen, wie sie die Soziologen später beschrieben („Hans, der Polizist“ oder „Hans, der Vater“), sondern es kann sich auch auf somatische oder affektive Zustände beziehen („Hans mit Rückenschmerzen“ oder „der glückliche Hans“).
Von der Rolle zum Theater ist es nicht weit. 1921 beginnt Moreno, systematisch mit der Bühne zu arbeiten. Das Spielen von Szenen, seien es solche, die das Publikum vorschlägt oder seien es solche, die den Schauspielern spontan einfallen, ist der Beginn des Stegreiftheaters. Moreno erkannte im klassischen Theaterspiel, dem Nachspielen von „kulturellen Konserven“, was er nicht wollte. Das kreative Spielen war wichtiger als das bloße Nachahmen. Das Stegreifspiel musste sich aber erst etablieren, es war ungewohnt, und so wurden manchmal Hilfskonstruktionen herangezogen, die wiederum neue Spielsettings begründeten, wie z. B. die „lebendige Zeitung“.
„Das Stegreiftheater mit seinem Ziel 100 %-iger Spontaneität war mit enormen Schwierigkeiten konfrontiert. Die erste Schwierigkeit kam von den Zuschauern. Sie waren erzogen worden, im Alltag Kulturkonserven zu gebrauchen, auf sie zu vertrauen und ihrer eigenen Spontaneität zu misstrauen. Die einzige Spontaneität, die sie zu schätzen gelernt hatten, war die, die aus der ‚belebten Konserve‘ kam. Wenn den Zuschauern wahre Spontaneität gezeigt wurde, vermuteten sie deshalb entweder, sie sei gut einstudiert oder ein Versuch, sie zu verulken. Wenn eine Szene schlecht gespielt war, betrachteten sie es als Zeichen, dass Spontaneität nicht funktionierte. Um den Unglauben des Publikums zu umgehen, wandten wir uns der Technik der ‚lebendigen Zeitung‘ zu. Da die Vorführungen auf den aktuellen Ereignissen des Tages beruhten, konnte niemand bezweifeln, dass sie spontan und ungeprobt waren.“ (Moreno zit. nach Hutter / Schwehm 2009, 63)
Lebendige Zeitung
Unter Lebendiger Zeitung wird ein Stegreifarrangement verstanden, bei dem mehrere Darsteller einen gemeinsam gelesenen Artikel mit verteilten Rollen szenisch darstellen. Das Spiel findet im Stegreifmodus statt, d. h. es wird vorher nicht genau festgelegt, wer was wann spielt, sondern die Rollenspieler entscheiden spontan ihre Vorgehensweise.
Morenos Stegreiftheater in der Maysedergasse in Wien wurde bald eine Institution und es kamen durch die Darsteller immer mehr persönliche Geschichten auf die Bühne, der therapeutische Effekt trat damit stärker in den Vordergrund. Es gab keine klassischen Zuschauer mehr, sondern die Zuschauer wurden zu Mitspielern und umgekehrt, Handlungsabläufe entwickelten sich spontaner. Das Theater wurde Ausdrucks- und Heilmittel zugleich. Das Nachspielen von persönlichen Erlebnissen, das so genannte „wahre zweite Mal“ wurde befreiend erlebt. Moreno hat damit genutzt, was Tennessee Williams seinen Helden Tom sagen lässt:
„Ich habe ein paar Zaubertricks auf Lager – hab ein paar Asse im Ärmel –, aber ich bin das genaue Gegenteil von einem Bühnenzauberer. Der liefert Euch Illusionen, die den Anschein von Wahrheit haben. Ich liefere Euch Wahrheiten in der freundlichen Verkleidung von Illusionen.“ (Williams 1987, 13)
Im Spiel auf der Bühne, in der Surplus-Realität setzten sich die Menschen mit ihren eigenen, persönlichen Fragestellungen und Problemlagen auseinander, hatten aber dabei den Schutz der „Als-ob“-Situation der Bühne.
„Absicht ist, die Krankheit sichtbar zu machen, nicht gesund, sondern krank zu werden. Der Kranke selbst treibt seine Krankheit aus. Die Wiederholung in der Illusion macht ihn frei.“ (Moreno 1970, 71)
Soziometrie und die Einbeziehung der Systeme
Wie bereits zu Beginn beschrieben, war Moreno aber kein Individualpsychotherapeut, sondern man kann ihn guten Gewissens als einen der Gründer der systemischen Therapie bezeichnen. Die beiden bekannten systemischen Therapeuten Arist von Schlippe und Jochen Schweitzer nennen in ihrem Standardwerk „Lehrbuch der systemischen Therapie und Beratung“ neben Kurt Lewin und Alfred Adler Jacob L. Moreno als „Wegbereiter für die systemische Sichtweise“ (Schlippe / Schweitzer 2007, 18). Was macht Moreno zum Systemiker?
Moreno verstand den Menschen ausschließlich in seinem sozialen Kontext. Die kleinste Einheit war für ihn schon immer der Mensch in seinem sozialen Netzwerk, nicht das Individuum (siehe Das soziale Netzwerk als Diagnostik). Erste Überlegungen zur Bedeutung größerer Systeme stellte Moreno bereits während seiner ärztlichen Tätigkeit im Flüchtlingslager Mitterndorf bei Wien an. Die systematische Aufarbeitung dieser Ideen nahm er jedoch erst zu Beginn der 1930er Jahre in New York vor (vgl. Scherr 2013). Moreno erkannte, dass soziale Gruppen einen direkten Einfluss auf das psychische Befinden haben, dass die Konstellationen innerhalb von Gruppen entscheidend sind und dass die Betroffenen, nicht die Fachleute, die Spezialisten für ihre eigene Situation sind. Diese drei Aspekte waren für seine Zeit in hohem Maße ungewöhnlich und brachten damit völlig neue Ansätze in die medizinische und psychotherapeutische Arbeit.
Das Flüchtlingslager Mitterndorf als Ausgangsort soziometrischer Forschung
„Das Problem der geplanten Bevölkerungsumsiedlungen wurde von mir zum ersten Male in den Jahren 1915 bis 1918 studiert. Der Untersuchungsort war eine italienische Kolonie mit einer Bevölkerung von mehr als 10 000 Menschen. Während des ersten Weltkrieges wurden viele Bauern österreichischer Nationalität und italienischer Abstammung, die vor der herannahenden italienischen Armee geflüchtet waren und ihre Südtiroler Heimat verlassen hatten, von der österreichischen Regierung in Mittendorf bei Wien angesiedelt. Die Regierung hatte drei Probleme zu erwägen und sie in der Siedlungsplanung zu berücksichtigen: Sicherung vor dem Feind, Lagerhygiene und Unterhalt. Eine soziale und psychologische Planung aber wurde nicht berücksichtigt; es wurde überhaupt nicht an eine solche gedacht. Die Regierung beauftragte die medizinische Abteilung, der ich angehörte, mit der Überwachung des sanitären Problems der neuen Gemeinschaft. In dieser Position und später als Chefarzt des Lagerkinderkrankenhauses hatte ich Gelegenheit, diese Gemeinschaft von den ersten Anfängen bis zu ihrer Auflösung zu studieren, die nach drei Jahren stattfand, als die Siedler bei Kriegsende wieder in ihre Tiroler Heimat zurückkehren konnten. Während dieser Zeitspanne entwickelte sich ein kompliziertes Gemeinschaftsleben. Nach und nach wurden Schulen, Krankenhäuser, Kirche, Theater, Läden, Kaufhäuser, Zeitung, Gewerbe und soziale Klubs eingerichtet. Doch obgleich die Regierung versuchte, der äußeren Notlage zu begegnen, und trotz der Einführung aller äußeren Einrichtungen, die durch das Gemeinschaftsleben bedingt werden, bestanden Reibungen und großes Unbehagen unter der Bevölkerung. Ganze Weinbauerndörfer waren in einen industriereichen Vorortsbezirk verpflanzt worden, Tiroler Gebirgsleute in einen flachen Landstreifen bei Wien. Sie waren wahllos zusammengewürfelt, nicht aneinander gewöhnt und fremd in der Umgebung. Als ich die psycho-sozialen Strömungen studierte, die sich in Bezug auf verschiedene Kriterien entwickelt hatten – z. B. das Kriterium der nationalen Zugehörigkeit, der politischen Parteizugehörigkeit, Sexualität, Verwaltung contra Siedler usw. –, begann ich, diese Mißstände als die Hauptquelle der berüchtigten Unzuträglichkeiten und Zwischenfälle zu betrachten. Infolge dieser Erlebnisse keimte in mir damals klar, daß der Kern jeder psycho-sozialen Planung jeder therapiebedürftigen Gesellschaft die ‚Soziometrie’ sein muß.“ (Moreno 1954, 43 f.)
Als Moreno 1925 Europa den Rücken kehrte, standen sein soziometrisches und sein psychodramatisches Konzept noch nicht ganz, aber die Grundsteine waren gelegt. Im Reisegepäck hatte er eine Idee für eine von ihm und Franz Lörnitzo entwickelte Tonaufzeichnungsmaschine, Erfahrungen mit dem Stegreiftheater, einen Plan für eine Psychodramabühne sowie die Grundlagen der Soziometrie einschließlich dem Konzept für ein interaktives Soziogramm.
Soziometrie, Gruppentherapie und Psychodrama: Morenos Durchbruch in den USA
Aus dem Patent für die Tonaufzeichnungsmaschine wurde nichts, aber Psychodrama und Soziometrie verhalfen Moreno in den USA der 1930er Jahre zum beruflichen Durchbruch.
Jakob Levi Moreno in den USA
In den USA angekommen lässt sich Moreno 1925 zunächst in New York nieder, wo ihn sein Bruder, der bereits vor ihm dort war, unterstützt. Moreno setzte seine Stegreiftheater-Tradition fort und entwickelte sie in Form von kleinen Stegreifexperimenten weiter. 1927 erhält er die US-amerikanische Ärztelizenz. 1928 heiratet Moreno die Kinderpsychologin Beatrice Beecher, um seinen Aufenthalt zu legalisieren. Folgerichtig lassen sich die beiden 1934 mit dem Erhalt der amerikanischen Staatsbürgerschaft wieder scheiden. Im selben Jahr demonstriert er erstmals an der pädiatrischen Abteilung eines Mount Sinai Hospitals sein Stegreifspiel. Moreno hält an Schulen, Universitäten und Kliniken Vorträge zum Stegreifspiel, und schließlich kann er 1931 wieder ein Stegreiftheater gründen („Impromptu Theatre“). Über die dadurch entstehenden Kontakte zur Theaterszene lernt er die Sozialwissenschaftlerin Helen Jennings kennen, die ihm ihrerseits den Kontakt zu Sozialpsychologen und Soziologen bahnt und ihn in seinen wissenschaftlichen und soziometrischen Ambitionen sehr fördert. 1931 wird das Jahr seines Durchbruchs, er kann seine soziometrischen Testverfahren der amerikanischen psychiatrischen Vereinigung (American Psychiatric Association APA) vorstellen. Dort referiert er Ergebnisse, die er in amerikanischen Schulklassen erhoben hat und wird daraufhin eingeladen, ebensolche Studien im Gefängnis Sing Sing weiter zu verfolgen. Die Ergebnisse seiner Sing Sing-Untersuchungen über den Zusammenhang von Beziehungen unter Gefangenengruppen und Resozialisierungsaussichten, die er bei der APA 1932 präsentiert, machen ihn bekannt. Die Soziometrie als sozialwissenschaftliche Methode und das Setting Gruppe sind damit etabliert. Es folgten ein umfangreicher Forschungsauftrag als soziometrischer Forscher an der Hudson School for Girls 1932–1934 und zahlreiche Publikationen. Unter anderem gründete er als Herausgeber eine Reihe von Zeitschriften: Impromptu (1931), Sociometric Review (1936), Sociometry: A Journal of Interpersonal Relations (1937). Hier schrieben auch namhafte Autoren wie Margaret Mead und Gordon Allport. Bis 1955 waren Moreno und seine Frau Zerka Toeman Moreno Herausgeber dieser Zeitschrift, welche ab 1955 das Organ der amerikanischen soziologischen Gesellschaft wurde.
An der Hudson School for Girls entwickelt Moreno seine konkreten Vorgehensweisen zur Verbesserung zwischenmenschlicher Beziehungen durch Rollenspiele, differenziert sein Konzept der Soziometrie zusammen mit Jennings und treibt auch die Gruppentherapie voran. 1934 erhält er die amerikanische Staatsbürgerschaft und veröffentlicht sein soziometrisches Grundlagenwerk „Who shall survive?“. Zu seinen zwei Praxen in New York gründet Moreno 1936 eine psychiatrisch-psychotherapeutische Klinik in Beacon bei New York. Hier differenziert sich das Konzept der Gruppentherapie soweit, wie das Psychodrama heute als Methode bekannt wurde. Er behandelt dort auch Menschen mit schweren Psychosen, die andere Psychiater als unbehandelbar zurückgewiesen hatten. Sein Biograf Marineau vergleicht Beacon mit der Berggasse in Wien: Es wurde für das Psychodrama und die Gruppenpsychotherapie „a place of birth, a very fertile ground for the development of sociatry, the theatre replacing the couch, the community extending the boundaries of the therapeutic dyad” (Marineau 1989, 135). 1938 heiratet er seine zweite Frau Florence Bridge, mit der er eine Tochter hat, 1949 heiratet er schließlich Zerka Toeman, mit der er einen Sohn hat. 1942 beginnt er, über Psychodrama zu publizieren, und gründet die Gesellschaft für Psychodrama und Gruppenpsychotherapie. Das Psychodrama verbreitet sich rasch in den USA und findet auch Verbreitung an Universitäten und psychiatrischen Kliniken. Auch Fritz Perls, der spätere Begründer der Gestalttherapie, und Eric Berne, der spätere Gründer der Transaktionsanalyse, lassen sich in Beacon ausbilden. 1947 gründet der unermüdliche Moreno eine weitere Fachzeitschrift, „Sociatry, Journal of Group and Inter-Group Therapy“, die zuletzt 1976 in „Journal of Group Psychotherapy, Psychodrama and Sociometry“ umbenannt wird. 1951 ruft er ein internationales Komitee für Gruppenpsychotherapie zusammen und 1954 gibt es den ersten internationalen Kongress für Gruppenpsychotherapie. Moreno reist in dieser Zeit sehr viel, engagiert sich in zahlreichen Zusammenhängen, u. a. auch zur Friedensstiftung. Er stirbt am 14. Mai 1974 in Beacon. 1993 werden seine sterblichen Überreste nach Wien überführt.
Erst in den frühen 1930er Jahren gelang es Moreno, ein systematisches Konzept zur Soziometrie zu entwickeln (vgl. Scherr 2013; Stadler 2013b). In „Who shall survive? Foundations of Sociometry, Group Psychotherapy and Sociodrama“ (Moreno 1934; deutsch: Die Grundlagen der Soziometrie. Wege zu einer Neuordnung der Gesellschaft, 1954), seinem Standardwerk zur Soziometrie beschreibt Moreno die Stationen seiner soziometrischen Forschungsarbeit (Moreno 1954, 43 ff.):
Studien im Flüchtlingslager in Mitterndorf bei Wien (1916–1917),
Studium der Entwicklung von Kleingruppen im Kinderkrankenhaus Mitterndorf (1917–1918),
Studium an einer Public School in Brooklyn, N. Y. (Kinder von 4–14 Jahren) (1931–1932),
Studium an der Riverdale Country School, N. Y. (Jugendliche von 14–18 Jahren) (1932),
Soziometrisches Studium an der New York State Trainings School for Girls, Hudson, N. Y. (1932–1938),
Entwicklung des Rollenspieltests, des Spontaneitätstests (Stegreifprobe) und Spontaneitätstrainings (Stegreifübung) am Stegreiftheater in Wien (1922–1925), Grosvenor Neighbour House, New York City, und der New York State Training School for Girls, Hudson, N. Y. (1932–1938),
Anwendung des soziometrischen Bevölkerungstests und der psycho-sozialen Planung bei der Bildung neuer Gemeinschaften, Centerville und Freetown, N. Y. (1933–1938).
Kernpunkt der Soziometrie
„[…] ist eine, in Abhängigkeit von einem Kriterium, mehr oder weniger ausführliche Netzwerkanalyse. Moreno nannte sie auch „Soziologie mikrodynamischer Vorgänge“ (1996, S. 19) und verstand darunter das „mathematische[n] Studium psychologischer Eigenschaften der Bevölkerung, mit den experimentellen Methoden und den Ergebnissen, die aus den Anwendungen qualitativer Prinzipien resultieren. Sie beginnt ihre Untersuchung mit der Erforschung der Entwicklung und Organisation der Gruppe und der Stellung der Individuen in ihr. Eine ihrer Hauptaufgaben ist es, die Zahl und die Ausdehnung psychosozialer Strömungen, wie sie in der Bevölkerung verlaufen, zu ermitteln“ (1996, S. 28 f.). Dieses mathematische Studium umfasste die Messung, Analyse und Interpretation von Netzwerken. Diese drei sind auch deshalb nötig, da es neben den offensichtlichen Strukturen von Gruppen auch solche gibt, die nicht auf den ersten Blick erkennbar, aber häufig noch wirksamer sind als die sichtbaren: die Tiefenstrukturen. Zwischen Individuen und zwischen Gruppen fließen Energien von Anziehung (positiver Wahl), Abstoßung (negativer Wahl) und Gleichgültigkeit (Neutralität); soziale Systeme sind deshalb Präferentialsysteme.“ (Stadler 2013b, 31)
Ohne die Kenntnis der Tiefenstrukturen – Moreno (1959, 32) nennt sie „Verkehrswege der sozialen Beziehung“ – sind Menschen in ihren Beziehungen nicht verstehbar und letztlich, so der Schluss von Moreno, auch nicht angemessen psychotherapeutisch behandelbar. Die Soziometrie befindet sich damit an der Schnittstelle von Sozialpsychologie, Persönlichkeitspsychologie und klinischer Psychologie. Die soziometrische Grundhaltung Morenos macht erst verstehbar, wie er zu seinem Gruppentherapiekonzept und letztlich zum Psychodrama kommen konnte. Der Übergang von der soziometrischen Messung und Analyse von Gruppen hin zu einer Behandlung von Gruppen fand an der New York State Training School for Girls statt. Nach der Datenerhebung, mit wem die Mädchen am liebsten wohnen und arbeiten möchten, und der Datenauswertung in Form von Soziogrammen (vgl. Schlechtriemen 2013), folgte eine gruppentherapeutische Intervention. Die Gruppen wurden entsprechend der Ergebnisse neu zusammengestellt und Moreno machte Rollenspiele und Psychodramen mit den Mädchen, um ihre Situation zu verbessern (Moreno 1954). In diesen Jahren 1932 bis 1934 liegt die Geburtsstunde der Gruppentherapie.
„Die Gruppenpsychotherapie hat Anerkennung gefunden, weil sie gewisse Bedürfnisse erfüllt, die die individuellen Therapien nicht befriedigen können. Wir leben von Geburt an in Gruppen. Störungen, die in großem Maße durch die uns umgebende Welt bedingt sind, können nicht beseitigt werden, wenn nicht das Milieu zu einem Teil der therapeutischen Situation gemacht und gleichzeitig behandelt wird.“ (Moreno 2008, 55)
Die Eröffnung des Beacon Hill Sanatoriums 1936 war der nächste Schritt der Ausdifferenzierung des gruppentherapeutischen Konzeptes. Hier konzipierte Moreno die Klinik als therapeutische Gemeinschaft: Mitarbeiter und Patienten lebten zusammen auf dem Klinikgelände. Nicht die distanzierte therapeutische Beziehung kann Heilung bringen, sondern die zwischenmenschliche authentische Begegnung. Er schreibt:
„Mir wurde klar, […] dass nur Menschen, die sich begegnen, eine natürliche Gruppe und einen kleine tatsächliche menschliche Gemeinschaft formen können. Es sind Menschen, die sich begegnen, die die verantwortlichen und aufrichtigen Begründer sozialen Lebens sind.“ (Moreno zit. nach Hutter / Schwehm 2009, 192)
In Beacon vollzog Moreno den zweiten wichtigen Schritt in Theorie und Praxis, den von der (soziometrischen) Gruppentherapie hin zur psychodramatischen Therapie. Er rundete sein Konzept des psychodramatischen Spieles ab, indem er hierfür konkrete Abläufe und Bestandteile experimentell mit seinen Patienten erprobte und beschrieb. Dazu gehören die Rollen des Protagonisten, der Mitspieler, der Bühne, der Gruppe und des Spielleiters (siehe Instrumente des Psychodramas). Das Psychodrama ist „Therapie in der Gruppe, durch die Gruppe, für die Gruppe und der Gruppe“ (Moreno zit. nach Leutz 1986, 92) (siehe Gruppe). Die Verbindung von Soziometrie, Gruppentherapie und Psychodrama war hergestellt. Die Grundprinzipien von Morenos psychodramatischer Gruppentherapie sind:
Die unmittelbare und authentische Begegnung, welche durch den Rollentausch der Gruppenmitglieder untereinander noch verstärkt wird. Prägnant bringt Buber Morenos Idee auf den Punkt: „Der Mensch wird am Du zum Ich“ (Buber 1962, 97),
die Beachtung der Interaktionen der Gruppenmitglieder, der Gruppendynamik und der Gruppenkohärenz,
das durch gemeinsames Erleben wachsende gemeinsame Bewusste und Unbewusste, welches sich z. B. in Rollenverteilungen innerhalb der Gruppe zeigt,
das Nutzen der gruppenimmanenten Selbstregulationsmechanismen, d. h. ein Protagonist bearbeitet ein Thema für die Gruppe und ein Thema ergibt sich aus dem anderen,
das Spiel als Möglichkeit, den eigenen inneren und den gemeinsamen kreativen Selbstheilungsprozess anzustoßen.
Die „Einladung zu einer Begegnung“ (in der Gruppe), welche Moreno zu seinen Wiener Zeiten als Titel seiner Schriftenreihe gewählt hatte, bleibt handlungsleitend für sein therapeutisches Vorgehen: Die Begegnung
„bedeutet Zusammentreffen, Berührung von Körpern, gegenseitige Konfrontation, sich gegenüberstehen, zu kämpfen und zu streiten, zu sehen und zu erkennen, sich zu berühren und aufeinander einzugehen, zu teilen und zu lieben, miteinander auf ursprüngliche Art und Weise zu kommunizieren, durch Sprache oder Geste, Kuss und Umarmung, Einswerden – una cum uno.“ (Moreno 1956 zit. nach Hutter / Schwehm 2009, 192 f.)
Aktuelle Entwicklungen
Das Psychodrama nahm seinen Ausgang bei Moreno in Wien und New York bzw. Beacon, hat sich aber danach sehr weit verbreitet und verschiedene Einfärbungen angenommen. Das US-amerikanische Psychodrama hat sich anders entwickelt als das südamerikanische, dies wiederum anders als das europäische. Und selbst letzteres ist kein homogenes Gebilde geblieben. Das US-amerikanische Psychodrama hat sich in mehrere akademische (Soziometrie und Rollenspiel) und einen New-Age-beeinflussten Zweig geteilt, das südamerikanische ist stark politisch und am Theater orientiert, das französische ist mehrheitlich psychoanalytisch geprägt, ein Teil des italienischen und schweizerischen Psychodramas integriert die Konzepte von C. G. Jung. Im deutschsprachigen Raum insgesamt hat sich nicht zuletzt dank Morenos Schülerinnen Grete Leutz und Heika Straub das klassische Psychodrama nach Moreno durchgesetzt und wurde lange Jahre als Gruppenpsychotherapiemethode gelehrt und praktiziert. Die humanistische Grundorientierung ist geblieben, je nach therapeutischem Stil manchmal etwas verhaltensorientierter, manchmal etwas prozessorientierter, manchmal die Psychodynamik etwas mehr in den Vordergrund rückend und manchmal mehr den systemischen Blick betonend. Bislang liegt kein Überblickswerk vor, welches die Entwicklungsstränge des Psychodramas systematisch darstellt. Zwei neuere Bände, der von Gershoni (2003) und der von Baim et al. (2007) beleuchten das Psychodrama aus unterschiedlichen Perspektiven und geben einen guten Überblick über neuere Entwicklungen (Cross-Over mit Kunst- und Familientherapie, traumaspezifische Ansätze, Arbeit in Großgruppen, transgenerationales Arbeiten, Kinderpsychodrama, neurowissenschaftliche Zusammenhänge, Evaluation etc.). Auch die „Zeitschrift für Psychodrama und Soziometrie“ (ZPS) als deutschsprachige Fachzeitschrift greift neue Entwicklungen des Psychodramas auf, z. B. das störungsorientierte Vorgehen oder Bezüge zur Neurobiologie und anderen Nachbarwissenschaften.
Monodrama
Vereinfacht gesagt ist Monodrama Psychodrama ohne Mitspieler. Nach dem Gruppenboom in den 1970er Jahren ist das therapeutische Setting Gruppe in den 1990ern aus der Mode gekommen. Gesellschaftliche Einstellungsänderungen und Hürden bei der Antragsstellung im Kassenverfahren in Deutschland sowie die lange Zeit schlechte Bezahlung von Gruppenpsychotherapie brachten Gruppen im ambulanten Setting im deutschsprachigen Raum beinahe zum Verschwinden. Einzig im stationären Bereich wurden noch zahlreiche Gruppen durchgeführt und deren Effektivität auch immer wieder aufs Neue belegt (siehe Evaluation). Aus der Not eine Tugend machen, so kann der Beginn des Monodrama-Settings wohl am besten beschrieben werden. Durch den Bedarf an handlungsorientierter Psychotherapie im ambulanten Bereich etablierte sich das Monodrama als Psychodramaspiel, bei dem nur eine Person eine Szene darstellt. Dies geschieht meist unter Zuhilfenahme von Intermediärobjekten wie Figuren, Stühlen und Symbolen. Manchmal ist es auch angezeigt, dass der Therapeut „mitspielt“, meist stellt der Patient seine Szene jedoch alleine dar und wechselt dazu die Rollen der beteiligten Personen.
Heute ist das monodramatische Vorgehen längst nicht mehr der Not geschuldet, sondern inhaltlich sehr elaboriert und detailreich beschrieben.
„Man kann diese Entwicklung [vom Gruppen- zum Einzelsetting, Erg. d. A.] aus guten wissenschaftlichen und ethischen Gründen (siehe Morenos (1974, S. 444) Postulat des „cosmic man“) bedauern und kritisieren. Diese weltanschaulich-ökologische Forderung darf aber nicht dazu führen, dass wir Psychodramatiker und Psychodramatikerinnen die zentrale Potenz des Psychodramas aus den Augen verlieren: Psychodrama aktiviert und fördert nämlich wie keine andere Psychotherapie-Methode die Kreativität des Menschen und befreit sie durch die Psychodrama-Techniken differenziert aus ihren (durch Abwehr entstandenen) Fixierungen hin zu frei kreativem Fühlen, Denken und Handeln. Diese Wirkung des Psychodramas ist nicht vom Gruppensetting abhängig. Psychodrama ist deshalb in der Einzelarbeit genauso hilfreich wie in der Gruppenarbeit, und das nicht nur als defizitärer Ableger der Gruppenarbeit, ‚wenn man leider keine Mitspieler zur Verfügung hat‘. Die Aktivierung und Befreiung der Kreativität und gerade auch die Möglichkeit, immer wieder zwischen somato-psychischer und metaperspektivisch-symbolisierender Arbeit zu wechseln, macht Psychodrama in der Einzelarbeit zu einem Verfahren mit vielfältigen kreativen Wirkungen und einem breiten Indikationsfeld.“ (Krüger 2005, 266)
Ein erstes Lehrbuch zum monodramatischen Setting erschien 1996 (Erlacher-Farkas / Jorda), neuere Veröffentlichungen dazu liegen von Krüger (2005), Schaller (2009) und Sturm (2009) vor. Monodrama wird heute indikationsabhängig sowohl in der Gruppe als auch im Einzelsetting angewandt. Näheres zum Setting findet sich im Abschnitt zur Bühne.
Soziodrama
Das Soziodrama ist eigentlich nicht neu, sondern eher wiederentdeckt (vgl. Wiener 2001; Wiener et al. 2011; Wittinger 2005; Kellermann 2007; Ameln et al. 2009). Meist wird Psychodrama mit einer protagonistenzentrierten Arbeit in Verbindung gebracht (siehe Instrumente und Arrangements), d. h. eine einzelne Person steht im Vordergrund. Das Soziodrama hat einen anderen Fokus. Hier steht eine ganze Gruppe im Mittelpunkt.
„Es handelt sich nicht um ein privates Problem von dem einen oder anderen Individuum in der Gruppe wie im Psychodrama, sondern um ein Problem, mit dem alle Individuen der Gruppe, indem sie an einem verbreiteten sozialen Konflikt bewusst oder unbewusst teilhaben, involviert sind. […] Wenn das Thema die Beziehung zwischen Liebe und Ehe ist, wird nicht die private Welt eines bestimmten Individuums, ein Liebhaber oder eine Ehefrau oder ein Ehemann und die Dreiecksbeziehung zwischen ihnen gezeigt, sondern die Rolle der Ehefrau, des Ehemannes, der anderen Frau, wie sie kollektiv in Erscheinung treten.“ (Moreno 1948 zit. nach Hutter / Schwehm 2009, 354)
Das Soziodrama wird an dieser Stelle angeführt, weil es lange Zeit nur eine Nebenrolle spielte, was nicht zuletzt auch damit zu tun hatte, dass seit etwa Mitte der 1980er Jahre die Gruppe im therapeutischen Setting nicht mehr en vogue war. Dies hat sich erst wieder in den letzten drei bis vier Jahren geändert: Gruppen werden im therapeutischen Setting wieder gefördert (vgl. Mattke et al. 2009).
Klassischerweise werden Soziodramen zu Themen inszeniert, welche ganze Gruppen und ihre Beziehungen untereinander und in ihnen fokussieren. Die Gruppe wird vom Leiter gebeten, sich ein kollektives, soziokulturelles Thema auszusuchen, welches dann szenisch dargestellt wird. Eine typische Konstellation ist z. B. die Gruppenkonstellation Schüler und Lehrer. Die Gruppe wird in zwei Hälften aufgeteilt, die eine Hälfte spielt die Schüler, die andere die Lehrer. Nach einer gewissen Aktionszeit tauschen die Gruppen kollektiv die Rollen und sammeln Erfahrungen in der Gegenposition. Den Abschluss bildet die Integrations- und Auswertungsphase. In der Integrationsphase berichten die Teilnehmer, was sie in ihren jeweiligen Rollen persönlich erlebt haben. Im Beispiel könnte ein „Schüler“ berichten, dass er sich in einer bestimmten Situation ohnmächtig gegenüber den Lehrern gefühlt habe, oder dass er sich als Schüler so verhalten habe, wie er es aus seinem Arbeitsleben kenne. In der Auswertungsphase geht es dagegen darum, den Bezug des in der Aktionsphase gezeigten Verhaltens zu aktuellen Themen in der Gruppe herzustellen. Es wird betrachtet, inwieweit die Gruppendynamik sich in dem Soziodrama Platz verschafft hat. Im Beispiel kann festgestellt werden, dass in der Gruppe eine Stimmung von Belehren und richtigen bzw. falschen Beiträgen herrscht.
Ameln et al. (2009, 90 ff.) treffen in Abgrenzung zu vorstehender Beschreibung des klassischen Soziodramas eine hilfreiche Unterscheidung zwischen verschiedenen soziodramatischen Arbeitsformen:
themenzentriert,
gruppenzentriert,
soziokulturell.
Die Autoren beziehen sich dabei auf das psychodramatische Konzept der Surplus-Realität. „Im Psychodrama werden nicht nur vergangene, gegenwärtige und zukünftige real erfahr- und vorstellbare Episoden gespielt und erlebt. […] Im Psychodrama können auch Erfahrungen gemacht werden, die über die Wirklichkeit hinaus ein neues und umfassenderes Wirklichkeitserleben ermöglichen.“ (Moreno 1974, 213) Diese Surplus-Realität wird eröffnet, sobald auf der psychodramatischen Bühne gespielt wird (siehe Abschnitt Bühne), also eine innere Wirklichkeit im Außen der Bühne gezeigt wird. Ameln dazu: „Ich fasse Surplus Reality daher nicht als einen durch den Inhalt des Dargestellten definierten Oberbegriff für Bühnen mit ‚unrealistischen‘ Themen auf, sondern als „Modus der Erfahrung“ (Moreno 1965, 212), der in jeder psychodramatischen Arbeit durch die Externalisierung der Wirklichkeit der KlientInnen entsteht.“ (Ameln 2013