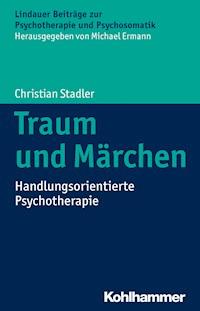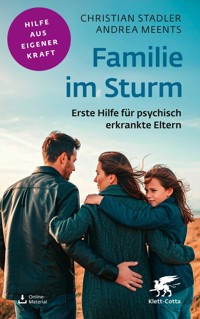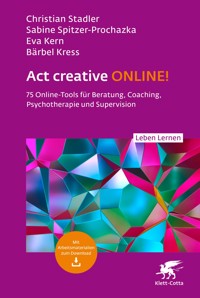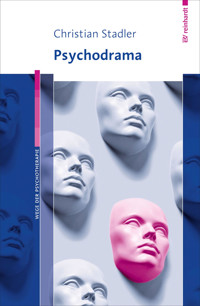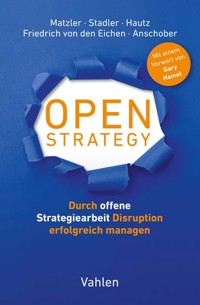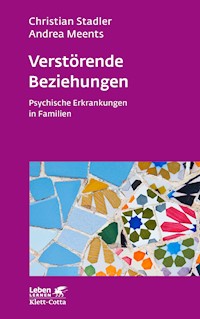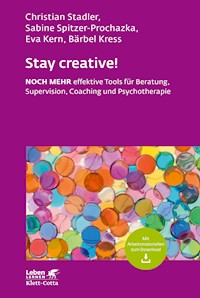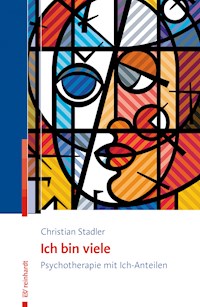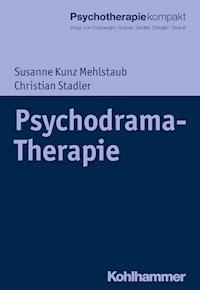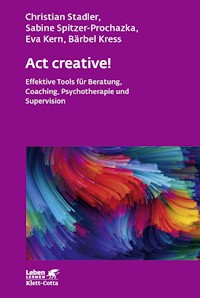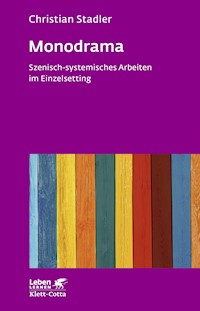
Monodrama - Szenisch-systemisches Arbeiten im Einzelsetting (Leben Lernen, Bd. 319) E-Book
Christian Stadler
24,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Leben Lernen
- Sprache: Deutsch
Reden allein reicht nicht - Innovative Herangehensweise - In jede Richtlinientherapie integrierbar Bereits Jakob Moreno, ein berühmter Seelenarzt und Zeitgenosse Sigmund Freuds, bemerkte, dass nicht die verbale Psychotherapie allein Besserung bei psychischen Problemen bewirken kann, sondern dass erlebensorientiertes »Handeln« dazukommen sollte. Mit dem »Psychodrama« entwickelte er ein szenisch-systemisches Vorgehen, das er in der Gruppen- und Einzeltherapie erfolgreich anwandte. Das »Monodrama«, wie es Christian Stadler in vorliegendem Band vorstellt, ist die Adaption von Morenos Psychodrama für das szenisch-systemische Arbeiten im Einzelsetting. Hier werden spezifische Techniken und Interventionen, basierend auf den jeweiligen theoretischen Grundannahmen, vermittelt und durch Beispiele anschaulich konkretisiert. Abbildungen erleichtern die Anwendung in Psychotherapie und Beratung, wobei die Interventionen in alle gängigen Therapieformen integriert und auch in der Supervision genutzt werden können. Dieses Buch richtet sich an: - PsychotherapeutInnen aller Schulen - Psychologische BeraterInnen - Coaches
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 202
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Christian Stadler
Monodrama
Szenisch-systemisches Arbeiten im Einzelsetting
Klett-Cotta
Zu diesem Buch
Monodrama ist die Anwendung des von Jakob Moreno entwickelten Verfahrens Psychodrama im Einzelsetting von Psychotherapie, Beratung und Supervision. Unter Beratung wird hier sowohl die psychosoziale Beratung wie z. B. Erziehungsberatung, Suchtberatung oder sozialpsychiatrische Beratung als auch das Coaching im Feld der Personal- und Organisationsentwicklung verstanden. Auch wenn das Arbeiten in Gruppen im therapeutischen und psychosozialen Bereich wieder ein Revival erlebt, arbeiten die meisten therapeutisch und beraterisch tätigen Kolleg*innen heute überwiegend im Einzelsetting. Das vorliegende Buch ist als kompakte Einführung in die Welt monodramatischer Interventionen gedacht, die auch ohne Grundkenntnisse des Verfahrens Psychodrama im beruflichen Alltag eingesetzt werden können.
Die Reihe »Leben Lernen« stellt auf wissenschaftlicher Grundlage Ansätze und Erfahrungen moderner Psychotherapien und Beratungsformen vor; sie wendet sich an die Fachleute aus den helfenden Berufen, an psychologisch Interessierte und an alle nach Lösung ihrer Probleme Suchenden.
Alle Bücher aus der Reihe ›Leben Lernen‹ finden Sie unter:
www.klett-cotta.de/lebenlernen
Impressum
Leben Lernen 319
Dieses Buch ist Reinhard Krüger gewidmet.
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
© 2020 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung
Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten
Printed in Germany
Umschlag: Jutta Herden, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von © istockphoto/LUM/KK555
Datenkonvertierung: Eberl & Koesel Studio, Altusried-Krugzell
Printausgabe: ISBN 978-3-608-89257-4
E-Book: ISBN 978-3-608-12054-7
PDF-E-Book: ISBN 978-3-608-20441-4
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Inhalt
Vorwort
Kapitel 1
Psychodrama
1.1 Psychodramatisches Grundverständnis
1.2 Wie geschieht im Psychodrama Veränderung?
Kapitel 2
Grundlegendes zum Monodrama
Kapitel 3
Die Frage der Indikation: Das störungsorientierte Arbeiten im psychotherapeutischen und beraterischen Monodrama
Kapitel 4
Zehn zentrale Monodrama-Techniken
4.1 Szenenaufbau – Verstehen, was ist
Variante Seelenlandschaft – Orientierung suchen
Variante Aufstellung – Verhältnisse klären
Der störungsorientierte Szenenaufbau
Szenenaufbau bei Menschen, die an einer Psychose erkrankt sind
Szenenaufbau bei Menschen mit einer Sucht- oder Abhängigkeitserkrankung
Szenenaufbau bei Menschen mit einer Posttraumatischen Belastungsstörung
Zusammenfassung störungsorientierten Vorgehens mit dem monodramatischen Szenenaufbau
4.2 Doppeln – Vertiefte Exploration und Innerer Dialog
Das Doppeln bzw. gedoppelt werden
Arten und Ziele des Doppelns
Störungsorientiertes Doppeln
Doppeln bei Menschen, die unter einer Psychose leiden
Doppeln bei Menschen, die unter einer Abhängigkeitserkrankung leiden
Doppeln bei Menschen, die unter einer Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) leiden
Zusammenfassung störungsorientierten Vorgehens mit dem monodramatischen Doppeln
4.3 Rollenwechsel und Rollenspiel im kulturellen Atom – Ich bin viele
Störungsorientierte Rollenwechsel und Rollenspiele in einer eigenen Rolle
Rollenwechsel bei Menschen, die unter einer emotional instabilen Persönlichkeitsstörung leiden
Rollenwechsel bei Menschen, die unter Suchterkrankung leiden
Rollenwechsel bei Menschen, die unter Angst leiden
Das Spielen in Rollen
Rollenspiel bei Menschen in schweren Krisen und Belastungen – Bewegung auf der Timeline
Rollenspiel bei Menschen, die unter Wiederholungskonflikten leiden – Reaktivierung der Selbststeuerung
Rollenspiel bei Menschen, die unter Zwangsstörungen leiden – Hauptsache Spielen
Zusammenfassung störungsorientierten Vorgehens mit dem monodramatischen Rollenwechsel und Rollenspiel
4.4 Spiegeln – ICH und die anderen von außen betrachtet
Wozu dient Spiegeln?
Spiegeln zur Entdeckung ›blinder Flecke‹
Spiegeln bei Menschen, die an einer Borderline-Persönlichkeitsstörung leiden – der hilfreiche Blick von außen
Die Spiegelposition zur Krisenbewältigung
Das Arbeiten mit der Spiegelposition bei Menschen, die unter einer Posttraumatischen Belastungsstörung leiden
Bewältigungsmärchen
Zusammenfassung störungsorientierten Vorgehens mit dem Spiegeln und der Regieposition
4.5 Rollenwechsel im sozialen Atom, Rollenspiel in der Rolle eines anderen, Rollenfeedback und Identifikationsfeedback
Monodramatische Rollenwechsel und Rollenspielen im sozialen Atom
Aufgaben der Therapeut*innen, während sich die Protagonist*innen im Rollenwechsel befinden
Das Rollenspiel in der Rolle eines anderen
Störungsorientierter Rollenwechsel und Rollenspiel im sozialen Atom
Rollenwechsel im sozialen Atom bei Menschen mit depressiven Störungen und Individuations-Abhängigkeits-Konflikten
Rollenwechsel und Rollenspiel bei sozialen Phobien
Rollenwechsel als verhaltensorientiertes Training bei Phobien
Zusammenfassung störungsorientierten Vorgehens mit dem Rollenwechsel und dem Spielen in der Rolle eines anderen
4.6 Rollentausch
Störungsorientierter Rollentausch bei Beziehungsproblemen
Indirekter Rollentausch bei gravierenden Beziehungsproblemen
Die letzte Begegnung – Abschiednehmen mit dem Rollentausch
Der Traum auf Objekt- und Subjektstufe
Zusammenfassung spezifischen Vorgehens mit dem Rollentausch
4.7 Szenenwechsel
Szenenwechsel in eine vergangene Szene
Störungsorientierter Szenenwechsel
Störungsorientierter Szenenwechsel bei Menschen mit somatoformen Störungen
Szenenwechsel bei Menschen mit isolierten Phobien und Panikattacken
Zusammenfassung störungsorientierten Vorgehens mit dem Szenenwechsel
4.8 Amplifikation
Störungsspezifische Amplifikation bei Menschen mit narzisstischer Akzentuierung
Szenenwechsel bei Übertragungskonflikten in der Beratung und Behandlung
Zusammenfassung störungsorientierten Vorgehens mit der Amplifikation
4.9 Sharing
Störungsorientiertes Sharing bei Themen von Schuld und Scham oder anderweitig großer Belastung
Störungsorientiertes Sharing bei Psychose und schweren strukturellen Störungen
Zusammenfassung störungsorientierten Vorgehens mit dem Sharing
4.10 Veränderung in der Zeit
Zusammenfassung störungsorientierten Vorgehens mit Zeitveränderungen
Kapitel 5
Monodrama in der Supervision
Literatur
Wo kann ich das Monodrama lernen?
Vorwort
Psychodrama ist der griechische Begriff für etwas Seelisches (Psycho), das handelnd (drama) dargestellt wird. Die ›Wahrheit der Seele durch Handeln ergründen‹, so hat es Jakob Levy Moreno (1889–1974)1, der Begründer des Verfahrens, ausgedrückt. Der psychodramatische Zugang zeichnet sich durch sein humanistisches und systemisches Grundverständnis sowie sein Denken in sozialen Netzwerken aus. Psychische, innere Sachverhalte werden im Psychodrama äußerlich sichtbar, und damit leichter und nachhaltiger handhabbar gemacht. Sinngemäß könnte man hier Tschechow zitieren: Das Eigentliche, »die eigentliche Atmosphäre beginnt, wo das Gerede endet«, im Handeln neben den Worten, hinter den Worten, jenseits aller Worte. Die konkreten Handlungsinterventionen des Psychodramas helfen dabei, hinter die Worte zu blicken.
Monodrama, von dem dieses Buch handelt, ist die Anwendung des Verfahrens Psychodrama im Einzelsetting von Psychotherapie, Beratung und Supervision. Unter Beratung wird hier sowohl die psychosoziale Beratung wie z. B. Erziehungsberatung, Suchtberatung oder sozialpsychiatrische Beratung als auch das Coaching im Feld der Personal- und Organisationsentwicklung verstanden. Auch wenn das Arbeiten in Gruppen im therapeutischen und psychosozialen Bereich wieder ein Revival erlebt, arbeiten die meisten therapeutisch und beraterisch tätigen Kolleg*innen heute überwiegend im Einzelsetting. Das vorliegende Buch ist als kompakte Einführung in die Welt monodramatischer Interventionen gedacht, die auch ohne Grundkenntnisse des Verfahrens Psychodrama im beruflichen Alltag eingesetzt werden können.
Dazu werden zunächst einige psychodramatische Grundbegriffe sowie das Prozessmodell der Veränderung, der Kreative Zirkel, vorgestellt. Anhand dieses Zirkels wird erläutert, wie man sich im Verfahren Psychodrama grundsätzlich eine Veränderung in der Beratung und Psychotherapie von Menschen vorstellen kann. Daran anschließend folgen die einzelnen Kapitel mit den zehn monodramatischen Haupttechniken und Interventionen. In diesen zehn Kapiteln wird aufgezeigt, für welche Störungen, beziehungsweise für Patient*innen und Klient*innen mit welchem Strukturniveau (OPD Achse IV; Arbeitskreis OPD 2014), diese Interventionen hilfreich sind. Das Strukturniveau beschreibt, wie gut strukturiert ein Mensch als ganze Person, unabhängig von seiner konkreten Fragestellung oder Symptomatik ist. Es umfasst Bereiche von Selbst- und Fremdwahrnehmung, Emotionalität, Beziehungsgestaltung und Regulationsfähigkeit.
Der Zusammenhang von Interventionen und Störungen bzw. Strukturniveau wird jeweils an einem Beispiel veranschaulicht und im praktischen Vorgehen beschrieben.
Das dem Buch zugrundeliegende Konzept besagt also, dass unterschiedliche Interventionen oder Psychodramatechniken für die Klient*innen und Patient*innen hilfreich sind, abhängig von der Struktur der Persönlichkeit (AK OPD 2014; Rudolf 2012), der Fragestellung oder Störung. Kurz: Nicht für jedes Problem ist dieselbe Intervention hilfreich. Diese Passung oder Spezifität der Interventionen zieht eine gewisse Vereinfachung nach sich. Darum spricht man heute auch im Allgemeinen von Störungsorientierung und weniger von Störungsspezifität.
Kapitel 1
Psychodrama
1.1 Psychodramatisches Grundverständnis
Wenn das in der Beratung und Psychotherapie eingesetzte Psychodrama auf einen Nenner gebracht werden soll, könnte man sagen: Das Psychodrama nimmt das, was die Menschen in ihrem Inneren beschäftigt und bringt es nach draußen, macht es für die betreffenden Patient*innen außerhalb ihrer Person sichtbar. Paul Holmes, ein englischer Psychodramakollege, hat dies sehr schön in drei Worte gefasst: »Inner World Outside« (2015). Der Vorteil dieser Bewegung ist ein zweifacher. Einmal ist das, was mich beschäftigt, dann draußen, d. h., ich trage es in diesem Augenblick nicht mehr in mir drin, kann nicht nur sprachlich und emotional damit umgehen, sondern kann es mit Händen be-greifen, ich kann es anfassen, daran handelnd etwas verändern. Und ich bin quasi als Nebeneffekt gezwungen zu überlegen, was und wen ich im Außen wohin positioniere in meinem Bild. Letzteres ist das Mentalisieren: Ich mache mir ein Bild von mir selbst, von dem, wie es in mir aussieht und von dem, wie ich die anderen sehe und erlebe (Bateman und Fonagy 2015).
Beispiel Version 1:
Anita, eine 35-jährige Patientin, ist Mutter zweier Kinder, von Beruf Mediendesignerin, wo sie einer Halbtagstätigkeit nachgeht, und Tochter einer suchtkranken Mutter. Sie beschreibt, dass sie seit drei Jahren depressive Gefühle hat. Ihr Ehemann habe dafür kein Verständnis.
Als Anita dies erzählt hat, stellt der Therapeut einen kleinen Tisch vor ihren Stuhl und öffnet darauf eine Schachtel mit unterschiedlich großen und verschiedenfarbigen Holzfiguren. Er bittet sie, dass sie das, was sie gerade erzählt hat, einmal mit diesen Figuren aufstellt. Sie nimmt eine kleine grüne Figur für sich und stellt sie nahe bei sich an den Rand des Tisches. Direkt daneben positioniert sie zwei weitere gelbe Figuren für ihre beiden Kinder. Danach nimmt sie einen quadratischen roten Klotz für ihre Arbeitsstelle, den sie nach kurzem Zögern etwas weiter weg von sich aufstellt. In ähnlicher Entfernung landet auch die blaue größere Figur für den Ehemann auf dem Tisch, und zuletzt nimmt sie eine große rote Figur und stellt sie mit einem Seufzen in die Mitte des Tisches: »Und das ist meine Mutter«.
Was ist passiert? Die Patientin hat Figuren, im Psychodrama werden diese Intermediärobjekte genannt, und Positionen gewählt. Sie hat sich klargemacht, wo sie steht, wo ihre Angehörigen und wo ihr Job in ihrem Leben gegenwärtig positioniert ist. Die Patientin hat diese Aufstellung nun vor Augen und kann somit die Gesamtkonstellation erkennen. Sie kann außerdem sehen, wer entsprechend ihres augenblicklichen, inneren Gefühls nahe bei ihr steht und wer weiter weg ist. Sie kann auch Bedeutungen erkennen: Wen hat sie an den Rand gestellt, für wen hat sie große, für wen kleine Objekte gewählt. In dieser kurzen Aufstellungszeit hat sie ihre Inner World ihres sozialen Netzwerks nach außen gebracht und etwas von sich verstanden. Hätte sie denselben Sachverhalt rein sprachlich darstellen wollen, hätte sie vermutlich weniger spontan gehandelt und sehr viel länger gebraucht, um die komplexen inneren Bezüge angemessen zu beschreiben. Sie kann sich nun mit einer der Figuren näher beschäftigen oder sie kann eine Beziehung zwischen zwei Figuren näher in Augenschein nehmen oder sie kann eine Veränderung einer Position ausprobieren, sie kann Wunschkonstellationen aufstellen. All dies ist im Draußen, auf der Tischbühne, relativ einfach möglich, und es hat Auswirkungen auf ihr inneres Befinden.
Im Psychodrama werden innere Sachverhalte externalisiert und das Mentalisieren wird gefördert. Was ist Psychodrama noch? Es ist die Beschäftigung mit Rollen. Begriffe wie Rollen und Rollenspiele lösen bei vielen Menschen negative Reflexe aus. Man fürchtet sich davor, kategorisiert oder bloßgestellt zu werden, etwas vorspielen zu müssen. Rollen im Psychodrama sind aber nur so etwas wie innere Anteile. Betrachten wir dazu noch einmal die o. g. Patientin. Wir beginnen noch einmal mit der Einstiegserzählung der Patientin.
Beispiel Version 2:
Nach Anitas Erzählung (siehe oben) sagt der Therapeut, dass sie in ihrem kurzen Bericht ja schon viele Rollen beschrieben hat, und bittet sie, dass sie diese einmal mit Figuren sichtbar macht. Eine Figur steht für sie selbst und die anderen für die verschiedenen Rollen, die sie hat.
Sie nimmt eine kleine grüne Figur für sich und stellt sie nahe bei sich an den Rand des Tisches. Direkt daneben positioniert sie eine große gelbe Figur (»Das bin ich als Mutter, das macht mich gerade zu 80 % aus.«) Danach nimmt sie eine kleine rote Figur für ihre Rolle als Mediendesignerin in der Firma, die sie nach kurzem Zögern etwas weiter von ihrer Figur entfernt aufstellt (»Die Mediendesignerin kommt aktuell wirklich zu kurz.«) In ähnlicher Entfernung positioniert sie auch eine sehr kleine blaue Figur für ihre Rolle als Ehefrau auf dem Tisch und zuletzt nimmt sie eine große rote Figur und stellt sie mit einem Seufzen in die Mitte des Tisches (»Das bin ich als Tochter meiner Mutter. Diese Rolle nervt mich am meisten!«)
Was ist der Unterschied zum ersten Vorgehen? Es wird in der zweiten Version nicht das soziale Netzwerk, also die anderen Personen in den Fokus gestellt, sondern die inneren, korrespondierenden Rollen der Patientin. Natürlich gibt es das eine nicht ohne das andere, es gibt keine Tochterrolle ohne eine Mutter, keine Mutterrolle ohne ein Kind, keine Mieterrolle ohne eine Vermieterrolle. Der Psychodramagründer Moreno hat die Zusammenschau dieser zwei Perspektiven das soziokulturelle Atom genannt: die sozialen Rollen (die Anderen) und die kulturellen Rollen (die inneren Anteile).
Der Vorteil der psychodramatischen Beschäftigung mit den inneren Rollen liegt auf der Hand. Veränderungen gelingen einfacher bei einem selbst als beim anderen. Und systemisch betrachtet wird sich die korrespondierende Rolle beim anderen automatisch ändern (müssen), wenn ich meine innere ändere. Wenn Anita ihre Tochterrolle ändern kann, wird sich ihre Mutter auch verändern. Der erste Schritt in Richtung Veränderung ist das Kennenlernen der inneren Rollen. Die Patientin kann z. B. eine Rolle besonders interessieren, weil sie z. B. so dominant ist oder so nervig oder so interessant. Anita könnte möglicherweise sagen, »Ich will meine Tochterrolle besser verstehen« oder »Ich will meiner Arbeitsrolle mehr Gewicht geben« oder »Ich will meine Mutterrolle kleiner machen und die Partnerinrolle größer«.
Auch dies beinhaltet eine Externalisierung innerer Zustände und ein Mentalisieren. Im Psychodrama können nicht nur soziale Netzwerke, bzw. deren innere Repräsentanten, außen auf einer Bühne dargestellt werden, sondern auch eigene innere soziale Rollen (Mutter, Tochter, Ehefrau, Mediendesignerin).
Zwei weitere Schritte sind psychodramatisch möglich. Wir bleiben zunächst bei den Rollen. Es gibt nicht nur soziale innere Rollen, sondern auch psychische, also so etwas wie innere Anteile (Körperzustände, Gefühle, Gedanken, Impulse). Nehmen wir noch einmal das Beispiel von oben.
Beispiel Version 3:
Wieder geht es um Anita. In dieser Version bittet der Therapeut sie, dass sie nun einmal überlegt, was für Gefühle und Gedanken oder Impulse damit verbunden sind, und dass sie diese einmal mit Figuren sichtbar macht. Eine Figur steht für sie selbst und die anderen für die verschiedenen Körperzustände, Gefühle, Gedanken und Impulse, die sie hat.
Sie nimmt eine mittlere grüne Figur für sich und stellt sie nahe bei sich auf den Tisch. Direkt daneben positioniert sie eine große dunkle Figur (»Das sind meine verzweifelten, depressiven Gefühle, wo ich mich schwer fühle wie ein Stein.«) Danach muss sie etwas nachdenken. Sie nimmt dann eine kleine gelbe Figur für ihre Glücksgefühle, wenn sie morgens allein ist und einmal nichts tun muss. Dann nimmt sie eine kleine rote Figur und stellt sie etwas weiter weg (»Das sind meine Gedanken, ob ich mich nicht besser von meinem Mann trennen soll.«) Zuletzt nimmt sie eine dunkle, große Figur und stellt sie neben die andere Figur, die für die Depression steht (»Das ist mein Impuls, meiner Mutter, wenn sie wieder betrunken anruft, zu sagen, dass sie sich doch zum Teufel scheren soll!«)
Wieder wird psychodramatisch externalisiert und mentalisiert von der Patientin. Sie macht sich klar, wie ihre innere Lage ist. Sie lernt zu unterscheiden zwischen gegebenen Rollen und Personen und ihren unterschiedlichen körperlichen, emotionalen, kognitiven und impulshaften Reaktionen. Sie kann sortieren, erkennen, was ihr nahe ist und was fern, was größer und was kleiner.
Eine Mischung aus Vorgehen 2 und 3 ist die Arbeit mit inneren Anteilen im Sinne einer Teile-Arbeit (Stadler 2017; Ameln et al. 2019; Schnabel et al. 2019), wie sie auch die Ego-States-Therapie vornimmt. Bestimmte innere Rollen treten als Cluster auf. So kann die Mutterrolle immer mit der Erschöpften einhergehen oder die Tochterrolle ist gebunden an ein bestimmtes Alter und an bestimmte Impulse.
Ein letzter psychodramatischer Schritt ist das Spielen in Rollen. Nehmen wir dazu noch einmal das Beispiel, wie es in der ersten Version beschrieben ist, als Ausgangspunkt.
Beispiel Version 4:
Anita hat das, was sie zunächst erzählt hat, mit Figuren aufstellt. Als alle Figuren an ihrem Platz stehen, bittet der Therapeut sie zu schauen, wo sie gerade die meiste Belastung oder das größte Konfliktpotential sieht. Sie deutet spontan auf den Ehemann.
Der Therapeut fordert sie auf, einmal aus der Rolle ihrer Figur zu ihrem Ehemann zu sprechen. Sie legt dazu den Finger auf ihre Figur und sagt: »Ich bin so enttäuscht von dir, dass ich mir überlege, mich von dir zu trennen. Lieber bin ich mit den Kindern allein, als dich auch noch immer ertragen und bedienen zu müssen.« Dann bitte ich sie, ihren Finger auf die Figur ihres Ehemannes zu legen und darauf aus seiner Rolle zu antworten. Sie sagt: »Ich bin von dir auch enttäuscht, du bist nur noch Mutter und nur noch genervt. Manchmal möchte ich dich richtig schütteln, damit du wieder die alte wirst.« Sie wechselt so ein paar Mal hin und her und es entsteht ein Dialog.
Mithilfe dieser Rollenwechsel kommt die Patientin in ein Rollenspiel. Sie beginnt zu handeln und versteht so dynamisch immer mehr von sich selbst und von ihrem Ehemann, bzw. – streng genommen – von dem Bild, das sie von ihrem Ehemann in sich trägt. Letzteres ist eine Objektrepräsentanz. Im Rollenspiel ändern sich dabei sowohl ihre Subjektrepräsentanzen (sie selbst und ihr Bild von sich) als auch die Objektrepräsentanz.
Dies ist in aller Kürze psychodramatisches Arbeiten. Wie dies durch Techniken und Interventionen angereichert werden kann und welche dieser Anreicherungen für welche Störungen und Erkrankungen hilfreich sind, wird in den Kapiteln zu den Techniken beschrieben. Doch zuerst braucht es noch zwei Dinge, einmal eine kurze Erklärung monodramatischer Begriffe und danach den Blick auf das psychodramatische Modell der Veränderung psychischen Erlebens und Verhaltens.
Kurze Einführung in die monodramatischen Begrifflichkeiten
Protagonist*in: Unter der Protagonist*in wird die Person verstanden, deren Thema gerade im Fokus der Beratung oder Behandlung steht. Im Beispiel oben Anita. Aus Sicht der Protagonist*in wird das Thema betrachtet und verstanden.
Bühne: Die Bühne ist der Ort, auf dem eine Aufstellung oder eine Szene dargestellt wird. Dies ist in der Regel nicht der Ort des rahmenden Gespräches, sondern ein anderer, definierter Platz im Raum. Zwei Arten der monodramatischen Bühne werden unterschieden: die Tischbühne und die Zimmerbühne. Als Tischbühne dient in der Regel ein kleiner Beistelltisch, auf dem mit Figuren und anderen Objekten (Holzklötze, Tücher, Steine, Moderationskarten) gearbeitet werden kann. Bei der Zimmerbühne wird ein Teil des Therapieraumes als Bühne definiert und manchmal auch abgegrenzt durch ein Seil oder ein Tuch. Auch auf der Zimmerbühne kann mit Objekten gearbeitet werden, die in der Regel aber größer sind (große Holzkegel, Tücher, Kissen, Stühle). Bei der Arbeit auf der Zimmerbühne begibt sich der oder die Protagonist*in somatisch in die Aufstellung oder Szene hinein.
(Intermediär-)Objekt: Ein Objekt ist ein unbelebter Gegenstand oder eine Sache, auf den sich der oder die Protagonist*in beziehen kann. Objekte können dabei alles Mögliche sein, z. B. eine Kerze, eine Tasse, eine Holzfigur, ein Stein, ein kleines Plastiktier oder eine Puppe. Wichtig ist, dass ein Bezug zwischen Protagonist*in und Objekt besteht. Dem Intermediärobjekt (Rojas Bermúdez 2003) wird von dem oder der Protagonist*in eine Bedeutung gegeben: Der Teddybär steht für die Mutter oder das Glas steht für die Chefin.
Aufstellung: Bei einer Aufstellung geht es um das Sichtbarmachen von verschiedenen inneren und/oder äußeren Rollen und deren Positionierung zueinander. Das bedeutet, es können sowohl soziale Netzwerke als auch innere Zustände aufgestellt werden. Es ist ein exploratives und größtenteils statisches, von konkreten Situationen abstrahierendes Vorgehen.
Szene: Eine psychodramatische Szene ist das Darstellen einer von der jeweiligen Protagonist*in vorgetragenen konkreten Situation oder Geschichte, die auf der Bühne eingerichtet und handelnd exploriert bzw. verändert werden kann. In einer Szene können sowohl Personen als auch innere Zustände ihren Platz haben.
Rollenspiel: Hierunter wird ein szenisches Handeln einer Protagonist*in verstanden, das im Als-ob-Modus dazu dient, eine in der Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft liegende Situation oder Begebenheit in ihrem zeitlichen Ablauf zu diagnostizieren, zu explorieren und/oder weiter voranzutreiben. Dies kann auch den Charakter eines Rituals oder eines Trainings annehmen.
1.2 Wie geschieht im Psychodrama Veränderung?
Das Psychodrama geht davon aus, dass sich in der kindlichen Entwicklung aus sozialen Interaktionen innere Erlebens- und Handlungsmuster entwickeln, die als Rollen beschrieben werden können. Die Summe der unterschiedlichen Rollen ergibt das Selbst des Menschen. Mit diesem Rollenrepertoire, das grundsätzlich lebenslang erweiterbar oder differenzierbar ist, tritt ein Mensch mit neuen sozialen und psychischen Gegebenheiten in Kontakt. Sind passende Rollenmuster für die neue Situation vorhanden, können diese abgerufen werden; sind keine passenden vorhanden, ist ein innerer kreativer Prozess gefordert, neue Muster zu schaffen, entweder durch eine Kombination aus vorhandenen oder durch die Integration ganz neuer Muster. Gelingt dies, und die neuen Muster bewähren sich, können sie in das Rollenrepertoire dauerhaft aufgenommen werden. Zum Beispiel war Bernd in der Schule recht gut in den romanischen Sprachen Spanisch, Italienisch und Französisch. Nach dem Studium beginnt er in einem Unternehmen zu arbeiten, dessen Hauptabsatzmarkt China ist. Er bekommt vermehrt Mails in cc, die in Chinesisch abgefasst sind. Das Erlernen des Chinesischen erfordert einen kreativen Prozess (und eine Lernanstrengung!), damit er sich hier zurechtfindet. Ebenso erfordert es z. B. einen kreativen Prozess, aus den Rollen des Jugendlichen und des jungen Erwachsenen, des Sohnes in die eines Ehemannes oder Familienvaters zu wechseln. Die neu entdeckten oder erworbenen Muster müssen auch eine positive Bestätigung durch die eigene Person und die Umwelt erfahren. Wird Bernd von seinen chinesischen Kolleg*innen für seine gute sprachliche Auffassungsgabe gelobt, wird sich die neue Rolle schneller und nachhaltiger ankern, als wenn kein positives Feedback dazu erfolgt. Und wenn er sich gefällt in der neuen Rolle des Familienvaters, wird er die Rolle auch besser integrieren können, als wenn er damit hadert, dass er jetzt schon Vater geworden ist.
Der Prozess der Erweiterung oder Veränderung des Rollenrepertoirs ist die Beschreibung des kreativen Zirkels. Gelingt dieser Anpassungs- oder Veränderungsprozess nicht, entwickeln sich Störungen, Symptome oder Krankheiten (vgl. Abbildung 1). Der innere kreative Prozess ist blockiert (vgl. Krüger 2015; Bender und Stadler 2012). Mit dieser Blockade gehen auch Störungen der Mentalisierungsfähigkeit einher. Um den kreativen Prozess wieder in Gang zu bringen und damit die Heilung bzw. Selbstheilungskräfte der Patient*innen zu aktivieren, werden die entsprechenden Psychodrama-Techniken eingesetzt. Wenn die Person/Rolle/Umwelt-Passung nicht stimmt, ist ein kreativer, schöpferischer Prozess erforderlich.
Abbildung 1: Psychodramatischer Kreativitätszirkel in Kombination mit dem transtheoretischen Veränderungsmodell von Prochaska & di Clemente (nach: Kunz Mehlstaub und Stadler 2018, S. 64)
Der kreative Zirkel setzt ein, wenn ein aktuelles Erleben und Verhalten nicht zur vorliegenden Situation passt (Störung Rolle-Umwelt). Die innere Konfliktlage führt zu einer Erwärmung und weiter in eine innere Handlungsbereitschaft. Kann die Kreativität genutzt werden, führt dies zu neuen Rolle-Umwelt-Mustern, die wiederum innerlich überprüft und bewertet werden. Bei einer guten Passung und entsprechender Bewertung sowie Wiederholung dieses inneren Prozesses wird das neue Muster ins Rollenrepertoire aufgenommen.
Die Psychodrama-Techniken und Interventionen werden eingesetzt, um diesen inneren Selbstheilungsprozess der Patient*innen in Gang zu bringen.
Kapitel 2
Grundlegendes zum Monodrama
Das Psychodramatische Denken und Herangehen ist damit in groben Zügen beschrieben, nun zu den Besonderheiten des Monodramas. Einfach gesagt ist das Monodrama ein Psychodrama im Einzelsetting. Das bedeutet, ein*e Klient*in/Patient*in bearbeitet ihr Thema mit den Möglichkeiten des Psychodramas. Konkret kann dies unterschiedlich aussehen:
Patient*in handelt mit sich alleine nach einer konkreten Vorgabe
Patient*in handelt in Anwesenheit eines oder einer Therapeut*in allein.
Patient*in handelt gemeinsam mit einem oder einer Therapeut*in. Letzteres wird in der Fachliteratur auch als Psychodrama à deux bezeichnet.
Sehen wir von der Sonderform des Allein-Handelns ab, bleibt die Unterscheidung, ob im Monodrama der oder die Therapeut*in in der Szene mitspielt oder nicht. Neben dem persönlichen Leitungsstil, der sich auf diese Entscheidung auswirkt, ist es eine Frage der Indikation. Je stabiler und klarer strukturiert die Patient*innen oder Klient*innen sind, desto eher können sie damit umgehen und profitieren, wenn die Leitung zeitweise auch mitspielt, vor allem als Stellvertreter*in in der Protagonist*innenposition.
Beispiel: