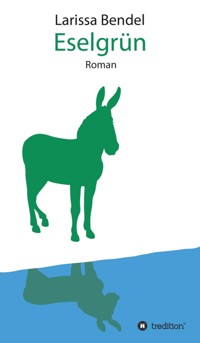4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wieder einmal packt sie ihren Koffer und fährt nach Oslo, ihre andere Heimat. Sie hat eine mehr als zweiwöchige Reise gebucht, ihr Lieblingshotel, in dem sie immer wohnt, wenn sie in der norwegischen Hauptstadt ist. Kurz vor ihrer Abfahrt aus Hamburg war sie noch beim Friseur gewesen. Ohne frisch geschnittene, gut sitzende Haare konnte und wollte sie noch nie wegfahren. Sie hat einen Plan. Im Sommer kurz vor ihrem vierzigsten Geburtstag sitzt Marta Seidenfeldt auf einer Bank im Osloer Frognerpark, isst einen Apfel und denkt. Sie spürt, dass sie irgendwie feststeckt im Dazwischen. Ihr Leben ist anders ‒ und anders, als sie es sich vorgestellt hatte. Puttgarden Mitte See ist ein Stadtroman über Hamburg und Oslo. Es ist ein Buch über Heimat: geistige, soziale, örtliche. Es ist ein Text über die Magie von Literatur und Popmusik. Und es ist eine Erzählung über Marta Seidenfeldt, die der Frage nachspürt, wie ihr Leben geworden ist, wie es ist, und ob es so bleiben soll oder wer sie eigentlich sein will. Puttgarden Mitte See ist, wie Marta, eigenwillig, ehrlich und sensibel.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 351
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
www.tredition.de
Larissa Bendel
Puttgarden Mitte See
Roman
www.tredition.de
© 2016 Larissa Bendel
Verlag: tredition GmbH, Hamburg
Lektorat: Katja Reibstein M.A.
Umschlaggestaltung: Stella Krause
ISBN
Paperback:
978-3-7345-1879-9
Hardcover:
978-3-7345-1880-5
e-Book:
978-3-7345-1899-7
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Vegeta Vertshus und Vega Fair Food: Danke für das Gefühl von Heimat. Ihr werdet schmerzlich vermisst.
Nina H.: Danke für deine ermutigenden Worte.
She shrugs her coat off and unlocks the door
Eats her dinner on the kitchen floor
Writes a poem and turns the radio on
Every singer sings the same old song
– „Mary Ellen Makes the Moment Count“ (Paul Waaktaar-Savoy, 2000)
1
Als ihr der Satz einfiel, musste sie unwillkürlich auflachen. „Die Pflastersteine waren so zersprungen wie ihr Herz.“ Wie hatte ihr diese pathetische, kitschige, verbrauchte Formulierung nur einfallen können, diese zufällige, bedeutungslose Assoziation, deren Herkunft sie eigentlich in einem jener Groschenromane vermutet hätte, die sie lediglich aus der Auslage von Bahnhofskiosken kannte, aber nie in ihren eigenen Gedanken? Manchmal sah sie diese Hefte auch bei Fahrgästen in der U-Bahn, die linke Seite mit dem Titelblatt nach hinten umgebogen, aber so, dass man Franziska und der Schmerz der Liebe, Veronikas Traum vom Glück, Julia – eine Nacht oder ein Leben? zwar nicht mehr lesen, aber noch erahnen konnte. Wer waren diejenigen, die diese Hefte kauften? Es mochte viele Gründe geben, sich so einer Geschichte zu widmen, und im Grunde ging es sie nichts an. Doch sie konnte nicht anders, als sich zu fragen, wer warum was las und ihre Gedanken dazu in die kulturhistorischen Entwicklungen einzuordnen. Sie selbst liebte amerikanische Klassiker oder preisgekrönte zeitgenössische Werke amerikanischer oder norwegischer Autoren und Autorinnen. Nie verließ sie das Haus, ohne ein Buch in der Handtasche zu haben.
Nicht nur die Beobachtung von Lesegewohnheiten; auch alles andere verwandelte sie nahezu reflexartig in eine umfassendere Problemstellung, eine knifflige Diskussion oder ein differenziertes Denkexperiment, polarisierte, spitzte zu, ironisierte. Sie fand, dass man den Alltag nicht einfach so hinnehmen könnte. Das Leben war so komplex; auch das Alltägliche musste für sie Tiefe und Substanz, feinsinnige Gedankenspiele und kritische Erkenntnisse haben, woraus sich dann auch immer eine kleine Portion Weltschmerz ergab, wenn man es genau betrachtete, ohne den sie zuweilen gern leben würde, aber nicht konnte. Melancholie war doch ein zu fruchtbarer Gemütszustand, wenn er, wohl dosiert, ihr Inneres zu öffnen schien für Erkenntnisse, ihre Sehnsüchte für einen kurzen Moment als fühlbares Durchfließen ihres Körpers aufblitzen ließ, sie an ihre Träume erinnerte, die in der mechanischen Routine des Alltags immer mal wieder unsichtbar wurden. Trotz allen Entsetzens, ein Simile wie „Die Pflastersteine waren so zersprungen wie ihr Herz“ überhaupt gedacht und sogar als Beschreibung ihrer Gefühlslage in Betracht gezogen zu haben, ging ihr der Satz nicht aus dem Kopf. Sie wehrte sich gegen das Eingeständnis, aber irgendwie war etwas Wahres daran, das sie denn auch gleich versuchte gedanklich zu ergründen.
Sie war wieder einmal in Oslo, hatte eine mehrwöchige Reise gebucht, ihr Lieblingshotel, in dem sie immer wohnte, wenn sie in der norwegischen Hauptstadt war. Noch nicht einmal ihre Freunde wussten, dass sie nicht in Hamburg war und wo sie sich aufhielt. (Obwohl sie es sicher vermuteten.) Sie hatte einfach nur weggewollt, die Fähre ab Kiel reserviert, ihren Koffer gepackt. Sie hatte einen Plan. Kurz vor ihrer Abfahrt war sie noch beim Friseur gewesen. Ohne frisch geschnittene, gut sitzende Haare konnte und wollte sie noch nie wegfahren. Eigentlich war es noch nicht wirklich an der Zeit gewesen, die Spitzen stutzen zu lassen oder auch etwas Neues, Peppiges auszuprobieren, das ihr das Gefühl vermittelte, in ihrem Leben eine große Wendung vollzogen zu haben. Aber zum Friseur musste sie, vor ihrer Reise, irgendetwas würde man schon abschneiden, begradigen oder umgestalten können.
Manchmal nahm sie ein altes T-Shirt mit auf ihre Fahrten, trug Turnschuhe, obwohl diese eigentlich nicht flott genug waren für eine junge oder noch jüngere Frau, sie aber gut in ihnen laufen konnte. Ihre Mutter wollte immer, dass sie noch eine extra Jacke mitnahm, und „lieber eine Hose zu viel, falls etwas nass würde“, und gab ihr diese Tipps auch noch, als sie längst erwachsen war. Aber sie ging mit Ersatzkleidung eher sparsam um, nahm eher zu wenig mit als zu viel, ließ häufig auch den Schirm in ihrer Unterkunft, was sie manchmal bereute und manchmal auch nicht. Die Sachen würden schon wieder trocknen. Aber ausgewachsene, fransige Haare? Undenkbar.
Um nicht zu stolpern, sah sie beim Gehen in regelmäßigen kurzen Intervallen auf den Boden, der zerfurcht war von eingelassenen Regen- und Schmelzwasserabflüssen. Er war gespickt mit wackelnden, zerbrochenen, fehlenden Pflastersteinen, grau, befleckt, hier und da fand sich ein Kaugummi, der nur noch ein dunkler Abdruck auf der Betonplatte, aber keine fühlbare Erhöhung mehr war, eine Zigarettenkippe, Bonbonpapier, ein verlorener Einkaufszettel. Die Luft war klar und warm, die Sonne schien, der Himmel war, bis auf einige in Abständen vorbeihuschende daunenkissenförmige, schafsartige Wölkchen strahlend blau, hin und wieder blies ein lauer Wind, der der Sonne für einen Moment ihre hochsommerliche beißende Kraft nahm.
Im Sommer ist in Oslo eine eigenartige Stimmung, so, als würde die Erde einem anderen Tagesrhythmus nachgehen als der Himmel. In den Straßen herrscht wilde Unordnung. Die scheinbar die gesamte Innenstadt umfassende Baustelle ähnelt einem Bild von Jackson Pollock, in dem sich die Bewegungen des Künstlers in seinen Strukturen spiegeln, ein assoziatives vermeintliches Chaos, das erst bei langem genauen Betrachten sein produktives systemisches, kreatives Wesen entfaltet. Ein Palimpsest, das seine verbrauchten Schichten nicht verbirgt, sondern Teil des Neuen werden lässt. Der Straßenbeton ist aufgerissen, Gebäudefassaden sind mit wehenden Tüchern und Schildern von Baufirmen verhängt, unter denen die Renovierung im Verborgenen vor sich geht. Zugänge zu Häusern, Parks, U-Bahn-Stationen sind gesperrt, Kreuzungsübergänge blockiert, Busse umgeleitet und Straßenbahnen auf alternative Schienenpfade verlegt. Viele dieser Orte sind temporär sich selbst überlassen, während anderswo das Klopfen und Dröhnen von Werkzeugen, das erzwungen anmutende, fast gewaltsame, immer lauter werdende Antreiben von Baggern und Presslufthämmern die sommerliche Leichtigkeit dumpf zerschneidet, der aufgewirbelte Staub sich in Haaren und Kleidern festsetzt, die Zunge trocken werden lässt. „Bitte die andere Straßenseite benutzen“ steht auf kniehohen, leuchtend gelben Schildern mit schwarzer Schrift an zahllosen Stellen, manchmal sogar einander direkt gegenüber in derselben Straße, sodass man als Fußgänger nicht mehr weiß, für oder gegen welche Straßenseite man sich eigentlich noch entscheiden soll. „Originell“, schmunzelte sie, halb amüsiert, halb angestrengt, „wo soll ich denn jetzt gehen?“, und kletterte in ihren Sandalen achtsam über aufgerissene Kantsteine und abgesackte Gehwege.
Der harte Winter mit den langen Frostperioden macht Straßenbau und Gebäudesanierungen viele Monate im Jahr unmöglich. Daher müssen diese Arbeiten in der kurzen Sommerphase durchgeführt werden, in der die Baumaschinen den Beton und das Pflaster aufbrechen, die alten, kaputten Steine durch neue ersetzen können, bevor eine Schneedecke oder mehrere Zentimeter dickes Eis die Stadt wieder überziehen.
Im Gegensatz zu dieser intensiven Geschäftigkeit am Boden, dem zivilisatorischen Gewusel von Straßenarbeitern, Einwohnern und Touristen strahlt der Himmel eine unbändige Ruhe aus, in klarem Blau, mit weißen Wolken oder durch ein Farbspiel der unzähligen Grau- und Blauschattierungen vor oder nach dem Regen. Dennoch steht er niemals still. Er ist permanent in Bewegung, ruhig, oft intensiv, aber nie überstürzt. Stundenlang ziehen gleichmäßig blaue oder blau-weiße Bänder über das Firmament. Bis sich dann, an einem Tag oder auch nur in einigen Stunden, dunklere, bedrohlichere Farben daruntermischen, die vielleicht Regen bringen, der anhält, der aber oft auch nur ein Intermezzo ist, das bei den Einwohnern der Stadt kaum einen Schirm provoziert, während die Besucher sich hektisch nach einem Unterstand umsehen.
Im Sommer sind die Tage unendlich lang, das weiß auch der Himmel, und lässt sich Zeit mit seinem Spiel der Wetterlagen und Temperaturen, des klaren, tiefblauen Wassers des nahezu windstillen Fjords, das bis zum Horizont reicht, oder den peitschenden Schaumkronen im Hafen, die Gedanken an die turbulenten Reisen der zähen, wetterfesten Wikinger evozieren, die den Naturgewalten trotzten. Auch an Regentagen wird es im Sommer nicht wirklich dunkel, strahlt die Mitternachtssonne ihr Echo bis in die südliche Hauptstadt, in der es sich in diesen Nächten nur unruhig schläft. Zu groß ist wohl das Verlangen, das Spiel des Abendlichts am Fjord zu beobachten. Zu verlockend die Verwunderung über die Nacht, die kein Schwarz konnotiert und sich aus ihrer klassischen Assoziationskette des Unheimlichen, Verborgenen befreit und märchenhaftem Zwielicht, einer rauen Feenstimmung weicht.
Im Winter scheint sich der Rhythmus von Himmel und Erde umzukehren. Die gnadenlose Kälte bei klarer Sicht lässt mitleidslos Hautstellen blutig aufplatzen, die nicht mit wärmenden Stoffen bedeckt oder fetthaltigen Cremes überzogen sind, fordert dem Körper Anstrengung auch nur beim Einkaufengehen ab, lässt den Kiefer steif werden, sodass das Sprechen, angekommen im warmen Raum, so mühevoll ist, als weiche die Betäubung nach einem Zahnarztbesuch nur gemächlich aus dem verspannten Kiefer. Nur nach dem Aufgehen der Sonne lugt das Tageslicht für einige Stunden hinter der langen Finsternis hervor, ehe die Polarnacht schon um die Mittagszeit wieder eine dunkle Schwere über die Stadt senkt. Die Straßen sind still, die Kälte beißend und unnachgiebig, aber anders als in Hamburg, wo man die Menschen im Winter mit gesenktem Kopf, verschlossenem Blick und missmutigen Gedanken, die an die Kälte, Nässe und Dunkelheit adressiert sind, durch die Straßen eilen sieht. Die Osloer gehen aufrecht und sehen dem Winter geradeheraus in sein Antlitz. Bei einem ersten Sonnenstrahl sind selbst im tiefen Winter die Außentische in Straßencafés besetzt, die Gäste eingehüllt in Decken, auf dem Tisch die nur kurz dampfenden Heißgetränke, die wenige Augenblicke später fast schon gefroren sind. Die dicke Schneedecke auf den Gehwegen dämpft die Schritte, zu hören ist nichts als das wohlige Knarzen der weißen, weichen Kristalle unter den Schuhen, das sie irgendwie immer an den Moment des Abdrucks beim Orthopäden erinnert, als sie als Kind einen Fuß in den Schaumstoffkasten setzen musste, um Einlagen anpassen zu lassen. Knick-, Spreiz- und Senkfuß. Auf den Straßen schnurren Motoren, klicken die Schneeketten und Spikes auf dem Asphalt. Dort, wo der Schnee noch unberührt ist von den Routen seiner Stadtbewohner, erfordert jeder Schritt Kraft beim Stapfen durch das hoch aufgetürmte Weiß. An anderen Stellen, wo die Straßen nicht von einer Schneedecke überzogen sind, glänzt oft blankes Eis, zentimeterdick, das hin und wieder durch sein Knacken auf sich aufmerksam macht, und dessen wunderschönes anthrazitfarbenes oder schwarzes Glänzen so trügerisch harmlos ist.
So wie damals, als sie das erste Mal im Winter dort war, als sie Lene besuchte. Es war bitterkalt in Oslo, der Himmel über der Stadt war strahlend blau, es gab keinen Neuschnee, sondern nur eine festgefrorene, platte, aber immer noch weiße Schneedecke, das Relikt starken Schneefalls in den Wochen zuvor. Ganz Oslo schien zu leuchten, die helle, glitzernde Schicht auf Häusern, Wegen und Bäumen erinnerte sie an den Belag des typisch norwegischen Karottenkuchens, den sie so liebt: Eine feste süße Cremeschicht mit Kokosstreuseln auf dem weichen, saftigen, von Karottenraspeln durchzogenen Boden mit dem Geschmack von Zimt. Auf manchen Fußwegen lag kaum noch Schnee; diese waren stattdessen bedeckt von einer schwarz glänzenden, dicken Eisschicht. Ihr fiel ein, dass sie und Lene sich damals an Simsen und Regenrinnen festgehalten hatten, um sich auf den meist abschüssigen Bordsteinen überhaupt vorwärtsbewegen zu können. Begleitet wurden ihre Wege von jenem sorglosen mädchenhaften Gekicher über das Abenteuer, dem Gefühl der Unverwundbarkeit, der Leichtigkeit unbedarfter Jugendlicher. An die Möglichkeit des Ausrutschens und von Knochenbrüchen dachten sie nicht einmal, die das Eis wahrscheinlich vor allem für ältere Stadtbewohner implizierte. Sie rutschten und stolperten auf den unebenen Gehwegen, die der Frost so unbarmherzig unmittelbar nach ihrer Instandsetzung wieder aufbricht, hielten sich aneinander fest, um sofort darauf wieder in Gekicher zu verfallen, kombiniert mit jenem Aufquietschen, das weiblichen Teenagern eigen scheint und das sie heute, mehr als zwanzig Jahre später, immer so nervt, ihre Ohren schmerzen lässt, wenn sie in der U-Bahn oder in der Stadt damit konfrontiert wird.
„Die Pflastersteine waren so zersprungen wie ihr Herz“, fiel ihr wieder ein, war fast zu einem Ohrwurm geworden, diese lächerliche Formulierung, die sie daran erinnerte, dass sie wieder einmal in Oslo war, und warum. Sie hatte einen Plan. Hier konnte sie denken, ihr Leben mental ordnen, inkognito sein, wenn sie es sich wünschte, Einsamkeit in Alleinsein umdeuten. Es war Juli, nur wenige Wochen vor ihrem vierzigsten Geburtstag, und obwohl sie ziemlich genau wusste, wer sie war, wollte sie ein für alle Mal herausfinden, wer sie sein wollte. Deshalb war sie nach Oslo gereist, zum unzähligen Mal, und sie würde erst zurückkehren, nach Hamburg, wenn sie die Spuren ihres Lebens entwirrt hätte.
2
Immer wieder betrachtete sie das Foto. Musterte es. Trat näher heran, ging einen Schritt zurück. Wandte sich ab, entschlossen, endlich weiterzugehen, das Bild, das sie in seiner Schlichtheit wie Virtuosität so faszinierte, hinter sich zu lassen. Eine inszenierte Momentaufnahme, voller menschlicher Wärme und zugleich den Betrachter herausfordernd, sich zu positionieren, zu Kunst und Alltag, zu Politik und Häuslichkeit. „In den 1970er Jahren…“, hörte sie entfernt die Stimme der Kunsthistorikerin, die sie durch die Ausstellung in der alten Hamburger Fabrikhalle führte, das Quietschen und Trapsen der Schuhe der anderen aus der Gruppe, die sich immer weiter entfernte. „Nur noch einmal“, disziplinierte sie sich, starrte wieder auf den unscheinbaren Rahmen an der Wand. 1984. Zwei ältere Männer, in Anzügen, sitzend auf einer Klavierbank vor dem Instrument. Im Hintergrund, verschwommen und außerhalb des Fokus des Fotografen, ist ein Raum zu sehen, vielleicht ein Wohnzimmer, es hängen Bilder an der Wand. Der Gesichtsausdruck der Männer ist neutral, aber doch eher freundlich. Unentwegt, sie dachte „unerbittlich“, verfolgen sie den Blick des Betrachters, so, als ob sie ihn direkt mit dem Akt seines Beobachtens konfrontieren wollen. Der linke der beiden Herren hat freundschaftlich, beruhigend seine Hand auf die des anderen auf dessen Oberschenkel gelegt. Vertrautheit, Sicherheit, Freundschaft, Homoerotik fallen ihr dazu ein. Die Gesichter der Männer sind fein zerfurcht von ihrem beginnenden Alter, ihre Augen wach und weise, klug und gütig. Menschlich. Alles, nur nicht rebellisch.
1984, dachte sie. Da war sie zehn, und sie kannte jeden einzelnen Popsong im Radio. Trat stundenlang mit sich selbst in den Wettbewerb, das kommende Lied möglichst schon bei den ersten Takten präzise mit Interpret und Titel, als sie älter war, auch mit dem Jahr seiner Veröffentlichung benennen zu können. Oft wünschte sie sich, schon vor dem ersten Ton das Stück zu antizipieren, das gleich gespielt werden würde. Manchmal gelang ihr das sogar. Solange sie zurückdenken konnte, gehörte Popmusik zu ihrem Leben. Ihre Eltern waren beide glühende Elvis-Presley-Fans, ihr Vater Jazzmusiker. Die Melodien aus dem Radio oder vom Plattenteller schallten durch die Wohnung, wann immer ihre Eltern zu Hause und nicht bei der Arbeit waren. Sie war gerade einmal fünf, sechs Jahre alt, als sie einen eigenen Kassettenrekorder, einen Schallplattenspieler und ein Radio für ihr Kinderzimmer bekam. Der Plattenspieler stand in einer dunklen, hölzernen Musiktruhe, die ihr ihre Großeltern gegeben hatten, Radio und Kassettenspieler darauf. Vorn ließ sich eine Klappe nach unten öffnen, hinter der sich rechts der Schallplattenspieler befand, links war Platz für Platten. Um Singles, die kleinen 45er, abzuspielen, gab es einen Stab, den man am Plattenteller befestigen konnte und auf den sich mehrere Platten stecken ließen. Die Unterste lag auf dem Plattenteller. War diese zu Ende, so plumpste die Nächste von oben herab und wurde von der Nadel, die unermüdlich über den schwarzen Lack fuhr, gelesen und abgespielt. So brauchte man nicht nach jedem Lied die Scheibe zu wechseln. Wo war ihre Musiktruhe geblieben? Irgendwann war sie verschwunden, einer Kompaktanlage von „Schneider“ gewichen, die damals in so vielen Kinder- und Wohnzimmern stand. Heute hätte sie ihre alte Musiktruhe gern in ihrer Wohnung stehen, als ein Erinnerungsstück aus der Vergangenheit, ein Zeugnis ihrer frühen Liebe zur Popmusik.
Ihre Eltern vertrauten ihr, wussten, dass sie mit den Geräten würde umgehen können, Schlafenszeiten nicht missachtete und die Lautstärke mit Bedacht wählte. Der Norddeutsche Rundfunk, NDR2, brachte ihr in diesen ersten Kindheits- und Teenagerjahren fast alles bei, was sie über Popmusik wissen wollte. Sonntags spätnachmittags, auf dem Rückweg im Auto von einem Ausflug in den Geesthachter Wald in der Nähe von Hamburg, von einem Tag am Strand in Grömitz in der Lübecker Bucht oder auch nur vom Spielplatz im Hamburger Stadtpark war es mucksmäuschenstill im Auto. „Psst“, sagte sie zu ihren Eltern, „jetzt kommt das Wunschkonzert.“ An allen anderen Tagen der Woche hieß die Sendung im Radio nur „Club“. Junge Leute hörten hier aktuelle Popmusik, erfuhren Nachrichten zu Themen, die sie interessierten. Aber am Sonntag gab es das „Club-Wunschkonzert“, bei dem Zuhörer ihre Lieblingstitel per Telefon durchgeben und über das Radio noch jemanden aus ihrem Freundes- oder Familienumfeld grüßen konnten. Etwas rätselhaft blieb ihr dabei immer eine Rubrik der Sendung, die „Kontaktecke“, gleichwohl war sie wie magisch fasziniert davon. Jugendliche, junge Erwachsene konnten sich beim Moderator der Sendung melden, wenn sie jemanden suchten, wiedersehen wollten: „Ich habe dich letztes Wochenende beim Schützenfest in Lüneburg getroffen. Du hast mit mir zu ‚Staying Alive‘ getanzt. Leider habe ich mich nicht getraut, dich nach deiner Telefonnummer zu fragen. Du hattest blonde, schulterlange Haare, eine Brille und trugst ein grünes T-Shirt. Bitte melde dich!“ Oder: „Vorgestern, am Freitag, bist du mir in der Mönckebergstraße in der Nähe des Rathauses aufgefallen. Du trugst einen Rock, blaue Sandalen und hattest eine große braune Umhängetasche bei dir. Wir haben uns angelächelt, aber in dem Moment kam mein Bus. Ich möchte dich unbedingt wiedersehen!“ Ihre Eltern lachten oft bei diesen Gesuchen, aber für sie waren sie äußerst spannend. Jedes Mal fragte sie sich, ob diese Personen wohl zueinanderfinden, wie es dann weiterginge mit ihnen. Und sie wünschte sich so sehr, einmal selbst in der Kontaktecke gesucht zu werden, jemandem aufgefallen zu sein, den sie selbst nicht oder nur flüchtig bemerkt hatte und der sie unbedingt kennenlernen wollte. Manchmal fingen die Beschreibungen ganz vielversprechend an: schlank, braune lange Haare, eine Brille, eine Stupsnase, ein rotes T-Shirt,… Aber dann kam unweigerlich etwas, das nicht zutreffen konnte: „Du warst am letzten Donnerstag bei einem Straßenfest in Pinneberg…“ Nein, da war sie nicht gewesen, konnte also nicht diejenige sein, die gemeint war. Doch wie fantastisch wäre es, wenn jemand einmal sie suchen würde, wenn sie jemandem so wichtig wäre, dass er sich gar an einen großen, norddeutschlandweiten Radiosender wendete, nur um sie zu finden! Aber eigentlich war ihr klar, dass das zumindest in der nahen Zukunft nicht passieren würde. Sie war noch viel zu jung, um überhaupt auf solche Partys zu gehen, wie sie in der Sendung erwähnt wurden, sie war ja noch ein Kind. Ein Kind, das gerade vom Spielen im Hamburger Stadtpark kam und mit seinen Eltern zurück nach Hause fuhr. Ein Kind, das den Tag über im Wald schlittengefahren war und das nun im Auto seiner Eltern Popmusik hörte, auf die Lieder der Neuen Deutschen Welle wartete, deren Sprache sie, im Gegensatz zu den Titeln aus England und Amerika, zumindest meistens verstehen konnte. Auch wenn sie mit dem „Schnee, auf dem wir alle talwärts fahr’n“ in Falcos „Kommissar“, dem „Bruttosozialprodukt“ bei Geier Sturzflug oder dem „Sperrbezirk“ der Spider Murphy Gang noch nichts anfangen konnte. Aber die Musik und ihre Texte waren für sie der Zugang zu einer Welt, nach der sie sich sehnte, deren Teil sie sein wollte. Sie evozierten die Assoziationen an spannende Abenteuer, intensive Erlebnisse und komplexe Gefühle, untermalt von treibenden Beats, flirrenden Synthesizerklängen und harten Drums, umspielt von weicheren, nicht minder kraftvollen Basslinien. Und sie repräsentierten eine Sprache von musikalischem Klang und der Bedeutung von Worten, die sie lernen, in die sie eintauchen, die sie für sich reklamieren wollte. Bei den englischen Titeln lauschte sie vor allem dem Rhythmus, der Stimmlage und -variation des Sängers oder der Sängerin. Sie mochte Titel mit schnellen, klaren Beats, „A Question of Time“, „Gambler“ „Rosemarie“, funkige Discosounds und alles mit Synkopen und Offbeats. Mit Balladen tat sie sich schwer, spürte, wie sie beim Zuhören ungeduldig wurde, unruhig, diese Stücke nicht als tröstend, romantisch oder angenehm empfand, sondern immer den Impuls hatte, vorzuspulen, einen Titel mit einem schnelleren Tempo zu finden, was beim Kassettenabspielen ging, beim Radiohören aber nicht. Die vermeintliche Emotionalität und Melancholie von Balladen empfand sie häufig als aufgesetzt, unecht, während sie Tiefe und Intensität eher in up-tempo-Songs, in treibenden Rhythmen spürte. Bis heute gibt es nur wenige Balladen, die sie wirklich bewegen, die sie wirklich schätzt und die sie immer wieder gerne hört, weil sie sie nicht langweilen.
In diesen ersten Jahren mochte sie sich auf keine einzelnen Bands oder Künstler festlegen, konnte mit dem Begriff „Fan“ nichts anfangen, auch nicht, als sie älter wurde. Er erschien ihr zu limitierend durch seinen impliziten Imperativ, einseitig Partei zu ergreifen für etwas oder jemanden, schien keine Offenheit zu lassen für Vielfalt, Entwicklung, Veränderung. Sie liebte vor allem einzelne Songs, bezeichnete sich später, als sie mit dem Begriff etwas verband, halb scherzhaft, halb ernst als „Song-Junkie“. Es gab und gibt sie einfach, jene Lieder, die sie immer wieder hören muss, über Jahre, Jahrzehnte, in denen sie bei jedem Hören wieder etwas Neues entdeckt, die sie immer wieder in einen Zustand versetzen, in dem sie nur eines ist: Hörende, Empfangende des Klangs, den sie so tief in ihr Inneres vordringen lässt, wie sie es sonst nur der Literatur gestattet. Die Musik findet dort einen Raum, der häufig sogar ohne Worte ist, eine verwinkelte Höhle in ihrem Inneren, in der sie all das aufbewahrt, manches hegt, anderes verflucht, was sich nicht an die Oberfläche befördern, abschütteln, vergessen oder auch zugänglich und sich zunutze machen lässt, weil die Gänge, durch die es gelotst werden müsste, zu eng, zu kurvig und zu steil sind. Leidenschaft, Essenzialität, das waren die Begriffe, mit denen sie sich zur Popmusik positionierte.
Die englischen Liedtexte nahm sie mit Verwunderung und Neugier auf, versuchte, Bekanntes aus ihnen herauszuhören, imitierte beim Mitsingen die Laute, die sie wahrzunehmen meinte, bat ihre Eltern, ihr zu sagen, worum es ging. Mit der Zeit lernte sie einige Vokabeln, „you“, „love“ und „I“, die immer wiederkehrten. Sie nahm sich vor, irgendwann jeden einzelnen dieser Texte mühelos verstehen zu können.
3
Hamburg war die Stadt, in der sie aufwuchs. Mit ihren Eltern lebte sie in einer Dreizimmer-Mietwohnung im Osten der Stadt, die ganz und gar mit einem grünen Teppich ausgelegt war, dessen Farbe sie liebte, weil sie so beruhigend wirkte und den Eindruck einer Wiese erweckte. Einer Wiese mitten in einem Haus aus Stahl und Beton und mit gemusterten Tapeten. Alle paar Jahre tapezierten ihre Eltern die Wohnung neu; dann durfte sie sich immer die Tapete für ihr Kinderzimmer mit aussuchen. Vor allem aber liebte sie es, am Abend, bevor ihre Eltern Kleister und den Tapeziertisch aus dem Keller wuchteten und die Wohnung mit Plastikfolie auskleideten, mitzuhelfen, die alten Tapeten abzureißen. Naja, nicht abzureißen. Eigentlich nahm sie nur ihre Wachsmalstifte und malte riesige Muster und Figuren darauf, kurz bevor sie von der Wand gekratzt wurden. Die Erlaubnis, die Wände bemalen zu dürfen, übte auf sie eine unerklärliche Faszination aus. Vielleicht deshalb, weil man das eigentlich nicht machte, die Wände bemalen, weil sie nun erlaubterweise etwas Verbotenes tun konnte. Es war gewissermaßen eine sozial sanktionierte Rebellion. Später, als Teenager und Erwachsene las sie die Literatur über das Leben der Beats in den Lofts im New York der Nachkriegsjahre. Darin ging es um Menschen, die ihre kargen Steinwände künstlerisch gestalteten und verschönerten, heimeliger machten und sich in ihren cold water flats, Wohnungen ohne warmes Wasser und oft ohne zentrale Heizung, die es Mitte des 20. Jahrhunderts in amerikanischen Großstädten gab, nicht um den Tapetengeschmack der konservativen Mittelschicht in den Vorstädten der amerikanischen Metropolen scherten. Dann dachte sie immer daran, wie sie als Kind ihr eigenes Zuhause mit Wachsmalstiften bearbeitet hatte, und sie fühlte sich wie eine Bohemienne im New Yorker Village. Ein Stadtkind war sie auch, und würde es auch immer sein, und stammte nicht aus einer langweiligen Vorstadt. Die Teppichwiese in der Wohnung, das Grün, das ein bisschen Natur nach drinnen zu transportieren schien, aber immer noch Urbanität, Zivilisation, Ordnung verkörperte, passte perfekt dazu. Es hatte etwas Wildes, aber gleichzeitig Sicheres. Sie liebte diesen grünen Teppich so sehr, dass sie auch in ihrer eigenen Wohnung, als Erwachsene, so einen auslegte, der sich über all ihre Wohnräume erstreckte.
Marta hatten ihre Eltern sie genannt. Genauer: Marta Seidenfeldt. Das war der Nachname ihres Vaters, den auch ihre Mutter nach der Heirat angenommen hatte. Damals war das noch selbstverständlich. Immer wieder hat auch Marta im Laufe ihrer Jugend die Namen der Jungs, die sie mochte, in die sie verliebt war, hinter ihren eigenen Vornamen gehängt. Um herauszufinden, ob der Junge der Richtige für sie war. Marta Beier. Marta Regenbach. Frau Marta Eisenau. Viel später, an der Universität, lernte sie über die Arbitrarität des Zeichens. Bis dahin war es selbstverständlich, dass die Dinge und Personen deshalb so hießen und benannt waren, weil sie so waren, wie ihre Bezeichnung es vorgab. Natürlich hießen Kühe Kühe, weil sie Tiere waren, die auf der Weide standen, wiederkäuten, Milch gaben, schwarz-weiß oder braun-weiß gefleckt waren. Hinter dem Wort „Esel“ dagegen verbarg sich ein ganz anderes Wesen, das niemals eine Kuh sein könnte. Darum galt es ganz genau zu prüfen, ob sie eine Marta Beier sein könnte – hielt sie der Beschreibung einer Marta Beier stand? Doch dann hörte sie irgendwann, dass die Dinge nicht nach ihrem Wesen benannt sind, sondern dass Namen und Bezeichnungen Konventionen, Vereinbarungen sind, die, wenn nur eine Gruppe, die groß genug ist, mitmacht, auch verändert werden können. Dass theoretisch eine Kuh auch „Esel“ heißen könnte, wenn man sich nur darauf einigt. Das erschien ihr zunächst ungeheuerlich, und so ganz glaubte sie nie daran, dass sich Sprache wirklich vollkommen willkürlich zu dem, was sie bezeichnet, entwickelt haben soll. Und so war ihr, als junge Studentin an der Universität, auch klar, dass sie niemals eine Marta Beier sein würde. Oder Marta Eisenau. Auch wenn es nur eine Vereinbarung war, eine Idee, die ihre Eltern gehabt hatten, als sie beim Amt die Geburtsurkunde ihrer Tochter beantragten, war sie Marta Seidenfeldt. Und sie hieß deshalb so, weil nur auf sie all jene Merkmale zutrafen, die „Marta Seidenfeldt“ hatte. Und das würde auch immer so bleiben.
4
Martas Finger und Handinnenflächen waren ganz blau. „Papa“, rief sie, „komm’ mal bitte und hilf mir! Wie geht das?“
„Du musst es zwischen die beiden weißen Seiten legen, mit der blauen, färbenden Seite nach unten. Und Du musst die Tasten fest hinunterdrücken, damit die Farbe auch auf das darunterliegende Blatt übertragen werden kann – so.“ Und er tippte „Marta, 6 Jahre alt“ auf das noch ganz unbeschriebene Papier.
An einem Sonntagnachmittag saß Marta an ihrem Schreibtisch, der in ihrer Zweizimmerwohnung im Wohnzimmer als Raumteilung fungierte. Zu ihrer Linken das große Regal mit den Wörterbüchern, Grammatiken, Lexika, historischen Werken, das Who is Who der Mythologie, in dem sie ständig wieder dieselben Namen nachschlug, weil sie sich die griechischen und römischen Götter und Helden und ihre Beziehungen zueinander einfach nicht merken konnte, egal, wie sehr sie es auch versuchte. Das Buch hatte sie sich nach ihrem Examen gekauft. In Amerikanistik bekam man in der Klausur, die Teil der Prüfungen war, immer irgendeinen Text aus der nordamerikanischen Literatur vorgelegt, der dann zu interpretieren und in den literarhistorischen Kontext einzuordnen war. „Leda and the Swan“ hieß das Gedicht, das sie bearbeitete, von H.D. Mit den Modernisten kannte sie sich aus und hatte keine Mühe, einen Bezug zur Zeit und zu anderen Texten herzustellen. Sie füllte Seite um Seite, bei sich hatte sie ein einsprachiges englisches Wörterbuch, mit dem sie schon in ihrer Schulzeit gearbeitet, das sie sicher durch ihre Abiturklausur in Englisch über die Autobiografie von Malcolm X manövriert hatte und das ihr treuer Begleiter geworden war und scheinbar unendliche Tipps in Bezug auf Wortschatz und Grammatik parat hatte. Doch wer steckte bloß hinter dem Schwan? Darüber gab das Wörterbuch leider keine Auskunft, und Marta fluchte auf dem bohnergewachsten Gang vor sich hin, als sie während der fünfstündigen Klausur eine kleine Pause nahm. Wen repräsentierte bloß dieser verfluchte Schwan? Es fiel ihr nicht ein, und sie beschloss, diesen Aspekt des Textes einfach zu ignorieren. Was blieb ihr auch anderes übrig?
Zeus! Zeus ist der Schwan!, schoss es ihr plötzlich durch den Kopf. Da saß sie aber schon in der U-Bahn auf dem Weg zu ihren Eltern, die ganz gespannt darauf warteten zu hören, wie ihre Tochter die erste ihrer Examensklausuren überstanden hatte. Was mache ich nur? Wie kann ich bloß diese Klausur noch ändern? Die Klausuren wurden immer an einem Samstag geschrieben, und den Rest des Wochenendes war die Universität natürlich geschlossen. „Soll ich Montagmorgen hinfahren und darum bitten, die Klausur zu vernichten, damit ich durchfalle und sie noch einmal schreiben kann?“, fragte sie ihre Eltern in Tränen aufgelöst. Das ganze Wochenende konnte sie an nichts anderes denken, doch bis Montag hatte sie schließlich beschlossen, alles so zu lassen, wie es war. Was nützte es? Sie hatte versagt, und sie musste diese Tatsache akzeptieren. Ihren Zorn über sich selbst ließ sie verbal an Hamburgs Alster, traditionell voller Schwäne, aus. Hamburg hat sogar einen Schwanenbeauftragten, bei der Stadt angestellt und liebevoll „Schwanenvater“ genannt, der sich nur um das Wohlergehen der Alsterschwäne zu kümmern hat; eine Bestimmung, die schon vor Jahrhunderten in das Gesetzbuch der Stadt eingetragen worden war. „Ihr verdammten Viecher!“, rief sie den Tieren beim Spazierengehen, beim Einkaufen, beim Bummeln an der Alster, in den Fleeten, in den Kanälen, immer wieder zu. „Ihr habt Schuld, wenn mein Examen schlecht wird!“ Sie war sich bewusst, dass ihre Reaktion kindisch war, aber dennoch ein Weg, mit ihrem eigenen geistigen Patzer umzugehen.
„Wissen Sie, wer der Schwan ist?“, wurde sie einige Wochen später von ihrer betreuenden Professorin begrüßt, als sie das Ergebnis ihrer Klausur bekam.
„Natürlich“, antwortete sie, „Zeus. Aber das ist mir erst auf dem Nachhauseweg in der U-Bahn eingefallen. Am liebsten hätte ich am Montag die Klausur zurückgeholt und noch mal geschrieben.“
„Schade, dass Sie es während der Prüfung nicht wussten. Aber ganz so schlimm war es auch nicht. Eine Eins haben Sie dadurch leider nicht bekommen, aber eine Zwei plus.“
Mit dem Ergebnis konnte sie leben, denn in ihren anderen Prüfungsteilen bekam sie nur Einsen. Aber sie kaufte sich umgehend das Who is Who der Mythologie, als mahnende Instanz für ihr Versagen, das sie sich, trotz ihres Einserexamens, viele Jahre nicht so recht verzieh.
Die Regale, die die Literatur, die Belletristik und hier und da versprenkelte Lyrikbände und Theaterstücke beherbergten, standen im Wohnzimmer an der Wand hinter dem Schreibtisch und hinter Martas Rücken, wenn sie arbeitete. Es waren schlichte weiße Borte, Marke „Billy“ von IKEA, die vom Fußboden bis zur Decke reichten. Ein paarmal hatte sie schon eines dazugekauft, aber der Platz schien dennoch nie zu reichen. Ständig kamen neue Werke hinzu, die sie gelesen hatte und die alphabetisch zwischen die vorhandenen Titel sortiert werden mussten. Ebenfalls außerhalb ihres Blickfeldes befand sich die Sitzecke mit dem Sofa und dem Sessel, dunkelgrün gemustert und aus dunklem, etwas antik anmutendem Holz gefertigt. Sehr bequem, mit einer festen Sitzfläche, vor dem Sessel ein Fußhocker, der stilistisch überhaupt nicht zur Sitzgarnitur passte. Aber so etwas war Marta nicht wichtig. Ihre gesamte Wohnung bestand aus einem Sammelsurium von einzelnen Möbelstücken, die nicht aufeinander abgestimmt waren, die aber als Einzelteile genau die Funktion erfüllten, die sie erfüllen sollten und die ihren Bedürfnissen gerecht wurden. Es war ihr Zuhause, und ihres allein, das niemandem anders gefallen musste außer ihr selbst. Und sie liebte es, weil sie alles dort wiederfand, was ihr etwas bedeutete, weil alle ihre Räume lichtdurchflutet und hell waren, weil jeder einzelne Gegenstand säuberlich auf dem Platz stand, an dem sie ihn haben wollte, geordnet, sortiert und sorgfältig durchdacht und geplant. Ihr fiel ein, als sie an ihrem Schreibtisch saß und schrieb, dass es wohl bezeichnend war, dass sich die Sitzecke hinter ihrem Rücken befand, während des Arbeitens also unsichtbar war. Sie erinnerte sich aber nicht, diese Anordnung bewusst gewählt zu haben. Es war einfach so, und sie hatte das Zimmer deshalb so eingerichtet, weil es ihr gefiel, weil es stimmig in seiner Vielstimmigkeit wirkte. Und dennoch spürte sie, welch hohen Stellenwert Arbeit, professionelles Wirken für sie doch hatte. Von der Arbeit ließ sie sich nur ungern ablenken; wenn sie schrieb, trat ihr Privatleben in den Hintergrund, machte sie erst eine Pause, wenn ihr Nacken steif wurde, ihre Finger vom Tippen zu schmerzen begannen, sie spürte, wie ihre Gedanken immer häufiger abschweiften von dem Text, hinter dem der Cursor blinkte und auf mehr Futter wartete, ihre Konzentration nachließ. Auch dass der Schreibtisch in der Mitte des Raumes stand, war wahrscheinlich kein Zufall, nicht nur ein Kunstgriff, sich in einer Zweizimmerwohnung gewissermaßen drei Räume zu schaffen, symbolisierte er irgendwie den Mittelpunkt ihres Lebens, den Ort, an dem sie arbeitete, an dem sie schrieb, ihre Texte, Briefe, E-Mails. Sie erinnerte sich kaum an ein Leben ohne Schreibtisch. Wann hatten ihr ihre Eltern den ersten Schreibtisch geschenkt? Zu ihrem fünften Geburtstag? Dem sechsten? Bei den Seidenfeldts gehörte ein Arbeitstisch selbstverständlich in ein Kinderzimmer. Erst heute, mit vierzig, wurde Marta auf einmal bewusst, dass ihr Kinderzimmer nie nur ein Raum zum Spielen, zum Toben gewesen war, sondern vielmehr immer ein Platz der Geborgenheit und des Schaffens. Stätte der Literatur und der Musik, aus der das kindliche Chaos unzähliger herumliegender Gegenstände immer wieder schnell verbannt war, wenn sie genug gespielt hatte, mit ihrer Eisenbahn, den Stofftieren, den Bauklötzen. Sie mochte es nie, wenn ihre Spielkameraden ihre mit Bedacht hergestellte Ordnung durcheinanderbrachten, den Ort ihres Rückzugs, die Schutzhülle ihres Selbst betraten, ihre Privatsphäre dadurch verletzten. Sie hatte gern Besuch, aber sie war immer fast genauso froh, wenn er wieder weg war. Und sie vergaß nicht, dass die Tochter einer befreundeten Familie ihrer Eltern, als Marta noch ganz klein war, die Schränke in ihrem Kinderzimmer mit Filzstiften malträtiert hatte und sich die Farbe nicht wieder ganz wegwischen ließ. So richtig verziehen hat Marta ihr das nie.
Mit dem Schreibtisch zu ihrem – wahrscheinlich – sechsten Geburtstag kam die Schreibmaschine. Sie hatte ihrem Vater gehört, war weißtürkis gemustert, und zeitweise bereute sie es ein wenig, die Marke vergessen oder nie darauf geachtet zu haben, denn mit dem Einzug erst einer elektrischen Schreibmaschine und später des Computers hatte sie sie irgendwann weggegeben. Erst viele Jahre später machte sie sich Gedanken über die Zuschreibung des Geheimnisvollen von Schreibmaschinen, über die von Hemingway und Kerouac, von Fitzgerald und Pound, die mit ihren Besitzern um die Welt reisten, Zeugen ihres unkonventionellen Lebens waren, denen die Ehre zuteilwurde, als erste die Weltliteratur zu kennen, die auf ihnen geschrieben wurde. Die, die auf Fotos ihrer Eigentümer verewigt waren, das Papier darin Zeugnis eines kreativen Aktes, der die Welt veränderte – nicht zuletzt die Welt Martas. Als sie sechs war, und auch später, war eine Schreibmaschine für Marta immer nur ein Arbeitswerkzeug gewesen, ein Mittel zum Zweck. War das falsch? War sie deshalb scheinbar so konventionell, angepasst in so vielem, weil sie diesen Gegenstand nicht als das wahrnehmen konnte, was er sein musste, um zu einer wahren Künstlerin zu gehören? Mythifiziertes, mystifiziertes Objekt? Oder war auch für Hemingway, für Kerouac die Schreibmaschine bloß ein Arbeitsmittel gewesen, noch dazu ein schweres, belastendes, in einer Zeit ohne handliche Taschencomputer, das ihre Besitzer in jedem Hotelzimmer wieder fluchend auf den Grund des Koffers legten, das sie gern zurücklassen würden, aber nur deshalb nicht konnten, weil es ihren Lebensunterhalt sicherte oder wenigstens sichern sollte? Und wieso hatte sie immer nur über die Schreibmaschinen der männlichen Autoren gelesen? Was für ein Verhältnis hatte Gertrude Stein zu ihrer? Edith Wharton? Und was bedeutet Siri Hustvedt ihr Computer? War dieses Schreibwerkzeug für die Schriftsteller vielleicht vor allem Symbol ihrer Männlichkeit, Symbol von Herrschaft über logos, Wort und Vernunft? Konnten Frauen eher auf dieses Symbol verzichten, benötigten keine externen Gegenstände, sich ihrer Weiblichkeit bewusst zu werden, sich ihren Wert als Mensch und Künstlerin zu vergegenwärtigen? Oder sind nur keine Geschichten über Autorinnen und das Verhältnis zu ihren Schreibmaschinen überliefert? Oder lasen Frauen und Männer schrieben? Waren die Frauen nur zu Hause, in der ihnen als eigen unterstellten vermeintlich natürlichen Sphäre, zwischen Hausarbeit und Kindererziehung, während die Männer auszogen, als Forscher und Entdecker der äußeren Welt sowie als Erforscher des Inneren mithilfe der Schreibmaschinen und durch die Produktion von Literatur? Nein, natürlich nicht, auch wenn der Literaturkanon das oft immer noch weismachen will. Von diesem Blickwinkel aus betrachtet war es dann vielleicht gar nicht so schlimm, dass Marta ihrem eigenen Schreibgerät nicht mehr Bedeutung zumessen wollte als einer der anderen Utensilien, die eine Hilfe für das Alltags- und Arbeitsleben darstellten, wie einem Staubsauger oder einem Fahrrad und natürlich ihrer Leselampe und ihres Radios und Plattenspielers. Es kam darauf an, was auf ihnen geschrieben wurde, nicht dass. Es ging ihr nicht um den Gegenstand, männlich oder weiblich konnotiert, sondern um das Ergebnis der kreativkünstlerischen Produktion. Die Symbolik ihrer Tätigkeiten war ihr nie wichtig, sie wollte Selbstverständlichkeit, Vielfalt, das Verwirklichen von Ideen und Träumen im Leben und Schaffen von Frauen wie von Männern.
Ab dem Tag ihres sechsten Geburtstags schallte täglich das Klappern und Hämmern der etwas schwerfälligen Tasten durch die Wohnung ihrer Eltern. Marta erlernte das Schreiben wie das Blockflöte spielen. Sie tippte seitenweise Buchstabenreihen, manchmal einzelne Worte, füllte Papier um Papier mit den verschiedenen Zeichen, die sich auf der Tastatur befanden, machte gewissermaßen Fingerübungen im Schreiben wie in der Musik. Immer wieder schlugen ihre Eltern vor, dass sie doch einen Kurs besuchen, das standardisierte Zehnfingersystem erlernen solle. Anfangs spielte sie öfter mit dem Gedanken, verwarf ihn aber, als sie hörte, dass in diesen Kursen typischerweise Frauen saßen, die Sekretärinnen wurden, ihren zumeist männlichen Chefs die Abschrift der Korrespondenz abnahmen, ihm assistierten, das taten, wozu er keine Lust oder Zeit inmitten seiner anspruchsvolleren und verantwortungsvollen Aufgaben hatte. Marta wollte niemandem assistieren, schon gar keinem männlichen Chef, sie wollte selbst, wenn überhaupt, einen – natürlich! – männlichen Sekretär haben, der ihr diese Aufgaben abnahm. Aber am liebsten wollte sie sowieso alles selbst machen, das Ausdenken und das Schreiben, das Kreative und das Produktive. Bah, sie würde nie das Zehnfingersystem erlernen, sondern mit ihrem eigenen ihren Weg gehen. Und sie würde nie jemandes Sekretärin sein.
Als sie genug geübt hatte, begann Marta, sinnvolle, zusammenhängende Buchstabenfolgen mit der Schreibmaschine zu tippen. Sie verfasste Geschichten, schrieb Tagebuch, um ihre Erinnerung zu unterstützen oder zu entlasten, notierte Ideen und Beobachtungen, die ihr einfielen.
An jenem verregneten Sonntagnachmittag, als ihre Finger und Hände so blau waren, hatte Marta von ihren Eltern Stapel mit Blaupapier bekommen, das ihr ermöglichte, ihre Texte gleichzeitig in zwei, wenn sie sorgfältig tippte, auch drei, Kopien anzufertigen. Sie konnte ihre Texte nun vervielfältigen, so tun, als hätte sie ein Lesepublikum, dem sie sie in mehreren Exemplaren austeilte. Das tat sie auch, und ihre Eltern lasen ihre Geschichten über Tiere, Freundinnen und Abenteuer am Strand und im Wald nun parallel. Aber das Blaupapier färbte eben auch ungeheuerlich, und so ganz hatte sie noch keinen optimalen Weg gefunden, es zu benutzen, ohne anschließend ihre Hände waschen zu müssen.
5
Wenn sie keine eigenen schrieb, las Marta die Geschichten anderer. „Das kostet eine D-Mark“, sagte die Dame am Tresen zu Martas Mutter. „Mit dem Ausweis, den ich Ihrer Tochter gleich ausstelle, kann sie sich so viele Bücher ausleihen, wie sie möchte, und diese vier Wochen behalten. Die Hörspiel- und Musikkassetten können für eine Woche mit nach Hause genommen werden. Gern führt Sie unsere Bibliothekarin an der Auskunft durch die Räumlichkeiten und zeigt Ihrer Tochter die Regale, die für sie am interessantesten sind. Der Ausweis gilt übrigens bis zur Vollendung ihres 18. Lebensjahres. Erst dann muss er verlängert und müssen die jährlichen Gebühren für Erwachsene bezahlt werden.“
Marta sah sich staunend, überwältigt um. Bücher, soweit das Auge reichte. Eine Treppe führte in ein zweites Stockwerk, das zur Bücherei gehörte. Auch hier Buchrücken an Buchrücken, Regale über Regale. „Was liest Du denn gern?“, fragte die freundliche Angestellte. Sie hatte einen wachen Blick und kurze, gewellte Haare, ein beiges, klassisch geschnittenes Kostüm und eine Stimme, die zeigte, dass sie Marta ernst nahm, sie nicht ansprach wie ein Kind, das nur schwer versteht.
„Alles“, antwortete Marta bestimmt, „nur Indianer-Geschichten mag ich nicht, und für Pferde interessiere ich mich auch nicht so.“
Ihre Mutter schleppte den Beutel voller Bücher nach Hause. Fünf Freunde, Hanni und Nanni, die Internatsgeschichten über Dolly und Betty, die besten Freundinnen, Astrid Lindgren, Otfried Preußler, Michael Bond, Paul Maar und vor allem Angela Sommer-Bodenburg. Zu Hause angekommen rollte sich Marta in dem Sessel zusammen, der in ihrem Zimmer neben der Musiktruhe stand, knipste ihre Leselampe an und versank in den Geschichten, bis es Zeit zum Schlafengehen war, ihre Mutter ihr den allabendlichen Apfel brachte, der das Abendbrot darstellte. Hanni und Nanni, Dolly und Betty aßen in ihren Internatsspeisesälen zu Abend, die Fünf Freunde am Tisch bei Onkel Quentin. Aber bei den Seidenfeldts war das Abendbrot nicht vorgesehen. Es wurde gemeinsam gefrühstückt, immer viel zu spät Mittag gegessen, oft erst gegen zwei, drei Uhr am Nachmittag, am Wochenende gab es Kaffee und Kuchen, in der Woche abends einen Apfel, vielleicht einen Joghurt. Ihre Mutter erzählte Marta noch als erwachsene Frau immer wieder die Anekdote, als die Seidenfeldts bei Bekannten eingeladen waren, erst zum Kaffee und dann zum Abendessen, und dass Marta ganz erstaunt in die Runde fragte, was „Abendbrot“ denn eigentlich sei.