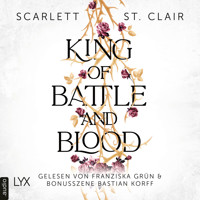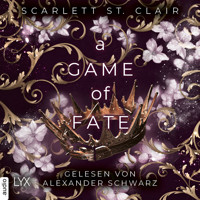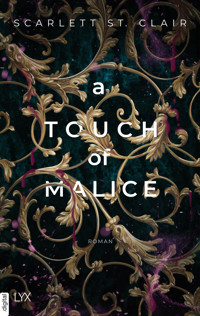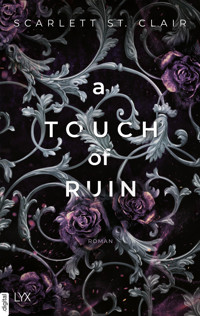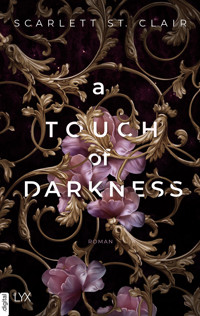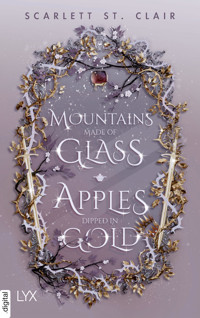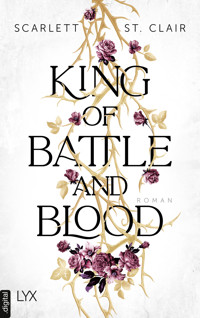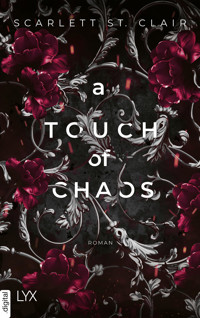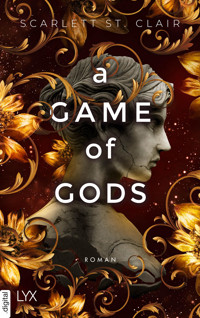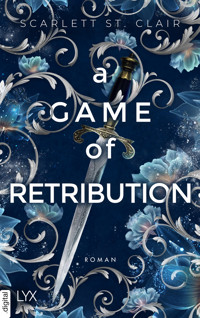9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: King of Battle and Blood
- Sprache: Deutsch
All die Sterne am Himmel scheinen nicht so hell wie meine Liebe zu dir
Seit Prinzessin Isolde von Lara Vampirkönig Adrian Aleksandr Vasiliev heiraten musste und ihre Heimat verlassen hat, ist in ihrem Leben nichts mehr, wie es einmal war. Menschen, die sie einst geliebt hatte, sind nun ihre Feinde, und ausgerechnet mit dem Mann, den sie geschworen hatte, zu hassen und zu töten, verbinden sie tiefe Gefühle, die sie noch nie zuvor für jemanden empfunden hat. Doch Isoldes Liebe zu Adrian hat einen hohen Preis: Tödliche Bedrohungen folgen ihr auf jedem Schritt, und in einer fremden Welt voller Rache und Intrigen ist der Blutkönig plötzlich der Einzige, dem sie noch vertrauen kann ...
»QUEEN OF MYTH AND MONSTERS hat mich von Beginn an gefesselt. Scarlett St. Clair hat eine mystische Welt erschaffen, nach der ich mich lange gesehnt habe.« MA.RIEEE__BOOKS
Band 2 der fesselnden KING-OF-BATTLE-AND-BLOOD-Trilogie von SPIEGEL-Bestseller-Autorin Scarlett St. Clair
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 501
Veröffentlichungsjahr: 2023
Sammlungen
Ähnliche
INHALT
Titel
Zu diesem Buch
Leser:innenhinweis
Widmung
Kapitel Eins
Kapitel Zwei
Kapitel Drei
Kapitel Vier
Kapitel Fünf
Kapitel Sechs
Kapitel Sieben
Kapitel Acht
Kapitel Neun
Kapitel Zehn
Kapitel Elf
Kapitel Zwölf
Kapitel Dreizehn
Kapitel Vierzehn
Kapitel Fünfzehn
Kapitel Sechzehn
Kapitel Siebzehn
Kapitel Achtzehn
Kapitel Neunzehn
Kapitel Zwanzig
Kapitel Einundzwanzig
Kapitel Zweiundzwanzig
Kapitel Dreiundzwanzig
Kapitel Vierundzwanzig
Kapitel Fünfundzwanzig
Kapitel Sechsundzwanzig
Kapitel Siebenundzwanzig
Anmerkung der Autorin
Die Autorin
Die Romane von Scarlett St. Clair bei LYX
Impressum
Scarlett St. Clair
Queen of Myth and Monsters
Roman
Ins Deutsche übertragen von Silvia Gleißner
ZU DIESEM BUCH
Seit Prinzessin Isolde von Lara mit Vampirkönig Adrian Aleksandr Vasiliev verheiratet wurde, ist in ihrem Leben nichts mehr, wie es einmal war. Um den jahrelangen Krieg gegen Adrian zu beenden und zumindest das Königreich ihres Vaters zu retten, musste sie ihre Heimat und ihre Familie schweren Herzens für ein unbekanntes Land verlassen, in dem die Sonne niemals scheint. Jetzt ist sie Königin von Revekka und wird schon bald über ganz Cordova herrschen – an der Seite eines Mannes, über den und dessen Volk man sie nichts als Lügen gelehrt hatte. Menschen, die behauptet haben, sie zu beschützen und zu lieben, sind jetzt ihre Feinde, und der Feind, den sie geschworen hat, zu hassen und zu töten, weckt Gefühle in ihr, die sie noch nie zuvor für jemanden empfunden hat. Doch die Liebe zu Adrian hat einen hohen Preis: Ein tödlicher Blutnebel bedroht plötzlich das gesamte Königreich, und Isolde weiß nicht, wem sie an ihrem Hof voller Intrigen und Verrat noch trauen kann …
Liebe Leser:innen,
dieses Buch enthält potenziell triggernde Inhalte.
Deshalb findet ihr hier eine Triggerwarnung.
Achtung: Diese enthält Spoiler für das gesamte Buch!
Wir wünschen uns für euch alle
das bestmögliche Leseerlebnis.
Euer LYX-Verlag
Für diejenigen von uns, die überleben mussten.
KAPITEL EINS
Isolde
Neun Leichname standen aufgespießt vor den Toren des Roten Palasts.
Ich konnte sie in diesem Augenblick vom Fenster der Bibliothek aus sehen, erhellt vom Licht der Fackeln. Im Laufe der letzten zwei Tage hatte ich eine Menge über das Pfählen gelernt. Zum Beispiel, dass es nach einer sorgsam ausgeführten Pfählung Stunden, ja sogar Tage dauern konnte, bis der Gefangene starb. Es war ein entsetzlicher Tod, und noch entsetzlicher war es mit anzusehen, wie jeder Körper langsam nach unten rutschte, bis sich durch sein Gewicht die Spitze des Speeres unausweichlich durch den Mund, die Kehle oder den Brustkorb bohrte.
Und die ganze Zeit über flehten sie alle, die an ihnen vorbeigingen, an, sie schneller zu töten. Doch niemand kam ihnen zu Hilfe, nicht einmal ich.
In der Folge von Ravenas Angriff flohen jene, die unser Königreich verraten hatten, doch mein Ehemann war ein gnadenloser König. Er hatte seine loyalen Noblessen angewiesen, auf die Jagd zu gehen, und er hatte sich ihnen angeschlossen. Innerhalb eines Tages hatten sie die Vasallen gefasst, die Adrians ehemalige Noblessen bei ihrer Rebellion unterstützt hatten, und nun stellten diese eine grausige Warnung für jedermann dar, der an Verrat dachte.
Ich fragte mich, was es über mich aussagte, wozu ich geworden war, dass ich kein Entsetzen angesichts Adrians Wahl der Bestrafung empfand.
Auch jetzt noch, als ich hinausstarrte, empfand ich nichts als Zorn – Zorn auf jene, die versucht hatten, mich zu verletzen, mir meine Macht zu nehmen, die mich für schwach hielten.
Unter ihnen mein Vater, der den Tod durch meine Hand gefunden hatte.
Du bist jeden Stern am Himmel wert, hatte er im Thronsaal von Lara gesagt, als Adrian Aleksandr Vasiliev um meine Hand angehalten hatte. Und mein Vater war bereit gewesen, für mich gegen ihn – den Blutkönig – in den Krieg zu ziehen.
Vielleicht hatte er seine Worte damals auch so gemeint – zumindest bis ich ihm einen anderen Weg eröffnet hatte, sein Königreich und den Rest von Cordova zurückzuerobern.
Ich konnte es immer noch nicht begreifen, konnte nicht verarbeiten, wie alles geendet hatte. In meinem Verstand tobten die Gefühle wie ein Wirbelsturm, und das stärkste von ihnen war der Schock. Er war eine Last auf meinem Körper, wog schwer auf meinem Herzen und machte meinen Blick blind. Doch in meiner Taubheit gab es immer wieder Ausbrüche von Wut und Trauer, die mich am ganzen Körper zittern ließen, bis zur Erschöpfung. Und doch konnte ich nicht schlafen, denn immer, wenn ich die Augen schloss, sah ich meinen Vater vor mir, in dessen Miene kein bisschen Zuneigung mehr stand, weil er nur noch besessen war von der Entschlossenheit, mein Leben zu beenden, weil dies auch Adrians Leben beenden würde.
Diese quälende Erinnerung war der Grund dafür, dass ich mich vor Sonnenaufgang in der Bibliothek wiederfand.
Wenn ich schon nicht schlafen konnte, konnte ich auch recherchieren. Für gewöhnlich bevorzugte ich die Gesellschaft des Bibliothekars Lothian und seines Geliebten Zann, aber heute Nacht war ich froh um die Stille, während ich Bücher über die Geschichte der Hexen durchblätterte.
Ravena war mit dem Buch Dis entflohen, von dem sie glaubte, es würde ihr die Macht geben, die sie immer gewollt hatte, auch wenn diese Macht wahrscheinlich einen überaus hohen Preis haben würde.
Alle Zauber kosteten etwas, doch der Tribut für dunkle Magie war Leben.
Und doch war ich vor zweihundert Jahren bereit gewesen, diesen Preis zu zahlen. Jetzt fragte ich mich, warum. Ich konnte mich nicht an den Grund erinnern, ebenso wie ich mich an keinen der Zauber erinnern konnte, die ich in das Buch geschrieben hatte. Jetzt kam ich hierher, um die Archive der Bibliothek zu durchsuchen, in der Hoffnung, dass etwas in diesen Texten Erinnerungen aus meinem Leben als Yesenia wachrufen würde.
Bisher konnte ich mich nur an einige wenige Dinge erinnern. Ich erinnerte mich an den Hohen Zirkel und an die meisten Beziehungen, die ich zu meinen Schwestern aufgebaut hatte. Ich erinnerte mich an Ravena, an ihren Verrat und an ihre Bindung zu König Dragos. Vor allem aber erinnerte ich mich an Adrian und die stille Art, in der wir uns ineinander verliebten. Doch diese Erinnerungen waren kein Vergleich zu dem Gefühl von Erleichterung, dem seltsamen Frieden, den ich durch das Wissen empfand, wer genau ich war.
Ich fühlte mich nicht im Zwiespalt wegen meiner zwei Leben – Yesenia war die Vergangenheit, ein früher gelebtes Leben. Heute war ich Isolde Vasiliev, Königin von Revekka, künftige Königin von Cordova, und ich war hier, um zu erobern.
»Ich wache nicht besonders gern allein auf«, sagte da Adrian.
Ich drehte mich um und sah ihn an einem der Bücherregale aus Ebenholz lehnen, die voll waren mit schwarz gebundenen Büchern. Er trug einen langen roten Morgenmantel mit Goldmustern. Sein Haar war offen und fiel ihm in lockeren Wellen auf die Schultern. Er stand da mit verschränkten Armen, und auch wenn er mich nur aufzog, war mir klar, dass ihn noch mehr aus dem Bett getrieben hatte – es war Sorge.
»Ich konnte nicht schlafen«, erklärte ich.
Er runzelte die Stirn, und mein Blick verweilte auf seinem Mund, bevor ich seinen Blick erwiderte. Das war eine Sache, die sich in den zweihundert Jahren, die wir getrennt gewesen waren, verändert hatte – seine Augen. Einst waren sie blau gewesen, doch heutzutage waren sie weiß gerändert. Ich hatte immer angenommen, dass dies nach seiner Verwandlung geschehen sei, doch andererseits hatte kein anderer Vampir, dem ich seit meiner Ankunft in Revekka begegnet war, solche Augen.
»Konntest nicht schlafen«, meinte er und legte den Kopf schief. »Oder wolltest nicht?«
Er kannte die Antwort, also stellte ich eine andere Frage.
»Habe ich dir je vom Buch Dis erzählt?«
Er schüttelte den Kopf. »Nein. Du hast mir auch nie das von Dragos erzählt.«
Es stimmte, ich hatte ihm nie vom Missbrauch des früheren Königs erzählt, und ein seltsames Schuldgefühl machte sich darauf in mir breit, obwohl ich wusste, dass das nicht seine Absicht gewesen war.
Nun war es an mir, die Stirn zu runzeln, als ich den Grund für mein Schweigen untersuchte.
»Andererseits, warum hättest du es auch tun sollen?«, fuhr er fort, und ich begegnete seinem Blick, als er auf mich zukam und die Hand an meine Wange legte. »Damals standest du weit über mir.«
»Hör auf«, sagte ich, und die Schuldgefühle wurden noch stärker. Um Status war es dabei ganz und gar nicht gegangen. Hätte Adrian es erfahren, hätte er Dragos getötet. Zwar hatte er das am Ende auch so getan, doch das geschah nach seinem Sieg über Revekka. »Du weißt, dass es nichts damit zu tun hatte.«
»Ah, aber so war es«, meinte er und trat noch einen Schritt näher. Seine Hand wanderte an meinen Nacken, und sein Körper drückte sich an meinen. Ich legte den Kopf ganz nach hinten, um seinen Blick festzuhalten. »Ich war nichts als ein besserer Wachmann, aber du – du warst mehr.«
Ich umfasste sein Handgelenk, nicht um ihn von mir zu schieben, sondern um ihn nahe bei mir zu halten.
Ich schüttelte den Kopf und spürte, wie sich mir die Kehle zuschnürte. Unwillkürlich hörte ich die Schreie meiner Schwestern – meines Zirkels – in der Nacht ihrer Verbrennung. Es war der erste Tag dessen gewesen, was später die Ernte genannt wurde und eine völlige Vernichtung jeder Hexe in Cordova nach sich zog.
Ich holte tief und schaudernd Luft.
»Ich habe den Tod aller verschuldet«, sagte ich.
»Dragos brauchte Macht, also hat er sich gegen die Einzigen gewandt, die Macht hatten«, entgegnete Adrian. »Du warst nur eine Möglichkeit, die Verantwortlichkeit abzuwälzen.«
Ich konnte kaum atmen. Als Adrian mein Blut genommen hatte, hatte ich nur die Konsequenzen des Fluchs gekannt, mit dem Dis ihn belegt hatte – dass das Kosten meines Blutes bedeutete, dass unsere Leben aneinandergebunden waren. Wenn ich starb, starb auch er. Ich hatte nicht gewusst, dass mich auch die Traumata meiner Vergangenheit verfolgen würden.
»Erzähle mir, wie du ihn getötet hast«, flüsterte ich und sah ihm forschend in die Augen.
Adrian versteifte sich, und seine Finger drückten sich leicht in meine Haut. Ich fragte mich, ob er dachte, ich würde die Flucht ergreifen, wenn ich nicht fest an seiner Seite stand – doch es gab nichts, das mich vertreiben würde, außer dem Tod.
»Wird es dir helfen, wenn du es weißt?«, fragte er.
In Wahrheit wusste ich das nicht, aber ich antwortete trotzdem: »Ja.«
Er blieb weiter still, doch als er dann sprach, wandte er den Blick nicht von mir, als wolle er sehen, wie es mich veränderte, zu hören, wie er Dragos hingerichtet hatte.
»Ich habe ihm den Kopf abgeschlagen. Mit einem stumpfen Schwert.«
Ich war nicht überrascht, weder von seiner Wahl der Waffe noch der brutalen Art, mit der er beschlossen hatte, den früheren König von Revekka hinzurichten. Und aufgrund der letzten zwei Tage hatte ich kein Problem damit, mir vorzustellen, wie er auf Dragos’ Hals einhackte, bis sein Kopf rollte.
»Und danach ließ ich ihn auf einer Pike aufgespießt stehen, draußen vor den Toren, wo jetzt unsere toten Verräter sind. Sein Körper lag darunter und wurde in kleine Stücke zerpickt, bis nur noch Knochen von ihm blieben.«
»Und die Knochen?« Ich konnte mir kaum vorstellen, dass er Dragos die Gnade eines Begräbnisses, egal in welcher Form, erwiesen hatte.
»Wenn wir nächstes Mal Hof halten, sieh dir meinen Thron genauer an.«
Etwas tief in meinem Magen drehte sich um. Adrian hatte ein Imperium auf den Knochen seines größten Feindes aufgebaut. Vor einem Monat noch wäre ich angewidert gewesen, aber das Leben an Adrians Hof hatte meine Meinung zu seiner Brutalität geändert. Hier war kein Platz für Verwundbarkeit, kein Platz für Vergebung. Es hieß erobern oder getötet werden.
Dragos hatte uns das gelehrt, und er hatte alles genommen.
Ebenso wie Ravena.
»Was denkst du gerade?«, fragte er.
Ich runzelte die Stirn. Adrian konnte meine Gedanken hören, aber nicht immer. Ich denke, es war für ihn schwerer geworden, wegen der Taubheit, die mich seit dem Tod meines Vaters überwältigt hatte. »Du kannst es nicht hören?«
»Deine Emotionen scheinen eher gemäßigt«, antwortete er.
Ich glaubte ihm nicht. Ich fühlte mich wie das reinste Chaos, aber ich schätzte es, dass er gefragt hatte.
»Ich denke daran, wie ich mir einen Thron aus Ravenas Knochen fertigen werde.«
Adrians Mundwinkel zuckten, und er lehnte sich zu mir. Sein Atem lag auf meinen Lippen, als er sagte: »Wenn das dein Wunsch ist, werde ich ihn persönlich anfertigen.«
Und dann lag sein warmer Mund auf meinem, und sein Arm legte sich um meine Taille. Er war wie ein Anker, an dem ich mich in der Dunkelheit meines Kummers festhalten konnte, das Einzige, das Gefühle in mir weckte, und ich sehnte mich nach mehr – nach seiner Hitze, dem Rausch, der Ablenkung.
Ich klammerte mich an ihn und grub die Finger in seinen Oberarm, als sein Mund sich von meinem löste. Seine Lippen wanderten über mein Kinn, meinen Hals, seine Zunge streichelte meine Haut, und ich hörte auf zu atmen, als ich dort das Kratzen seiner Zähne spürte. Er schien es zu bemerken und löste sich von mir.
»Ich muss mich nicht nähren«, sagte er und hob die Hand, um über meine Wange zu streicheln. »Aber ich will dich.«
Adrian hatte mein Blut nicht mehr genommen seit jener Nacht, in der er sich zum ersten Mal von mir genährt hatte. Als ich ihn danach fragte, sagte er nur: »Ich brauche dich stark.« Doch würde er mich in wenigen Stunden, wenn die Morgendämmerung anbrach, einmal mehr verlassen, um die letzten zwei Rebellen zu jagen – seine ehemaligen Noblessen Gesalac und Julian.
Und dafür musste er stark sein.
»Es geht mir gut genug«, entgegnete ich.
»Nein, du schläfst nicht«, widersprach er.
»Wer braucht schon Schlaf?« Ich ging auf die Zehenspitzen und schlang die Arme um seinen Nacken. »Wenn es so viel gibt, das wir tun könnten?«
Seine Hände lagen an meinen Hüften, er blieb reglos.
»Adrian«, bat ich. Sein Name war ein atemloses Flüstern, und mein Blick fiel erneut auf seine Lippen, während meine Fingerspitzen über seine Wange strichen. »Bitte.«
Erst als ich ihm in die Augen blickte, gab er nach, und sein Mund traf auf meinen. Ich genoss es, dass mein Verstand sich verabschiedete, dass der Schrecken und die Wut der letzten Tage einer glückseligen Hitze wichen, die anzuschwellen schien, mich bis zum Bersten füllte und mir zugleich bewusst machte, wie sehr ich dies brauchte – ihn brauchte.
Adrians Finger gruben sich in meine Haut, und er führte mich, bis mein Rücken an die Wand traf, an die er meine Handgelenke drückte, sodass er mich ungehindert küssen und mit den Lippen bis zu meinen Brüsten wandern konnte, die er mit aller Aufmerksamkeit verwöhnte. Selbst durch den Stoff meines Nachthemdes fühlte sich seine Berührung wundervoll an, und schon bald waren meine Hände frei, um durch sein Haar zu fahren und seinen Mund wieder zu meinem zu ziehen.
Zwischen uns band Adrian seinen Morgenmantel auf und zog mein Hemd hoch, bevor er mein Bein hob und über seinen Arm legte, sodass seine Erektion sich an mich drückte. Ich sog scharf die Luft ein, ließ stöhnend den Kopf nach hinten sinken und entblößte meinen Hals, wo er meine Haut küsste und daran knabberte. Seine Stimme war ein berauschendes Vibrieren.
»Ich liebe es, wie du schmeckst«, sagte er und rieb sich an mir, bis ich mich viel zu hohl und leer fühlte.
»Ich brauche dich in mir«, sagte ich und legte die Hände an seine Schultern, bereit, ihm die Stütze zu bieten, die er brauchte, um mein drängendes Verlangen zu heilen. »Dann kannst du mein Blut haben.«
Sein leises Lachen war atemlos. »Oh, Spatz. Ich werde dich bis zum Bersten füllen.«
Unsere an die Wand gedrückte Stellung bot mir keine Gelegenheit, zuzusehen, als er in mich drang, aber ich fühlte ihn, und atmete aus, als er immer tiefer in mich glitt und dann zustieß. Ich konnte gar nicht zu Atem kommen, während jede neue Woge der Lust höher stieg als die davor. Ich ertrank darin und wollte nie wieder zurück an die Oberfläche.
»Isolde«, sagte Adrian, und ich öffnete die Augen. Er erwiderte meinen Blick, grimmig und lustvoll. »Sieh mich an.«
Er umfasste meinen Nacken mit einer Hand, presste die andere flach an die Wand und bewegte sich tiefer, rieb sich härter an mir. Ich verlor die Kontrolle über mein Gesicht, mein Mund gefangen zwischen Stöhnen, Zähneknirschen und Lippenbeißen. Als der erste klagende Aufschrei über meine Lippen kam, senkte sich Adrian über mich, und seine scharfen Zähne bohrten sich in meine Haut.
Ich klammerte mich an ihn und grub die Nägel in seine Haut. Er bewegte sich weiter in mir, nur langsamer, und seine Lippen sogen an mir im Einklang mit seinen Stößen. Einmal löste er sich, um meinen Mund zu küssen, bevor er sich wieder der Wunde widmete, die er verursacht hatte, und mit dem Geschmack meines Blutes auf meinen Lippen folgte ich jeder Woge aus Schmerz und Lust, bis sie mich in die Dunkelheit stürzte.
Ich erwachte mit der Erinnerung daran, wie Adrian mich gefüllt, mich gevögelt und gebissen hatte, und wie ich in etwas Himmlisches und Göttliches aufgestiegen war – etwas, das mich aus dem Kummer zur Glückseligkeit gebracht hatte. Ich wollte zurück und diese Macht zurückerlangen, doch einmal mehr fand ich mich in diesem trauernden und verwirrten Körper wieder.
Wie war ich ins Bett gekommen?
Rechts neben mir rührte sich etwas, und ich drehte mich um und sah Adrian am Fenster stehen, getaucht in das blutrote Licht von Revekkas Morgendämmerung. Er trug eine Rüstung, die golden und silbern glitzerte, als er sich zu mir umdrehte. Er hatte das Haar zurückgebunden, und die Konturen seines Gesichts traten scharf hervor, umrissen von Schatten.
Er war grimmig, beängstigend schön und jetzt schon in Rot gehüllt.
»Rechnest du damit, verletzt zu werden?«, fragte ich, setzte mich auf und schob die Decken von mir. Ohne ihr Gewicht fühlte ich mich schon besser. Ich hatte Adrian noch nie in Rüstung gesehen. Weder als er kam, um mein Königreich zu beanspruchen, noch als wir nach Revekka zurückkehrten.
Es alarmierte mich, und ich musste mir schwer Mühe geben, die Panik hinunterzuschlucken, die mir in die Kehle stieg, denn ich wusste, dass ich nicht gegen sein Fortgehen protestieren konnte. Es war notwendig für das Überleben unseres Königreiches – für das, was Adrian aufgebaut hatte und was wir beide gemeinsam weiter aufbauen würden.
Adrian schenkte mir ein kleines Lächeln, als finde er meine Sorge eher niedlich als berechtigt.
»Es ist lediglich eine Vorsichtsmaßnahme«, sagte er. »Ich jage keine Sterblichen mehr.«
Heute würde er nach Gesalac und Julian suchen, die Sorin nicht bis jenseits der Grenzen unseres Landes hatte verfolgen können, was bedeutete, dass sie sich wahrscheinlich versteckt hielten, geschützt von Revekkiern. Oder verließen sie sich darauf, dass das Land sie verbergen würde, bis sie mit der nächsten Phase ihres Plans beginnen konnten?
Und was war ihr Plan?
Von den beiden fürchtete ich Gesalac mehr. Er war der Unverblümteste und hatte die größere Rechnung mit Adrian offen, da Adrian Gesalacs Sohn getötet hatte, nachdem dessen fortwährende Belästigung mich verärgert hatte. Ich hatte ihm ein Messer in den Hals gejagt, als er mich angefasst hatte.
Und Adrian hatte den Job beendet.
Julian war weniger eindrucksvoll, aber wie Gesalac sah auch er mich als seine Feindin an. Seine Meinung von mir hatte ihn sein Auge gekostet.
»Denkst du, du wirst sie finden?«, fragte ich.
Meine Lungen fühlten sich schwer in meiner Brust an, und meine Atemzüge waren viel zu flach.
Ich hatte Angst davor, was geschehen würde, falls ihnen die Flucht gelang.
»Vielleicht«, sagte Adrian. »Sie werden wahrscheinlich Zuflucht bei Königen suchen, deren Gesuche, unsterblich zu werden, ich abgelehnt habe.«
Könige wie Gheroghe von Vela, der Sklavenkönig, der das Volk meiner Mutter unterworfen hatte.
Ich stand auf.
»Können sie Vampire erschaffen?«, fragte ich.
»Das können sie«, antwortete er. »Und wahrscheinlich werden sie das auch tun.«
Unter Adrians Herrschaft behielt nur er die Berechtigung zu entscheiden, wer unsterblich wurde. Wer immer sich dem widersetzte, wurde hingerichtet – doch Gesalac und Julian hatten bereits ihr Todesurteil unterschrieben. Sie hatten also nichts mehr zu verlieren.
»Was passiert dann?«
Adrian hob mit einem Finger mein Kinn hoch und antwortete: »Ich werde sie alle töten.«
Ich sollte Trost aus seiner Zuversicht ziehen, und ich hatte keinen Zweifel daran, dass er Rache üben würde – aber würde sie zu spät kommen?
Adrian holte mich mit einem Kuss aus meinen Gedanken, einem sanften Streifen seiner Lippen, bevor er mich an sich zog. Als unsere Körper sich aneinanderdrückten, veränderte sich sein Verhalten, und seine Zunge schob sich in meinen Mund, seine Hand tauchte in mein Haar ein, und sein Knie spreizte meine willigen Schenkel. Ein Stöhnen stieg mir in die Kehle, als die Reibung unserer Körper ein Fieber in mir entfachte, das mich füllte, mich anspannte und mich durchdrang.
Ich wollte ihn berühren, doch seine Rüstung hinderte mich daran. Ich war versucht, meine Macht und seine Zurückhaltung zu testen. Könnte ich ihn überreden, seinen Aufbruch hinauszuzögern?
Andererseits wollte ich, dass es vorbei war. Ich wollte, dass Gesalac und Julian gefasst wurden. Ich wollte ihre Folter und ihren Tod mitansehen.
Adrian musste meine Gedanken wahrgenommen haben, denn er löste sich von mir. Sein Mund war angespannt, und seine Augen leuchteten.
»Du wirst dich heute ausruhen«, sagte er.
Auf seine Anweisung hin presste ich die Lippen zusammen, und er schob sehr sanft mein Haar weg, bog meinen Kopf nach hinten und entblößte meinen Hals. Er drückte die Lippen auf die Stelle, an welcher er mich in der Bibliothek gebissen hatte. Sie war inzwischen verheilt, aber die Erinnerung auf meiner Haut war noch lebendig.
Ich hielt den Atem an und schauderte bei der sanften Berührung seiner Lippen. Eine Woge aus Hitze blühte in meiner Brust auf und machte mich benommen.
Adrian löste sich von mir, musterte mich und wand eine Strähne meines Haares um seinen schlanken Finger.
»Du wirst dich heute ausruhen«, wiederholte er. »Wenn du mich heute Nacht willst.«
»Versuchst du gerade, mich zu bestechen?«, fragte ich.
»Ich hätte dein Blut nicht nehmen sollen«, sagte er. »Du konntest es nicht verkraften.«
»Ich fühle mich gut«, sagte ich.
»Es spielt keine Rolle, dass du dich gut fühlst«, widersprach er. »Du hast das Bewusstsein verloren.«
Ich runzelte die Stirn. »Warum ist das … schlecht?«
Seine Hand in meinem Haar lockerte sich, und er strich mit dem Daumen über meine Lippen.
»Du solltest immer wachsam sein, wenn wir zusammen sind«, sagte er. »Als ich dein Blut nahm, war ich in dir. Und du wurdest schlaff. Du warst weggetreten. Also ja, das ist schlecht.«
Ich senkte den Blick und fühlte mich unwillkürlich ein wenig schuldig, sogar ein wenig beschämt. Ich hatte nicht daran gedacht, was Adrian durchlebt hatte, nachdem ich ohnmächtig geworden war. Nun dachte ich darüber nach, wie verunsichert er gewesen sein musste.
»Isolde«, versuchte er meine Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, aber ich hielt den Blick weiter abgewandt und schluckte.
»Ich werde mich ausruhen«, sagte ich, in einem Tonfall, der weit mehr verärgert klang, als ich wollte.
»Isolde«, wiederholte er leise, und als ich ihm endlich in die Augen sah, war sein Blick sanft. »Du bist mein Licht.«
Ich nahm sein Gesicht in beide Hände.
»Du bist meine Dunkelheit«, sagte ich und küsste ihn.
Einen langen Moment lang sahen wir einander an, und dann trat er einen Schritt zurück, und ich fühlte, wie die Distanz in mein Herz sank.
»Begleitest du mich hinaus?«, fragte er.
»Natürlich.«
Ich trug noch mein Nachthemd und wollte Adrian nicht aufhalten, indem ich in mein Gemach zurückging, um mich umzuziehen. Stattdessen bot er mir einen wollenen Übermantel an. Der Stoff war schwer und die Ärmel zu lang, aber er war warm und roch nach ihm.
Wir gingen schweigend. Ich hatte die Hand auf Adrians Arm gelegt, und als die Türen zum Hof aufgingen, raubte mir eine Woge kalter Luft den Atem. Frost hatte sich auf die Steine gelegt und schimmerte wie blutige Spinnweben unter dem Licht der Sonne.
Adrians Männer waren dort mit ihren Pferden versammelt, und als wir erschienen, knieten sie nieder und erhoben sich auf seinen Befehl wieder. Manche waren Soldaten, andere waren Noblessen, und auch wenn keiner von ihnen sich auf Gesalacs und Julians Seite gestellt hatte, konnte ich nicht anders, als im Stillen ihre Loyalität zu Adrian infrage zu stellen. Seit ich mit ihm hier angekommen war, hatte er vier der neun Noblessen verloren.
Warteten die anderen vielleicht nur auf den rechten Augenblick, bis sie zuschlugen?
Plötzlich drehte sich mir der Magen um. Sollten sie entscheiden, heute anzugreifen, konnte Adrian es mit ihnen aufnehmen?
Mein Blick richtete sich auf Adrians General Daroc und seinen Geliebten Sorin. Optisch bildeten die beiden ein fantastisches Paar, aber sie könnten nicht unterschiedlicher sein. Daroc mit seinen starken und kantigen Gesichtszügen sah immer streng aus. Seine Augen waren durchdringend, als versuche er, jedermanns Gedanken zu lesen, und vielleicht konnte er das ja auch, aber ich hatte gleich zu Beginn gelernt, dass Vampire ihre Fähigkeiten nicht freiwillig preisgaben. Selbst Sorin, der offener war als alle anderen, hatte mir nicht erzählt, dass er sich in einen Falken verwandeln konnte. Das hatte ich erst durch Zufall erfahren, als er im Wald zu meiner Rettung gekommen war, nachdem Ravena und ein vom Nebel besessener Ciro mich angegriffen hatten. Wenn ich ihn nun ansah, mit seinen sanften Zügen und den Grübchen, wenn er lächelte, konnte ich nur schwer glauben, dass er irgendetwas anderes als gut sein konnte.
Und doch hatte jemand Ravena verraten, dass Adrian mein Blut gekostet hatte. Dies machte mich zu seiner größten Schwachstelle – denn unsere Leben waren nun aneinandergebunden.
Ich habe Jahrhunderte darauf gewartet. Auf dich, hatte Adrian gesagt. Er war so bereitwillig gewesen, getröstet von der Gewissheit, dass er den vier trauen konnte, die die Konsequenzen des Bluttrinkens kannten – Daroc, Sorin, Adrians Cousine Ana Maria und sein Vizekönig Tanaka – und doch, wie sich herausstellte, konnten wir niemandem trauen.
Ich atmete tief durch und versuchte, die Anspannung loszuwerden, die mir aufs Herz drückte, weil eine solche Schwäche meinem größten Feind bekannt war. Dann sah ich Adrian an, der meine Hand an seine Lippen hob, während sein Blick sich in meinen brannte.
»Wir werden zu Sonnenuntergang zurückkehren.«
Die Worte waren ein inniges Versprechen, und ich hielt mich an ihnen fest. Er eroberte meinen Mund mit einem heißen Kuss und strich mit dem Daumen über meine Unterlippe, als er sich von mir löste.
»Sieh zu, dass du das tust«, sagte ich, und er drehte sich um und stieg auf Shadow. Ich wollte ihn jetzt schon zurück, aber ich wollte auch, dass er heute Nacht wiederkam, triumphierend und mit Gesalac und Julian als Gefangene.
Mit einem letzten Blick ritt er los, und seine Männer reihten sich hinter ihm ein. Sie ritten durch das Tor, und ich folgte ihnen und sah zu, als sie zwischen den neun gepfählten Leichnamen hindurchritten, die unsere Türschwelle zierten.
Nicht einmal die kalte Brise konnte den Verwesungsgeruch in Schach halten. Er lag in der Luft – dezent, aber säuerlich – und drehte mir den Magen um. Trotzdem blieb ich stehen und blickte Adrian nach, bis ich ihn nicht länger auf dem steilen Pfad hinunter nach Cel Ceredi sehen konnte. Erst dann rührte ich mich wieder und stieg zur Turmmauer hinauf, wo ich sie weiterverfolgte, durch die Stadt lief, bis zur äußersten Mauer – ein Streifen aus Schatten, gehüllt in Rot, während sie in den düsteren Wald stürmten. Und selbst als sie außer Sichtweite waren, verweilte ich dort.
»Kommt hinein, meine Königin«, sagte Tanaka, atemlos von dem mühevollen Aufstieg die Steinstufen hinauf. Ich fragte mich, wann er zu uns in den Hof gekommen war. Ich hatte ihn zuvor gar nicht bemerkt.
Tanaka, Adrians Vizekönig, war älter als alle anderen Vampire, denen ich begegnet war. Seine Haut war weiß und runzelig, selbst an den Wangen, und obwohl sein Haar noch dunkel war, hatte sein Haaransatz sich bis fast an den Hinterkopf zurückgezogen.
Ich fragte mich, wie alt er wohl war und warum er so spät in seinem Leben verwandelt worden war. Obwohl ich einige wenige Erinnerungen an mein früheres Leben als Yesenia hatte, erinnerte ich mich nicht an diesen Mann oder an seine Verbindung zu Adrian. Aber es war möglich, dass er Adrian in den zweihundert Jahren seit meinem Tod nähergekommen war.
Es war viel geschehen in meiner Abwesenheit.
»Meine Königin?«, fragte Tanaka.
»Ich bin noch nicht so weit«, sagte ich, ohne den alten Mann anzusehen.
»Aber es ist kalt«, wandte er ein.
Die Kälte machte mir nichts aus. Zumindest gestattete sie mir, etwas über diese seltsam entfernte Taubheit hinaus zu fühlen, die mich seit dem Tod meines Vaters im Griff hatte.
»Wenn Euch ungemütlich ist, dürft Ihr gern in den Palast zurückkehren«, antwortete ich.
Er atmete hörbar aus und versuchte es noch einmal. »Adrian wird sehr ärgerlich mit mir sein, falls Ihr Euch erkältet.«
»Dann werde ich Euch ganz sicher vor seinem Zorn schützen«, sagte ich, doch meine Antwort fühlte sich selbst für meine Ohren lustlos an. Ich war abgelenkt, aber nicht von etwas Speziellem. Ich war tatsächlich nicht in der Lage, mich auf einen Gedankengang zu konzentrieren. Es war, als sei mein Verstand ein Puzzle, und seit dem Bluttrinken und dem Verrat versuchte ich, ein Bild meiner Welt zusammenzufügen – mit all ihren Wahrheiten und ihren Lügen.
Ich blieb noch einige Minuten lang auf dem Turm stehen. Tanaka versuchte nicht noch einmal, mich zur Rückkehr in den Palast zu überreden, aber er wich auch nicht von meiner Seite. Ich fragte mich, warum er blieb. Tat er es aus wahrer Loyalität zu Adrian, oder war das nur eine Finte?
»Der Winter ist über uns gekommen«, sagte Tanaka. Seine Stimme war leise, fast als spreche er mit sich selbst.
Ich warf ihm einen kurzen Blick zu, und er nickte zum östlichen Himmel, wo sich Wolken sammelten, dicht und schwer, Wolken eines bevorstehenden Sturms.
»Bis Sonnenuntergang wird es schneien.«
Ich runzelte die Stirn. Die Winter in Revekka waren streng. Ich bezweifelte, dass dies Adrian beeinträchtigen würde, doch machte ich mir Sorgen um jene außerhalb unserer Stadt.
»Ist Revekka vorbereitet?«
Der Blutnebel war noch immer eine Gefahr, und nun, da es weniger Noblessen gab, konnten die anderen überleben?
»Wir werden unser Bestes tun«, antwortete er.
»Was ist unser Bestes?«, hakte ich nach, und als ich Tanaka ansah, war er erstarrt, mit halb offenem Mund, als sei ihm die Antwort im Hals stecken geblieben – oder vielleicht hatte er auch gar keine. Doch nach einem Moment fasste er sich wieder.
»Dies ist Wintervolk, meine Königin. Sie wissen, wie man überlebt.«
So sehr ich mir wünschte, draußen zu bleiben und auf Adrians Rückkehr zu warten – ich war Königin von Revekka, und während mein Ehemann auf der Jagd war, würde ich planen müssen.
Diese Welt dachte, sie würde einen Eroberer kennen, als Adrian geboren worden war, doch meinen Zorn musste sie erst noch zu spüren bekommen.
»Ich muss mit Gavriel sprechen«, sagte ich, entschlossen, Informationen über Lara zu bekommen. Zu Adrians Pech hatte ich nicht die Absicht, mich auszuruhen. »Ruft ihn in den Garten.«
Und mit einem letzten Blick zum Horizont verließ ich die Mauer.
KAPITEL ZWEI
Isolde
Tanaka und ich trennten uns am Fuße der Treppe, und ich kehrte in meine Gemächer zurück. Ich war bis auf die Knochen durchgefroren, meine Haut so kalt, dass sie sich anfühlte, als sei sie fest über die Knochen gespannt, und mein langes Haar zerwühlt vom Wind. Doch mit jedem Schritt taute ich mehr auf und fuhr fort, zu planen.
Letztendlich würde ich zusammen mit Killian nach Lara zurückkehren müssen und vorzugsweise, bevor sich die Neuigkeit vom Tod meines Vaters verbreitete. Ich hatte nur wenig Vertrauen darauf, dass mein Volk mich willkommen heißen würde, und noch weniger darauf, dass die Neun Häuser – oder was von ihnen noch übrig war – meine Krönung zulassen würden. Und obwohl ich wusste, dass Adrian alles erzwingen konnte, das ich begehrte, hatte ich nicht den Wunsch, auf diese Art zu erobern.
Die erste Königin von Lara zu werden war mir wichtig. Es war immer das Ziel meines Lebens gewesen, und auch wenn sich nun alles anders entwickelt hatte, wollte ich es nicht weniger. Und nicht nur Lara wollte ich besitzen. Ich wollte Vela. Ich wollte zusehen, wie das Leben aus König Gheroges Gesicht wich, wenn ich sein Königreich eroberte, das Heimatland meiner Mutter zurückgewann und ihr Volk – mein Volk – befreite. Doch so gern ich gleich morgen aufgebrochen wäre, wusste ich, dass die Konsequenzen verheerend wären. Die Lage in Revekka musste sich erst beruhigen, und ich konnte nur hoffen, dass ich in dieser Zeit Ravenas Absichten mit dem Buch Dis herausfinden würde.
Als ich die oberste Stufe der Treppe erreichte, die in mein Privatgemach führte, war ich erfüllt von Feuer und Rache.
Als ich näher kam, hörte ich Violeta und Vesna, meine Kammerzofen. Ich hielt einen Moment lang inne und versuchte, Teile ihrer Unterhaltung aufzufangen, doch ihre Stimmen drangen nur als leises, unverständliches Gemurmel durch meine geschlossene Tür. Ein Teil von mir schämte sich, weil ich sie auszuspionieren versuchte, doch mein Vertrauen in andere war zerbrochen. Ich hatte kein Zutrauen mehr in meine Fähigkeit, Freund von Feind zu unterscheiden, ungeachtet ihrer Position oder ihres Alters.
Also lauschte ich noch eine Weile, fing aber nur einige Wörter auf.
Mutter. Jasenka. Kseniya.
Vesna sprach von ihrer Familie. Wahrscheinlich davon, dass sie diese Woche aus ihrem kleinen Dorf in Jovea nach Cel Ceredi zogen. Adrian hatte Tanaka angewiesen, für sie eine kleine Unterkunft zur Miete zu finden, nachdem ich darum gebeten hatte, sie umzusiedeln. Ich hatte viele Gründe dafür – einerseits sah ich Vesna nicht gern traurig und wollte, dass sie für die Nacht zu ihren Schwestern heimkehren konnte. Und vielleicht empfand ich außerdem auch ein klein wenig Schuld angesichts der Tatsache, dass ich der Grund für ihre Vaterlosigkeit war. Ich hatte nicht über das Messer in meiner Hand hinaus gedacht, als Vesnas Vater an meinen Hof gekommen war und meinem Ehemann seine Tochter als Konkubine angeboten hatte im Austausch für Unsterblichkeit.
Also hatte ich Vesna zu mir genommen und ihm das Gegenteil gegeben.
Ich wusste, wie Vesna zu dieser Sache stand, aber was ihre Mutter oder ihre zwei jüngeren Schwestern anging, war ich mir nicht so sicher. Ich hatte ihnen den Ehemann und Vater genommen, und ungeachtet seines missbräuchlichen Wesens wurden Wahrheiten durch Emotionen häufig verdreht.
Sahen sie mich als ihre Befreierin oder als Mörderin?
Und war das überhaupt wichtig? Ich war ihre Königin.
Ich schob diese Gedanken beiseite und betrat meine Gemächer. Violeta und Vesna verstummten und standen sogleich auf. Ich konnte nichts gegen das Misstrauen tun, das sich in meine Eingeweide krallte, weil sie so plötzlich still wurden.
»Meine Königin«, grüßten sie einstimmig und knicksten.
»Ich habe heute viel zu erledigen«, erklärte ich und ging zu meinem Schrank, um ein Kleid zu wählen. Ich hatte nicht vor, mich langwierig auf den Tag vorzubereiten. Mir war, als sei dieser Luxus dahin und nur passend für eine Königin, die nicht zu herrschen beabsichtigte.
»Natürlich«, sagte Vesna »Doch wollt Ihr nicht zuvor etwas essen, meine Königin?«
»Nein«, sagte ich. Schon die Erwähnung von Nahrung drehte mir den Magen um. Alles, was ich seit dem Tod meines Vaters zu mir genommen hatte, schmeckte verbrannt, aber ich bot ihnen keine weitere Erklärung.
Ich hatte keinen Zweifel daran, dass die beiden sich an Befehle zu halten versuchten, die Adrian ihnen erteilt hatte, doch wenn ich mich weigerte, war da nicht viel zu machen.
Ich wählte ein Kleid – hellblau mit Goldfäden. Es hatte einen Rundhalsausschnitt und einen Rock, der zwar aus Tüll, aber trotzdem schmal war. Die langen Ärmel würden mich innerhalb des Schlosses warm genug halten, während draußen der Sturm aufzog.
Als ich umgezogen war, brachte ich vor dem Spiegel mein Haar in Ordnung. Normalerweise versuchte Violeta, eine Art Zopf zu flechten, aber heute bändigte ich es nur so weit, dass ich die Perlentiara meiner Mutter tragen konnte. So kurz nach dem Verrat meines Vaters erschien es mir nur passend, ihr Gedenken zu ehren. Es fühlte sich nicht an, als sei es genug, doch ich hatte kaum mehr von ihr. Meine Verbundenheit zu ihr und ihrem Volk war wie ein Schmerz, den ich bis tief in meinen Knochen fühlen konnte. Er war Teil meiner Seele geworden, die bei der Geburt zerbrochen war und nie heilen würde.
Ich würde immer um das trauern, was hätte sein können, hätte meine Mutter überlebt und mich die Eigenheiten ihrer Welt gelehrt. Mir war klar, dass ich, selbst wenn es mir gelang, die Nalani zu befreien, immer anders sein würde – nie eine von ihnen, sondern fremd. So war es gewesen, als ich Prinzessin von Lara gewesen war, und nun als Königin von Revekka war es genauso.
Und selbst wenn es mir gelang, sie zu befreien – würden sie mich nur als eine weitere Eroberin oder als eine der ihren ansehen?
Violeta brachte meine Tiara. Zuletzt hatte ich sie an dem Tag getragen, an dem mein Königreich unter Adrians Herrschaft gefallen war, dem Tag, an dem er um meine Hand angehalten hatte. Es war ein schlichter Silberreif, besetzt mit Süßwasserperlen. Von den Dingen, die mir von meiner Mutter geblieben waren, war sie mein Lieblingsstück. Es war die Krone, die sie auf ihrem Hochzeitsporträt getragen hatte.
Nun fragte ich mich, unter welchen Umständen sie sie wohl erhalten hatte. War sie ein Geschenk ihrer Eltern gewesen, gegeben in dem Verständnis, dass ihre Ehe mit meinem Vater eine friedliche Allianz besiegeln würde? Oder war sie eines der wenigen Besitztümer, die sie mitnehmen durfte, als mein Vater sie gefangen genommen hatte?
Ich drehte mich zum Spiegel um, setzte die Krone auf und suchte in meinem Gesicht nach Zügen meiner Mutter. Doch alles, was mir entgegenblickte, waren die Züge meines Vaters – sein tiefes Stirnrunzeln, seine hohlen Wangen, seine besorgte Stirn.
Ich sah elend aus.
Ich wandte mich vom Spiegel ab und sah, dass Violeta ein Paar Perlenohrringe in den Händen hielt.
»Ihr solltet diese hier tragen, meine Königin«, sagte sie.
Sie hatten ebenfalls meiner Mutter gehört, und obwohl ich sie schon so viele Male getragen hatte, ließ mir ihr Anblick jetzt Tränen in die Augen steigen. Ich atmete tief durch und schluckte die seltsame Welle der Rührung hinunter, die in meinem Blut aufwallte.
»Danke, Violeta.«
Ich nahm die Ohrringe und weigerte mich, in den Spiegel zu sehen, als ich sie anlegte. Als es an der Tür klopfte, versteifte ich mich, voller Anspannung.
Violeta und Vesna sahen mich an.
»Wir können sagen, dass Ihr beschäftigt seid«, schlug Vesna vor. »Es wäre nicht gelogen.«
Richtig, doch egal, wie schnell ich mich heute an meine Agenda machte, würden die Dinge, die ich geplant hatte, Zeit brauchen, um sich zu entfalten. Außerdem, was wenn es Ana war, um mit mir zu sprechen? Ich wollte nicht die Chance verpassen, sie zu sehen, vor allem da ich so viel mit ihr zu besprechen hatte, eingeschlossen ihrer Nutzung von Magie.
»Geh an die Tür«, sagte ich.
Vesna gehorchte, und als sie die Tür öffnete, erkannte ich die Stimme auf der anderen Seite.
Ich seufzte, und noch bevor Vesna seine Anwesenheit ankündigen konnte, sagte ich: »Komm herein, Killian.«
Der Commander des Militärs von Lara – und einer meiner ehemaligen Liebhaber – betrat mein Gemach. Er war schwarz gekleidet – nicht, weil er trauerte, sondern weil er es weder über sich brachte, das Blau von Lara zu tragen noch das Rot von Revekka. Obwohl der Verrat meines Vaters ihn verletzt hatte, war er noch nicht bereit, mein Königreich zu akzeptieren, auch wenn er an meiner Seite gegen Gesalac und den roten Nebel gekämpft hatte.
»Meine Königin«, grüßte er und verneigte sich.
»Du hast dich rasiert«, stellte ich fest. Ich war überrascht zu sehen, dass sein langer Bart bis ans Kinn gestutzt war. Er hatte sich seit Beginn seines Bartwuchses nicht rasiert, was für mich keine Rolle gespielt hatte. Doch hatte ich vermutet, dass er ihn so trug, weil sein Vater es ebenso getan hatte. Nun fragte ich mich, ob diese Veränderung vielleicht seine Art war, sich von seiner Loyalität zu König Henri zu distanzieren.
»J-ja«, sagte er und fuhr sich über den Hinterkopf. »Ich hatte heute auf einen Moment deiner Zeit gehofft.«
»Und ich nehme an, mit heute meinst du jetzt.«
Sein Blick huschte zu Violeta und Vesna. »Auf einen Moment … allein.«
Allein. Dieses eine Wort ließ meinen Rücken kerzengerade werden und mein Herz rasen. Ich wünschte mit niemandem allein zu sein außer Adrian. Doch zugleich machten mir Schuldgefühle das Herz schwer. Killian hatte mir geholfen, und er war ebenso niedergeschmettert von dem Verrat meines Vaters wie ich. Doch auch wenn ich wusste, dass er loyal mir gegenüber war – wäre er auch meinem Ehemann gegenüber loyal?
»Ich befürchte, ich habe heute Morgen keine Zeit«, sagte ich. »Ich muss mich mit Gavriel treffen.«
Killians Schultern versteiften sich. »Warum?«
Die Worte kamen ohne Umschweife aus meinem Mund.
»Ich habe Fragen über Lara«, erklärte ich.
Er schwieg einen Moment lang und wünschte wahrscheinlich, er hätte seine anfängliche Reaktion unter Kontrolle gehalten, aber das war nicht nötig, denn ich wusste, wie er sich fühlte. Es war dasselbe Gefühl, das ich jedes Mal gehabt hatte, wenn er meine Befürchtungen bezüglich Laras Politik oder Verteidigung bagatellisiert hatte.
»Vertraust du mir nicht?«, fragte Killian.
»Das hat nichts mit Vertrauen zu tun.«
»Warum fragst du dann nicht mich?«
»Weil du zu nahe dran bist«, sagte ich. »Ich brauche die Wahrheit.«
»Willst du mich einen Lügner nennen?«, fragte er.
Ich ballte die Faust, um nicht die Augen zu verdrehen. »Nein«, antwortete ich. »Es sei denn, du wusstest, dass mein Vater vorhatte, mich zu töten, als er hierherkam. Dann würde ich dich einen Lügner nennen. Und dann würde ich dich einen Verräter nennen.«
Killian wurde blass, und als er antwortete, war seine Stimme ein leises Grollen, das den Schmerz durchblicken ließ, den ich ihm mit diesen wenigen Worten zugefügt hatte. »Du kannst doch nicht denken, ich hätte zugelassen, dass er dich verletzt.« Als ich schwieg, fuhr er fort: »Hätte ich von seinen Absichten gewusst, hätte er es nicht mal über die Grenzen von Lara hinaus geschafft.«
Ein Teil von mir hatte erwartet, dass Killian die Entscheidung meines Vaters rechtfertigen würde, denn als er nach Revekka gekommen war und entdeckt hatte, dass der Blutkönig nicht nur immer noch am Leben, sondern ich auch noch in ihn verliebt war, war er ebenso aufgebracht gewesen. Doch stattdessen versuchte Killian, mich zu schützen.
»Ich wünschte, ich hätte es gewusst«, fügte er hinzu. »Ich hätte dir diese Qual gern erspart.«
Es gab eine Menge über Killian und die komplizierte Natur unserer Freundschaft zu sagen, aber sein vielleicht größtes Qualitätsmerkmal war seine Loyalität – nicht zu Krone oder Titel, sondern zu mir.
»Ich zweifle nicht an dir«, sagte ich. »Doch eben deshalb muss ich mit Gavriel sprechen. Deine Sicht auf Lara ist von meinem Vater beeinflusst. Wie sollen wir die Wahrheit erkennen?«
»Ist das eine Einladung, mich dir anzuschließen?«, fragte er.
Ich musterte ihn kurz und sagte dann: »Nur wenn du dich bereit erklärst, meine Farben zu tragen.«
Sein Kiefer spannte sich an. »Welche Farben?«
»Rot für Revekka, Blau für Lara und Grau … für die Zeit, wenn ich Vela erobere und das Volk meiner Mutter befreie.«
»Du wünschst, Vela zu erobern?«, fragte er und runzelte die Stirn.
»Ich werde Vela erobern«, sagte ich. »Ich werde es niederbrennen.«
Killian wartete vor meiner Tür, während Violeta mir half, meine Stiefel zu schnüren, und mir einen pelzverbrämten Mantel um die Schultern legte. Trotz der Kälte wollte ich Gavriel nicht im Palast treffen. Ich traute seinen Mauern nicht, mit all den verborgenen Gängen und Geheimtüren – alle möglichen Leute könnten uns zufällig begegnen oder vielleicht belauschen. Im Garten war es dagegen schwieriger, sich zu verstecken. Außerdem war es ein Ort, aus dem ich Trost und Stärke zog, denn dort fühlte ich mich meiner Mutter am nächsten, obwohl ich meilenweit von ihren Gärten in Lara entfernt war. Für deren Weiterbestehen hatte, lange über ihren verfrühten Tod hinaus, mein Vater gesorgt.
Einmal mehr spürte ich den emotionalen Widerstreit zu meinem Vater, dessen Liebe zwar zur Errichtung von Altären im Gedenken meiner Mutter geführt hatte, aber nicht zu Taten für das, was das Wichtigste war – die Freiheit ihres Volkes und das Leben ihrer Tochter.
Ich geleitete Killian durch den Eingang zum Roten Palast hinaus und folgte einem Pfad, der sich zwischen grünen Hecken und einer Reihe steinerner Stufen wand, die in die weitläufigen Gärten führten. Es war kälter geworden, seit ich Adrian heute Morgen verabschiedet hatte, und kurz fragte ich mich, wo er jetzt wohl war, ob er schon Erfolg hatte, Gesalac oder Julian ausfindig zu machen, und wann er wieder zu Hause wäre.
»Alles lebt noch«, bemerkte Killian.
Und es stimmte – die Bäume waren noch üppig, die Blumen blühten, und die Hecken wuchsen dicht – und doch wirbelte nun Schnee in der Luft und sammelte sich in den Ritzen der Blätter und Blüten, rot glitzernd unter dem schweren Himmel.
»Der Winter kommt schnell über uns«, sagte da eine Stimme, und ich drehte mich um und sah Gavriel, der sich von der Palastmauer abstieß, an der er gelehnt hatte. Er war eine imposante Gestalt, sowohl durch seinen Körperbau als auch seine Größe. Während er näher kam, ließ er den Blick aus zusammengekniffenen Augen prüfend über die Landschaft schweifen und fuhr fort: »Bald wird alles sterben.«
Seine Worte fühlten sich unheildrohend an und jagten mir einen Schauer über den Rücken.
Vor heute hatte ich nur ein Mal mit Gavriel zu tun gehabt, und das war gewesen, nachdem ich die Schändung des Dorfes Vaida in Lara entdeckt hatte. Adrian hatte ihn damit beauftragt, auf Burg Fiora zu bleiben, und dort war er geblieben, bis mein Vater sich für meine Krönung auf die Reise nach Revekka gemacht hatte.
Jetzt fragte ich mich, was geschehen wäre, wenn sie gar nicht gekommen wären.
Gavriel verneigte sich tief vor mir.
»Meine Königin, Commander Killian«, grüßte er und richtete sich auf. »Ich entschuldige mich. Ich hatte nicht die Absicht, Euch zu erschrecken.«
»Ich hatte nicht so früh mit dir gerechnet«, sagte ich.
Er grinste. »Es wäre geschmacklos gewesen, zu spät zu einem Treffen mit meiner Königin zu erscheinen.«
Ich musterte den Vampir. Seine Sprechweise machte mich neugierig.
»Woher kommst du, Gavriel?«
»Keziah«, antwortete er.
Ich wusste nicht viel über Keziah, abgesehen davon, dass sein Herrscher sich geweigert hatte, sich den neun Königen anzuschließen, die dann die Neun Häuser von Cordova bildeten. Es war nicht das einzige Land in Cordova gewesen, das es vorzog, sich weder gegen den Blutkönig zu organisieren, noch sich auf seine Seite zu stellen. Unter den Neun Häusern wurde diese Entscheidung als Zaudern aufgefasst – als Schwäche, die ausgemerzt werden musste. Doch als die Neun Häuser eine Armee aufstellten, um gegen Keziah zu ziehen, stellten sie fest, dass seine Bewohner alles andere als schwach waren. Sie hatten hart gekämpft, um die Kontrolle über ihr Land zu behalten, und die Könige der Neun Häuser hatten sich schließlich zurückziehen müssen.
Jedes Jahr versammelten sich die Könige seitdem zu einem Treffen, um ihre sogenannte »vereinte Herangehensweise« der Herrschaft über die Häuser zu besprechen. Unter der Geringschätzung der meisten Teilnehmer hatte mein Vater mich mitgenommen, seit ich sechzehn Jahre alt gewesen war, und dort hatte ich gelernt, was Männer wirklich fürchten – alles, was mächtiger ist als sie.
Die Könige, peinlich berührt, weil sie so brutal geschlagen worden waren, lästerten immer über Keziah, aber das Thema einer Invasion sprachen sie nie wieder an.
Ich erinnerte mich daran, dass ich damals beschlossen hatte, dass ich Keziah auf meiner Seite haben wollte, sollte ich je in den Krieg gegen die Vampire ziehen.
Wie die Zeit doch alles verändert hatte.
»Wie lange dienst du meinem Ehemann schon?«
»Seit zehn Jahren«, antwortete er.
»So kurz erst?«
Er lachte leise. »Nicht alle von uns wurden vor Jahrhunderten geboren. Ich kam nach Revekka, sobald ich alt genug wurde, um König Adrian Gefolgschaft zu schwören.«
»Ich dachte nicht, dass Keziah von Vampiren regiert werden will«, sagte ich.
»Meine Leute sind stolz und sehr tapfer, aber selbst sie sind nicht stark genug, um zu überleben, was aus dieser Welt geworden ist.«
Ich fragte mich, was er tun würde, falls Adrian darin versagte, Keziah zu schützen.
»Falls Ihr versucht, die Tiefe meiner Loyalität zu ergründen, solltet Ihr mich vielleicht danach fragen. Es würde uns beiden Zeit sparen, wo wir davon so wenig haben.«
»Deine Loyalität zu Adrian ist nicht das, was ich einschätzen möchte«, entgegnete ich. »Sondern deine Loyalität zu mir.«
»Ihr seid ein und dasselbe.«
Diese Feststellung beruhigte mich nicht gerade. Stattdessen machte sich Enttäuschung in mir breit. Ich wünschte Adrians Gleichgestellte zu sein, aber Gleichstellung bedeutete nicht, dass wir ein und dieselbe Person waren.
»Wie sehr du dich doch irrst«, sagte ich. Dann holte ich Luft und fragte: »Wie geht es meinem Volk?«
»Sie sind beunruhigt, verunsichert«, sagte er.
Damit hatte ich gerechnet, doch es zu hören, war trotzdem entmutigend.
»Die Nachricht über die Zerstörung von Vaida hat sich schnell verbreitet, und so kurz nach Eurer Hochzeit mit Adrian glauben manche in Eurem Volk, dass er sein Versprechen, sie zu schützen, gebrochen habe.«
Ich warf einen Blick zu Killian, der einst das Gleiche angenommen hatte.
»Und das Heiligtum von Asha ist nicht gerade hilfreich dabei«, ergänzte Gavriel.
Ich sah ihn wieder an. »Das Heiligtum?«
»Ihr habt dort eine Priesterin, die behauptet, Asha habe ihre Erlösung gesandt.«
Trotz der starken Präsenz von Göttinnen in meinem Leben und im Leben aller in Cordova war ich nie religiös gewesen. Ich konnte nicht begreifen, wie ich jemanden verehren sollte, der mir so jung meine Mutter genommen hatte. Aber ich wäre dumm, wenn ich nicht die Macht jeder der beiden Göttinnen anerkennen würde. Und es war wahre Macht, denn sie war stark genug gewesen, um Adrian zu erschaffen.
»Hast du davon gehört?«, fragte ich Killian, der mit den Schultern zuckte und dann den Kopf schüttelte.
»Ein bisschen Getuschel hier und da«, meinte er. »Mehr nicht. Auf jeden Fall habe ich keinerlei Beweis gesehen, dass es wahr wäre.«
»Man braucht keine Beweise, wenn die Menschen es glauben«, sagte ich. Die reine Tatsache, dass irgendwer der Priesterin glauben und auf die Wahrhaftigkeit ihrer Worte vertrauen könnte, war gefährlich – vor allem für meine Herrschaft.
»Woher wissen wir, dass dies nicht irgendeine Lüge ist, die von der Priesterin verbreitet wird?«, fragte ich.
»Das wissen wir nicht«, sagte Gavriel.
»Dann finde es heraus«, befahl ich.
»Wie Ihr wünscht«, sagte er. »Noch etwas, meine Königin?«
»Kehre morgen nach Lara zurück«, sagte ich. »Teile dem Hof mit, dass mein Vater beschlossen hat, seinen Aufenthalt in Revekka zu verlängern.«
Ich erwog, das Ganze noch auszuschmücken und hinzuzufügen, dass König Henri seine Tochter zu sehr vermisst habe, um nur eine Woche zu bleiben, aber ich schaffte es nicht, die Worte auszusprechen.
»Meine Loyalität gilt Euch, meine Königin.« Gavriel akzeptierte meine Befehle mit einer Verneigung und ging.
Nach seinem Abgang blieb ich lange still und dachte über seine Worte nach. Mir war klar, dass die Rückkehr nach Lara nicht leicht wäre, wenn man bedachte, wie ich bei meiner Abreise behandelt worden war, aber dies machte meine Pläne noch komplizierter.
»Bei den Gerüchten über die Erlösung durch Asha, was ist mit Nadia?«, fragte ich Killian mit belegter Stimme.
Nadia, meine Zofe und die Frau, die mich mit großgezogen hatte, war eine leidenschaftliche Anhängerin von Asha, und ich hörte unwillkürlich ihre Stimme, als mir Gavriels Warnung durch den Kopf ging.
Asha ist unsere Retterin, hatte sie immer gesagt. Sie wird unsere Erlösung senden.
Wann?, fragte ich dann. Wenn wir alle tot sind?
Vorlautes Kind, die Göttin hat dir das Leben geschenkt!
Meine Mutter hat mir das Leben geschenkt, sagte ich darauf. Sie ist auch für mich gestorben.
Als Killian nicht antwortete, sah ich ihm in die Augen. Ich wusste schon, was er sagen würde, noch bevor die Worte aus seinem Mund waren, und doch konnte ich mich nicht gegen den Schmerz und den Kummer wappnen zu wissen, dass sie sich nie für mich entscheiden würde.
»Nadia liebt dich«, sagte er. »Aber ihre Göttin liebt sie mehr.«
Vielleicht wäre ich zusammengezuckt, hätte da nicht eine Glocke geläutet, grell und hektisch und so durchdringend, dass es mir bis in die Knochen fuhr.
»Was ist das?«, fragte Killian, und obwohl ich dieses Geläut noch nie gehört hatte, brachte es mein Herz zum Rasen, versetzte mich in Panik.
»Etwas Schreckliches«, sagte ich und spürte plötzlich einen Kloß in meiner Kehle.
KAPITEL DREI
Isolde
Ich raffte mit einer Hand meine Röcke und stürmte durch den Garten. Killian folgte mir, und als wir das obere Ende der Treppe erreichten, hatte das Läuten aufgehört und war furchtbaren, ohrenbetäubenden Schreien gewichen.
Im Hof hatte sich eine Menge versammelt. Ich drängte mich bis nach vorn durch und sah Miha und Isac, die an der Spitze einer kleinen Gruppe von Soldaten nach Cel Ceredi ritten, wo riesige schwarze Hunde meine Untertanen in den Straßen verfolgten, zerrissen und verstümmelten.
Diese Kreaturen waren Aufhocker. Sie wurden angezogen von Leben, in der Gier, es zu beenden. Als Nadia mir keine Angst mehr mit Hexengeschichten machen konnte, hatte sie die Aufhocker bemüht, um mich davon abzuhalten, mich nachts aus der Hohen Stadt hinauszuschleichen.
»Weißt du, sie suchen nach Mädchen wie dir«, hatte sie immer gesagt. »Störenfriede, die sich nicht an die Regeln halten, und wenn du allein im Wald bist, springen sie dir auf den Rücken und zerreißen deine Kehle!«
»Wie können sie mir denn die Kehle zerreißen, wenn sie auf meinem Rücken hocken?«, hatte ich gefragt.
»Stell keine Fragen, vorlautes Kind!«, sagte sie dann immer, und obwohl wir beide lachten, wusste ich, dass in dem, was sie sagte, auch Wahrheit lag. Aufhocker rissen einem wirklich die Kehle heraus, nur war ihnen egal, ob man ein Störenfried war oder nicht – alles, was Blut besaß, war ihnen Beute.
Adrian hätte mich nie allein gelassen, wenn er geahnt hätte, dass sie uns angreifen würden. Doch wahrscheinlich hatte er dasselbe gedacht wie ich – dass die Monster sich nicht über die Grenzen nach Revekka hinauswagen würden –, und obwohl ich es nun besser wusste, hätte ich nie damit gerechnet, dass sich ein Rudel aus zwölf oder mehr Hunden am helllichten Tage einer Stadt nähern würde. Nicht einmal die Feuer, die an den Toren loderten, hatten sie ferngehalten.
»Was ist das für ein Wahnsinn?«, flüsterte Killian.
Es war mehr als Wahnsinn. Es war das reinste Chaos und würde schnell zu einem Blutbad werden, wenn wir nicht handelten.
»Du bleibst hier«, sagte Killian und zog sein Schwert.
Ich sah ihn finster an. »Wie oft noch, Killian …«
»Ich darf dich nicht verlieren«, schnitt er mir das Wort ab. Ich starrte ihn an, nicht so sehr überrascht von seinen Worten als vielmehr von der Aufrichtigkeit, die in ihnen lag – und der Verzweiflung. Sein Blick war unerbittlich und ein harter Zug lag um seinen Mund, als er fortfuhr. »Und ich werde dich nicht verlieren.«
Er trat einen Schritt zurück.
»Bleib hier«, wiederholte er. »Bitte.«
Dann drehte er sich um und stürmte durch die Tore.
Ich blickte ihm nicht nach, denn ich hatte nicht die Absicht, auf seine Bitte zu hören. Doch ich konnte mich nicht ohne meine Waffen in den Kampf stürzen. Als ich mich umdrehte, fiel mein Blick auf jene, die sich hier versammelt hatten, hoch auf dem Hügel, ohne Absicht, denen zu unseren Füßen zu helfen.
»Bereitet die große Halle darauf vor, die Verwundeten aufzunehmen«, befahl ich. »Wer von euch kämpfen kann, nimmt seine Waffen und folgt mir. Und jemand bringe mir ein Pferd.«
Schon drängte ich mich durch die Menge in den Palast zurück und eilte nach oben. Ich stürmte in mein Gemach, zu meinem Nachtkästchen, wo ich meine Messer aufbewahrte. Für gewöhnlich steckten sie in Hüllen an meinen Handgelenken, doch heute würde ich sie als Wurfmesser einsetzen, um so viel Distanz wie möglich zu diesen räudigen Höllenhunden zu wahren.
Ich fand mein Schwert in der Truhe am Fußende meines Bettes und schnallte es mir um die Taille. Als ich fertig war, legte ich die Krone meiner Mutter und meinen Mantel ab, die mir nur im Weg wären.
Dann nahm ich eins meiner Messer, schnitt eilig meinen langen Rock ab, sodass er mir bis knapp über die Stiefel reichte, und schob dann das eine Messer in den Gürtel an meiner Taille und das andere zwischen meine Brüste.
Dann eilte ich hinunter und traf auf Tanaka. Er erwartete mich mit strenger Miene und versperrte mir den Weg.
»Ihr könnt nicht in den Kampf ziehen, meine Königin«, sagte er.
Ich legte den Kopf schief, mit schmalen Augen und voller Zorn. Wann würde es aufhören, dass meine Wünsche mit denen Adrians kollidierten?
»Ich bin nicht Königin geworden, um meinem Volk von der Sicherheit eines Turmes aus beim Sterben zuzusehen.«
»König Adrian …«
»Ist nicht hier, also werde ich mein Volk im Kampf anführen. Ihr dürft hier im Schutz meiner Burg bleiben.«
Ich schritt an dem alten Mann vorbei.
»Ihr trotzt seinen Befehlen«, fuhr Tanaka fort, noch während ich weitereilte. »Aber nicht Ihr werdet den Preis dafür zahlen.«
Ich ignorierte ihn.
Mir war egal, dass Adrian Anweisungen hinterlassen hatte.
Die Konsequenzen einer Missachtung seiner Wünsche konnten nicht so schwer auf meinem Gewissen lasten wie der Tod unserer Untertanen.
Als ich den Palast verließ, traf ich auf Violeta, die mit einem großen Ross bereitstand. Das Pferd, Reverie, war weiß mit schwarzen Flecken, und seine Mähne sah beinahe silbrig aus, sogar unter diesem seltsamen rot getönten Licht. Als ich aufstieg, begegnete ich Violetas Blick.
»Suche Ana. Falls sie es nicht schon weiß, muss sie darauf vorbereitet sein, den Verwundeten zu helfen. Tu, was immer sie sagt.«
Damit ritt ich los und trieb Reverie den steilen Hügel hinab, auf dem der Rote Palast stand, in die Stadt hinunter. Ich sah mich nicht um, um zu sehen, wer mir folgte, ich war nur besorgt, ob ich schon zu spät käme. Sogar von hier aus konnte ich schon das Blut sehen. Es befleckte die dünne Schneeschicht, die sich auf dem Boden gebildet hatte, und bildete Pfützen unter leblosen Körpern. Und die ganze Zeit über attackierten diese bösartigen Kreaturen weiterhin Sterbliche wie Vampire.
Als ich mein Pferd antrieb, flog etwas an mir vorbei und verfehlte nur knapp meinen Kopf. Ich duckte mich und dachte schon, es sei ein Pfeil. Doch dann sah ich, wie Gavriel sich mitten im Flug aus der Gestalt einer Krähe zurückverwandelte, in einen der Aufhocker krachte und ihn mit seiner Klinge durchbohrte. Die Kreatur brüllte auf, doch ein Hieb in den Hals, der ihr den Kopf abtrennte, brachte sie schnell zum Schweigen.
Noch mehr Hunde stürzten sich auf Gavriel, und einige wandten sich mir zu, wohl angezogen vom Geräusch der Hufe.
Ich zog mein Schwert und bereitete mich auf einen Aufprall mit den Kreaturen vor, doch als wir näher kamen, bäumte mein Pferd sich auf, schnaubte und warf den Kopf hoch. Es machte scharf kehrt, und ich stürzte zu Boden, während es davonstürmte. Ein paar Hunde rannten ihm nach, während zwei andere sich mir stellten. Ich rappelte mich auf und packte mein Schwert. Ich fühlte mich klein vor ihnen, mit ihren dämonischen, rot glühenden Augen und den scharfen Zähnen, von denen Blut tropfte und sich zu ihren Pfoten sammelte.
Sie hielten sich nicht länger damit auf, abzuschätzen, ob ich eine Gefahr war oder nicht – sie griffen einfach an. Ich wusste, dass ich es nicht mit beiden zugleich aufnehmen konnte, also konzentrierte ich mich auf den Hund zur Rechten und bewegte mich so, dass ich in seiner direkten Angriffslinie stand. Als er herankam, hieb ich mit dem Schwert auf seine Schnauze und brachte ihm eine tiefe Wunde bei. Doch das hielt ihn nicht auf. Er verbiss sich in mein Schwert und riss es aus meinem Griff, sodass ich einen Satz vorwärts machte.
Hektisch griff ich nach dem Dolch an meiner Seite, als die Kreatur erneut angreifen wollte. Ich trieb ihm die Klinge in den Kopf, direkt zwischen seine Augen.
Der Hund brüllte auf und verbiss sich in meinen Arm. Ich schrie, nahm aber mehr einen Schock als Schmerz wahr, bevor ich den zweiten Dolch zwischen meinen Brüsten hervorzog und auch ihn in den Kopf der Bestie rammte. Diesmal stöhnte der Hund auf, doch bevor er zusammenbrechen konnte, wurde ich nach hinten geworfen, als der zweite mich rammte.