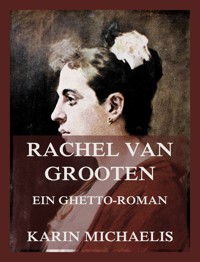
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Karin Michaelis war eine dänische Journalistin und Schriftstellerin. Sie ist vor allem für ihre Romane, Kurzgeschichten und Kinderbücher bekannt. Im Laufe von 50 Jahren schrieb Michaelis mehr als 50 Bücher auf Dänisch, Deutsch und Englisch. Ihre Werke wurden aus dem dänischen Original in mehr als 23 Sprachen übersetzt und unter verschiedenen Namen veröffentlicht. Zu ihren bekanntesten Werken gehört diese Roman über das Leben der Jüdin Rachel.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 236
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Rachel van Grooten
Ein Ghetto-Roman
KARIN MICHAELIS
Rachel van Grooten, K. Michaelis
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN: 9783988682437
Deutsch von Mathilde Mann
www.jazzybee-verlag.de
INHALT:
Einleitung.1
Die Erzählung des Richters.11
I12
II17
III19
IV.. 23
V.. 29
VI39
VII44
VIII47
IX.. 49
X.. 52
XI55
XII58
XIII64
XIV.. 67
XV.. 75
XVI84
XVII88
XVIII93
XIX.. 98
XX.. 103
XXI106
XXII110
XXIII112
XXIV.. 114
Einleitung.
In der hellen Abendstunde saß Simon Jumaisohn am Fenster und verzehrte sein mit Knoblauch eingeriebenes Brot und aß saure, grüne Gurken dazu. Während er so da saß und zum Himmel hinaufsah und kaute, und mit sich selber über die Geschäfte des Tages schwatzte, klang ein wirrer Lärm aus der großen, gemeinsamen Küche des Hauses zu ihm herauf, in der sich die Frauen beständig um die Kochtöpfe und um den Platz an dem offenen Feuerherd zänkten.
Simon stopfte die Watte fester in seine Ohren hinein und wünschte aus tiefstem Herzen, dass alle diese Weibsbilder unter der Zucht und dem Willen eines Mannes stünden –– er selbst aber wollte nicht gern dieser Mann sein. Er fürchtete sich sogar, ihnen nur auf der Treppe zu begegnen. Wenn eine von ihnen zu ihm kam und um ein altes Kleidungsstück oder ein elendes Stück Hausrat feilschte, ließ er sich gutwillig übers Ohr hauen, nur um sie loszuwerden. Alle Frauen glichen, so meinte er, unreinen Tieren, selbst wenn sie zuweilen auch noch so schön von Angesicht waren.
Simon rechnete aus, dass es nur noch ein Tag bis zum Sabbath sei, wo er sich Kohlsuppe mit Graupen und gelben Wurzeln, eine höchst angenehme Speise, gönnte. Bei dem bloßen Gedanken daran bewegte er die Zunge in seinem Munde.
Sobald die Dunkelheit den Himmelsstreif zwischen den vorspringenden Giebeln überzog, ging Simon zu Bett. Dadurch sparte er an Licht. Aber die neun Kinder der Gabriele Mengs da unten in ihren schubfachähnlichen Kojen hörten nicht auf, herumzuspringen und zu brüllen, und fortwährend knarrte die Treppe.
Es währte lange, bis die gute Stille hereinbrach.
Simons Gedanken wurden langsam und sanft, er fühlte, wie sie dem Traume entgegenglitten, dem süßen Traume.
Jetzt ging der Mond auf und gewann die Oberhand über die Finsternis der engen Gasse. Er glitzerte wie Reif auf den Kleidern, die an langen Nägeln an der Wand entlang hingen. Der Schein kroch tastend über die bis an die Decke aufgestapelten Möbel und brach sich in den perlengrauen Metallstiften der großen Kronleuchter. Diese Kronen hatten jetzt seit vier Jahren auf einen Käufer gewartet, ach, was nützte es da, dass er selbst bei einer christlichen Witwe, die sich in Geldverlegenheit befand, zu einem Spottpreis dazu gelangt war!
Simon wurde sonderbar beklommen zu Mute.
Er lag da und weinte unter der Sternendecke, die ihm seine Mutter aus bunten, seidenen Flicken genäht hatte. Lag da und weinte über seine Hasenscharte, seine pfeifende Stimme und seinen Unstern, und es kam ihm so traurig zum Bewusstsein, wie jung er noch war.
Ganz im Geheimen hatte er ein schönes Bild anfertigen lassen und es an ein Heiratsbüro in Hamburg geschickt. In dem begleitenden Brief äußerte er, auf die Schönheit des Gesichts komme es gar nicht an, wenn ihre Gestalt nur dafür bürge, das sie gesunde Kinder zur Welt bringen könne. In Hamburg, das wusste er, saßen Judenmädchen genug, die auf die Hilfe des Heiratsvermittlers warteten, aber er hatte auch gehört, dass einige von ihnen sehr schmächtig von Körperbau seien, und keine Mitgift konnte ihm die Schmach der Unfruchtbarkeit aufwiegen.
Da aber Simon sich nicht entschließen konnte, mit Geld um sich zu werfen, ehe das Ergebnis sicher war, und der Makler sein Wort als Pfand verlangte, ward nichts daraus –– nicht einmal sein Bild bekam er zurück.
Oben in Kopenhagen saß ein Mädchen, eine entfernte Verwandte, und machte ihm ein Anerbieten durch ihren Bruder, aber ihr Gesicht war durch Lungenschlag entstellt.
Simon lag da und grämte sich. Er war doch nicht garstiger als Bander Hieb und Samuel Melchior, die dralle Frauen und kräftige Kinder bekommen hatten –– aber die Stimme, die, wie die Leute sagten, gleich einem Zugwind durch die Hasenscharte pfiff, die war sein Unglück. Er hatte sich bemüht, die Zunge rund zu machen und den Schlund zu erweitern, um die Stimme dick zu machen, aber es half ihm nichts. Man lachte ihn aus, lachte ihm ins Gesicht hinein und hinter seinem Rücken, und nannte ihn einen Mauljuden, obwohl sein Vater wie auch seine Mutter von so reiner Rasse waren wie nur jemand im ganzen Lande.
Könnte er nur träumen ... wie in jener Nacht, als er träumte, dass er zu Aaron Kitzig gehen und ein Geschäft machen solle, und wirklich am nächsten Tage in Aarons Keller auf einen silbernen Becher stieß, der ihm als Zinn verkauft wurde. Aber Aaron hatte auch Schmerzen in seiner geschwollenen Wange, so dass er weder sehen noch nachdenken konnte ...
. . . Oder einen jener lieblichen Träume von Kindern, die auf des Herrn Geheiß der Kraft seiner Lenden entsprossen und ihn Vater nannten ...
Simon entschlummerte. Vor seinem Bett stand jemand und sagte zu ihm: „Morgen wirst du deinem Glücke begegnen, Simon Jumaisohn, gib aber recht acht, dass du nicht blind daran vorübergehst!" Und als sich Simon selbst im Traum erlaubte, daran zu zweifeln, entgegnete die Stimme: „Als Zeichen dafür, dass ich die reine Wahrheit rede, will ich dir das linke Auge ausstechen!"
Im selben Augenblick erwachte Simon und fühlte einen bohrenden Schmerz im linken Auge.
Er war wie versteinert und wagte nicht einmal, die Hand ans Auge zu führen, bis er endlich entdeckte, dass der Schmerz –– und wohl auch der ganze Traum –– von dem grellen Schein eines Prismas stammte, der sein Auge getroffen hatte.
Das ganze Zimmer war wie überschneit von blauweißem Mondlicht. Simon faltete seine Hände, hüllte sich in die Sternendecke und entschlummerte wieder.
Aber am nächsten Morgen war er ganz dumm vor Verwirrung. Es rührte ihn nicht einmal, als die rothaarige, unzüchtige Judith Wagner seine Tür öffnete und nach ihm rief.
Simon ging, wie er das jeden Morgen zu tun pflegte, über den Lumpenmarkt, wühlte mit seinem Stock in den verschiedenen Haufen und schloss kleine geizige Geschäfte mit den alten leckäugigen Juden ab, die zwischen den Lumpen saßen, als seien sie daraus emporgewachsen. Die ganze Zeit hindurch aber hatte er eine Empfindung, als sei er nicht da, wo er sein sollte. Das machte ihn unruhig. Ein Wetterhahn, der sich kreischend auf der Stange drehte, ließ ihn zusammenfahren, ein zusammengefaltetes Stück Papier, das in einem Rinnstein schwamm, verursachte ihm heftiges Herzklopfen, bis er es herausgefischt und untersucht hatte.
Man fragte, was ihm fehle, und er blieb die Antwort schuldig. Missmutig trieb er sich in den Gassen und Straßen umher und starrte nur unverwandt auf die Pflastersteine und den Schmutz herab. Er erinnerte sich jetzt wieder des schönsten Traumes seiner Kindheit: dass er zwischen den Pflastersteinen eine goldene Münze fand, und als er sich bückte, um sie aufzunehmen, war da noch eine, und so ging es weiter, bis die Straße einem goldschimmernden See glich. Und noch nach Jahren konnte er sich den süßen Schauer und den Griff der Finger, die nach den rollenden Münzen haschten, vergegenwärtigen.
Seine armen Plattfüße fingen an zu brennen. An keinem Tage war er so viel gegangen, aber je weiter die Zeit vorschritt, um so eifriger klammerte er sich an die Verheißung des Traumes –– eingedenk der Worte: Herr, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn!
Gleichzeitig schalt er seine fürchterliche Dummheit, die ihn blindlings Schatten nachjagen ließ, und beschloss, zur Strafe an den beiden nächsten Feiertagen auf den Genuss der Kohlsuppe zu verzichten.
Ohne darüber nachzudenken, hatte er sich weit von den Stellen entfernt, wohin er gehörte und wo er zu verkehren pflegte. Er stand vor dem großen, blumengeschmückten Friedhof der Christen. Hinter der Mauer wuchsen Springen, ihr bitterer Wohlgeruch lockte ihn, und er ging da hinein wo er noch niemals gewesen war.
Es war gegen Abend, und es war schon menschenleer. Simon wandelte auf den frisch geharkten Wegen zwischen den Gräbern dahin wie in einem Garten. Ein linderndes Wohlbehagen bereitete ihm die weiche Erde unter seinen breiten Fußflächen.
Auf einer Bank saß eine Frau, zusammengekauert, als schlafe sie, als Simon aber näherkam, richtete sie sich mit einem Schrei auf, erhob die Arme über den Kopf und entfloh zwischen die Gräber. Die Bäume und die ineinander verwobenen Schatten des Abends verbargen sie bald. Simon stand eine Weile da und sah ihr nach, dann ging er hin, um sich auf die Bank zu legen.
Simon Jumaisohn dachte nicht sogleich an den Traum, als er das kleine Bündel öffnete. Aber er dachte auch nicht daran, dass dies der Friedhof der Christen war, mit dem er nichts zu schaffen hatte, und dass er das Kind liegen lassen oder es dem Totengräber übergeben konnte, der gerade ausläutete.
Erst als er mit dem Bündel unter seinem Mantel bis in die schmutzigen Gassen gelangt war, wo er und seine Glaubensgenossen wohnten, ward ihm klar, was er getan hatte.
Es war ein Freitagabend, und die Gassen waren bis zum Gedränge angefüllt mit rufenden und schreienden Menschen. Im Schein der schwelenden Lampen, die die Verkäufer an Stangen über ihren Karren oder Tischen aufgehängt hatten, sah er hunderte von Armen und Händen, die wie Drohungen in der Luft herumfochten. Die Frauen drängten sich hindurch in ihren bunten Nachtjacken mit Daunen in den struppigen Haaren, mit Kindern an der Brust und Kindern auf den Fersen. Die Männer schlampten dahin, diejenigen anschreiend, mit denen sie sprachen, um sich Gehör zu verschaffen. Auf den Karren lagen Fische und Obst und Gemüse in Haufen. Am durchdringendsten war der Geruch von Zwiebeln und Fischen, die in großen kupfernen Kesseln in Fett gekocht und mit großen Kellen aufgefüllt wurden. Unter den Kesseln lohte das Feuer und warf einen roten Flammenschein auf die Gesichter ringsumher und beleuchtete magisch die vielfarbigen Lumpen.
Simon war an diesen Lärm und diese Erregung gewöhnt, die dem Sabbatfrieden voraufgingen, aber als er so vorsichtig mit dem kleinen Leben unter dem Mantel daher gegangen kam, stieg eine sonderbare Furcht wie vor geheimen Feinden in ihm auf. Er hätte gern einen halben Gulden ausgegeben, um von dem Gewühl befreit zu sein.
Unter den Frauen waren viele in Festgewändern, mit Federhüten und leuchtenden seidenen Bändern herausgeputzt. Ihre Münder hoben sich scharlachrot von der milchweißen Haut ab. Das waren die Törinnen, die Geld an sich lockten und es wieder verschwendeten. Simon schüttelte den Kopf. Nein, die klugen Frauen, die waren leicht zu erkennen. Die hielten den Schal dicht um die Schultern zusammen, damit niemand sehen konnte, was sich dahinter befand. Und hatten sie etwas erhandelt, schnell war auch das unter dem Schal geborgen.
Simon war jetzt nahe an seinem Hause. Er musste nur noch durch die Diamantenschleifergasse. Dort war es still. Er sah zu den dunklen Häusern empor, kannte jedes einzelne, dachte an die Schätze, die jetzt hinter Schloss und Riegel schliefen, dunkel in der Dunkelheit. Auch die größten Steine, selbst die, denen man eine Wache gegen die Diebe beigab, vermochten nicht in der Dunkelheit zu funkeln wie ein elendes Johanniswürmchen. Und doch war allein das Anschauen dieser Steine eine Wonne, die man wohl mit der Wonne vergleichen konnte, mit der Moses in das gelobte Land hineinsah.
Und Simons Augen wurden grün und schmal bei dem Gedanken an den kleinen Lederbeutel, den er auf dem bloßen Leibe trug, und der Strahlen von Hitze unter der Haut verbreitete.
Und er seufzte. Hätte er jetzt, wie andere Männer in seinem Alter, ein Weib, o, er würde nicht einen Tag warten, sondern die Steine, Stück für Stück, fassen lassen und ihr den Schatz als Darlehn reichen. Und so oft er sie anrührte, wusste er, dass sie, die seinem Körper all die glückselige Süße schenkte, auch noch in andrer Weise kostbar war, weil sie die Frucht der Arbeit aller seiner Tage barg und in Ehren hielt.
So war es zwischen seinem Vater und seiner Mutter bis zur letzten Stunde gewesen. Und als die Mutter starb, hatte Simon danebengestanden und seinen alten Vater mit zitternden Händen die Ringe von den Fingern der Leiche und die Ketten von ihrem Halse lösen sehen, hatte gesehen, wie er sich abmühte, um die Ringe aus den gelben Ohren zu lösen, die sonst stets von dem Haar bedeckt gewesen waren. Aber Simons Vater hatte in derselben Nacht, während er bei der Leiche wachte und betete, die Steine aus ihrer Fassung gebrochen und aus Leder den Beutel genäht in dem sie seither lagen. Den Beutel, den Simon seinerseits wieder von der Lende des Vaters löste und an der seinen trug.
Simon gedachte der Jahre, die er niemals vergessen konnte, als er, wie sein Vater vor ihm, über den kleinen Flammen in der Schleiferei saß und die Haut hart brannte. Es war ihm eine Lust und ein Schmerz gewesen, dazusitzen mit den grauen Steinen, bis sie weiß wurden, gern hätte er die Nacht mit zur Hülfe genommen. Und noch heute konnte er sich nach diesen Jahren sehnen. Aber der Vater hatte Recht gehabt, der Verdienst war gering, gut für ein Kind, verächtlich für einen Mann.
Simon schlich sich wie ein Dieb in das Haus. Der Dunst von Zwiebeln und kochendem Weißkohl umhüllte ihn . . .
Aber das Kind wollte keine Milch zu sich nehmen. Simon bemühte sich, sie ihm mit einem Löffel einzuflößen. Er kniete nieder und flehte zu dem großen und gerechten Gott seiner Väter um Vergebung für alle Sünden und alle unrechten Gedanken –– und um Hilfe für dies armselige kleine Geschöpf. Das Kind aber schrie sich blau.
Mitten in der Nacht kam Gabrielle Mengs und klopfte an die Tür. Sie war barfüßig. Ohne zu fragen, schlug sie die feuerrote Nachtjacke zurück und legte das Kind an ihre große Brust. Da wurde alles ruhig.
Vor drei Wochen hatte Gabrielle eine schwere Niederkunft durchgemacht, damals verfluchte Simon sie und ihr Geschrei.
Am nächsten Morgen kam die unzüchtige Judith Wagner, wickelte das Kind und gab ihm die Brust. Johannah Salomon und Eva Krische taten wie sie.
Das Kind nahm die Brust von schwarzhaarigen und von rothaarigen, von frischen und welken Frauen. Das Kind nahm die Milch von einer jeden, die ihre Güte anbot.
Und Simon ließ es geschehen, während er sich die Hände rieb und ihm die Tränen aus den Augen rannen. Er hatte das Glück gefunden und war zufrieden wie ein Wurm in seiner Not. Er grämte sich nicht mehr über seine pfeifende Stimme und die Hasenscharte, er schämte sich nicht mehr, weil er am Tage des Gerichts als einer von denen dastehen würde, die das Geheiß des Gesetzes niemals erfüllet haben.
In der ersten Zeit schlief das Kind bei ihm unter der Mutter Sternendecke, und die Frauen kamen abwechselnd und reichten ihm die Brust –– von ganz weit her, aus den Gassen am Marktplatz, kamen sie. Bald aber bettete er sich auf den Fußboden, damit das Kind sich ruhig ausstrecken und sich im Schlaf in dem breiten Bett herumrollen konnte.
Alle erboten sich bereitwillig, die Kleider des Kindes zu waschen. Aber diese Freude ließ Simon sich nicht nehmen. Er stand mit der Sonne auf und verbrauchte Seife und warmes Wasser wie ein Verschwender, wusch und spülte und rang, breitete die nasse Wäsche Stück für Stück aus, besichtigte sie und hängte sie zum Trocknen auf Schnüre, die er in dem offenen Fenster ausspannte. Die Sonne trocknete sie freundlich und schnell. Nur wenn das Wetter schlecht war, musste sich die Wäsche mit der Küche begnügen.
Simon versäumte jedoch die Arbeit nicht über das Kind. Wenn er weg war, lieh er das Kind, das nach seiner Mutter Rachel benannt war, an die Frauen aus. Bald war die Kleine bei Johannah, bald bei Sara, bald in der gemeinsamen Küche und bald in den Kojen bei Gabrielles Kindern.
Zur Abendzeit holte er dann das Kind zu sich hinauf, schob den Riegel vor die Tür, verhängte das Fenster und spielte mit ihm, bis es in seinen Armen einschlief.
Rachel lachte, wenn sich die Farben in den grauen Prismen der Kronleuchter brachen. Sie lernte, aus einem Krug zu trinken und selbst Brot in den Mund zu stopfen, und Simon empfand eine himmlische Freude, dass er ihr helfen konnte und seine Zuflucht nicht mehr zu Fremden zu nehmen brauchte.
Eines Tages lag Rachel vor dem Hause und spielte mit einer toten Maus und einer Glasscherbe, sie erschrak über das Herannahen eines Wagens und schnitt sich mit der Glasscherbe in die Hand, die heftig blutete. Simon kam gerade vorüber. Ihm ward so bange, dass ihm das Herz stillstand.
Seitdem wagte er nicht mehr, sie den Frauen und Kindern des Hauses anzuvertrauen. Deshalb gewöhnte er sich daran, ehe er ausging, sie in das Zimmer einzuschließen und alles so einzurichten, dass sie umherkriechen konnte, ohne sich ein Leid zu tun. Mehrmals im Laufe des Tages guckte er bei ihr ein und brachte ihr kleine Geschenke.
Wenn die Sonne zu Rachel hineinschien, legte sie sich auf den Rücken in den Sonnenstreif und schlief ein, war sie hungrig, so kroch sie nach der Ecke hin, wo Milch in einem Krug fand, und wo feines Weißbrot lag, das Simon heimlich bei einem christlichen Bäcker kaufte. Oder sie schlug mit ihren kleinen Zähnen ein Loch in ein weichgekochtes Ei und sog das Dotter und das Weiße aus.
Immer war da genug für sie zu sehen, genug, womit sie spielen konnte. Simon brachte einen gelben Vogel in einem Bauer mit, und hängte den Bauer unter die Decke, und der Vogel zwitscherte Rachel etwas vor und hüpfte auf seinen Stäben hin und her. Er brachte auch einen großen grünen Vogel mit, der sprechen konnte; vor dem war sie bange, daher musste er ihn wegnehmen. Auf dem Fensterbrett stand ein Glas mit Goldfischen. Ein Bauer mit geschwinden weißen Mäusen wurde an eines der Beine des Bettes festgebunden.
Zur Kohlsuppe hatte Rachel keine Neigung, sie ließ sie zu einer Pfütze aus dem Munde heraussickern, wenn Simon sie ihr einflößen wollte. Da verlor sie auch für ihn ihre Anziehungskraft. Er verschaffte sich ein altes deutsches Kochbuch, worin er von süßen Suppen las, die aus Wasser und Graupen und Fruchtsaft, aus Bier und eingeweichtem Brot bereitet wurden, und er las von Suppen aus Mehl und Milch. Er bereitete sie selbst, tastete sich vorwärts, und es gelang ihm, Rachels Geschmack zu treffen.
Später entdeckte er, dass Rachel den Geruch von Knoblauch nicht leiden konnte. Er dachte daran, auch dieses Leibgericht aufzugeben, wenn er aber mehrere Tage den Geschmack von Zwiebeln entbehrt hatte, ward ihm elend und flau wie nach langem Fasten, und so endete es denn damit, dass er nicht nur sein Brot damit einrieb, sondern mit einem ganzen Haufen voll Zwiebeln unter der Zunge umherging.
Rachel wandte den Kopf ab, wenn er mit ihr sprach, oder sie ballte ihre Hände fest um die Nase zusammen, und Simon hatte das schlechteste Gewissen von der Welt und fastete wieder, indem er sich mehrere Tage, mit dem Knoblauchgeruch begnügte, der gleich einem heißen Atem über dem ganzen Stadtviertel lag.
Eines Tages hatte er sich einen alten Samtmantel eingetauscht. Er trug ihn nach Hause und hängte ihn an einem Nagel auf. Rachel stellte sich unter den Mantel und wich nicht vom Fleck. Er begriff den Grund nicht eher, als bis er die Wollust sah, mit der ihre kleine Nase die daran haftenden Überreste alten Moschusduftes einsog.
Simon ging auf die Straße hinab und streifte umher, bis er einen der strahlenden Läden fand, in denen wohlriechende Sachen verkauft wurden, und er erhandelte für teures Geld ein Flakon mit verdünntem Rosenöl. Nie hatte er Rachels Augen so glänzen sehen, als da er den Deckel von der Flasche schraubte.
Seither hielt Rachel das kleine Flakon in der Hand wie einen Zauberring, der nicht verloren gehen durfte. Und wenn Simon da war, ließ sie ihn herankommen, er mochte nach Knoblauch stinken oder nicht. Sie hielt nur die Flasche vor die Nase.
Rachel liebte die Sonne und blanke Gegenstände, und Simon gönnte ihr alles, was er besaß. Und eines Tages gab er der Versuchung nach, ihr die glänzenden Steine zu zeigen, die sonst wohlverwahrt in dem Lederbeutel an seiner Lende ruhten. Er löste die Schnur und nahm die Steine heraus, legte sie in die flache Hand und ließ sie dort ruhen, so wie man Tauben mit Korn lockt, nur dass er Sonnenstrahlen lockte. Und wenn er die Hand leise hin und her bewegte, sprangen die Funken spielend, hüpfend heraus.
Rachel stand zwischen seinen Knien und lachte über dies Spiel. Dann fingen ihre kleinen Hände an, zwischen den weißen und grünen Steinen zu wühlen, lange und mit Sorgfalt. Sie wählte sich einen aus und blitzschnell steckte sie ihn in den Mund.
Simon ward bange und bat um den Stein, das Kind öffnete die Hand und zeigte ihm lachend, dass er gar nicht da war, er war verschluckt.
Wie gelähmt stand Simon da und begriff, was geschehen war. Er fasste sich nach der Stirn. Er fing an zu weinen.
Für den Stein allein hätte er ein Haus kaufen können und noch viel mehr, für den Stein hätte er viele Jahre lang wie ein Prinz leben können. Den Stein hatte seine Mutter die Hälfte ihres Lebens getreulich um den Hals getragen ...
Endlich fiel es ihm ein, dass der Diamant ihr schaden könne. Stundenlang fuhr er fort, sie zu fragen, ob es auch weh tue, während ein unbekanntes Gefühl von Todesangst in ihm aufquoll. Er saß die ganze Nacht an ihrem Bett, wachte und lauschte den friedlichen Atemzügen die den Lippen des Kindes entstiegen. Und als sie im Schlaf lächelte, weinte er und dankte seinem Gott. Er betrachtete den Stein als verloren, es kam ihm nicht in den Sinn, dass er jemals wieder zum Vorschein kommen könne. Aber seit dieser Stunde ward ihm das Kind teurer denn je. Nie ermüdete er, ihr von dem Stein zu erzählen, den sie verschluckt hatte.
Simon Jumaisohn kam mit einem Spiegel nach Hause, mit einem alten venezianischen Spiegel. Er hatte ihn sich in Gedanken an Rachel eingetauscht. Er stellte den Spiegel vor ihr auf, und das Kind eilte auf den Spiegel zu und stieß sich das Gesicht. Als sie begriff, dass sie es selber sei, war sie beglückt.
Sie verbrachte Stunden vor dem Spiegel, zu ihrem Bilde sprechend. Sie liebkoste es. Sie starrte in ihre eigenen Augen, bis ihre Pupillen wuchsen und wuchsen, bis sie endlich hintenüber sank, durch ihren eigenen Blick in hypnotischen Schlaf gehüllt.
Simon durfte ihr im Spiegel zulächeln, aber nur im Spiegel. Er durfte ihr übers Haar streichen . . im Spiegel. Er durfte im Spiegel Rachels kleinen, roten Mund küssen. Sie kniff ihn zusammen. Selbst im Spiegel wand sie sich unter seinen Liebkosungen.
Und wenn Simon die Spiegelfläche mit seinem Bilde berührt hatte, rieb sie noch lange nachher das Glas mit einem seidenen Tuch. Des Nachts deckte sie den Spiegel zu, wie sie auch ihr eigenes Gesicht bedeckte, wenn sie schlief.
Im Spiegel sah sie, dass ihr Haar wuchs, und dass ihre Augen größer wurden.
Sie wurde so groß, dass sie am Fenster sitzen und auf die Straße hinabsehen konnte. Sie schnitt den Kindern im Hause gegenüber Gesichter zu. Sie warfen Kohlstücke und Fischabfall hinab. Es fiel in einen nassen Brei von stinkendem Schmutz. Die Kinder drohten Rachel mit geballten Fäusten. Sie wandte ihnen den Rücken.
Sie ließ das Haar, wenn es stürmte, wie einen Rauch durch das geöffnete Fenster wehen. Es belustigte sie, die seine, kribbelnde Kälte an der Kopfhaut zu fühlen. Und zu wissen, dass das Haar ihr nicht weglaufen konnte. Es war ihr Gefangener, so wie die weißen Mäuse und die Vögel unter der Decke.
Weiterhin sah sie die grüne Gracht. An Sommertagen sammelte sich ein verfaulter Schleim auf dem lauwarmen Wasser.
In Rachel stieg ein süßer kleiner Gedanke auf: sie wollte das Brotmesser nehmen und Simon Jumaisohn den Hals abschneiden, aber ihre Finger hatten einen Abscheu, ihn zu berühren.
Er kaufte seine Wäsche und schöne Kleider für sie, sie ward deswegen nicht dankbarer.
Und dann kam sie in die Schule in der Taubenstraat. Sie stopfte sich Watte in die Nasenlöcher und auf die Watte hatte sie von dem wohlriechenden Wasser geträufelt, das Simon für sie kaufte. Sie hüllte das Kleid fest um ihre Glieder, um nur nicht die anderen Kinder zu berühren.
Simon holte sie aus der Schule ab. Es freute ihn, von der Behändigkeit ihres Verstandes zu hören. Er nahm sie mit zu den fremden Schiffern in den Schuten auf der Zwanengracht, und sie besaß eine begehrliche Auffassung für ihre Sprache. Mit Geschenken mussten sie ihr Lächeln erkaufen.
Sie selber fand den Weg in eine der großen Diamantschleifereien, wo ihr die Männer scherzend Diamantstaub auf ihre Fingerspitzen gaben. Sie vergaß nicht, dass sie Simons großen, kostbaren Stein im Magen hatte.
Oft dachte sie daran, mit einem der Schiffe davon zu segeln, aber alle Schiffer hatten hässliche Hände, so wie Simon, das hielt sie zurück.
Erst im vierzehnten Jahr fing sie an, sich allein aus dem Judenviertel herauszuwagen. Die großen Marktplätze liebte sie und die Springbrunnen. Eines Tages fand sie den Weg in ein Haus, das voll von Bildern hing. Seither ging sie jeden Tag dahin.
Einer von den jungen Malern sah sie und nahm sie mit in sein Atelier. Da war ein Glasdach. Die Sonne schien. Da befand sie sich wohl.
Rachel lag nackend auf einem Tigerfell und ließ sich malen. Es war Stille in ihrem Blut. Das Sonnenlicht bereitete ihr stärkere Wonnen als die Liebkosungen des jungen Malers. Und doch hatte er ihr Gefallen erregt. Aber die Klugheit, die ihr der Aufenthalt im Ghetto eingeflößt hatte, behielt die Übermacht, und aus Berechnung blieb sie keusch.
Seine Freunde sahen sie, und sie beherrschte sie mit ihrem Blick. Der Spiegel hatte sie seine Macht gelehrt.
Eines Tages brachten sie eine alte Wahrsagerin mit, sie sollte ihnen ihren Ruhm prophezeien. Auch Rachel wollte über ihre Zukunft hören. Die Frau nahm ihre Hand, ließ sie gleich wieder sinken, legte sich nieder und lauschte ihrem Herzschlag und machte dann die jungen Leute ganz wirr mit ihren Reden, dass Rachel ein Vampir sei, der ihr Blut aussaugen würde.
Rachel ging auf die Rolle ein und tat das ihre, um sich mit einer Glorie von Unheimlichkeit zu umgeben, so dass die jungen Leute sie mit schreckgemischter Leidenschaft betrachteten.
Es war ihre Absicht, sich, wenn die Zeit gekommen war, demjenigen zu verkaufen, der am meisten bot.
Simon war dies alles nicht verborgen. Er folgte ihr wie ein Hund, ohne ihr das geringste Hindernis in den Weg zu legen. Des Abends ging sie oft ins Theater oder in die Oper. Das starke Licht, die Festfreude entsprachen dem Bedürfnis ihrer Sinne.
Sie ging aber zu Fuß bis an die offenen Plätze, dort erst nahm sie einen Wagen. Wollte sie zurück, so ließ sie den Wagen wieder halten, ehe er das Judenviertel erreichte, denn sie hatte einmal die Verachtung des Kutschers bemerkt, als er vor Simon Jumaisohns Wohnung in der Gasse hielt.
In diesem einen Punkt war er unerbittlich. Selbst Rachel vermochte ihn nicht dazu zu bewegen, den Stadtteil seiner Väter zu verlassen.
Die Erzählung des Richters.
Was will ich doch hier in der Gegend meiner Kindheit, wo alles für mich verändert ist?
Was will ich hier?
Ich sitze in meinem kleinen Zimmer in dem kleinen Gasthof an dem abfallenden Marktplatz.
Niemand kommt, um mich aufzusuchen, niemand erkennt es an, dass ich hierhergehöre. Meine Kindheitsgefährten sind ins Tal hinabgegangen, haben sich über die ganze Welt verbreitet, oder sie haben die Geschäfte ihrer Väter übernommen. Der eine steht der Schmiede vor, ein anderer baut die schweren Kutschen, die man noch in gewissen Teilen von Wales benutzt, und ein dritter ist Schulmeister geworden.
Mich grüßt man nicht mehr. Man glaubt ich sei ein Fremder, und ich kläre diesen Irrtum nicht auf.
Was will ich denn hier?
Was ich will? Ich habe es ja gesagt. Oder habe ich vergessen, es zu sagen? Ich will es alles niederschreiben, langsam, bis auf das Allerletzte.
Und dann, hinterher?
Hinterher? hinterher ... weiß ich es?
Dorthin, wo meine Mutter hinabgebettet wurde, gehe ich jeden Abend. Ich stehe auf dem schräg abfallenden Friedhof, wenn die Sonne sinkt und warte auf ein Zeichen von meiner Mutter.
So viele Jahre lang war sie vergessen, kaum entsinne ich mich mehr ihres Antlitzes, ihrer Stimme, aber jetzt taucht sie auf wenn die Dunkelheit sich herabsenkt steigt aus dem Grabe wie ein Nebel, eine dunkele, zitternde Erinnerung. Meine Mutter ...
Was für Gedanken waren es, mit denen sie umherwanderte, als sie uns unter dem Herzen trug? Verbarg sie einen Kummer, den wir einsogen, ehe wir jemals das Licht des Tages erblickten? Litt ihr Gemüt unter einem Zwiespalt, einer Angst, einer Schwäche, die wir als Erbteil übernahmen? Nichts weiß ich hierüber.
Und dann gehe ich nach Hause.
Nach Hause, sage ich. Ja, heim zu dieser kleinen Kammer aus Holz, wo klagende Töne erklingen, wenn der Abendwind über dem hohen Abhang herabsinkt. In dieser Kammer sitze ich allein und denke zurück.
Aber weshalb schreibe ich dies nieder? Wer soll Nutzen daraus ernten?
Ich habe von dem Leben, nein, von dem Tode habe ich gelernt, dass alles, was es in der Welt Schlechtes gibt, von den Menschen im Namen der Liebe und kraft der Liebe gegeneinander ausgeübt wird.
Aber mein Fall so nennt man ja die Gewalttätigkeit des Schicksals gegen den einzelnen mein Fall ist einzig in seiner Art, und niemand kann eine Lehre daraus ziehen. Und doch fahre ich fort.
Es ist ein Meer, das geleert werden muss. Und ich lege mich am Strande nieder und schöpfe mit meiner hohlen Hand ...
Ich verteidige nicht, ich erkläre nicht, ich schreibe nur nieder, was geschehen ist.
Und ich glaube, dass in dem endlosen Raum, wo die Seelen suchend umherschwirren, um die Ruhe der Ewigkeit zu finden, meine Worte von denen vernommen werden, für die sie geschrieben sind. Sie werden sich nähern und lauschen ... sich nähern gleich wilden Tieren, die während eines Gewitters sich den Wohnungen der Menschen nahen, um Schutz in ihrer Herzensangst zu suchen.
Allan und Rachel . .
Im Atmen der Nacht höre ich euer klagendes Seufzen. In den Wolken des Himmels sehe ich euer friedloses Streifen. In den tiefen Wassern erkenne ich die Verzweiflung in euern Herzen!
Allan und Rachel ... ihr seid davongegangen. Ich allein blieb zurück.
Ich Menschenkind, das einsamer ist als die Wüstenei.
Schwer ist mein Joch und lang ist mein Tag ...





























