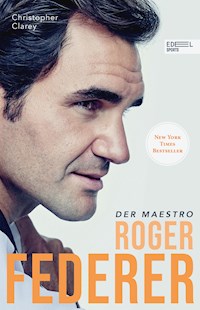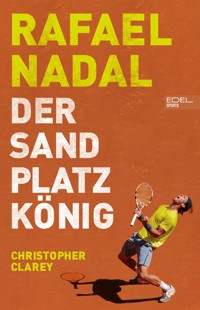
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edel Sports - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Zum Karriereende eines der größten Tennisspieler unserer Zeit blickt Bestseller-Autor Christopher Clarey auf die beeindruckende Bilanz von Rafael Nadal bei den French Open von Paris zurück. Dort, im legendären Tennisstadion Roland Garros, war der spanische Ausnahmeathlet lange Jahre über unbezwingbar. 14 seiner insgesamt 22 Grand-Slam-Titel gewann Nadal auf dem roten Sand von Paris – eine historische Bestmarke, der Clarey mit diesem Buch ein kongeniales Denkmal setzt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 597
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhalt
1Das Denkmal
2Der Kodex
3Die Waffe
4Das Material
5Der Besuch
6La Primera
7Die Wegbereiter
8Der Durchmarsch
9Die Niederlage
10Die Gründer
11Der Gegenschlag
12Die Klassiker
13Die Sprache
14Die Rituale
15Die Durststrecke
16La Décima
17Das Königreich
18Der Herbst
19La Última
20Die Ringe
Rafael Nadals Grand-Slam-Titel
Kapitel 1
DAS DENKMAL
Rafael Nadal nahm zum ersten Mal seit 19 Jahren nicht an Roland-Garros teil und zog dennoch die Massen an.
Tausende Fans strömten zum Beginn der French Open 2023 durch das Eingangstor und die breite Steintreppe hinunter, wo eine 3 Meter hohe, glänzende Edelstahlstatue des Spaniers in Aktion für viele der erste Selfie-Stopp war.
Da „schwebte“ er entgegen allen Erwartungen aus reiner Willenskraft und schlug der Schwerkraft ein Schnippchen.
Warum wurde ausgerechnet ein Spanier in der Kathedrale des französischen Tennis verewigt? Und warum wurde bereits im Jahr 2021 eine Statue für einen Champion errichtet, der – zu diesem Zeitpunkt – noch aktiv war?
Aber die eigentliche Frage lautete natürlich: Wie war es möglich, dass jemand das härteste Tennisturnier der Welt 14-mal gewinnen konnte?
„Für mich ist das die erstaunlichste Bilanz in der Geschichte des Individualsports“, so Feliciano López, Nadals Freund und ebenfalls spanischer Tennisstar. „Einen Grand-Slam-Titel zu gewinnen, davon träumt jeder Tennisspieler. Aber 14-mal denselben Titel zu gewinnen, davon träumt man nicht mal. Das ist verrückt.“
Entgegen der landläufigen Meinung ist Rafael „Rafa“ Nadal dem Kult um seine Person nicht ganz abgeneigt. Im Rafa-Nadal-Museum, das 2016 in der Rafa Nadal Academy in seiner Heimatstadt Manacor auf Mallorca eröffnet wurde, gibt es die volle Dröhnung Selbstverherrlichung, die im krassen Widerspruch zu Nadals bescheidenem Image steht.
Bei dieser French-Open-Statue aber hatte der Star seine Finger nicht im Spiel. Seine Erfolge an diesem Ort waren einfach derart gigantisch, dass die logische Reaktion nur ein Denkmal sein konnte. In Frankreich fügte man sich in das Unvermeidliche.
„Es stimmt schon, auch wenn ich es nicht gerne sage, aber was ich in Paris erreicht habe, ist etwas Besonderes“, räumte Nadal ein. „Ich bin dankbar dafür, und ich verstehe die Geste. Ich habe etwas erreicht, das man sich nur schwer vorstellen kann.“
Und so ist sein Abbild heute ein integraler Bestandteil der Roland-Garros-Landschaft und ihrer Rekorde. Die beeindruckende Statue ist ein Werk des spanischen Künstlers Jordi Díez Fernández, sie hat sich zu einer regelrechten Pilgerstätte entwickelt. Dies ist nicht der Louvre. Es gibt keine Absperrungen, keine roten Samtseile, keine Alarmanlage. Hier kann man der Kunst ganz nah kommen. Ich habe einen weiblichen Fan den stählernen Fuß Nadals küssen sehen und viele andere, die fröhlich die peitschende, über die Schulter ausschwingende berühmte Vorhand des Stars – und der Statue – imitierten.
Kevin Wu, ein junger US-Amerikaner, dem seine Eltern zum College-Abschluss Tickets für die French Open schenkten, war einer dieser Pilgernden, die sich um das Denkmal versammelten.
„Ich finde, die Statue ist absolut berechtigt, weil er hier so oft gewonnen hat. Irgendwie ist das Rafas Turnier.“
Es war zweifellos sein Turnier – und auch sein Belag. Der zermahlene Ziegelstein bei den French Open und in anderen Nadal-Hochburgen wie Monte Carlo, Barcelona und Rom ist grobkörnig und tückisch. Die weite Sandfläche wird am Ende eines jeden Satzes abgezogen. Sie entlarvt den Dilettanten und Nachzügler und belohnt den Veteranen, vor allem den Sandplatzwühler Nadal, der auf diesem Belag aufgewachsen ist.
Für Nadal ist Sand, was Wasser für Michael Phelps oder Luft für Simone Biles ist: ein natürlicher Lebensraum, wie geschaffen für den Sieg in Serie. Dabei war Sand gar nicht der Lieblingsbelag des jungen Nadal, er war und wird dennoch für immer sein bester Belag bleiben.
Im Juni 2023 kehrte ich zu den Anfängen zurück und besuchte Nadals Jugendplätze. Ich verließ Paris während der French Open, flog für ein paar Tage in den Süden nach Mallorca und wirbelte auf den bescheidenen Plätzen, auf denen Rafa am Rande seiner Heimatstadt Manacor Tennis zu spielen begann, ein wenig roten Sand auf. Beim Streifzug durch die Gänge und Umkleidekabinen des Club Tenis Manacor, der schon bessere Tage gesehen hat, kommt man nicht umhin, sich zu fragen: Wie gut standen die Chancen, dass von hier ein großer Champion kommt?
Sie standen sicherlich schlecht, aber vielleicht doch nicht ganz so schlecht, wenn man bedenkt, dass Mallorca, eine Insel mit weniger als eine Million Einwohner, wenige Jahre vor Nadal einen weiteren Nummer-eins-Spieler hervorbrachte: Carlos Moyá. Ein verblichenes Banner mit dem Konterfei der beiden Jungs aus der Gegend, die es zu etwas gebracht haben, flatterte über den Plätzen des Clubs.
„Als kämen zwei Weltranglistenerste hintereinander von Rhode Island“, staunte der ehemalige US-Tennisstar und spätere Sportanalyst beim TV-Sender ESPN James Blake.
Viele Dinge mussten zusammenkommen, um Nadal zu seinem Riesenerfolg zu verhelfen: ein Onkel Toni, der sich mit Tennis auskannte und mit der Familie unter einem Dach wohnte, ein weiterer Onkel, Miguel Ángel, der ein Weltklassefußballer war, die Eltern Sebastián und Ana María, die ihrem Sohn Spielraum ließen, Carlos Moyá als Vorbild und Carlos Costa als Agent und gelegentlicher Hitting Partner und vor allem der Junge selbst, der über das ideale Temperament verfügte, um sein außergewöhnliches Talent und seine überbordende Energie optimal zu nutzen.
„Es ist der perfekte Sturm“, urteilte Emilio Sánchez, der ehemalige spanische Tennisstar und spätere Trainer.
So viel hätte Nadal vom Kurs abbringen können: Verletzungen, Familiendynamiken, Fußball, das große Geld, Langeweile, Druck, die azurblaue Verlockung des nahen Mittelmeers jenseits aller sandrot gefärbten Socken, schweißgetränkten Bandanas und täglichen Entbehrungen.
Wie gut standen die Chancen?
Ich weiß noch, wie mir ähnliche Gedanken durch den Kopf gingen, als ich das bescheidene Skiresort Kopaonik in Serbien besuchte, wo der spätere Erzrivale Nadals, Novak Djokovic, seine erste Tennisstunde direkt gegenüber der Familienpizzeria bekam – so wie Nadal seine erste Stunde von Onkel Toni direkt gegenüber der Familienwohnung in Manacor erhielt.
Als ich 2010 auf diesen serbischen Hartplatz trat, der rissig und vernachlässigt dalag, konnte ich mir leicht vorstellen, dass alles auch ganz anders hätte kommen können. In Djokovics Familie gab es keine ambitionierten Tennisspieler, nur Skifahrer. Wären diese Plätze nicht genau an dieser Stelle gebaut worden und hätte Jelena Gencic, die charismatische Tennislehrerin mit einem ausgezeichneten Auge für Talente, nicht gerade in jenem Sommer auf diesen abgelegenen Plätzen in den serbischen Bergen Tennisstunden gegeben, hätte Djokovic nie den frühen Start und die soliden Grundlagen bekommen, um ein zukünftiger Tennisprofi zu werden.
Gencic jedoch war zufällig dort und auch bereit, den jungen Novak auf unbekanntes Terrain zu führen. Wie sich herausstellte, war dieser Typ mit den borstigen Haaren genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort, und er schaffte es trotz Krieg, wirtschaftlicher Not und Isolation bis an die Spitze der Tenniswelt.
Wenn man Nadal besser verstehen möchte, muss man seinem Beispiel folgen. Man muss schwitzen und leiden, die Extrameile gehen, auch an den freien Tagen. Als ich dieses Buch schrieb, fühlte ich mich wie Rafa zu Ritualen hingezogen – Spaziergänge am frühen Morgen, Kaffeemahlen, Atemübungen –, um mich von der Zielgeraden abzulenken. In der Art von Method Acting entwickelte ich ein Method Writing.
Je mehr man über Nadal erfährt, desto weniger leicht möchte man es sich machen, möchte man die Spreu vom Weizen trennen. Als ich das Buch Der Maestro über Roger Federer schrieb, war mein Idealzustand definitiv ein Flow-Zustand. Wenn man über Nadal schreibt, hat man das Gefühl, die Anstrengung körperlich spüren zu müssen, das Brennen, während man die Erzählung Ziegelstein für Ziegelstein aufschichtet und gelegentlich an seiner Jogginghose herumzupft, damit es am Laptop rundläuft.
Lange vor Nadals Aufstieg reiste ich in einen anderen Teil Spaniens – in das verschlafene Monzón in der Region Aragonien – und strich mit der Hand an der Wand der Fabrik entlang, wo Conchita Martínez ihre Liebe zum Tennis entdeckte. Wände haben schon so manche Tenniskarriere ins Rollen gebracht, und die schüchterne Conchi schlug stundenlang gegen diese Wand und zeigte bald so vielversprechende Leistungen, dass ihre Familie, die nur über geringe Mittel verfügte und so gut wie nichts über Tennis wusste, sie schweren Herzens im Alter von zwölf Jahren nach Barcelona ziehen ließ, damit sie dort trainieren konnte. Martínez war die erste Spanierin, die Wimbledon gewann, als sie im Finale die alternde Rasenkönigin Martina Navratilova bezwang. Später beriet sie als spanische Davis-Cup-Kapitänin Nadal und seine Teamkollegen.
„Natürlich gehört auch eine Portion Glück dazu, aber ich glaube, das Wichtigste ist Leidenschaft für das, was man macht. Und es zu genießen“, sagte mir Martínez. „Ich erinnere mich, dass ich damals einen Schläger in die Hand nahm und ihn nie wieder loslassen wollte, und ich bin mir sicher, dass Rafa nicht nur eine Leidenschaft für Tennis hat, sondern auch leidenschaftlich gern lernt, um sich ständig zu verbessern. Das ist der Schlüssel. Natürlich ist Rafa ein Champion auf einem anderen Niveau. Was er alles erreicht hat, ist ein wahrgewordener Traum, und man kann nur ‚Wow‘ sagen. Aber wenn du anfängst, weißt du nie, wohin es dich führen wird.“
Noch eine weitere, viel längere Reise habe ich unternommen, in die Außenbezirke von Harare in Simbabwe, auf eine familiengeführte Avocado-Farm, die in Wahrheit eine familiengeführte Tennisfabrik war. Der Besitzer war ein grauhaariger, oftmals barfüßiger Mann namens Don Black. Er hatte in seiner Jugend in Wimbledon gespielt und war von dieser Erfahrung so berauscht, dass er sich sein eigenes kleines Wimbledon im ländlichen Afrika schuf und seine eigenen Champions heranzog.
Nach und nach legte er vier Rasenplätze an, die er hegte und pflegte, er hing ein Schild mit derselben Zeile aus dem Gedicht „If“ von Rudyard Kipling an den Zaun, das auch in Wimbledon über dem Spielereingang zum Centre Court zu lesen ist – auf Deutsch übersetzt etwa: „Wenn du Triumph und Niederlage hinnimmst / Und beide Betrüger gleich willkommen heißt.“
Don und seine Frau Velia hatten drei Kinder – Byron, Wayne und Cara –, die trotz der politischen Unruhen in ihrer Heimat auf der Tour und, was besonders symbolträchtig ist, in Wimbledon spielten. Byron und Cara schafften es auf Platz eins der Doppel-Weltrangliste, und auch wenn es keinem der Geschwister gelingen sollte, Dons Traum von einem Sieg im Herren- oder Dameneinzel im All England Club zu realisieren, wurden sie dem Traum doch gerecht: Cara gewann 1997 das Juniorinneneinzel und 2004 das Mixed mit Wayne; Byron erreichte das Viertelfinale im Einzel und das Finale im Herrendoppel.
Wie gut standen also die Chancen?
Nadal, so schließe ich aus unseren vielen Gesprächen im Laufe der Jahre, hat nicht viel Zeit und Energie darauf verwendet, um über diese Frage nachzusinnen.
Eine seiner Stärken ist seine Fähigkeit, im Moment zu bleiben. Das war schon immer das Ziel eines jeden Tennisspielers, es war aber auch schon lange vor dem Zeitalter der sozialen Medien schwer zu erreichen. Nadal lernte, sich durch Routinen und Rituale auf das Wesentliche zu konzentrieren; er lernte, das Komplexe durch die Macht der Gewohnheit zu simplifizieren. All das gelang ihm auf eine sehr natürliche Art und Weise. Er wuchs an Herausforderungen, ganz gleich, ob real oder eingebildet, aber ein Grübler war er nicht. Seine ungeheure nervöse Energie und sein Wettbewerbswille trieben ihn voran, und wenn er doch mit hochgezogener Augenbraue nachdenklich wurde, erschien ein Rückblick nur von begrenztem Wert.
Der einzige Punkt, der noch einen Unterschied machen kann, wenn man mit seiner Schuhspitze den Sand von der Grundlinie wischt, sich Haarsträhnen hinters Ohr klemmt, den Schweiß aus dem Gesicht wischt und den Ball vor dem Aufschlag aufspringen lässt, ist der Punkt, den man gleich spielen wird.
Ein weiterer Erfolgsfaktor dürfte gewesen sein, dass Nadals Wurzeln nicht nur seine Wurzeln sind. Sie sind auch seine Gegenwart. Er muss keine nostalgische Pilgerfahrt mit Kamerateams und Chronisten zu einem bescheidenen Ort unternehmen, an dem alles begann: nach Manacor mit seinen 45.000 Einwohnern und den Sandplätzen am Rande der Stadt. Er fährt ständig daran vorbei, auch wenn er nur noch selten anhält. Seine hochmoderne Tennisakademie befindet sich in der Nähe. Die Wohnung, in der er seine Kindheit verbrachte, befindet sich noch näher, und sein Traumhaus auf den Klippen, mit einer in den Felsen geschlagenen Bootsrampe im James-Bond-Stil, steht im Ferienort Porto Cristo, nur zwölf Kilometer von Manacor entfernt; sie dient dem Nadal-Clan schon lange als Zufluchtsort.
Wenn man zu Recht davon spricht, dass Nadal am Boden geblieben ist, dann ist das der Boden. Er wurde in Manacor geboren, wuchs dort auf, und abgesehen von einem Jahr mit Höhen und Tiefen in einem Internat in der mallorquinischen Hauptstadt Palma ist er in Manacor geblieben, hat eine Einheimische geheiratet – María Francisca Perello – und ist ein Einheimischer geblieben. Er kehrte meist so schnell wie möglich von seinen Reisen, die ihn weit über seine Heimatinsel hinaus bekannt gemacht haben, hierhin zurück. Als Teenager lebten er, seine Eltern und seine jüngere Schwester Maribel mit den Großeltern und Toni Nadals Familie in einem Wohnhaus im Zentrum von Manacor. Jede Generation und Familie hatte eine eigene Etage. Das Gebäude lag an einem der Hauptplätze des Städtchens, auf dem sich auch die Hauptkirche befindet, die Nadal von seinem Balkon aus direkt vor Augen hatte. Sobald er aus der Haustür trat, fand er sich in einer Gemeinschaft voller vertrauter Gesichter, Nachbarn und Ladenbesitzer wieder, die er höflich grüßte; eine Gemeinschaft, in der Angeberei verpönt war. Diesen tief verwurzelten Sinn fürs Bodenständige brachte er auch in die Tenniswelt ein, sodass auf den Turniergeländen von Monte Carlo, Rom und Roland-Garros so etwas wie ein dörfliches Flair mit ihm aufkam.
Mallorca blieb seine Heimat. Dort begann seine Geschichte, dort entwickelte er sich und dort wird er wohl auch weiterhin leben. Für Nadal, der Kontinuität und Loyalität schätzt, scheint es irgendwie passend, dass der grobkörnige Belag, auf dem er unter tío Toni in die Lehre ging, der Belag ist, mit dem er für immer in Verbindung gebracht werden wird.
Das Spiel auf Sand entspricht Nadals Werten, und sicherlich sind einige dieser Werte auch auf den Sand zurückzuführen: die Arbeitsmoral, der Wille, es sich nicht zu einfach zu machen, die Selbstverständlichkeit, nach einer Trainingseinheit den Platz für die nächsten Spieler mit dem Schleppnetz abzuziehen, um die Oberfläche wieder zu glätten.
Und doch war Nadal natürlich auch nicht einfach nur ein Sandplatzspezialist. Er lehnte dieses Etikett bereits in seinen ersten Jahren auf der Tour ab, als Technik und Aufschlag nicht unbedingt darauf schließen ließen, dass er eines Tages durch die Decke gehen würde. Er gewann spektakulär und häufig auch auf den anderen, schnelleren Belägen des Profitennis – und entwickelte sich so zu einem der größten Sportler aller Zeiten.
„Dass er eine großartige Karriere vor sich hatte, erkannte ich spätestens 2005, als er das erste Mal die French Open gewann“, sagte mir Brad Gilbert, der Andre Agassi, Andy Murray und Coco Gauff trainiert hat. „Rafa verlor früh in Wimbledon, und dann war das Turnier in Kanada in diesem Jahr unglaublich schnell. Ich habe seitdem keinen so schnellen Hartplatz mehr gesehen. Er hat dort im Finale Andre geschlagen, und da erkannte ich: Dieser Typ ist eben nicht nur ein Sandplatzspieler. Er ist ein absolut großartiger Tennisspieler, der sich an alles anpassen kann.“
Nadal war talentiert, ehrgeizig und vielseitig genug, um zweimal auf Rasen Wimbledon und sechs weitere Grand-Slam-Titel auf den Hartplätzen der Australian Open und US Open zu gewinnen.
Der rutschige rote Sand aber war sein sicherer Hafen, hier kamen seine vielfältigen Fähigkeiten und seine kämpferische Einstellung voll zur Geltung. In einem Sport, der im Laufe der Jahrzehnte an Dynamik aufgenommen, aber an Raffinesse verloren hat, belohnt Sand nach wie vor Geduld und Spielaufbau. Er erfordert eine spezielle Beinarbeit, weil die Spieler je nach Situation in die Schläge hineinrutschen müssen.
„Ich kenne Trainer, die ihren Spielern raten, bei jedem Ball auf Sand zu rutschen, aber das stimmt einfach nicht“, äußerte sich dazu Michael Chang, der Überraschungssieger der French Open 1989.
Die Profis können mittlerweile auf jedem Belag rutschen, um ihre Reichweite zu vergrößern und ihre Verteidigung zu stärken. Man muss sich nur Novak Djokovic vor Augen führen, der in offener Schlagstellung fast im Spagat in eine beidhändige Rückhand rutscht. Auf dem festen Untergrund eines Hartplatzes kann ein Spieler jederzeit loslaufen und die Richtung wechseln. Auf Sand rutscht man in Erwartung eines Richtungswechsels und timt den Ballkontakt mit dem Ende des Rutschvorgangs. Rutscht man zu früh oder zu spät los, ist die Synchronisation im Eimer.
Reine Geschwindigkeit, die Nadal einst im Überfluss besaß, reicht nicht aus. Die Choreografie muss perfekt sein. Und Nadal startete und stoppte mit Präzision und Kraft. Er war kein Ballerino in Turnschuhen wie der geschmeidig-elegante Roger Federer, Nadals einstiger Rivale. Doch in Nadals Raubtierstyle lag eine eigene, sehr majestätische Art.
„Seine Bewegungsabläufe auf Sand sind einfach besser als die von allen anderen“, sagte Roger Federer einmal zu mir. „Weil er auf beiden Seiten eine offene Schlagstellung hat, ist es, als würde er zwei Vorhandbälle von der Grundlinie aus spielen. Ich kann das nicht, also verliere ich hier und da ein, zwei Meter. In dieser Hinsicht hat er einen riesengroßen Vorteil. Ich weiß nicht, wie er das hinbekommen hat, es ist jedenfalls ungemein schwierig.“
Nadals explosive und gleichzeitig äußerst kontrollierte Bewegungen sind einer der Gründe für die vielleicht phänomenalste Leistung im Individualsport des 21. Jahrhunderts. Man möchte sich mit der flachen Hand gegen die Stirn schlagen.
Der moderne Tennissport hat eine lange Geschichte. Wimbledon etwa wurde erstmals im Jahr 1877 ausgetragen. Als Nadal 2005 in Paris die Tennisbühne betrat, lag der Rekord für die meisten gewonnenen Titel im Herreneinzel bei den French Open, dem wichtigsten Sandplatzturnier der Welt, bei sechs. Dieser Rekord war fest in der Hand von Björn Borg. Seit Borgs frühzeitigem Rücktritt Anfang der 1980er-Jahre haben es sein schwedischer Landsmann Mats Wilander, der Brasilianer Gustavo Kuerten, Ivan Lendl und Novak Djokovic geschafft, immerhin je drei zu gewinnen.
„Niemand wird es noch einmal schaffen, sechs zu gewinnen“, äußerte sich der ehemalige Weltranglistenerste Ilie Nastase Anfang der 1990er-Jahre mir gegenüber. „Das war eine andere Zeit.“
Tatsächlich hat Nadal die Rekordzahl von Borg mehr als verdoppelt!
„Genauso wie es für einen normalen Profi schwer vorstellbar sein dürfte, wie ich oder Guga Kuerten oder Ivan Lendl drei gewonnen haben, ist es für uns schwer vorstellbar, wie Rafa 14 gewonnen hat“, so Wilander. „Ich kann es mir nicht erklären. Diese absolute Hingabe, wenn man weiß, dass eine Niederlage unglaublich wehtun wird, aber man dennoch bereit ist, dieses Risiko immer und immer wieder auf sich zu nehmen. Das ist etwas, das wir so nie hatten.“
Der französische Tennisveteran Nicolas Mahut weiß, was es heißt, Rekorde zu brechen. Er bestritt 2010 in der ersten Runde von Wimbledon das bisher längste Match der Tennisgeschichte gegen John Isner und verlor ein stakkatoartiges, von Aufschlägen dominiertes Spiel, das sich über drei Tage mit insgesamt elf Stunden und fünf Minuten Spielzeit zog, mit 70:68. Die Regeln wurden im Anschluss bei den Grand-Slam-Turnieren geändert, um solche Marathon-Finalsätze auszuschließen.
Trotz dieser Extremerfahrung haute Nadals Rekord Mahut wirklich um. „Wenn man 14-mal bei Roland-Garros spielt, hatte man eine gute Karriere“, äußerte er sich in der französischen Sportzeitung L’Équipe. „Wenn man dort 14 Matches gewinnt, ist das nicht schlecht. Wenn man es 14-mal in die zweite Woche schafft, gehört man zu den Großen. Aber wenn man 14-mal den Titel holt, ist das einfach unfassbar. Dafür gibt es keine Worte.“
Betrachtet man Nadals unglaubliche Leistungen in Paris über all die Jahre, scheint es nicht undenkbar, dass er auch im Ruhestand einen Weg finden wird, sich noch den 15. Titel zu sichern …
„Sie werden nie wieder jemanden erleben, nicht zu Ihren Lebzeiten und auch nicht zu denen Ihrer Kinder, der 14-mal ein Grand-Slam-Turnier gewinnt“, prophezeite der rumänische Tennisstar der 1970er-Jahre Ion Tiriac, einer der einflussreichsten und scharfsinnigsten Persönlichkeiten des Tennissports.
Ebenso unwahrscheinlich ist es vielleicht auch, dass jemand zu unseren Lebzeiten Djokovics Rekord an Grand-Slam-Titeln im Herreneinzel antasten wird – wie viele es auch am Ende sein werden. Das Besondere an Nadals French-Open-Rekord ist aber diese tiefe Verbindung eines Spielers zu einem Belag – und die Fähigkeit, jedes Frühjahr aufs Neue reinen Tisch zu machen.
„Er war so bescheiden, jedes Jahr wieder bei null anzufangen“, sagte der französische Tennisstar Gilles Simon, ein Meister der Taktik und Zeitgenosse Nadals.
Nadal kam bei den Grand-Slam-Titeln nah an Djokovic heran, aber an Nadals Roland-Garros-Rekord kam niemand auch nur annährend heran. Selbst seine beiden größten Rivalen erreichten keine ähnliche Dominanz auf ihrem jeweils besten Belag. Federer, genial auf Rasen, gewann Wimbledon bis zu seinem Rücktritt 2022 rekordverdächtige achtmal. Djokovic brilliert auf allen Belägen, vor allem aber auf Hartplätzen; er konnte – Stand Anfang 2025 – Wimbledon bisher siebenmal und die Australian Open rekordverdächtige zehnmal gewinnen. Ohne Nadals Erfolge in Paris hätte er für diese Leistung vermutlich noch deutlich mehr Aufmerksamkeit erhalten.
„Von allen Statistiken aus dieser großartigen Ära des Herrentennis sind es vor allem Rafas 14 French-Open-Siege, die die Leute in der Umkleidekabine verblüfft haben“, resümierte John Lloyd, einer der führenden Trainer und ehemaliger britischer Tennisstar, in einem Interview mit der BBC.
Als Nadal anfing, Vollzeit auf der Tour zu spielen, lag der Rekord der Herren für die Gesamtzahl an gewonnenen Grand-Slam-Titeln bei 14 und wurde von Pete Sampras gehalten. Nadal hat allein 14-mal bei nur einem Grand-Slam-Turnier gewonnen.
„Wenn man mir oder einem von uns vor zehn Jahren gesagt hätte, dass Rafa 14-mal gewinnen würde, hätten wir uns kaputtgelacht“, sagte der ehemalige Spitzenspieler und einer der besten Tennistrainer Darren Cahill. „Jetzt lachen wir, weil es tatsächlich passiert ist. Oh mein Gott!“
Nadal hat sich seinen Roland-Garros-Rekord über einen Zeitraum von fast 20 Jahren erarbeitet – eine sportliche Ausnahmeleistung, die in diesem Jahrhundert der außergewöhnlichen Sportrekorde wohl nur mit Phelps’ Rekord von 23 Goldmedaillen vergleichbar ist (wobei Phelps viele dieser Goldmedaillen nicht allein, sondern auch mit der Staffel gewonnen hat).
„Ich kann mir kaum vorstellen, dass es eine größere sportliche Herausforderung gibt, als bei Roland-Garros auf Sand fünf Sätze gegen Rafa zu spielen“, so Cahill vor Nadals letzter Saison. „Die Art und Weise, wie er spielt. Die Energie, die er auf den Platz bringt. Die physische Präsenz und das Selbstvertrauen; die mentale Einstellung, sein Ansatz, niemals aufzugeben. Jedes Mal, wenn er da rausgeht, jedes Mal, wenn er spielt, nimmt er nichts als selbstverständlich hin. Es spielt keine Rolle, ob der Gegner auf Platz 100 oder eins der Weltrangliste steht, er behandelt alle gleich und mit demselben Respekt. Wenn man Spiele oder Sätze gegen ihn gewinnt oder zufällig einer der wenigen ist, die ihn bei Roland-Garros tatsächlich geschlagen haben, dann hat man sich das wirklich verdient.“
Trotz dieses phänomenalen Rekords, trotz seiner beeindruckenden Karriere, trotz der 24-Meter-Yacht ist Nadal ein bodenständiger Champion geblieben. Er hat sich stets viel mehr darauf konzentriert, das Maximum aus sich herauszuholen – Punkt für Punkt, Match für Match, Trainingseinheit für Trainingseinheit –, als darauf, etwas zu erreichen, was nach ihm niemand mehr erreichen wird.
„Ich bin glücklich so, wie ich bin“, sagte er 2020 zu mir und klopfte sich zur Betonung auf den großen Brustkasten. (Für seinen Geschmack hatte ich wohl eine Frage zu viel über seine Tennisrekorde gestellt.) „Mein Glück hängt nicht von diesen Zahlen ab. Ich bin sehr dankbar für alles, was ich erlebt habe. Ich kann mich wirklich glücklich schätzen, aber ich habe es schon oft gesagt: Besessenheit ist nie gut. Wenn ich besessen davon bin, mehr Titel zu gewinnen, nur um besser als jemand anderes zu sein, endet das nur mit Frust. Ich setze mir keine Ziele, die mich womöglich am Ende weniger glücklich machen.“
Nadal gluckste reflexartig, als er das sagte – ein weiterer seiner Ticks, der mir eine Art Familientick zu sein scheint (vielleicht bei langen Debatten in der Casa Nadal am Abendbrottisch entwickelt?). Ich habe Nadals Onkel Toni einmal auf die gleiche Weise eine Aussage unterstreichen hören. Offenbar ein Versuch, eine angespannte Gesprächssituation aufzulockern; als würde Nadal merken, dass man seinen Standpunkt nicht erwartet hat und die Sache ein bisschen anders sieht als er. Und gleichzeitig macht er damit klar, dass er seine Meinung – man könnte auch von Programmierung sprechen – nicht ändern wird.
„Ich muss nicht 12-, 13- oder 14-mal Roland-Garros gewinnen“, sagte er damals. „Ich muss nicht 21, 22 oder 23 Grand-Slam-Titel gewinnen, um jemanden zu übertreffen oder mit ihm gleichzuziehen. Was passiert, passiert. Ich kann letztlich nur mein Bestes geben. Ich kann nicht immer auf das schauen, was neben mir ist, und denken: Dieser Typ hat aber ein größeres Haus als ich. Natürlich gibt es immer jemanden, der mehr Geld, ein größeres Boot, eine schönere Frau hat. Ich kann doch die Dinge nicht immer nur von außen betrachten; das wäre der sicherste Weg, um ständig unzufrieden zu sein. Es muss von innen kommen.“
Von außen betrachtet steht allerdings außer Frage, dass Nadals French-Open-Rekord seine größte Leistung ist: Diese Megastatistik wird auch noch in 20, 50 oder sogar 100 Jahren die Einzigartigkeit des sympathischen Spaniers herausstellen. Deswegen will ich sie in den Mittelpunkt dieses Buches stellen, als Linse, durch die ich sein Leben und seine Karriere betrachte. Ich will auch tief in Roland-Garros eintauchen, den Ort, an dem er sich selbst und die Grenzen des Tennis neu definierte und die Messlatte für die nächsten Generationen, die vielleicht mehr als er von außen angetrieben sind, in schwindelerregende Höhen legte.
Da seine Spielerkarriere nun zu Ende ist, ist dieses Buch ein Portrait eines Champions und seines Testgeländes. Ich fühle mich gut positioniert, es zu schreiben, denn ich habe einen großen Teil meines Lebens in Frankreich und Spanien verbracht und 30 Jahre lang von den French Open berichtet. Es ist das Grand-Slam-Turnier, das ich am besten kenne, dem ich mich am tiefsten verbunden fühle – auch weil ich eine Pariserin geheiratet, mit ihr drei französisch-amerikanische Kinder aufgezogen und die ersten Jahre nur ein paar Blocks vom Turniergelände entfernt gewohnt habe.
Ich habe beobachtet, wie Roland-Garros immer wieder und nun völlig verändert wurde. Das Fußballfeld, auf dem ich als Anwohner früher kickte, ist längst verschwunden und der Erweiterung des French-Open-Geländes zum Opfer gefallen. Vom ursprünglichen Tennisstadionkomplex aus dem Jahr 1928 ist nur das Rechteck aus rotem Sand im Centre Court und ein kleines Fachwerkhaus am Rand der Anlage übriggeblieben. Dort war einst der spätere French-Open-Sieger Yannick Noah untergebracht. Heute, weniger poetisch, aber ebenso symbolisch, beherbergt es eine überteuerte Snackbar.
In den Jahren bei Roland-Garros habe ich viele Veränderungen miterlebt, aber vor allem viele Siege von Nadal gesehen: Titel in drei verschiedenen Dekaden, Titel jenseits aller Vernunft. Ich saß im Pressebereich und war auf seiner Siegesparty in der Nähe des Eiffelturms, als er 2005 als 19-Jähriger – mit langen Haaren, einem neongrünen ärmellosen Shirt und weißen Dreiviertelhosen – sein Debüt gab. Und ich war 2022 dabei, als er mit 36 zum letzten Mal siegte, mit kahlen Stellen am Kopf und in sehr viel konservativerer Kleidung. Da benötigte er täglich schmerzstillende Injektionen in seinen linken Fuß, um die Matches zu überstehen.
Die französischen Meisterschaften gab es bereits seit 114 Jahren, als Nadal auf der Bildfläche erschien. Aber Paris, selbst Paris, hatte noch nie jemanden wie ihn erlebt. Heute können ihn seine Fans hier sehen, wann immer sie wollen. Alles, was sie dafür tun müssen, ist, durch das Eingangstor von Roland-Garros zu spähen.
Kapitel 2
DER KODEX
Rafael Nadal konnte mit seinem Tennisspiel erwachsene Männer zum Weinen bringen: Roger Federer in Melbourne und Wimbledon, seinen Vater Sebastián in New York und anderswo, seinen Trainer und Onkel Toni immer wieder in Paris.
Jim Courier jedoch überraschte mich in Indian Wells. Wir unterhielten uns im März 2023 auf einer brennend heißen Terrasse in der kalifornischen Wüste. Der US-Amerikaner mit der starken Vorhand und einer noch stärkeren Arbeitsmoral war einmal die Nummer eins und blieb es eine Weile: Er gewann vier Grand-Slam-Titel, darunter zweimal die French Open. Als blitzgescheiter Autodidakt war er in seiner Zeit als leicht aufbrausender Spieler kein einfacher Interviewpartner gewesen, später entwickelte er sich zu einem der einfühlsamsten und eloquentesten Sportkommentatoren. Wir haben im Laufe der Jahre oft miteinander gesprochen, und an diesem wolkenlosen Nachmittag unterhielten wir uns darüber, welche Elemente von Nadals Spiel andere Spieler kopieren und anwenden könnten und welche nicht.
„Na ja, ich glaube, dass dieser Punkt-für-Punkt-Wettbewerbsgeist und diese Beständigkeit angeboren sind und dass es für andere sehr schwer ist, das zu kopieren“, meinte Courier. „Selbst Novak, großartig wie er ist, hat seine Höhen und Tiefen und Flauten. Rafa hat das normalerweise nicht, es sei denn, er ist verletzt. Er ist der Beste, den ich je im Herrentennis gesehen habe, er spielt jedes Spiel, als ginge es um sein Leben.“
„Also, was kann man kopieren …?“, überlegte ich.
„Ich würde mal sagen, die Einstellung, die Art und Weise, wie er mit Niederlagen und Erfolgen umgeht“, antwortete Courier. „Er ist im Grunde die Verkörperung des berühmten Kipling-Zitats. Und es ist irgendwie auch erstaunlich, dass – so berühmt der Typ auch ist – er nie berühmt wirkt. Er zieht den Trainingsplatz ab, wenn er fertig ist. Er fühlt sich nicht im Mindesten privilegiert. Das ist etwas, das jeder ganz einfach kopieren kann. Man kann den Platz abziehen, Menschen die Hand schütteln, ihnen in die Augen schauen. Körperlich und mental auf seinem Level zu sein, ist superschwer, aber diese Details …“
Ich dachte, jetzt würde Courier ausholen, doch plötzlich musste er schlucken.
„Da bekommt man fast feuchte Augen“, sagte er.
Nach einem Moment der Stille fragte ich: „Warum trifft dich das so?“
„Weil es schwer ist, Mann“, erklärte er mit brüchiger Stimme. „Dieser Typ hat nie einen Schläger zerbrochen. Es ist eben schwer. Emotional.“
Wir sprachen noch weitere 30 Minuten über Nadals Schlagtechnik, seine Rituale vor dem Aufschlag, seine Spielmuster. Aber nichts war aufschlussreicher als der Moment, als Couriers Schutzwall fiel und er ins Stocken geriet. Als langjähriger Spitzenspieler hatte er die gleichen Belastungen, Fallstricke und Versuchungen erlebt wie Nadal, ohne dabei die gleiche Konstanz und Ausdauer zu erreichen. Ich glaube, was Courier so bewegte, waren Nadals Gegensätze: die Mischung aus Selbstbeherrschung und leidenschaftlichem Wettbewerbswillen, aus Bescheidenheit und dem Ehrgeiz, das absolute Maximum aus sich herauszuholen, aus unerbittlicher, zerstörerischer Kraft und absolut authentischem Anstand.
Es war nicht so, dass Nadal nie temperamentvoll wurde. Andy Murray bestätigte dies. „Du bist wahrscheinlich der einzige Tennisspieler, der noch nie aus Wut seinen Schläger geworfen hat“, meinte Murray in einer Videobotschaft, die Nadal zu seinem Rücktritt 2024 geschickt wurde. „Aber wenn du auf der PlayStation verloren hast, war das anders. Ich habe gesehen, wie Rafa den Controller in Hotelzimmern auf der ganzen Welt herumgeschmissen hat, wenn er und sein Kumpel Juan Mónaco mit ihrem geliebten Real Madrid kurz vor Schluss noch gegen mich verloren haben.“
Ich wusste bereits, dass Nadal den, wie ich es nenne, „Taxifahrertest“ bestanden hatte: ob ein Star Menschen, die in der Hackordnung weiter unten stehen, auch dann noch mit Respekt und Einfühlungsvermögen behandelt, wenn die Kameras ausgeschaltet sind. Ich habe gesehen, wie er sich nach den Turnieren persönlich bei den Stenografen im Interviewzimmer bedankte. Ich habe gesehen, wie er einen überfüllten Raum durchquerte, um vertrauten Gesichtern die Hand zu schütteln. Aber er hatte auch, von einigen wenigen Ausnahmen abgesehen, den „Kollegentest“ bestanden. Seine Konkurrenten hatten am eigenen Leib erfahren, wie kraftvoll seine Schläge und wie schnell seine Beine waren, aber was sie wirklich bewunderten, waren seine menschlichen Werte.
„Die ganz Großen schenken einem nichts, und egal wie der Spielstand ist, Rafa gibt da draußen keinen Millimeter Boden ab“, erinnerte sich John Isner als einer von nur drei Spielern, die Nadal bei Roland-Garros in den fünften Satz gezwungen haben. „Er gibt vom ersten bis zum letzten Ball 100 Prozent. Man muss versuchen, mit seiner Intensität mitzuhalten, was schwierig ist. Als ob er einen Motor hat, der nie ausgeht. Er geht da raus, schaut seinen Gegner an und sagt: ‚Ich spiele heute vielleicht nicht mein bestes Tennis, aber ich werde den längeren Atem haben, ich werde dich übertreffen und bezwingen.‘ Und das macht er dann auch. Meiner Meinung nach – da bin ich vielleicht voreingenommen, weil ich in der Tenniswelt zuhause bin – ist er der größte Kämpfer in der Geschichte des Sports überhaupt.“
Eine gewagte These, selbst wenn es um Nadal geht. Aber dass ein Veteran wie Isner, ein nachdenklicher Absolvent der University of Georgia und großer Sportfan, so weit geht, vermittelt ganz gut einen Eindruck von der mentalen Stärke, die Nadal im Lauf seiner Karriere entwickelt und verfeinert hat. Allein der Gedanke, gegen ihn zu spielen, war beängstigend, vor allem auf Sand.
Mackenzie McDonald besiegte bei den Australian Open 2023 einen humpelnden Nadal in der zweiten Runde, der darauf seine Saison aufgrund einer Hüftverletzung beendete. Das war auf einem Hartplatz. 2020 war McDonald bei den French Open auf Sand auf Nadal getroffen, und zwar im Centre Court. Nadal gewann 6:1, 6:0, 6:3.
„Ich habe damals gar nicht erst geglaubt, ihn schlagen zu können“, erzählte mir McDonald. „Ich habe mich rund 15 Minuten auf dem Platz aufgewärmt, und dann wurde mir klar, dass er, wenn man alles zusammenrechnet und bedenkt, dass das Turnier 15 Tage dauert, etwa ein halbes Jahr auf diesem Platz verbracht hat, um Matches zu gewinnen. Dieser Gedanke vor dem Spiel war wahrscheinlich nicht hilfreich. Aber für mich war es schon eine Ehre, mit ihm auf dem Platz zu stehen. Und ich habe ordentlich den Arsch versohlt bekommen.“
McDonald, von klein auf ein Nadal-Fan, machte nicht nur die klassische Erfahrung, vom Sandplatzkönig weggefegt zu werden. Wie alle seine Vorgänger und Nachfolger bekam er die volle Packung nicht nur auf dem Platz, denn Nadal absolvierte auch schon vor dem Spiel sämtliche seiner Rituale, um sich vorzubereiten: eiskalte Dusche, kurze Sprints und Känguru-Sprünge in der Umkleidekabine und im Tunnel.
„Beim Duschen habe ich ihn nicht beobachtet“, lachte McDonald. „Beim Rest aber schon. Er nimmt ordentlich Raum ein. Man merkt, dass das sein Revier ist, als ob er es markieren will. Er hat alles genauso gemacht wie immer, bis in den kleinsten Ablauf. Er hat diese Aura um sich, und ich dachte: ‚Alles klar, wie zum Teufel soll ich da mithalten?‘ Ich kam mir ganz klein vor und war wie in Ehrfurcht erstarrt. Und er ging da raus und rannte und sprang herum. Und als er das Match gewann, sah es aus, als hätte er noch nie zuvor ein Match auf diesem Platz gewonnen. Alles, was er macht, ist absolut zielgerichtet.“
Diese Eigenarten entwickelte Nadal schon sehr früh. Sein Onkel Toni war dafür wohl weichenstellend. Der strenge, unangepasste Mann mit der rauen Tenorstimme, der eine gute Auseinandersetzung vielleicht noch mehr schätzte als eine gute Vorhand, wurde von Jordi Arrese, dem ehemaligen spanischen Spieler und Davis-Cup-Kapitän, auch „Dr. No“ genannt. Toni konnte schon ziemlich raubeinig sein, er hatte aber auch Tiefe.
Die meisten Rivalen Nadals, darunter Federer, arbeiteten im Laufe der Jahre zumindest zeitweise mit Sportpsychologen zusammen. Nadal tat dies weniger. Als er als Jugendlicher in einem Tenniszentrum in der mallorquinischen Hauptstadt Palma zu trainieren begann, erhielt er die Gelegenheit dazu. Aber er und Toni lehnten das Angebot ab. Gegen Ende seiner Karriere gestand Nadal, er habe in zwei Phasen seiner Karriere einen Psychologen aufgesucht: „Einmal, als ich noch sehr jung war, und einmal, als ich älter war. Vielleicht ist das ein Tabuthema, aber ich finde es natürlich.“
Davon abgesehen hatte Nadal mit seinem Onkel einen inoffiziellen Leistungspsychologen stets an seiner Seite, er wurde von ihm bei jedem Schritt und Rutscher begleitet.
Toni ist sicher nicht der einzige Grund, warum sein Neffe zu einem der größten Sportler aller Zeiten wurde, aber er ist der wichtigste Grund neben Rafael selbst. Toni prägte Rafaels Spielweise und Wettkampfmentalität und begleitete ihn auf einzigartige Weise auf seinem Weg vom Anfänger zum Seriensieger.
„Klar, es war und ist manchmal kompliziert, seinen Onkel als Trainer zu haben“, antwortete Rafael, als ich ihn zum ersten Mal nach Toni fragte. „Aber es ist auch ein großer Vorteil, und ich bin sehr dankbar dafür.“
Er ergänzte, auch Toni könne ihm, Nadal, dankbar sein. Da kann man ihm nur zustimmen.
Toni war das zweite von fünf Kindern und kam nach Sebastián Nadal zur Welt. Ihr Vater, der ebenfalls Rafael hieß, war auf Mallorca ein bekannter Musiker und Universalgelehrter mit einem lebhaften Geist und ebensolcher Einstellung. Er hatte sicherlich nicht damit gerechnet, dass seine Nachkommen eines Tages Weltklasseathleten werden würden. Toni war der Erste in der Familie, der sich für Tennis interessierte und ernsthaft Sport betrieb. Nach einem späten Start entwickelte er sich dank seiner guten einhändigen Rückhand und seiner verbissenen Verteidigung zu einem der 30 besten Spieler Spaniens. Anfang der 1980er-Jahre spielte er für den Real Club de Tenis Barcelona, einen der besten Clubs des Landes – genau wie Rafael zu Beginn seiner eigenen Karriere. Was ihm jedoch fehlte, waren die Kraft und das Waffenarsenal, über das die Spieler auf der Tour verfügten.
Toni brachte Rafael im Alter von drei Jahren mit Tennis in Berührung. Er warf ihm Bälle auf dem roten Sand im Tennisclub in Manacor zu. Toni und Sebastián waren beide beeindruckt davon, wie sauber der kleine Rafael die Bälle von Anfang an traf.
Toni war Ende 20, als er seinem Neffen im Alter von vier Jahren die erste richtige Trainingsstunde gab. Schnell war klar, dass der Junge außergewöhnliches Talent hatte. Alberto Tous, der erste Mallorquiner, der auf der Tour spielte, kehrte später als Trainer auf die Insel zurück, und als Rafael sechs Jahre alt war, schlug Tous auf Tonis Bitten hin ein paar Bälle mit Rafa.
„Er war so winzig. Ich fing im Midcourt an und unterhielt mich mit Toni, während ich mit Rafa Bälle schlug“, erzählte mir Tous. „Und ich schwöre, wir haben etwa drei Minuten lang gespielt, und der Junge hat nicht einen Ball verfehlt. 180 Sekunden, und nicht einen Ball verfehlt! Am Ende fing ich den Ball auf, um den Wechsel zu beenden, drehte mich zu Toni um und sagte: ‚Er ist eine Wand!“‘
Es sollte nicht das letzte Mal sein, dass Rafael so beschrieben wurde. Nur dass eine Wand den Ball nicht mit doppeltem Tempo und Spin zurückspielt …
Ohne Tonis Einfluss hätte sich Rafael wohl eher dem Fußball als dem Tennis zugewandt. Die Anziehungskraft des fútbol war angesichts der Vorherrschaft dieses Sports in Spanien und auf Mallorca enorm. Rafael hatte eine offensichtliche Begabung für das Spiel, er war ein erfolgreicher Torschütze in Jugendmannschaften. Außerdem liebte er es als Kind, seinem Onkel Miguel Ángel Nadal zuzusehen, der für den FC Barcelona, den RCD Mallorca und die spanische Nationalmannschaft spielte.
„Rafa hat das große Glück, in zwei Sportarten sehr gut zu sein“, so Antonio Mesquida, Rafas Jugendfußballtrainer, in einem Interview mit dem Diario de Mallorca im Jahr 2000. Es war das Jahr, in dem sich Nadal zwischen den beiden Sportarten entscheiden musste.
Miguel Ángel, der von der britischen Presse auch „Beast of Barcelona“ genannt wurde, war ein beeindruckender Verteidiger und Mittelfeldspieler und eigentlich Tonis erstes Trainingsprojekt in der Familie. Unter Tonis Anleitung gewann Miguel die Jugendmeisterschaften der Balearischen Inseln. „Ich war sein erstes Versuchskaninchen“, meinte Miguel Ángel im Dokumentarfilm Mestre Toni.
Trotz seines ebenfalls großen Tennistalents entschied sich Miguel Ángel für den Fußball, und angesichts seiner erfolgreichen Karriere hat er ganz offensichtlich die richtige Wahl getroffen.
Tennis stand in der Familie Nadal eher an zweiter Stelle. Aber Rafaels außergewöhnliches Talent und Tonis Verfügbarkeit und Methode stellten die Weichen neu, auch wenn Rafa auf seinem Weg sicher gelegentlich Zweifel überkamen. Als er 18 war und bereits zu den Top 50 gehörte, gab er der spanischen Tageszeitung El País ein Interview. Er wurde gefragt, ob er seinen Traum verwirklicht habe, indem er Tennisprofi geworden sei.
„Bueno“, antwortete er zögernd. „Mein Traum war eigentlich, Profifußballer zu werden, wie mein Onkel.“
Stattdessen lebte er nun den Traum eines anderen Onkels. Dieser war einst nach Barcelona gezogen, um Tennisprofi zu werden, hatte aber seine Grenzen erkannt und war stattdessen Trainer geworden.
„Ich sage das nicht, um anzugeben, aber Rafael spielt wegen mir Tennis“, sagte Toni einmal.
Sein Neffe stimmte zu. „Ich glaube, ich hatte viel Glück. Er hat seit meiner frühen Kindheit auf mich aufgepasst und mir mit allem geholfen. Ich verdanke ihm, dass ich Tennisspieler geworden bin. Ohne ihn wäre es nie dazu gekommen.“
An dieser Stelle lohnt es darauf hinzuweisen, dass auch Ilie Nastase seinen Teil dazu beitrug.
Im Dezember 1972 war Toni fast zwölf Jahre alt und noch kein Tennisspieler, besuchte aber den Masters Grand Prix, der in diesem Jahr in Barcelona in einer neuen Arena, dem Palau Blaugrana, stattfand. Das Masters war der Vorläufer der heutigen ATP Finals: ein Turnier mit den jeweiligen Top 8 der Weltrangliste zum Saisonabschluss. Toni saß im Finale auf der Tribüne, um zu sehen, wie Nastase, der unbeständige Star aus Rumänien, gegen Stan Smith aus den Vereinigten Staaten antrat. Nastase war amtierender US-Open-Sieger, Smith amtierender Wimbledon-Sieger. Es war die Zeit der Holzschläger und des Serve-and-Volley-Tennis, und der charismatische, unberechenbare Nastase mit den langen, windzerzausten dunklen Haaren verwandelte genug akrobatische Überkopfbälle und schnittige Passierschläge in Winner, um Smith in fünf Sätzen zu schlagen.
Toni Nadal war verzaubert. Er hatte ein neues Idol, und obwohl Toni gut genug im Tischtennis war, um Juniorenmeister der Balearischen Inseln zu werden, war fortan Tennis seine Leidenschaft und wurde schließlich zu seinem Beruf.
Es mag ein amüsanter Beweis für Tonis Komplexität sein, dass sein frühes Tennisidol Nastase in vielerlei Hinsicht das genaue Gegenteil von dem war, was Toni seinen Schülern später beibrachte; Nastase war auch das Gegenteil von den Tugenden, die Rafael verkörperte. Obwohl der Rumäne Weltranglistenerster wurde und zwei Grand-Slam-Turniere gewann, galt er gemeinhin als Underachiever. Er war temperamentvoll und impulsiv, abwechselnd ungehobelt und liebenswert, verfügte lediglich über eine begrenzte Aufmerksamkeitsspanne und pflegte mitten im Match einen Hang wahlweise zum Vulgären oder zu Albernheiten, obendrein schikanierte er die Schiedsrichter.
Aber die Jugend liebt Rebellen, und Nastase war ein Rebell (auch wenn er oft wie sein eigener ärgster Feind wirkte). Nastase konnte Punkte wie Lappalien behandeln, so austauschbar wie Halloween-Süßigkeiten. Rafael hingegen behandelte sie so ernsthaft wie Staatsangelegenheiten. Und doch – es mag unwahrscheinlich klingen – führte hier ein Champion zum nächsten.
Das war nicht der einzige scheinbare Widerspruch bei Toni. Im Laufe der Jahre sprach er oft davon, wie wichtig es sei, dass Rafael die „Realität“ akzeptierte, dass er sich die ungeschminkte Wahrheit über die eigenen Grenzen und die vor ihm liegenden Herausforderungen anhörte, vor allem, wenn es um Federer ging.
Als Toni seinen Neffen zu trainieren begann, ließ er neben diesem Realitätsdogma aber auch die Fantasie zu. Rafael war das erste Enkelkind und damit das „Maskottchen“ der Familie. Er war voller Energie und voller Vertrauen, und Toni hatte seinen Spaß mit ihm. Zum Beispiel behauptete er, dass er magische Kräfte besäße. Beim ersten Turnier trat der siebenjährige Nadal gegen einen elfjährigen Jungen in einem U-12-Mannschaftswettbewerb in Mallorca an. Auf dem Weg zum Turnier besprach Toni mit Rafael im Auto die Optionen und erklärte, wenn Rafa zu sehr in Rückstand geraten sollte, solle er dem älteren Jungen einfach sagen, dass seine Familie gehen müsse und sie das Match an einem anderen Tag beenden könnten. Rafael protestierte, woraufhin Toni vorschlug, dann werde er eben bei einem zu großen Rückstand dafür sorgen, dass es regnete.
Das Match begann, und Rafael geriet verständlicherweise in Rückstand.
„Es stand 1:0, 2:0, 3:0, 4:0, aber dann begann er aufzuholen. 4:1, 4:2, 4:3“, berichtete Toni Nadal später in einem spanischen Fernsehinterview. „Rafa läuft wie ein Irrer, und bei 4:3 fängt es an zu regnen. Also unterbreche ich das Match, damit sich alle auf der Clubveranda unterstellen können. Da kommt Rafa zu mir und sagt: ‚Du, Natali, du kannst jetzt den Regen abstellen, ich glaube, dass ich ihn schlagen kann.“‘
Fünfzehn Jahre später, im Wimbledon-Finale 2008 gegen Federer, gab es eine Regenunterbrechung, als Nadal zwei zu Null Sätze in Führung lag, und als Toni während dieser Zwangspause zu Rafael in die Umkleidekabine kam, begrüßte dieser ihn mit den Worten: „Das war jetzt aber nicht der richtige Zeitpunkt, um es regnen zu lassen!“
Rafael nannte seinen Onkel nicht nur „Tío Mago“ (Zauber-Onkel), sondern auch „Natali“, weil Toni ihn glauben ließ, er sei eigentlich ein italienischer Fußballstar des AC Mailand. „Mein Bruder spielte ja für Barcelona, also musste ich ein etwas besseres Team wählen, und das war damals Milan“, erklärte Toni. „Also war ich der Star von AC Mailand. Ich erinnere mich sogar noch an die Aufstellung, die ich Rafael zeigte: Im Tor stand Pappardelle, und in der Verteidigung hatten wir Spaghetti, Makkaroni und Fettuccine.“
Toni ging sogar so weit und bezog auch den ehemaligen Barcelona-Spieler Txiki Begiristain in den Schwindel ein. Unter Rafaels zustimmendem Blick fragte Txiki Toni, wann er ihn denn mal besuchen käme, um den Spielern von Barcelona zu erklären, wie man ein richtiger Fußballstar werde.
Aber irgendwann hatte die Charade natürlich ein Ende. „Ich war am Boden zerstört, als ich meinen Onkel Toni einmal tatsächlich Fußball spielen sah“, erzählte Nadal viele Jahre später dem spanischen Fernsehsender TVE. „Ich kam nach Hause und sagte zu meiner Mutter: ‚Toni ist gar nicht so gut!‘ ‚Ich hatte einen schlechten Tag‘, gab Toni schlagfertig zurück.“
Es gibt noch viele solcher Geschichten. Rafaels Erkenntnis, dass er nicht alles glauben durfte, was sein Onkel ihm erzählte, hinderte ihn offenbar nicht daran zu glauben, was dieser über Tennis erzählte – und wie man das Beste aus sich herausholte.
Tonis wahres Talent bestand eher nicht darin, seinem Neffen Vor- und Rückhand beizubringen. Darin war er sicher nicht besser als andere Trainer mit einem viel umfassenderen technischen Know-how. Tonis Begabung – vielleicht sogar sein Genie – bestand darin, den Boden dafür zu bereiten, seinem jungen Schüler die Herausforderungen und Anstrengungen für eine jahrzehntelang anhaltende Leistung schmackhaft zu machen und ihm auch den entsprechenden Verhaltenskodex zu vermitteln.
„Mein Hauptziel war, dass Rafael unabhängig wird“, erklärte Toni.
Rafaels verletzungsanfälliger Körper und sein schwungvoller Spielstil waren eigentlich weniger auf Langlebigkeit ausgerichtet, seine Philosophie schon: Rafael zog seine Motivation nicht daraus, besser als andere zu sein, sondern besser als Rafael zu sein. Selbstzufriedenheit war daher keine Option.
„Letzten Endes ist es ja nicht immer möglich, andere zu übertreffen, aber sich selbst zu übertreffen, das ist die große Herausforderung“, so Toni. „Im Prinzip war es das, was Rafael von klein auf akzeptieren sollte. Er hat es verstanden und angenommen.“
Rafael und ich sprachen 2020 darüber in einem unserer längsten Interviews.
„Ich glaube, dass jeder im Laufe der Jahre seine Sicht auf das Leben verändert“, sagte er. „Wenn man älter wird, hat man eine andere Sicht auf die Dinge. Meine grundsätzliche Motivation, warum ich weiterspiele, habe ich aber nicht wesentlich geändert.“
„Wie meinst du das?“, fragte ich.
„Erstens spiele ich gern, und zweitens: Auch wenn ich meine persönlichen Ziele habe, war es nie mein Ziel, der Welt oder den Menschen zu beweisen, was ich bin oder nicht bin. Es ging mir und meiner Familie, meinem Team und allen, die mir nahestehen, immer um die persönliche Motivation. Es hat mich nie motiviert, anderen etwas beweisen zu wollen oder aufgrund äußerer Umstände zu kämpfen.“
Rafael, der von innen heraus leuchtet, war und ist tatsächlich selbstmotiviert. Das erklärt sicher auch, warum er es geschafft hat, bis Ende 30 Tennis zu spielen, ohne den Biss zu verlieren.
„Ich habe gelernt, das Leiden zu genießen“, sagte er uns einmal nach seinem Sieg bei den Australian Open 2009, nachdem er sich durch zwei aufeinanderfolgende Fünfsatzmatches gegen Fernando Verdasco und Federer gekämpft hatte.
Oder wie es ein mir bekannter Marathonläufer gerne ausdrückt: Schmerz ist unvermeidlich. Leiden ist optional.
In diesem Geist erhielt Rafael nicht nur seine Tennisausbildung, es war die Grundlage für alles. Toni wollte es seinen Schülern nicht leicht machen, und am meisten wünschte er sich, dass sie von sich aus eine entsprechende Einstellung verinnerlichten, dass sie es schätzten, es nicht leicht zu haben.
„Man muss sich den Schwierigkeiten stellen und sie angehen, man darf nicht vor ihnen zurückschrecken. Zu viele Eltern und Trainer machen es ihren Kindern zu leicht. Wir haben das für Rafael nie gemacht.“
Toni ist kein perfekter Trainer. Die Entscheidung, in den ersten Trainingsjahren in Mallorca immer wieder von Sand- auf Hartplätze zu wechseln, erwies sich für die Knie seines Neffen als Fehlentscheidung.
„Wir haben auf Sand- und Hartplatz trainiert, haben ständig den Belag gewechselt“, erinnerte sich Nadal. „Natürlich wussten wir damals nicht, dass das ein Problem war, und so hatte ich später viele Knieprobleme. Das würde ich heute anders machen. Diese drastischen Belagwechsel sind nicht gut für den Körper, und ich habe das fast jeden Tag gemacht.“
Aber Tonis mentaler Ansatz und die Charakterbildung wirkten bei Rafael sicherlich Wunder. Professionelle Leistungspsychologen wie der Schweizer Christian Marcolli zeigen sich beeindruckt. Der Ex-Fußballer des FC Basel arbeitete erfolgreich mit dem leicht erregbaren, hypersensiblen jungen Federer zusammen. Er half ihm, seine Emotionen im und außerhalb des Wettkampfs zu kontrollieren. Marcolli traf Rafael Nadal bei mehreren Gelegenheiten, beriet ihn aber nie.
Für Marcolli bestand Tonis Meisterleistung darin, Rafael von Beginn an klarzumachen, dass er ständig mit Problemen konfrontiert sein würde, dass er damit rechnen und sich sogar darauf freuen sollte.
„Es kommt sehr selten vor, dass Trainer auf diesem Niveau darüber sprechen“, so Marcolli zu mir. „Es ist eine besondere Art, die Dinge zu betrachten: Probleme sind normal, und es kann spannend sein, sie zu lösen. Die meisten von uns reagieren sofort mit ‚Das will ich nicht‘, wenn sie das Wort ‚Problem‘ hören. Aber ich habe das Gefühl, dass die Nadals diesem Wort eine völlig neue Bedeutung gegeben haben. Ein Problem ist nichts, was es zu vermeiden gilt, und wenn man Rafa in schwierigen Momenten zusieht, ist er voll da. Ich hatte nie den Eindruck, dass er lieber auf das Problem verzichten würde, als es zu lösen.“
Marcolli lachte. „Ehrlich gesagt, bin ich mir sicher, dass er glatte Sätze schon bevorzugen würde, so: zack, zack, und ab nach Hause. Aber wenn das eben nicht ging, handelte er nach der Devise: OK, jetzt zeige ich, was ich kann!“
Es gab sehr seltene Ausnahmen – alle im Zusammenspiel mit Djokovic. Aber im Großen und Ganzen lief Nadal ein Rennen, das nie gewonnen werden konnte, weil das Rennen nie endete. Es ging allein darum, die Anstrengungen, kontinuierlichen Verbesserungen und unvermeidlichen Widrigkeiten – erwartete wie unerwartete – anzunehmen.
„Aus der Sicht eines Leistungspsychologen ist diese Einstellung in jeder Hinsicht wunderbar“, sagte Marcolli. „Diese Einstellung ist gerade in einer so schwierigen Sportart wesentlich. Du wünschst dir Perfektion, aber jeder Fehler wird brutal bestraft. Dieser Sport schafft ständig Probleme. Und du bist exponiert, ungeschützt und völlig auf dich gestellt.“
Bei allen Unterschieden in ihrer Persönlichkeit erkannte Marcolli aus psychologischer Sicht auch Gemeinsamkeiten bei Nadal, Federer und Djokovic.
„Eines der wichtigsten Dinge, die notwendig, aber unglaublich schwierig sind, ist zu definieren, wer man ist, was die eigene Art zu spielen ausmacht. Und dann in den schwierigen Momenten die Ruhe in sich selbst zu finden und dies zu seinem Vorteil zu nutzen, während dein Gegenüber gestresst ist“, erklärte Marcolli. „Ich sage damit nicht, dass Rafa nicht gestresst ist, aber es geht übergeordnet um die Klarheit und die damit verbundene innere Ruhe. Seine Titel beweisen es. Je mehr ein Spieler gewinnt, desto mehr wird er in seinem Ansatz bestätigt. Roger, Novak und Rafa haben das verinnerlicht, und in diesem Punkt unterscheiden sie sich von den anderen. Man weiß, was man in schwierigen Momenten von ihnen zu erwarten hat, und kann dem nichts entgegensetzen, weil es so gut ist.“
Nadals Herangehensweise auf Sand war nicht sonderlich schwer zu durchschauen. Er drängte seine Gegner zurück oder zwang sie mit seinem Spin und seiner Präzision aus ihrer Komfortzone, wartete auf einen kurzen oder hohen Ball und bewies dann seine innere Ruhe, indem er die Vorhand durchzog und den Punkt machte.
„Du weißt, was kommt, kannst aber nichts dagegen machen“, fasste Gilles Simon zusammen, als wir an einem Frühlingstag auf einer Terrasse in Roland-Garros saßen.
Kein führender Tennisstar hat sich so gezielt mit Nadals Methoden und Denkweisen auseinandergesetzt wie die junge polnische Tennisspielerin Iga Swiatek. Ihr bester Belag ist wie bei Nadal Sand. Und wie Nadal stieg sie mit ihrer starken Topspin-Vorhand, ihrer Explosivität und fokussierten Herangehensweise gerade in enormen Drucksituationen im Wettkampf zur Nummer eins auf. Im Gegensatz zu Nadal besaß sie diese Stärke jedoch nicht von klein auf. Die sensible und intelligente Spielerin kämpfte häufig mit ihren Nerven und weinte sogar manchmal während der Matches. Sie erzählte mir, sie habe sich früher leicht ablenken lassen.
„Plötzlich bewegte sich mein Kopf wie der einer Taube“, sagte sie, und zur Verdeutlichung riss sie die Augen weit auf und drehte den Kopf schnell nach rechts und links. „Ich schaute überall hin, nur nicht dorthin, wo ich hätte hinschauen sollen.“
Nadal sei ihre Inspiration gewesen, der einzige Spieler, dessen Matches sie regelmäßig verfolgte, und auch noch lange nachdem Swiatek selbst die Nummer eins war und mehrere Male bei den French Open gesiegt hatte, hing noch ein Nadal-Poster und ein von ihm signiertes T-Shirt an der Wand ihres Zimmers.
„Als Kind habe ich gar nicht so viel Tennis geschaut, wie man meinen könnte“, erzählte mir Swiatek. „Ich beschäftigte mich ja so viel mit Tennis, jeden Tag vor und nach der Schule, dass ich den Sport nicht auch noch in meiner Freizeit schauen wollte. Aber ich habe Rafa schon von klein auf bewundert. Ich würde sagen, der entscheidende Moment war, als ich zum ersten Mal nach Paris zum Juniorenwettbewerb kam und dort Rafa und die anderen Champions beobachten konnte. Das war das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, wie sie zu den Besten gehören zu können und dieses Leben auch zu wollen. Ich habe Rafa immer für seine Hingabe bewundert, seine Bescheidenheit und seinen unglaublichen Tennisstil, vor allem natürlich für seine Vorhand und Athletik.“
Swiatek trainierte später an Nadals Akademie in Manacor und baute auch eine persönliche Beziehung zu ihm auf. Auf seinen Wunsch hin sprach sie bei der Graduiertenfeier 2023. Ihren eigenen inneren Rafa entwickelte sie mithilfe der polnischen Leistungspsychologin Daria Abramowicz, die zu ihrem Reiseteam gehört.
„Ich erinnere mich an keinen anderen Athleten, der über so viele Jahre hinweg so resilient wie Rafa war. Er war in der Lage, dieses unglaubliche Maß an Charakterfestigkeit aufrechtzuerhalten“, erklärte mir Abramowicz einmal. „Charakterfestigkeit ist ein faszinierendes Wort. Es kombiniert Entschlossenheit, gelegentliche Sturheit – aber auf gute Art –, Stärke und Motivation. Der entscheidende Punkt im Prozess ist, wenn die Dinge nicht so laufen, wie man will. Das ist Rafas ultimative Superkraft, glaube ich.“
Toni würde wahrscheinlich behaupten, gerade der eingeschränkte Kontakt zu Sportpsychologen hätte bei seinem Neffen dazu beigetragen, diese Charakterfestigkeit und das Selbstvertrauen zu entwickeln, um in den entscheidenden Momenten an sich zu glauben. Aber Toni förderte diese Charakterfestigkeit auf seine Weise. Er erfand Hindernisse, wenn es keine gab, zum Beispiel gab er Rafa abgenutzte Tennisbälle, damit sein Schüler lernte, sich klaglos mit einer nicht optimalen Situation abzufinden.
Toni ist ein Geschichtenerzähler. Er wird heute gut dafür entlohnt, seine Weisheiten an die Businesswelt weiterzugeben. Eine seiner bevorzugten Anekdoten handelt von einem Juniorenturnier, als Rafael 15 war. Toni beobachtete Rafaels Match aus der Ferne und bemerkte, dass er 0:5 gegen einen schwächeren Spieler zurücklag. Ein Freund sprach Toni an, weil er den Eindruck hatte, Rafael spiele mit einem kaputten Schläger. Toni ging der Sache nach und sprach mit Rafael, der jetzt erst bemerkte, dass er ein Problem hatte. Er wechselte den Schläger, verlor aber dennoch 6:0, 7:5.
Nach dem Match fragte Toni Rafael, wie ein erfahrener Spieler wie er nicht merken konnte, dass sein Schläger kaputt war. Rafaels Antwort: „Na hör mal, ich bin es so gewohnt, selbst schuld zu sein, dass ich nicht einmal auf die Idee gekommen bin, es könnte am Schläger liegen, dass ich am Verlieren war.“
„Ich finde Selbstkritik absolut notwendig“, erklärte Toni bei einem TedX-Talk in Málaga. „Ohne ist es sehr schwer, Fortschritte zu erzielen und sich zu verbessern. Also habe ich immer darauf geachtet, dass Rafa selbstkritisch ist. Er sollte mir nicht mit Ausreden kommen, egal ob es um eine Niederlage oder irgendetwas anderes ging.“
Zu diesem ambitionierten Ansatz gehörte etwa, dass er seinen Neffen beim Training bisweilen mit Bällen bewarf, wenn dieser unaufmerksam war. Das würde heute sicher nicht mehr allseits auf Zustimmung stoßen. Tonis Ansatz ist bei Nadal dennoch tief verankert.
„Ich erinnere mich an einen Tag, als wir ein Golfturnier auf Mallorca spielten“, begann Alberto Tous zu erzählen. „Rafa hatte bereits vier- oder fünfmal Roland-Garros gewonnen. Ich sagte: ‚Rafa, lass uns nach dem Turnier zusammen Mittagessen gehen und ein bisschen Zeit miteinander verbringen.‘ Worauf er antwortete: ‚Nein, ich kann nicht, Toni wartet auf mich. Ich habe eine Stunde, und ich muss unterwegs anhalten und etwas essen. Ich habe nur Zeit für ein Stück Pizza. Wenn ich um 16:30 Uhr nicht da bin, bringt er mich um.“‘
Tous legte sich die Hände um den Hals und machte eine Würgebewegung, als er mir die Geschichte erzählte.
„Toni ging auch nach vier oder fünf Roland-Garros-Siegen weiter nach dem Motto vor: bäm, bäm, bäm, weiter, weiter, weiter.“
Toni trainierte viele junge Spieler, doch nur Rafael wurde ein großer Champion. Insofern gebührt Rafael der Großteil des Verdienstes. Er war es, der unter Druck die Mittel und Wege fand, wenn er gegen die besten Spieler der Tennisgeschichte antrat. Er war es, der die Vorhand inside-out spielte, um den Punkt zu machen, der Stoppbälle erlief, schwierige Volleys mit großer Präzision zurückspielte, völlige Ruhe an den Tag legte, um seinem Gegner noch weniger Anlass für Optimismus zu geben.
„Wir sollten nicht vergessen, dass Rafa ein Tier ist“, schloss Tous.
Wir sollten auch nicht vergessen, dass noch weitere Personen eine Schlüsselrolle bei Rafaels Erfolg spielten.
Vater Sebastián zum Beispiel. Der erfolgreiche Geschäftsmann besaß eine Fensterfabrik auf Mallorca und investierte auch anderweitig. Er hätte an vorderster Front stehen können. Aber es behagte ihm nicht, wie viele andere Eltern erfolgreicher Kinder sich vom Rampenlicht anziehen zu lassen, deswegen beschloss er, im Schatten zu bleiben. Er spielte dennoch eine wichtige Rolle als Berater und half bei der Verwaltung der florierenden Geschäfte seines Sohnes. Er finanzierte auch Rafaels frühe Karriere und lehnte das Angebot des Königlich Spanischen Tennisverbands ab, der Rafael finanziell unterstützen wollte, denn das hätte dessen Umzug nach Barcelona erfordert. Sebastián ließ Toni klugerweise das öffentliche Gesicht des Unternehmens sein, und Toni weigerte sich klugerweise, direkt von Rafael bezahlt zu werden. Er wollte sich seine Unabhängigkeit bewahren und ließ sich stattdessen an den Gewinnen des Familienunternehmens beteiligen.
Toni erzählte gerne, dass sein Bruder Sebastián ihn praktisch dazu gedrängt habe, Rafael zu trainieren, weil die Mitarbeiter in der Familienfirma ihr Arbeitspensum nicht erfüllten, wenn Toni dort war.
„Mein Bruder verdient das Geld, damit ich mit seinem Sohn reisen kann“, so Toni Nadal 2003 in der L’Équipe. „Die Rollen zu tauschen, steht für mich und meinen Bruder nicht zur Diskussion. Ich weiß nicht, wie sich das auf Rafas Tennis auswirken würde, aber eins ist sicher: Die Fabrik würde bankrottgehen.“
Toni erzählte mir, dass Sebastián ihm auch einmal vorgeschlagen habe, von Rafa direkt bezahlt zu werden. „Ich hatte aber das Gefühl, dass es dann unsere Beziehung verändern und ich mich nicht mehr so frei ausdrücken könnte.“
Außenstehende wundern sich oft, woher Toni sein Know-how hatte, um seinen Neffen bis an die Spitze zu bringen. Ein Teil der Antwort war sicher Tonis Neugierde und Offenheit: Er liebte es, Fragen zu stellen und sein Wissen zu erweitern. Zur Wahrheit gehörte aber auch, dass die Nadals viel bezahlte Hilfe von jemandem in Anspruch nahmen, der die Herausforderungen aus eigener Erfahrung kannte und wusste, was es brauchte, um wirklich zur Elite zu gehören.
Carlos Costa wurde im September 2001 Agent des 15-jährigen Nadal, er zählte damals zu den besten Spielern der Welt. Mit Platz zehn in der ATP-Weltrangliste hatte er 1992 seinen Karrierehöhepunkt erreicht, es war das Jahr, in dem er in Estoril und Barcelona gewann und im Finale der Italian Open gegen Courier verlor. Costa war auf Sand am besten und fungierte in Nadals ersten Profijahren häufig als dessen Hitting Partner.
Wahrscheinlich hätte sich der Kontakt gar nicht erst ergeben, wenn nicht der IMG-Agent David Serrahima, bei dem Nadal seinen ersten Vertrag unterzeichnete, die Agentur verlassen hätte. Costa, der sich 1999 von der Tour zurückzog, war auf der Suche nach neuen Herausforderungen. „Carlos fragte mich: ‚Was soll ich mit meinem Leben anfangen?“‘, erzählte mir sein Agent Jorge Salkeld. „Wir sprachen über die verschiedenen Optionen, und diese Option wurde an ihn herangetragen, da IMG eine Lösung für Rafas Management finden musste. Carlos war begeistert, weil Rafa bereits einen ausgezeichneten Ruf hatte. Und Carlos war ein großartiger Mentor für den jungen Nadal. Er war nicht nur ein Top-10-Spieler, sondern ging auch sehr verantwortungsvoll mit ihm um. Es war eine gute Sache für Rafa, jemanden in seinem Team zu haben, der sich so gut mit Tennis auskannte und bis zum Ende ein Teil des Teams blieb.“
Dann gab es noch Jofre Porta. Der unkonventionelle spanische Nationaltrainer hatte geholfen, Carlos Moyá aufzubauen. Porta wird heute von den Nadals kaum noch als Wegbegleiter genannt, war aber doch ein wichtiger Teil des frühen Beraterstabs um Rafael. Er beriet ihn technisch und reiste manchmal mit, damit sich Toni eine Auszeit nehmen konnte, zum Beispiel 2004 zu den Miami Open. Dort traf Rafael zum ersten Mal auf Federer (und besiegte ihn).