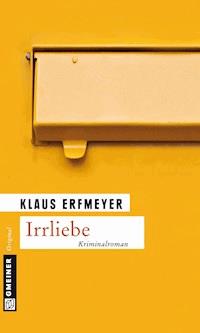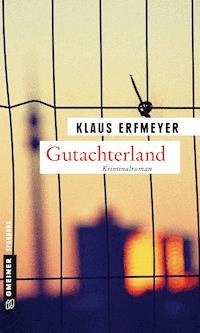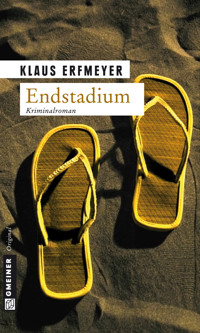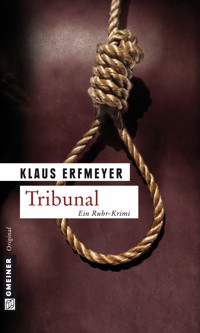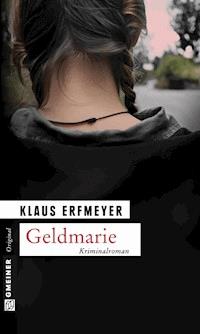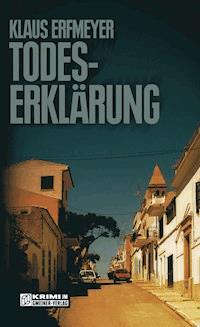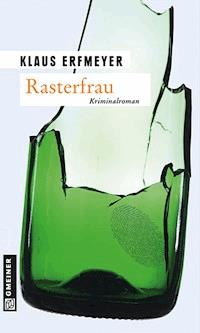
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Rechtsanwalt Stephan Knobel
- Sprache: Deutsch
Mit gemischten Gefühlen übernimmt Rechtsanwalt Stephan Knobel die Vertretung von Maxim Wendel. Dieser wurde wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt und strebt eine Wiederaufnahme des Prozesses an. Doch er hat nicht nur die Tatwaffe zweifelsfrei berührt, sondern auch ein Motiv: Der ehemalige Lehrer, der zu Schulzeiten jungen Schülerinnen nachstellte, hat angeblich eine Studentin vergewaltigt, wobei das Mordopfer ihn beobachtet haben soll …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 337
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Klaus Erfmeyer
Rasterfrau
Knobels achter Fall
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2013 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75/20 95-0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung und E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © SIN – Fotolia.com
ISBN 978-3-8392-4152-3
für
meine Tochter Liona Merita
und
den Abiturjahrgang 1983 des Helmholtz-Gymnasiums Dortmund
1
Stephan Knobel nahm den Weg über die alte Bundesstraße 1, den Hellweg, der in einigem Abstand zur parallel verlaufenden Autobahn von Dortmund aus ostwärts führte. Er passierte Felder, die sich nordwärts im Horizont des beginnenden Münsterlandes und südwärts in den Ausläufern des Sauerlandes verloren und in der mittäglichen Sonne dieses Julitages unter der flirrenden Hitze wie erstarrt schienen. Mit dem Auto über den Hellweg zu fahren, hieß, der alten Handelsstraße zu folgen und sich der früheren Bedeutung dieses Weges bewusst werden zu können. Es gab sie nach wie vor, die Mühlen und großen Gehöfte, die den Hellweg säumten und schon im Mittelalter ihren Besitzern zu Wohlstand verholfen hatten. Die kleinen Orte an dieser Straße wirkten noch heute reich und rein und beeindruckten durch schöne Fachwerkbauten, doch Stephans Ziel entbehrte jeden Idylls: Er fuhr in die Justizvollzugsanstalt Werl. Es wirkte wie ein Anachronismus, dass die in diesem Städtchen errichtete Strafanstalt, gelegen in der Freiheit und Weite verkörpernden lieblichen Soester Börde, just die Straftäter beherbergte, die langjährige oder sogar lebenslange Freiheitsstrafen abzusitzen hatten.
Stephans Besuch galt einem jener Insassen, die wegen Mordes einsaßen. Es würde im Dezember vier Jahre her sein, dass die Schwurgerichtskammer des Landgerichts Dortmund den Studienrat Maxim Wendel wegen der vorsätzlichen und zur Verdeckung einer Straftat begangenen Tötung des Rentners Rudolf Gossmann zu lebenslanger Haft verurteilt hatte. Wendels Revision gegen dieses Urteil war im April des folgenden Jahres vom Bundesgerichtshof zurückgewiesen worden. Seither war das Urteil rechtskräftig.
Vor etwa einem halben Jahr hatte Wendel begonnen, Stephan in unregelmäßigen, doch immer kürzer werdenden Abständen Briefe zu schreiben, die stets mit der Bitte begannen, ihn in der Haftanstalt zu besuchen, bevor Wendel mit vielen Worten verbreitete, das Opfer einer Verschwörung und somit eines Justizirrtums geworden zu sein.
Stephan hatte die Briefe anfangs kommentarlos weggeworfen und die stets langen Schreiben nicht einmal ganz durchgelesen, bis Wendels Hartnäckigkeit schließlich von Erfolg gekrönt war.
Seit einigen Wochen hatte Stephan Wendels turnusmäßige Briefe gelesen, doch das Ansinnen des Gefangenen schien ebenso klar wie aussichtslos: Maxim Wendel wollte seinen Fall neu aufrollen lassen. Er strebte eine Wiederaufnahme des Prozesses und seinen Freispruch an. Wendel erinnerte daran, dass Stephan ihn aus einem längst abgeschlossenen Verfahren kenne, und es schien, als sollte diese Bekanntschaft Stephan motivieren, sich Wendels Falls anzunehmen.
Doch was Stephan Knobel von Maxim Wendel wusste, sprach nicht für ihn, sondern bestätigte eher das Bild, das die Staatsanwaltschaft bei der Mordanklage gegen Wendel gezeichnet hatte. Wendel reagierte mit einem abnorm wirkenden Automatismus auf hochgewachsene, blonde Frauen und nutzte jede sich bietende Gelegenheit, sich ihnen zu nähern und aufzudrängen. Es waren unbekannte Schönheiten, die aus dem Nichts auftauchten, bezaubernde Wesen, die Wendel eroberten und dirigierten, und aus dem Augenblick heraus Wendel mit allen Sinnen tasten und taktieren ließen, ohne dass sie von ihrer geheimnisvollen Macht etwas ahnten. Wendel heftete sich wie ein Magnet an diese Frauen, ließ sich von Anmut und vermeintlicher Reinheit betören, sog gierig Parfumnoten ein und deutete unverbindliche Gesten als lockende Signale. In seiner Phantasie fand Wendel mit diesen Frauen zu einer irrealen Zweisamkeit. Seinem triebhaften Handeln folgte nicht zwingend Ernstes nach. Manchmal blieb es bei einem Augenzwinkern, manchmal bei verbalen Annäherungsversuchen, die wegen ihrer gleichzeitigen Dreistigkeit und Unbeholfenheit häufig albern wirkten. Hin und wieder berührte Wendel die Frauen scheinbar wie zufällig und ließ sich zu anzüglichen Bemerkungen hinreißen.
Maxim Wendel hatte sich im Prozess selbstgefällig als Filou bezeichnet, tat sein Handeln als eine verhängnisvolle, jedoch harmlose Neigung zu dem von ihm so genannten blonden Gift ab, doch genau dieses Gift war zu seinem Verderben geworden. Letztlich saß Wendel genau aus diesem Grund ein.
Stephan hatte den Weg über den Hellweg nicht wegen der Schönheit der Strecke gewählt. Er hatte Zeit gewinnen wollen, weil er sich unsicher war, ob er mit dem Besuch Wendels in der Strafanstalt das Richtige tat. Er besuchte einen verurteilten Mörder, dem er wohl nicht würde helfen können– und der es dennoch schaffte, Stephan in seinen Bann zu ziehen, so, wie es ihm vor etwa sechs Jahren bereits einmal gelungen war.
Wendel hatte Stephan vorab die von der Justizvollzugsanstalt ausgestellte Besuchserlaubnis zugeschickt. Die Zeit war vorgegeben: Donnerstag, 28. Juni, 10.30 Uhr. Die Besuchszeit betrug maximal 120 Minuten. Dem Schreiben war der Hinweis beigefügt, dass sich jeder Besucher durch Ausweis oder Pass legitimieren müsse.
Um 10.35 Uhr saß er Maxim Wendel im großen Besucherraum gegenüber. Der Raum hatte Kantinenatmosphäre. Sie setzten sich an einen Tisch in der Ecke. An drei oder vier weiteren Tischen empfingen andere Gefangene ihre Besucher. Es waren eigenartig unemotionale Begegnungen zwischen der Außenwelt und der Welt innerhalb der Gefängnismauern, in der die Zeit langsam vor sich hinkroch und von den stets gleichen Ritualen geprägt war.
»Sie sind da, endlich!«
Wendel lächelte und schwieg gerührt. Er rieb sich verlegen durch sein Gesicht und schüttelte ungläubig den Kopf.
Stephan hatte Maxim Wendel als drahtigen, sportlichen, rund 35-jährigen Mann in Erinnerung, der auf sein gepflegtes Äußeres Wert legte und sich in seinem häufig forschen Auftreten gefiel. Der schlanke, fast 1,90 Meter große Mann hatte in der Haft seine Sportlichkeit bewahrt. Stephan vermutete, dass er hier alle Möglichkeiten nutzte, seinen Körper zu trainieren. Das Gesicht war schmaler als früher, sein Haar grauer, der Schnäuzer entfernt. Doch diese Veränderungen waren unbedeutend. Stephan spürte, dass Maxim Wendel ein gebrochener Mann war. Jetzt, wo er ihn vor sich sah, ohne dass Wendel mehr als die wenigen Worte zur Begrüßung gesprochen hatte, offenbarte sich dieser Zusammenbruch in radikaler Nüchternheit. Wendels lange Briefe zeugten von einer Verzweiflung, die schon wegen ihrer vielen Worte nicht so markant überzeugten wie Wendels Gesichtsausdruck und mit ihm seine ganze Körpersprache, die in diesen erst wenigen Augenblicken Bände sprachen.
»Es ist das erste Mal, dass ich eine Justizvollzugsanstalt von innen sehe«, sagte Stephan frei heraus. »Sie wissen, dass ich kein Strafverteidiger bin. Ich habe während meiner ganzen bisherigen anwaltlichen Tätigkeit nicht einen einzigen strafrechtlichen Fall bearbeitet.«
Stephans Worte wirkten hölzern und entschuldigend. Sie wollten die von Wendel gehegten Erwartungen dämpfen, doch sie blieben wirkungslos.
Wendel sah Stephan eine Weile an. Dann lächelte er wieder, zaghaft und doch eigenartig ermutigend.
»Aber Sie sind doch hier, Herr Knobel!«, sagte er sanft. »Sie waren einmal mein Anwalt, und Sie werden wieder mein Anwalt sein.«
Wendel beobachtete Stephan gerührt weiter, als sei für ihn ein Wunder wahr geworden.
»Sie wissen, welche Voraussetzungen das Gesetz aufstellt, um einen abgeschlossenen Prozess neu aufzurollen?«, fragte Stephan geschäftsmäßig. »Die Hürden eines solchen Verfahrens sind extrem hoch.«
Wendel nickte. »Insbesondere müssen neue Beweise vorgelegt werden, die meine Unschuld belegen«, wusste er. »Ich hatte viel Zeit, mich in der Gefängnisbibliothek in das Strafprozessrecht einzuarbeiten. Ich weiß über diese rechtlichen Feinheiten im Moment vielleicht mehr als Sie selbst, Herr Knobel. Doch über diese Beweise verfüge ich nicht. Ich kann Ihnen nicht einmal eine Geschichte erzählen, wie es gewesen sein könnte. Sicher ist nur, dass ich in eine Falle getappt bin.«
»Herr Wendel…«, hob Stephan an.
»Sie haben 120 Minuten Zeit, Herr Knobel«, unterbrach ihn Wendel. Der Glanz in seinen Augen war verflogen. Er war augenblicklich auf die Sachebene übergewechselt.
»120 Minuten sind die maximale Besuchszeit eines jeden Strafgefangenen pro Monat«, erklärte er. »Ich habe die gesamten 120 Minuten des Monats Juni auf Sie gebucht, Herr Knobel. Wenn Sie eher gehen, können oder müssen Sie das tun. Es besucht mich hier ohnehin niemand. Also ist es egal, wenn die unverbrauchte Zeit verfällt. Die Zeitdimension in so einer Anstalt ist eine andere, glauben Sie mir.«
Wendel redete ruhig und abgeklärt. Stephan war sich unsicher, ob die wie abgerufen wirkende Gleichgültigkeit nur Teil einer Kulisse war, in deren Schatten Wendel sich in der Haftanstalt über die Zeit rettete, während innerlich ein Feuer zu lodern begonnen hatte, das ihm noch einmal Kraft gab, die eigene Befreiung aus der aussichtslos erscheinenden Lage zu versuchen. Doch Wendel konnte nichts liefern. Er hatte es gerade zugegeben. Er blieb stoisch dabei, den Rentner Gossmann nicht getötet zu haben. Wendel sagte nicht mehr und nicht weniger als das, was er gebetsmühlenartig immer wieder im Prozess behauptet und zuletzt den Richtern entgegengeschrien hatte. All dies hatte er auch Stephan geschrieben. Es war die Wiederholung des längst Bekannten. Stephan verzichtete darauf, Wendel darüber zu belehren, dass unter diesen Voraussetzungen ein Wiederaufnahmeverfahren sinnlos sei.
»Sie fragen sich, warum ich Sie überhaupt herbestellt habe«, vermutete Wendel und sah Stephan aufmerksam und seltsam provozierend ins Gesicht. »Wir müssen ganz von vorn anfangen«, sagte er weich, doch es klang, als habe er diesen Satz für das Gespräch einstudiert, um ihn an passender Stelle zu platzieren.
Stephan dachte an ihre gemeinsame Zeit zurück, in der er Wendel als durchgehend sturen und uneinsichtigen Menschen kennengelernt hatte, der wenig Bereitschaft zeigte, einen Perspektivwechsel zu wagen.
»Wenn es einen Anwalt gibt, der sich in die Sache richtig – und zwar von Anfang an– einarbeiten und die Wahrheit finden kann, dann sind Sie das, Herr Knobel«, fuhr er fort. »Ich weiß, dass Sie nie Strafverteidiger waren. Aber Sie werden die Wahrheit finden können, und wenn Ihnen das gelingt, werden die prozessualen Finessen nicht so schwer sein. Notfalls lassen Sie sich von einem Fachmann helfen.«
»Sie wurden im Mordprozess von Dr. Gereon Trost verteidigt«, entgegnete Stephan. »Er gilt als ausgewiesener Strafrechtsexperte. National anerkannt und renommierter Referent auf allen möglichen Tagungen.«
Wendel nickte.
»Sicher«, meinte er. »Und ich sage nichts gegen Dr. Trost. Aber er will keine Wiederaufnahme beantragen, weil er sie für aussichtslos hält. Das sage ich Ihnen ganz ehrlich. Ich hatte ihn bereits darum gebeten, als der Bundesgerichtshof meine Revision verworfen hatte. Über Monate, nein, über Jahre habe ich ihn immer wieder gedrängt, für mich tätig zu werden oder mir zumindest einen anderen Anwalt zu nennen, der mich vertreten könnte. Tatsächlich hat er mir vier oder fünf Anwälte vermittelt. Aber der eine interessierte sich nur halbherzig für den Fall und winkte ab, als ich ihm gestehen musste, dass ich ihn nicht würde bezahlen können. Zwei oder drei hielten mein Ansinnen schon nach bloßem Lesen des Urteils für chancenlos, und einer meinte sogar, dass ich darüber froh sein sollte, dass mir eine anschließende Sicherungsverwahrung erspart geblieben sei. Alle Beweise sprächen gegen mich. Für sie war ich der Täter. Darin waren sich alle einig. Genauso, wie ich für Dr. Trost nach wie vor der Täter bin. Trost sagte immer wieder, dass er die aus seiner Sicht schlüssige Argumentation der Staatsanwaltschaft nicht habe widerlegen können. Und neue Beweise, die aus heutiger Sicht zu einer anderen Beurteilung führen könnten, gäbe es nun mal nicht. Also keine Wiederaufnahme. Fertig.«
»In den Medien stand zu lesen, dass Sie unzweifelhaft die Tatwaffe in der Hand hatten, Herr Wendel. Sie haben das stets bestritten. Wie erklären Sie sich Ihre Fingerabdrücke auf der Flasche, mit der Gossmann tödlich an seinem Hals verletzt wurde? In einem Wiederaufnahmeverfahren müssen wir zu diesem Punkt etwas sagen können. Es nützt nichts, die Fakten zu ignorieren.«
Wendel schwieg einen Moment, ohne dass er sich mit Stephans Frage zu beschäftigen schien.
»Was macht Ihre Lebensgefährtin, Herr Knobel?«, fragte er stattdessen unvermittelt.
Stephan wich zurück. So kannte er Wendel. Die drängenden Fragen ließ er gern unbeantwortet im Raum stehen, wechselte nach seinem Belieben die Gesprächsebenen, brüskierte sein Gegenüber und gefiel sich offenbar darin, als Ignorant wahrgenommen zu werden.
»Sind Sie noch zusammen?«, fragte Wendel. »Sie hieß Maria, wenn ich mich recht erinnere.«
»Marie«, korrigierte Stephan. »Marie Schwarz.– Ja, wir sind noch zusammen«, bediente er Wendels Frage. »Wir sind Eltern einer kleinen Tochter. Sie heißt Elisa und ist jetzt acht Monate alt.«
»Glückwunsch!« Wendel nickte anerkennend. »Ihr Leben baut sich weiter auf, meines reduziert sich. Das ist ein schlichter Befund. Mein Leben hatte gerade erst in neue Bahnen gefunden«, erinnerte er sich. »Etwa ein Jahr vor der vermeintlichen Tat habe ich meine spätere Frau kennengelernt. Wenige Monate danach haben wir geheiratet, und unmittelbar nach meiner Verurteilung hat sie die Scheidung eingereicht. Das war meine Kurzehe, Herr Knobel. Mit einem Mörder wolle sie nicht länger verheiratet sein, schrieb ihr Anwalt im Scheidungsantrag. Meine vielen sexuellen Abenteuer mit anderen Frauen hätten sie gekränkt, aber der Mord hätte das Fass zum Überlaufen gebracht.– So etwas ist doch fast ulkig, oder?« Wendel lachte bitter. »Wissen Sie, es gibt hier Knackis, bei denen wächst durch die Haft der soziale Zusammenhalt mit ihrer Familie. Auf Distanz geht vieles besser. Man streitet nicht mehr, man schlägt sich nicht mehr. Die Frau weiß ihren Mann in sicherer Verwahrung. Sie, die von draußen kommt, ist endlich die Stärkere. Es gibt nur 120 Minuten im Monat, in denen man sich streiten könnte. Aber das Zoffen bleibt aus. Das eingesperrte Männchen hängt hier am Tropf…«
»Ihre Scheidung tut mir leid«, warf Stephan ein. »Ich wusste nicht einmal, dass Sie geheiratet hatten.«
»Ihnen muss nichts leidtun«, winkte Wendel ab. Er richtete sich auf und verschränkte die Arme vor der Brust. »Meine Frau hat ja recht: Ich war kein guter Ehemann. Ich habe reichlich Fehler. Schade ist nur, dass sie sich nicht wegen meiner Fehler von mir scheiden ließ, sondern deswegen, weil ich vermeintlich diesen Gossmann ermordet hätte. Also bin ich jetzt von einer Frau geschieden, die einen Fremdgeher als Ehemann wohl noch ertragen hätte, aber eben keinen Mörder. Wie auch immer: Unsere Ehe war schon zu Ende, als sie kaum begonnen hatte. Geblieben sind nur Schulden, die ich nicht begleichen kann. Natürlich musste ich auch die Kosten der verlorenen Prozesse tragen.«
»Geld ist ein gutes Stichwort«, merkte Stephan an.
»Ist es«, bestätigte Wendel, »und ich werde es nicht vergessen. Ich rieche förmlich, wie wichtig es Ihnen ist. Aber lassen Sie mich noch einmal auf Ihre Marie zurückkommen.«
Er lehnte sich vor und sah Stephan fest ins Gesicht.
»Sie und Ihre Marie waren es damals, die die gegen mich erhobenen Vorwürfe aus der Welt schafften. Ihnen gelang das, worauf es in diesem Fall ankommt: Sie haben auf das Detail geschaut. Und ich möchte, dass Sie es wieder tun, Herr Knobel! Sie haben einen Blick für das Detail, Sie und Ihre Marie.«
»Marie ist im Moment mit ihrer Mutterrolle ausgefüllt«, sagte Stephan. »Sie arbeitet stundenweise als Lehrerin, den Rest der Zeit nimmt Elisa ein. Marie kann nicht mehr in dem Umfang wie früher für mich arbeiten. Und ich bin beruflich kaum in der Lage, mich über Tage und Stunden in einen Fall zu vergraben.«
»Ach, tatsächlich?– Leiden Sie unter Arbeitsüberlastung?« Wendel warf Stephan einen spöttischen Blick zu und wandte sich dann von ihm ab. »Arbeiten Sie immer noch mit diesem fetten Löffke zusammen, der in der Prinz-Friedrich-Karl-Straße wie ein Graf in einer Villa residiert?«, fragte er und sah dabei an die Decke, als sei es ihm peinlich, Stephan mit seiner beruflichen Realität zu konfrontieren.
»Sie saßen damals im Mansardenbüro dieses protzigen Kanzleigebäudes.– Säulen vor dem Eingang wie bei einem kleinen Palast«, erinnerte sich Wendel.
»In der Mansarde sitze ich inzwischen wieder«, erklärte Stephan. »Allerdings sind Löffke und ich keine Sozien mehr. Ich habe mich von ihm getrennt. Wir sind nur noch eine Bürogemeinschaft.«
»Das zeugt von Charakterstärke«, lobte Wendel und nahm den Blick von der Decke. »Und jetzt?«, bohrte er weiter. »Sitzen Sie nun in Ihrer Mansarde und scheffeln Millionen? Haben Sie schon ein Haus für Ihre Familie gekauft?«
»Sehe ich danach aus?«
Wendel hob fragend die Schultern. »Vermutlich nicht«, sagte er. »Sonst wären Sie nicht hier. Das ist wiederum gut für mich, denn dann müssen Sie noch hungrig sein. Damals waren Sie es jedenfalls. Für scheinbar aussichtslose Fälle bekommt man offensichtlich nur die Anwälte, die sich für jeden Euro richtig ins Zeug legen müssen. Da nützt kein Advokat, der den Fall wirtschaftlich nicht nötig hat. Ich hätte Sie auch in dem Mordprozess als Anwalt gewollt, aber ich wurde sozusagen von Dr. Trost abgefangen. Wenn der allseits anerkannte Stern der Strafverteidigung für Sie tätig werden will, lässt man sich darauf ein, wenn man mit dem Rücken an der Wand steht. Zumal ich ja wusste, dass Sie kein Strafrechtler sind. Aber vielleicht wären Sie hungriger gewesen, Herr Knobel.– Sie, gemeinsam mit Ihrer Marie.«
»Meine damalige Tätigkeit für Sie betraf doch nur ein Fällchen«, relativierte Stephan.
»Fällchen?« Wendel schlug mit der Hand auf den Tisch.
Ein Justizvollzugsbeamter schaute missbilligend herüber und mahnte zur Ruhe.
»Wie reden Sie denn, Herr Knobel?«, ereiferte sich Wendel leiser. »Erinnern Sie sich denn überhaupt noch an das von Ihnen so genannte Fällchen?– Sind Sie zu stolz geworden? Zu bequem? Sind Sie ein zweiter Löffke, dem die fettige Suppe aus dem Maul läuft?– Sie können sich das gar nicht leisten, Herr Knobel! Ich habe ein Gespür für solche Dinge.«
»Sie und ich wissen, worum es damals ging, Herr Wendel«, entgegnete Stephan gelassen.
Doch Wendel entließ ihn nicht.
»Nein!– Schildern Sie meinen damaligen Fall!«, forderte er in einem Ton, in dem er früher seine Schüler angehalten haben mochte, seine Fragen zu beantworten. »Ich möchte wissen, ob Sie noch einen Riecher für die Gerechtigkeit haben.«
»Sie haben sich einer Schülerin zu sehr genähert«, antwortete Stephan. »Was soll das, Herr Wendel? Sie wissen doch, wovon wir hier reden.«
»Ich will Sie an das erinnern, was Sie für mich getan haben, Herr Knobel, und ich wünsche mir aus tiefstem Herzen, dass in Ihnen wieder der unbedingte Wille geweckt wird, sich der Gerechtigkeit verpflichtet zu fühlen, der Sie damals zum Sieg verholfen haben«, beharrte Wendel und merkte sofort, dass er mit seinen pathetischen Worten bei Stephan auf Widerstand traf.
»Bitte!«, sagte er weicher, »es ist mir wichtig!«
»Sie waren Lehrer für Chemie und Sport am Nordstadt-Gymnasium«, rekapitulierte Stephan. »Natürlich erinnere ich mich noch an die Details. Nach einer Chemiestunde in der Oberstufe wandte sich eine Schülerin an Sie. Ich glaube, sie war damals 17 Jahre alt. Die Schülerin forderte Sie auf, die von Ihnen vergebene Note des von ihr absolvierten Chemietests zu überprüfen. Sie hatte die Note ›mangelhaft‹ bekommen. Sie sagten, dass Sie die Note und den ganzen Test mit ihr in einem nahegelegenen Café besprechen wollten, das Sie dann am selben Tage nach Schulschluss mit der Schülerin aufgesucht hatten. Im Café saßen Sie mit der Schülerin an einem Ecktisch. Bei dem Gespräch, in dem es nach Angaben der Schülerin nur am Anfang um den Chemietest, dann jedoch um bestimmte sexuelle Vorlieben gegangen sein soll, hätten Sie der Schülerin an die Oberschenkel gefasst. Bei der späteren Überprüfung stellte sich heraus, dass der Test in der Tat von Ihnen bei dieser Schülerin zu schlecht benotet worden sei. Er hätte mit ›ausreichend‹, nach einer weiteren Meinung sogar mit noch ›befriedigend‹ bewertet werden müssen. Da Sie der Schülerin, eine für ihr Alter sehr reife und aufreizend gekleidete junge Frau, im Unterricht nach übereinstimmender Bekundung anderer Schülerinnen und Schüler häufig Blicke zuwarfen, wurde vermutet, dass Sie dieser Schülerin absichtlich eine schlechte Note erteilt hatten, um über ihren zu erwartenden Protest gegen die Note die Nähe zu ihr zu suchen. Es kam hinzu, dass Sie in der Vergangenheit auch anderen Schülerinnen in auffallender Weise nachgeschaut haben sollen. Die Disziplinarstelle bei der Bezirksregierung Arnsberg erteilte Ihnen daraufhin einen Verweis wegen Verstoßes gegen die Wohlverhaltenspflicht, weil Sie es an der gebotenen Distanz zu Schülerinnen vermissen ließen. Der Griff an die Oberschenkel der Schülerin konnte nicht bewiesen werden, sodass sexueller Missbrauch nicht im Raum stand.«
»Soweit der nüchterne Sachbericht des Juristen«, schnaufte Wendel. »Jetzt werden Sie mal ein wenig leidenschaftlicher!«
»Es gibt keinen Grund zur Leidenschaft«, gab Stephan kühl zurück. »Ich habe gegen die Verfügung der Bezirksregierung Klage erhoben. Wir haben beweisen können, dass die gegen Sie gerichteten Aussagen der Mitschülerinnen und Mitschüler auf einer Absprache beruhten, die das Ziel hatte, sich Ihrer als Chemielehrer zu entledigen. Sie galten als fachlich schwacher Lehrer. Aber es stand fest, dass Sie für diese– wie auch für andere, meist blonde, große Mädchen– eine Vorliebe hegten, sich dieser konkreten Schülerin jedoch nicht in vorwerfbarer Weise näherten. Dass Sie mit ihr zu einem Gespräch in das Café gegangen sind, war ungeschickt, doch wir konnten Gäste des Cafés ausfindig machen, die am Nachbartisch saßen und bekunden konnten, dass es während des ganzen Gesprächs nicht ein einziges Mal um Privates ging. Sie saßen nicht einmal nebeneinander oder über Eck, sondern einander gegenüber, sodass Sie der Schülerin auch nicht an den Oberschenkel greifen konnten. Deshalb haben wir den Prozess gewonnen. Es war reines Glück, dass wir den Beweis führen konnten. Ich habe nie verstanden, dass Sie so dumm sein konnten, sich einer solchen Falle auszusetzen. Sie wussten doch, welcher Ruf Ihnen an der Schule vorauseilte, Herr Wendel!«
»Es ist meine Sache, wo und wie ich meine Gespräche mit Schülern führe«, entgegnete Wendel unbeirrt und tat, als sei er noch im Schuldienst tätig.
»Sie galten schon damals als uneinsichtig«, erinnerte Stephan.
»Wir haben den Prozess gewonnen, weil Sie sich absolut für mich eingesetzt haben, Herr Knobel«, überging Wendel Stephans Vorhalt. »Wir haben gewonnen, weil Sie und Ihre Marie alles in diesem Fall von rechts nach links und zurückgedreht haben. So einen Anwalt brauche ich jetzt wieder. Deshalb will ich Sie, Herr Knobel. Ich brauche Sie!«
»Ich bin nicht unsensibel oder oberflächlicher geworden, Herr Wendel.« Jetzt lächelte Stephan. »Sie müssen mich nicht provozieren. Wenn mich nicht irgendetwas an der Sache reizen würde, wäre ich nicht hier. Aber ich bin unsicher.«
»Endlich! Gratuliere! Endlich ein Anwalt, der auch einmal unsicher ist. Ihr Kollege Dr. Trost war sich zu Beginn meiner Verteidigung sicher, dass ich freigesprochen werde. Doch als er die Beweisführung der Staatsanwaltschaft kannte, meinte er, dass es schwierig werde. Und als ich verurteilt war, prognostizierte er, dass unsere Revision keine Chance hätte. Leider hatte er recht behalten.« Wendel verzog zynisch die Mundwinkel.
»Ich kenne Ihren Fall nicht im Detail«, sagte Stephan. »Natürlich habe ich den Prozess wegen des Mordes an Rudolf Gossmann damals in den Medien verfolgt. Ich kenne die Geschichte aber nur in groben Zügen. Soweit ich weiß, sagten alle Zeugen übereinstimmend gegen Sie aus. Das Tatwerkzeug trug Ihre Fingerabdrücke. Und das Mordmotiv lag offen zutage. Ich bin mir sicher, dass der Kollege Dr. Trost alles versucht hat, was möglich war. Er gilt als Fuchs bei Strafverteidigungen und als ein Stratege, vor dem sich Staatsanwaltschaft und Gericht fürchten. Er lauert auf Verfahrensfehler und schlägt in jede Kerbe, die sich ihm bietet. Wenn ich einen Strafverteidiger brauchte, würde ich vermutlich Dr. Gereon Trost wählen.«
»Ich brauche nur die Wahrheit«, sagte Wendel nüchtern. »Wenn die Wahrheit auf dem Tisch liegt, brauche ich keine Verfahrenstricks. Ich habe Rudolf Gossmann nicht umgebracht, Herr Knobel.«
»Viele, die hier sitzen, werden bestreiten, der Täter gewesen zu sein«, war sich Stephan sicher.
»Zum Geld«, wechselte Wendel das Thema, ohne auf Stephans Einwurf zu reagieren.
Wendel hatte sich also nicht geändert. Jetzt, als Stephan erstmals seit Jahren wieder mit ihm redete, kehrten Details der früheren Begegnungen mit Wendel in seine Erinnerung zurück. Wie oft hatte Stephan in den Gesprächen mit Wendel darauf dringen müssen, konkret auf seine Fragen zu antworten, wenn Wendel abschweifte und sich auf das fokussierte, was ihm im Augenblick wichtig war? Immerhin hatte Wendel begriffen, dass Stephans Honorierung auch für ihn von entscheidender Bedeutung war.
»Ihnen ist klar, dass ich pleite bin«, sagte Wendel. »Doch wenn die Wahrheit ans Licht kommt, werden sich die Medien um die Story reißen. Ich verkaufe die Geschichte an ein Magazin, und die Honoraransprüche daraus trete ich an Sie ab, Herr Knobel. Sie werden an diesem Fall mehr verdienen als ein normales Verteidigerhonorar nach Gebührenordnung. Und denken Sie an den Reputationsgewinn!– Unbezahlbar…«
Stephan rollte mit den Augen. »Ich kenne die vage Aussicht auf Honorare, die aus Veröffentlichungen von Fällen gespeist werden sollen, Herr Wendel«, bemerkte er trocken.
»Sie werden keinen Mörder vertreten, dessen Tat Sie irgendwie dem Gericht als menschlich und rechtlich nachvollziehbar erklären müssen. Sie helfen einem Menschen, dem Unrecht widerfahren ist«, warb Wendel. »Weder Sie noch ich haben irgendetwas zu verlieren. Ich habe hier unendlich viel Zeit. Aber alles Nachdenken ist müßig, wenn ich meine Theorien nicht draußen auf ihre Richtigkeit überprüfen kann.«
»Sie hatten bereits im Prozess behauptet, dass man Ihnen den Mord an Gossmann unterschieben wollte«, sagte Stephan. »Ist das immer noch Ihre Theorie?«
»Welche denn sonst, Herr Knobel?«, fragte Wendel geduldig. »Wenn ich nicht der Täter war, ist das die einzig mögliche Theorie.«
»In den Zeitungen stand zu lesen, dass man diese Theorie genau untersucht habe. Aber es gab keinen einzigen Anhaltspunkt für ihre Richtigkeit. Es sprach alles gegen, aber nichts für Sie, Herr Wendel.«
»Machen Sie es, oder machen Sie es nicht, Herr Knobel? Ich kann nicht mehr anbieten, als ich gesagt habe. Es ist mein aufrichtiger Wunsch, dass Sie das Mandat übernehmen. Setzen Sie unsere Honorarabrede schriftlich auf! Ich werde alles unterschreiben. Seien Sie gewiss, dass ich Ihnen alle Fragen zur Sache wahrheitsgemäß beantworten und helfen werde, soweit ich es von hier aus kann. Nehmen Sie Kontakt zu Trost auf! Lassen Sie sich den Fall erklären! Ich bitte Sie, Herr Knobel, aber ich flehe Sie nicht an!«
Wendel sah Stephan mit eigentümlichem Stolz an.
»Ich habe das Flehen nicht nötig«, fügte er an, wissend, dass Stephan das Mandat nötig haben könnte. »Ja oder Nein, Herr Knobel?«
Stephan dachte eine Weile nach. Welche andere Frage Wendels hätte er bei seinem Besuch in der Haftanstalt erwarten können? Wunderte ihn, dass Maxim Wendel abermals seine Unschuld beteuerte, nachdem er dies bereits in jedem Brief getan hatte? War es nicht Wendels unerschütterliches Beharren, nicht der Täter des ihm zur Last gelegten Mordes zu sein, dass die scheinbare Aussichtslosigkeit des angetragenen Mandats hinterfragte und ihn herausforderte?
»Ich habe mich damals gewundert, dass Sie ausgerechnet mich mit Ihrer Vertretung in der Disziplinarangelegenheit beauftragt hatten«, sagte Stephan. »Angesichts des Ihnen vorauseilenden Rufes hätte ich an Ihrer Stelle einen Spezialisten beauftragt.«
»Einen Spezialisten?«, wiederholte Wendel erstaunt. »Wenn man weiß, dass man unschuldig ist, braucht man keinen Fachidioten. Ich hatte Sie nach dem Zufallsprinzip aus dem Telefonbuch ausgewählt. So einfach war das.«
»Aber Sie haben bei dem Mordprozess den Starverteidiger schlechthin beauftragt«, entgegnete Stephan.
»Ein Mordvorwurf ist schon ein anderes Kaliber als eine vermeintliche Tätschelei. Dr. Trost ist auf spektakuläre Fälle aus. Ich dachte, dass wir beide voneinander profitieren. Aber heute denke ich, dass ich jemanden wie Sie brauche: keinen Winkeladvokaten, sondern ein hungriges Trüffelschwein, das der Sache auf den Grund geht.«
Stephan zog eine Visitenkarte aus seinem Portemonnaie, notierte noch zusätzlich seine häusliche Festnetznummer darauf und gab sie Wendel.
»Sie sind noch hungrig, oder?« Wendels Augen leuchteten beglückt.
»Mich treibt nicht nur das Interesse an Ihrem Fall an«, bekannte Stephan und stand auf.
Er konnte sich nicht erinnern, einem Mandanten gestanden zu haben, dass seine wirtschaftliche Not ihn Fälle übernehmen ließ, denen er sich fachlich nicht gewachsen fühlte. Stephan fühlte sich zur Robenhure verkommen.
»Ich weiß«, nickte Wendel. »Sie brauchen Geld. Ich habe es geahnt. Sie säßen sonst nicht mehr in der Mansarde.– Wir sind beide hungrig, Herr Knobel!– Ich auf die Freiheit!– Lassen Sie sich von Dr. Trost die Akten geben. Ich werde ihn informieren, dass Sie mein neuer Anwalt sind.«
2
Dr. Gereon Trost galt als der Strafverteidiger schlechthin. Wer mit dem Gesetz in Konflikt geraten war, wollte bevorzugt von ihm verteidigt werden, doch Trosts Profession gestattete ihm nach knapp 30-jähriger Berufspraxis, nicht längst jedes strafrechtliches Mandat annehmen zu müssen, das ihm angetragen wurde. Die Verteidigung von Kleinkriminellen langweilte ihn regelmäßig, und die Täter schwererer Delikte hatten im Wesentlichen nur dann eine Chance, von ihm vertreten zu werden, wenn sie seine hohen Honorare zu zahlen imstande waren. Trost rechnete nicht über die Gebührenordnung ab, sondern vereinbarte mit seinen Mandanten stattliche Wahlverteidigerhonorare. Der gewöhnliche Kriminelle, finanzschwach und nur in den Deliktsgruppen rund um Hausfriedensbruch, Diebstahl, Betrug und Sachbeschädigung unterwegs, konnte bei Trost nicht landen, wenn der Fall nicht in irgendeiner Weise außergewöhnlich war und ihm deshalb Gelegenheit bot, über die mediale Wirkung Nutzen für sich zu ziehen. Nur dann fand auch der kleine Ganove Trost bei Trost, wie es in den einschlägigen Kreisen hieß. Zuletzt hatte Trost in einem aufsehenerregenden Prozess einen Landstreicher vertreten, der in das Weihwasserbecken einer katholischen Kirche uriniert hatte. Derartige Fälle fanden schnell in die Medien, vor denen Trost kanonartig das Credo wiederholte, das ihn zum Verteidiger aus Berufung machte: Jeder Straftäter, was auch immer er getan hatte, verdiene eine gute Verteidigung, die das Gegengewicht zu der staatlichen Macht zu sein hatte, die dem Angeklagten im Gerichtssaal in Form von Staatsanwaltschaft und Gericht gegenüber saß. Dr. Gereon Trost unterstrich unablässig, dass sein Beruf nicht nur Job, sondern Leidenschaft sei, ihm in jedem Fall aber Freude bedeute. Die Juristen, die mit ihm zu tun hatten, wussten, dass sich hinter diesen Worten nicht nur publikumswirksame Werbung, sondern auch ein Stück Wahrheit verbarg, denn Trost beherrschte gekonnt die Klaviatur der gesetzlichen Regelungen im Strafgesetzbuch und in der Strafprozessordnung, wenn er die Verteidigung eines Mandanten übernommen hatte. Eine Einstellung des Verfahrens schon im Ermittlungsverfahren mochte für den Mandanten günstig sein, für Trost indes war erst der Freispruch im Hauptverfahren das Salz in der Suppe. Deshalb hieß es, dass Trost seine Munition nicht bereits im frühen Stadium verschoss, sondern es lieber zur Anklageerhebung kommen ließ, um auf der Bühne der Hauptverhandlung mit Beweisanträgen, kunstvollen Fragen, juristischen Feinheiten und flammenden Plädoyers zu glänzen, die ihm den erhofften Sieg einbrachten.
Trost galt in seinem beruflichen Auftreten als arrogant, und er pflegte den ihm vorauseilenden Ruf, weil er wusste, dass ihm die dadurch erzeugte Ablenkung vom eigentlichen Fall zumeist die Chance bot, gleichsam einer lauernden Schlange hervorzuschnellen, um mit einem Überraschungscoup dem Prozess zur entscheidenden Wende zu verhelfen. Zu Trosts Selbstverständnis gehörte es, Strafprozesse vor dem Amtsgericht als fade Kost zu bezeichnen. Es war nicht nur die Banalität der hier verhandelten Vergehen, die ihn gähnen ließ, sondern auch die für ihn unattraktive personale Besetzung solcher Verhandlungen. Ein Amtsrichter und die Staatsanwaltschaft, die sich hier häufig nur von einem Referendar vertreten ließ, konnten seinen Ansprüchen nicht genügen, auch nicht das Amtsgericht als Schöffengericht, denn die beiden zusätzlichen Laienrichter, die Trost immer als Hausfrau Lieschen Müller und Hausmeister Anton Krause betitelte, waren am wenigsten dazu angetan, seine juristischen Hochseilakte nachzuvollziehen.
Trosts Welt war die Große Strafkammer vor dem Landgericht. Hier konnte er sich mit drei Berufsrichtern und der möglichst von einem gestandenen Oberstaatsanwalt vertretenen Anklagebehörde messen. Neben der gewichtigeren Besetzung der Großen Strafkammer war auch der Verhandlungsort ein ganz anderer als bei den Sitzungen des Amtsgerichts. Mühte sich der Strafrichter zumeist in kleinen Räumen, die allenfalls Wohnzimmergröße hatten und sich deshalb der Bezeichnung als Saal nicht würdig erwiesen, durch eine Vielzahl von Verfahren, tagte die Große Strafkammer in einem der großen Säle des Dortmunder Landgerichts. Ausgestattet mit schweren hölzernen Richterbänken und ebenso gewichtigem Mobiliar für die Verteidigung und die Staatsanwaltschaft und einem großzügigen Platzangebot für die Zuschauer, war dies die geeignete Bühne, die Trost zur Höchstform auflaufen ließ. Hier ließ sich wirkungsvoll plädieren. Hier konnte er, wenn er zu seinen rhetorisch brillanten Ausführungen anhob, seinen Platz verlassen und durch den Saal schreiten, den Blick gekonnt vom Gericht zu den übrigen Prozessbeteiligten schweifen lassen und sich insbesondere immer wieder dem Publikum zuwenden, in dem nicht selten zahlreiche Pressevertreter saßen, die er gern mit seinen rhetorischen Fragestellungen in seine Gedankenführung einband. Tagte die Große Strafkammer als Schwurgericht, ging es also um sogenannte Kapitalverbrechen, war der äußere Rahmen für Trost perfekt. Des öffentlichen Interesses an solchen Verfahren gewiss, präsentierte er sich glanzvoll und schnalzte mit der Zunge, wenn es ihm gelang, Zeugen, Staatsanwaltschaft und das Gericht aufs Glatteis zu führen. Dabei gab er sich äußerlich gern konziliant und nachsichtig und schnaufte genussvoll, wenn er registrierte, dass das Gericht bei seinen lichtvollen Ausführungen auf die auf der Richterbank präsente Kommentarliteratur zugriff, um sich der Richtigkeit der von ihm dargebotenen juristischen Feinheiten zu versichern.
Dr. Gereon Trost hatte vor Kurzem seine Kanzlei an den neuen Phönix-See im Dortmunder Stadtteil Hörde verlegt.
»Jugendstil war gestern, neue Sachlichkeit mit Ambiente und Lifestyle ist heute«, hatte er den Journalisten in den Block diktiert, als er sein altes Quartier in der Gartenstadt verließ, um seine neuen Büroräume in einem mit schwarzem Marmor verblendeten Haus zu beziehen, das in der Reihe der vielen vornehmen Neubauten in der ersten Reihe am Seeufer wie ein Edelsteinwürfel aussah und gleichzeitig Trosts neues Wohndomizil war. Die Zeitungen hatten berichtet, dass der seit 15 Jahren verwitwete 60-jährige sportliche Starverteidiger und Hobbysegler sich hier einen Traum verwirklicht habe. Das Foto zeigte ihn von seiner Terrasse winkend, die den unverbaubaren Blick auf den See bot, der nach jahrelangen Bodenmodellierungen eine Senke füllte, in der einst ein Stahlwerk stand, das diesen Stadtteil dominiert und mit Gestank und Dreck belastet hatte. Jetzt sah man über den See auf die lange im Schatten der Industrie verborgen gebliebene und aufwendig restaurierte Hörder Burg und mit ihr auf eine gänzlich neue Skyline, die alle Besucher des Sees als das Ergebnis einer wundersamen Wandlung empfanden und mit ungläubigem Staunen betrachteten.
Als Stephan Knobel seinen Kollegen in dessen neuer Residenz aufsuchte, wusste er sowohl von dem Zeitungsartikel über Trosts Umzug als auch– und im Besonderen– von dem Ruf, der dem Strafverteidiger vorauseilte und Stephan Respekt einflößte. Stephan war weit davon entfernt, sich wie Trost als Juristen aus Leidenschaft zu bezeichnen. Er haderte oft mit dem Beruf und zweifelte an dem Rechtssystem, das häufig die Gerechtigkeit hinter dem Recht zurückstehen ließ. Vor allem konnte Stephan Gerichtssäle nicht als eine für ihn geschaffene Bühne betrachten. Stephan Knobel empfand sich als Gegenentwurf zu Dr. Gereon Trost– und er war es auch.
Doch als Trost Stephan mit einladenden Worten in sein neues Büro bat, offenbarte sich eine ganz andere Seite des Starjuristen. Er begrüßte Stephan gelöst und herzlich, präsentierte stolz die gediegene Einrichtung und stellte ihm mit kindlicher Freude auch die technischen Besonderheiten des Büros vor, die es ihm unter anderem gestatteten, Besucher unbemerkt zu filmen und zu belauschen.
»Kommen Sie mir nicht mit der Vertraulichkeit des Wortes«, verteidigte er mit einem schelmischen Augenzwinkern sein in Sekundenschnelle preisgegebenes Geheimnis. »Als Anwalt muss man immer gewappnet sein. Der beste Mandant kann schnell zum ärgsten Feind mutieren. Da ist es gut, auf der Hut zu sein. Mir wird später keiner vormachen können, in diesem Büro irgendetwas getan oder gesagt zu haben, wenn es nicht der Wahrheit entspricht.«
Dann führte er Stephan auf die von dem Zeitungsfoto bekannte Terrasse und bot ihm den von ihm so bezeichneten Logenplatz an, der einen beeindruckenden Blick auf den am anderen Seeufer gelegenen Innenbereich des Stadtteils Hörde bot und sich mit der in der Sonne des frühen Abends glänzenden Oberfläche des Sees zu einem sehenswerten Panorama vervollständigte.
Trost fragte umsichtig nach Stephans Wünschen, servierte Orangensaft und Schokoladen-Dinkelkekse auf dem eleganten Glastisch, und Stephan lehnte sich entspannter in seinem Korbsessel zurück.
»Sie arbeiten mit Hubert Löffke unter einem Dach«, wusste Trost und lächelte. »Fühlen Sie sich wohl in der Aura dieses behäbigen Aufschneiders?«, preschte er vor und schenkte Saft ein. »Sie haben sich doch schon beruflich von ihm getrennt, warum nicht auch räumlich?«
Trost sah Stephan mit seinen wachen stahlblauen Augen forschend ins Gesicht, doch Stephan antwortete nicht.
»Ich kenne Sie nur aus der Akte des verwaltungsgerichtlichen Prozesses, den Sie seinerzeit für Wendel geführt haben«, sagte er. »Sonst weiß ich nur das über Sie, was mir das Internet verrät, das ich vorhin wie ein Orakel befragt habe. Aber ich schließe aus diesem von Ihnen für Wendel geführten Disziplinarverfahren, dass Sie ein heller Kopf sein müssen. Sie wie ich wissen, dass es unter Anwälten viele Idioten gibt, und Sie verzeihen mir meine Offenheit, wenn ich behaupte, dass Hubert Löffke ein Idiot ist.«
»Wie kommen Sie darauf?«, entfuhr es Stephan überrascht, obwohl er Trosts Einschätzung uneingeschränkt teilte.
»Löffke hält neuerdings Vorträge in Altersheimen«, antwortete Trost grinsend und genoss es, Stephan überraschen zu können.
»Thema: Klug vererben– beruhigt sterben.– Wussten Sie das? Ich habe das von einem mit mir befreundeten Heimleiter erfahren. Löffke kann doch nicht bei Trost sein!«
Er war über sein zufälliges Wortspiel amüsiert und lächelte vergnügt.
»Der Kerl ringt langsam nach Luft«, war er sich sicher. »Es ist wie überall, Kollege Knobel. Die Spreu trennt sich vom Weizen. Immer mehr Anwälte kämpfen ums wirtschaftliche Überleben.«
Trost schmunzelte. »Ich falle immer mit der Tür ins Haus. Das ist Ihnen natürlich längst bekannt! Aber so wissen Sie gleich, woran Sie sind. Und zugleich mache ich mir schnell ein Bild von Ihnen, Herr Knobel. Ich darf sagen: Es freut mich, dass Sie sich der Sache Maxim Wendel annehmen.«
Stephan blinzelte Trost unsicher an. Dessen Freundlichkeit und Offenheit überraschten und irritierten ihn. Trosts Freude darüber, dass Stephan Wendels Vertretung übernommen hatte, konnte nur Spott bedeuten.
»Gerade, weil Sie kein Strafverteidiger sind, Herr Knobel«, ahnte Trost Stephans unausgesprochene Gedanken. »Wendel hat mir aus der Haftanstalt geschrieben, dass er Sie beauftragt hat, in dieser Sache noch einmal alles zu durchleuchten. Ich soll Ihnen meine Akten von damals geben, und das tue ich natürlich.«
»Wendel hatte Sie schon kurz nach dem verlorenen Revisionsverfahren gebeten, eine Wiederaufnahme zu prüfen«, sagte Stephan.
Trost nickte, faltete andächtig seine Hände über seinem Bauch und sah eine Weile aufs Wasser.
»Ja, das hat er«, bestätigte er dann, »und ich weiß aus anderen Fällen, dass Verurteilte immer wieder eine Wiederaufnahme anstreben, weil sie das Ergebnis des Prozesses nicht für sich akzeptieren können. Stellen Sie sich vor, man schickt Sie lebenslang in den Knast. Wenn diese Botschaft erst einmal Ihr Inneres erreicht hat, wenn Sie also verstehen, dass in der Regel mindestens 17 bis 20 Jahre vor Ihnen liegen, bevor Sie überhaupt einen Antrag auf Entlassung stellen dürfen, dann bricht Ihre Welt zusammen. Jeder Mensch mit normalem Freiheitsdrang will raus. Die Wenigsten empfinden das Urteil als gerecht, selbst wenn es richtig ist. Also belügen sie sich und glauben, dass es ungerecht ist. Wiederaufnahme ist so ein Zauberwort, und viele verwenden es aus den unterschiedlichsten Motiven. Einige meinen, sie hätten gar nicht bestraft werden dürfen, weil sie vermeintlich nicht der Täter waren, andere, dass sie Opfer ungerechter Richter waren und so fort. Alles Unsinn!– Hinter dem Drängen auf eine Wiederaufnahme des Verfahrens verbirgt sich häufig nur die psychische Sperre des Verurteilten, das in der Sache richtige Urteil nicht gegen sich gelten lassen zu können. Ich verliere wie jeder Anwalt ungern Prozesse, aber manchmal kommt es eben doch vor. Es gibt Fälle, da helfen keine prozessualen Tricks. Auch der beste Anwalt kann nicht aus Schwarz Weiß machen. Und Sie wissen, dass ich nicht der Schlechteste bin.«
Aha, dachte Stephan und schlürfte seinen Orangensaft. Trosts Eigenlob war für Stephan erträglicher als dessen ehrerbietiges Gebaren, mit dem er Stephan zur Übernahme des Mandats Wendel beglückwünscht hatte. Stephan fühlte sich sicherer.
»Sie waren zu Beginn der Verteidigung Wendels der Auffassung, ihm zum Freispruch verhelfen zu können«, fasste er nach.
»Das stimmt«, bekräftigte Trost. »Aus heutiger Sicht muss ich sagen, dass ich mich damals völlig unprofessionell verhalten habe. Man darf es eigentlich nicht laut aussprechen: Ich hatte Maxim Wendels Version geglaubt, hatte mich von seiner Überzeugungskraft anstecken lassen und meine günstige Prognose abgegeben, obwohl ich noch nicht alle Beweise kannte, die die Staatsanwaltschaft in das Verfahren einführte.«
Stephan schüttelte erstaunt den Kopf.
»Ja, es war mehr als dilettantisch«, räumte Trost selbstkritisch ein, »und dieser Fehler relativiert sich nicht dadurch, dass mir solches in meiner langjährigen Karriere als Strafverteidiger kein zweites Mal passiert ist.«
»Hätten Sie Ihre Verteidigung anders aufgebaut, wenn Sie Zweifel an Wendels Version gehabt hätten?«, fragte Stephan.
Trost überlegte eine Weile, griff in Gedanken in die Vergangenheit zurück und ließ den Prozess Revue passieren.
»Ich denke, nein«, antwortete er schließlich. »Ich habe alle für Wendel streitenden Argumente verwertet und alle von der Staatsanwaltschaft vorgelegten Beweise hinterfragt, eigene Beweisanträge gestellt und wirklich alles getan, um den Fall aufzuklären und jeden noch so winzigen Aspekt herauszuarbeiten, der für Wendel sprach. Aber da war nichts zu machen. Die Beweisführung der Staatsanwaltschaft war hieb- und stichfest. Sie können sich denken, dass dies ein Ergebnis ist, das nicht meinem beruflichen Selbstverständnis und meinem Ehrgeiz entspricht«, meinte er und fügte selbstbewusst hinzu: »Ich bin eitel, Herr Knobel. Und demzufolge schätze ich es nicht, in meiner Eitelkeit gekränkt zu werden.«
»Für Wendel war es wohl schlimmer als für Sie«, entgegnete Stephan lakonisch.
»Natürlich war es schlimmer für ihn als für mich«, sagte Trost. »Er war wütend und schrie nach der Urteilsverkündung. Allerdings stellt sich die Frage, ob ein Mörder vom Ausgang des Prozesses enttäuscht sein darf, wenn es nicht gelingt, beim Gericht Zweifel an seiner Schuld zu wecken. Darf man enttäuscht sein, wenn einem nicht verdientes Glück versagt bleibt?«