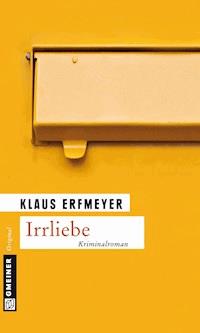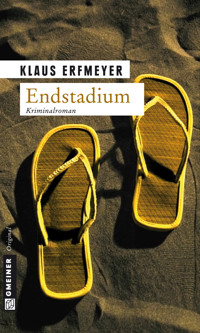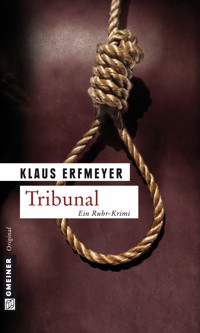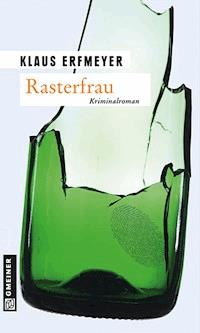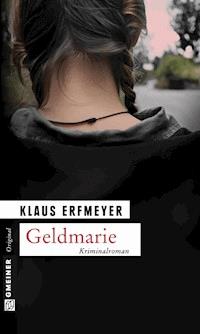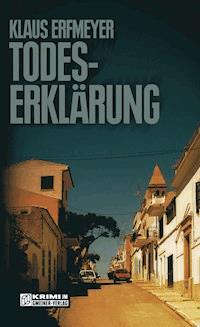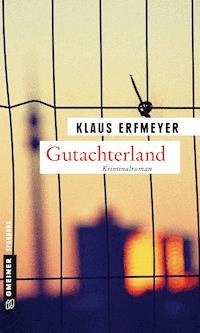
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Rechtsanwalt Stephan Knobel
- Sprache: Deutsch
Ehrgeiz und Können haben den arroganten Dortmunder Patrick Budde zu einem anerkannten Psychologen und Sachverständigen gemacht. Als sich seine Frau Miriam von ihm trennt, bittet er Rechtsanwalt Stephan Knobel darum, seine Ehe abzuwickeln. Doch der Routineauftrag nimmt schnell eine überraschende Wendung: Miriam verschwindet mit einem Mann, der nach einem früheren Gutachten Buddes ein gefährlicher Triebtäter ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 284
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Klaus Erfmeyer
Gutachterland
Knobels neunter Fall
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2015 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
1. Auflage 2015
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung: Benjamin Arnold
E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © bildamacha / photocase.de
ISBN 978-3-8392-4804-1
Haftungsausschluss
Für meine Tochter Liona Merita und meine Frau Anja
Kapitel 1
Der Portier hatte ihre Ankunft zu dieser späten Stunde nicht mehr erwartet. Es war kurz vor 23 Uhr, als ihn die Nachtglocke im Büro hinter der Hotelloge aufschreckte.
Das alte Hotel, in dem er nun seit drei Jahren im Wechsel mit einem Kollegen den Rezeptionsdienst leistete, lag nahe der Dortmunder Innenstadt unmittelbar neben der Bahnstrecke, die – auf einem Damm verlaufend – die hier beginnende Nordstadt mit ihren Sexlokalen und Spielhallen vom Zentrum trennte und wie eine Grenze zwischen sozialen Welten wirkte. Das Haus war über die Jahrzehnte von baulichen Veränderungen, die kosmetisch der Verelendung der Nordstadt Einhalt gebieten sollten, im Wesentlichen unberührt geblieben. Lediglich die alte Haustür war durch eine große Glastür ersetzt worden. Auch der Kreis der Hotelgäste war gleich geblieben. Zumeist stiegen Vertreter, Monteure und Geschäftsreisende hier ab, die eine einfache und kostengünstige Übernachtungsgelegenheit suchten und mit dem schlichten, aber verlässlichen Service des Hotels zufrieden waren. Die funktional und schmucklos eingerichteten Zimmer verfügten durchweg über aus den 70er-Jahren stammendes Inventar. Neu waren einzig die Flachbildfernseher, die Giuseppe Mantini, seit nunmehr fast 20 Jahren Eigentümer des Hauses und neben seiner Eigenschaft als Hotelier auch Betreiber zweier Pizzerien, in jedem der 20 Zimmer diebstahlsicher montiert hatte. Mantini wusste, dass seine Gäste nach ihrer Ankunft im Hotel dieses zumeist bis zum nächsten Morgen nicht mehr verließen, und folgerichtig hatte er sein Geschäft nicht auf gesellige Runden in dem ohnehin nur kleinen Aufenthaltsraum ausgerichtet, sondern auf häufig einsame Männer, die sich allein vom Fernsehen unterhalten ließen. Er verzichtete auf eine Bar in seinem Haus. Stattdessen bot er Getränke – bevorzugt Bier, süffigen Wein und Spirituosen – überteuert in einem im Foyer stehenden Automaten an, und ein an alle Zimmertüren geheftetes Blatt informierte über die üppigen Preise und Mantinis noch viel teureres Angebot, über die Bildschirme Erotikfilme konsumieren zu können. Der Hotelier vermutete nicht zu Unrecht, dass auch dieser Service ihn davor bewahrte, sein Haus mangels Gästen schließen zu müssen, denn er wusste, dass er mit einem verlässlichen Angebot für eine klar umrissene Zielgruppe besser fuhr als manche Konkurrenten, die es allen recht machen wollten und keinen Gast auf Dauer binden konnten. Mantinis Konzept war einfach: schlichte Zimmer, geringe Übernachtungspreise – und der ebenso sichere wie lukrative Zuverdienst aus dem Verkauf von Getränken und dem stets erweiterten Filmangebot. Er setzte auf das bezahlbare Minimum und servierte morgens ein im Preis inbegriffenes karges Frühstück. Es gab kein Buffet, keine Frischwurst und auch keinen Fruchtsalat. Kaffee und Tee standen in Thermosflaschen bereit. Jeder Gast bekam zwei Brötchen, Marmelade in verschweißten Döschen, portionierte Butter und Honig – das war’s. Mantinis Stammgäste indes wussten einen besonderen Service zu schätzen, von dem nur jene Kenntnis hatten, die sich das Vertrauen des Hoteliers erworben hatten oder sich auf die Empfehlung eines anderes Gastes berufen konnten: Wer sich unter diesen Voraussetzungen an Mantini wandte, wenn er selbst hinter dem Tresen Dienst schob, erhielt Kontaktdaten, die den Weg zur Erfüllung aller besonderen Wünsche der Gäste ebneten. Man erhielt Zugang zu Pokerrunden und Prostituierten, Vermittlern jeder Art von Diensten und Händlern von Waren, die legal nicht den Besitzer wechseln konnten. Mantini verstand, derartige Kontakte in einem ausgeklügelten System von Kontrolle und Gegenkontrolle zu vermitteln, das zum einen ihn und seine Kontaktperson schützte und zum anderen sicherstellte, das er die stets wechselnden Schlüsseldaten nicht aus der Hand gab. Wer den Kontakt ein zweites Mal suchte, musste erneut den Weg über Mantini wählen – und hierfür wieder im Hotel absteigen. Das Hotel war in Person seines Eigentümers zu einer Vermittlungsagentur unterschiedlicher Bedürfnisse und Geschäfte geworden, dessen Erfolgsrezept darin bestand, dass außer Mantini niemand Überblick über deren Art und Umfang hatte und er sein Wissen nur seinem Notizbuch und nicht seinen Angestellten anvertraute. Mantini hatte seinem Empfangspersonal eingeschliffen, dass sie es mit der Aufnahme der Personalien des Gastes nicht besonders genau nehmen mussten und großzügig darüber hinwegzusehen hatten, wenn sogenannte Servicedamen für einige Stunden im Hotel weilten und sich dort so selbstverständlich bewegten, als seien sie dort zu Hause.
Mantini entlohnte seine Herren am Empfang mit regelmäßigen Barzuwendungen, die er immer dann tätigte, wenn sie sich ihrer Vertrauensstellung in besonderer Weise würdig erwiesen hatten und gegenüber ihrem Chef mit gespieltem Desinteresse wortlos ihren Obolus dafür einforderten, dass alles in dem Hotel so reibungslos weiterlaufe wie bisher. Mantini quittierte diese zum Ritual gewordenen Forderungen mit der Hingabe von Fünfzig- oder Hunderteuroscheinen, die zumeist im stillen Einverständnis ihre Besitzer wechselten.
Mantinis Portiere brauchten Geld, viel mehr Geld, als sie mit ihrem Job hinter dem Tresen des alten Hotels redlich würden verdienen können.
Der eine war ein früherer Frisör, der seinen Salon aus wirtschaftlicher Not aufgeben musste, nachdem er als einst gefeierter Starfrisör hohe Umsätze und damit teure Autos fahren konnte, die er nach dem Niedergang des Geschäfts ebenso wenig zu bezahlen vermochte wie den Unterhalt für seine beiden noch immer schön anzusehenden Exfrauen.
Der andere war der, der am heutigen Abend im Hotel Dienst tat. Ein stiller Mann, Mitte 40, im Hotelfach zu Hause und mit besten Referenzen angesehener Häuser versehen, die Mantini ungläubig hätten aufsehen lassen, wenn er nicht aus dem Kreis seiner vertraulichen Gäste gewusst hätte, dass dieser Mann nicht mehr auf dem offiziellen Markt vermittelbar war und dringend Geld benötigte. Mantini hatte feinsinnig bemerkt, dass bei dem anderen etwas Dunkles auf der Seele lag – und er hatte erkannt, dass dieses Dunkel der Seele die beste Gewähr dafür bot, das er das Dunkel der Geschäfte Mantinis unangetastet ließ, wenn man sich nur wechselseitig in Ruhe ließe. Mantini hatte in diesem Mann den idealen Portier gefunden. Der Hotelier ahnte, dass diesen schlanken Portier mit seinen für dieses Hotel übertrieben scheinenden guten Manieren eine gewisse Verzweiflung nahezu demütig einen Job machen ließ, den er keinesfalls lieben konnte. Er würde ihn so lange ausführen, bis er eines Tages auf seinem rätselhaften Weg weitergehen musste. Deshalb spürte Mantini auch, dass der Zeitpunkt der Trennung nahte, und er bedauerte sie schon jetzt, wissend, dass die Loyalität des anderen dauerhaft sein und dessen Wissen niemals zur Gefahr für Mantinis Geschäfte werden würde.
Kapitel 2
Der Portier hatte das Büro und den Tresen seitlich verlassen. Er ging zu der großen Glastür, die zur Straße hinausging und der schmucklosen Außenfassade so etwas wie einen Blickfang bescherte. Wer von der Straße aus das Hotel betrachtete, konnte in der Dunkelheit durch die Glastür in das beleuchtete Foyer und an dessen Ende bis auf den Empfang blicken. Das Hotel wirkte hier einladend und transparent, und es schien, als hätte diese vor rund fünf Jahren getätigte Investition Mantinis ihren Teil dazu beigetragen, als verschleiere ausgerechnet der gläserne Zugang zum Hotel die krummen Geschäfte, die hier vermittelt wurden.
Ab 20 Uhr war der Eingang an jedem Abend verschlossen, und es war Sache des Portiers, ab diesem Zeitpunkt, zu dem auch stets der Nachtdienst begann, Besucher in das Haus zu lassen oder mit Gesten und Worten abzuwimmeln, wenn Gefahr drohte. Es oblag dem Portier, die von Mantini so genannte »Gefahrenlage« einzuschätzen. Einzige Weisung Mantinis war, die Polizei nur dann hineinzulassen, wenn ein Durchsuchungsbeschluss vorlag (dessen Aussehen und Inhalt er seinen Portieren vorbereitend erläutert hatte), und ihn in diesem Fall sofort zu verständigen.
Der Portier sah durch die geschlossene Glastür nach draußen. Die ohnehin nur notdürftige Straßenbeleuchtung verwandelte den feinen Novemberregen in grauweiße Schleier. Die Gestalt vor der Glastür verhielt sich still. Die Lampe unter dem Vordach wurde mittels eines Bewegungsmelders gesteuert und schaltete nach zu kurzer Zeit wieder ab. Der Portier fand mit gekonntem Griff den seitlich neben der Eingangstür in das Mauerwerk eingelassenen Taster, mit dem er die Vordachbeleuchtung händisch einschaltete, ohne dass er seinen Blick von der Person abwandte, die vor der Tür stand.
Jetzt erst sah er die Frau, die sich vor rund zwei Stunden telefonisch angekündigt und das Hotel ihren wispernden Worten nach von einem der wenigen verbliebenen öffentlichen Telefone aus angewählt hatte. Es war ein eigentümliches Telefonat gewesen – schon deshalb, weil nur selten Frauen in diesem Haus logierten, vor allem aber deshalb, weil sich ein Gespräch entwickelt hatte, das so anders war als die Telefonate, die der Portier üblicherweise mit sich ankündigenden Gästen führte.
Der Anruf war eingegangen, als sich der Portier in Erwartung eines ruhigen Freitagabends dem kleinen Fernseher gewidmet hatte, der dem Nachtdienst von 20 Uhr abends bis 5 Uhr morgens über die Zeit half, bevor der kleine und als solcher fast nie genutzte Aufenthaltsraum mit Frühstück einzudecken und den Gästen ab halb sechs zur Verfügung zu stellen war. Anrufe am Freitagabend waren selten. Gäste für die nächste Arbeitswoche (auch wenn es häufig nur eine vermeintliche Arbeitswoche war) hatten zumeist schon vorbestellt. Gäste, die sich nur für ein Wochenende einquartieren wollten, waren die Ausnahme.
Die Frau, die gegen halb neun an diesem Abend angerufen hatte, begann ihr Telefonat mit den Worten, dass sie sich nicht sicher sei, das Richtige zu tun.
»Ich überfalle Sie förmlich in der Nacht«, hatte sie gesagt und dabei unsicher gelacht. Der Portier hatte nicht sofort geantwortet. Sein Anstand und seine Intuition geboten, sich zurückzuhalten. Er wollte eine Frau, der der Anruf Überwindung gekostet hatte, nicht mit Worten lenken, die unangemessen wirken und falsch sein konnten. Er hatte einige Augenblicke in den Hörer gehorcht, doch es hatte keine Stille geherrscht. Der Portier hatte ruhig und hörbar geatmet. Er war unauffällig präsent, abwartend und einladend.
»Darf ich Ihnen weiterhelfen?«, hatte er schließlich unaufgeregt gefragt.
Warum hatte er sich interessiert gezeigt? War es die Höflichkeit, die ihm zu eigen war und die er auf der Hotelfachschule vervollkommnet hatte? Dort hatte er gelernt, fehlgeleitete oder belästigende Anrufe zuvorkommend abzuwehren. Nüchtern betrachtet war ungewiss, ob die Frau ein Zimmer suchte – insbesondere, ob sie ein Zimmer in diesem Hotel suchte. Also wäre es nicht falsch gewesen, ihrer Unsicherheit mit Verbindlichkeit zu begegnen. Er hätte sie auffordern können, sich präzise zu erklären, und sie hätte – das spürte er – das Gespräch beendet. Er hätte ungestört wieder fernsehen können. Spontangäste waren selten in diesem Haus. Mantini schätzte sie auch nicht – er witterte in diesen Fällen Gefahr. Er konnte sich keine Gäste vorstellen, die zufällig auf das alte Hotel in einer Seitenstraße hinter dem Bahndamm stießen.
Hätte der Portier die Frau abgewimmelt, hätte er alles richtig gemacht. Aber er machte es anders. Er eröffnete der Frau eine Option. ›Sucht die Nähe zu Frauen‹, hatte man ihm attestiert. Ein Satz, dessen Aussage so unschuldig sein kann – und die doch so fatal war. Der Satz deutete auf etwas Triebhaftes hin, als nähme mit der Suche nach Nähe ein böses Schicksal seinen Lauf. Es war nichts dergleichen. Er war sich seiner sicher, so sicher man sich seiner sein kann, wenn man sich selbst vertraut.
»Mein Anruf muss Ihnen merkwürdig erscheinen«, hatte sie gesagt.
»Warum sollte er?«, hatte er geantwortet, sofort spürend, dass er nicht ehrlich gewesen war. »Wir sind ein Hotel«, hatte er lapidar angefügt und sich augenblicklich aus der Unverbindlichkeit gelöst. »Auch als Portier bin ich natürlich Mensch.«
Er hatte über diesen dümmlichen Satz gelächelt, dann hatte er sich gefragt, warum er ohne Not den Damm einriss, den er soeben errichtet hatte. Mehr noch, er hatte ihr die Tür geöffnet. Er hatte sich auf die Lippen gebissen. Was war unnormal daran, sich einem Menschen zu öffnen, der auf der Suche war. Er war normal, würde sich nicht ins Gegenteil verkehren lassen, hatte nichts Unrechtes gemacht. Sucht nach Nähe … – Ja, warum nicht?
»Sie sollten bei der Telefonseelsorge arbeiten«, hatte sie erwidert. Ihre Stimme war bei diesem Satz gehoben, als hätte sie Kraft aufwenden müssen, um sich leicht zu geben.
Doch er spürte, dass ihr nichts leicht war.
›Neigt dazu, zu psychologisieren‹, zitierte er aus der Erinnerung. ›Versteckt seine Neigungen hinter dem scheinbaren Begehren, dem anderen helfen zu wollen‹, fuhr es ihm durch den Kopf.
»Habe ich Sie sprachlos gemacht?«, hatte sie gefragt.
»Nein«, hatte er mit Bedacht erst nach einigen Sekunden geantwortet. Seine Stimme war die ganze Zeit ruhig geblieben. »Ich habe mich in meinen eigenen Gedanken verfangen«, hatte er ihr erklärt. Er war ehrlich.
›Glaubt daran, dass das, was er sagt und denkt, gut und richtig ist‹, erinnerte er sich.
»Ich suche ein Zimmer – für eine Weile«, hatte sie schließlich gesagt. »Vielleicht nur für eine Nacht, vielleicht bis irgendwann – und irgendwann kann übermorgen, nächste Woche oder wann auch immer sein.«
Es war ein schnörkelloses Eingeständnis ihrer Hilflosigkeit gewesen. – ›Neigt dazu, zu psychologisieren …‹
»Wie kommen Sie ausgerechnet auf dieses Hotel?«, hatte er gefragt, als ihm ins Gedächtnis stach, dass Mantini ihn geohrfeigt hätte, wenn er erfahren hätte, wie arglos er das Hotel preisgab.
»Ich will nicht gefunden werden.«
Ihre Stimme war klar und hell. War es ihre Stimme, die ihn fesselte? Hätte er sich auf die Frau eingelassen, wenn sie mit brüchiger Stimme gesprochen hätte? Oder wenn sie rauchig und alt geklungen hätte? Was wäre gewesen, wenn die Frau geweint und ihr Schluchzen ihn in die Verantwortung genommen hätte? Er hätte sie abgewimmelt, wusste er. Das Telefonat gewährte wohltuende Distanz.
»Ich kann Ihnen keine professionelle Hilfe geben«, antwortete er knapp und eher, um Mantinis Distanzgebot zu genügen. Er musste sich herausziehen, einer Aufgabe entledigen, die er nicht übernommen hatte.
›Fängt die Menschen ein‹, erinnerte er sich, und die Erinnerung schlug unerbittlich zu. – Ja, alles was er ohne Hintergedanken und nur aus einer Laune heraus tat, konnte aus der Sicht eines Dritten ganz anders interpretiert und gegen ihn ausgelegt werden. Heute war er sich sicher, dass man für und gegen jeden Menschen alles finden, attestieren und begründen konnte. Jeder Mensch war grau, und es oblag allein dem Geschick eines Gutachters, sich der Klaviatur seiner Methoden und Theorien zu bedienen, um aus dem Farbgemenge das Weiß oder das Schwarz hervorzuheben. Er mochte die Frau am Telefon, ohne sie zu kennen und bisher auch nur einmal gesehen zu haben.
»Bekomme ich ein Zimmer?«
»Selbstverständlich«, antwortete er, ohne sich eilfertig oder anbiedernd zu geben. »Darf ich für Sie reservieren?«
»Ich komme im Laufe des Abends«, entschied sie. »Ich vermute, Sie haben noch Kapazitäten frei.«
»Ich möchte doch lieber Ihren Namen vormerken«, entgegnete er höflich.
»Miriam«, diktierte sie ihm durchs Telefon in den Notizblock.
»Und der Nachname?«
»Bitte, es kostet mich enorme Überwindung, überhaupt diesen Schritt zu gehen.«
»Machen wir später«, entschied er. »Ich werde da sein, wenn Sie hier ankommen.«
Der Portier näherte sich der Tür und winkte die Frau ins Licht der Eingangsbeleuchtung. Die Frau vor der Glastür war älter, als er sie vom Klang ihrer Stimme her eingeschätzt hätte. Sie mochte Mitte 30 bis 40 sein. Eine hochgewachsene schlanke Frau in einer dunklen Flanelljacke. Auf ihren schwarzen zusammengeknoteten Haaren glänzten Regentropfen.
Der Portier drückte den Türöffner.
Das laute Summen an der Glastür schien sie zuerst zu irritieren. Sie drehte sich noch einmal um, als müsse sie sich vergewissern, dass ihr niemand gefolgt war. Dann trat sie ein.
»Eigenartiges Gefühl, wenn man sich erstmals in die Augen sieht, nachdem man sich doch schon fast tiefgründig unterhalten hat.« Er lächelte verlegen, auch über seine gestelzten Worte. »Enttäuscht?«
›Sucht die Nähe zu Frauen …‹ – Nein, er verhielt sich nur nett.
»Sie tragen ja tatsächlich eine Uniform!«, spöttelte sie mit einem flüchtigen frechen Grinsen und wischte sich Regentropfen aus ihrem glänzenden Gesicht. Er sah ihre strahlend weißen Zähne.
»Ein Livree«, korrigierte er.
»Ich dachte, so etwas gebe es nur im Vier Jahreszeiten in München oder im Sacher in Wien …«
»Willkommen in Dortmund«, parierte er und deutete eine Verneigung an.
»Danke, ich komme aus dieser Stadt.« Sie trat in das Foyer.
Sie flüchtet vor ihrem Mann, ahnte er.
»Geht es Ihnen besser?«, erkundigte er sich.
»Nein. Wie sollte es?«
»Weil Sie gerade eben für einen Moment fast ein wenig gelöst wirkten.«
»Mir ist nicht zum Lachen zumute, auch wenn ich es zwischendurch immer wieder versuche«, erwiderte sie ernst.
»Haben Sie entschieden, wie lange Sie bleiben wollen?«, fragte er.
»Zunächst nur diese Nacht«, antwortete sie. »Dann sehen wir weiter.«
Er nickte.
»Ich zeige Ihnen Ihr Zimmer.« Er ging hinter den Tresen und nahm einen Schlüssel vom ledergepolsterten Brett, das noch aus der Anfangszeit des Hotels stammte und mit seinen verschnörkelten Messinghaken und den Schlüsseln mit ihren birnenförmigen Kunststoffanhängern, in die die Zimmernummern eingeprägt waren, fast museal wirkte.
»Brauchen Sie meine Daten?«, fragte sie.
»Nicht jetzt. – Außerdem wollen Sie doch nicht gefunden werden.« Er lächelte. »Folgen Sie mir bitte!«
Ihm war aus seinen Diensten in den großen Häusern bekannt, dass die verlässliche Vertraulichkeit den besonderen Wert eines guten Hotels ausmachte und neben allen Annehmlichkeiten im Service gerade die vom Gast eingeforderte Verschwiegenheit das Haus empfahl.
Er verließ den Tresen und ging durch das Foyer voran. Erst jetzt fiel ihm auf, dass sie kein Gepäck bei sich trug. Sie erriet seine unausgesprochene Frage.
»Ich bin einfach gegangen und über zwei Stunden umhergefahren«, erklärte sie. »Es war kein einfacher Entschluss für mich. Ich brauche jetzt nur etwas Ruhe.«
Er ging voran. Es kam so gut wie nie vor, dass er einem Gast sein Zimmer zeigte. Es gab auch nichts zu zeigen, was der besonderen Erwähnung wert gewesen wäre. Er kam sich lächerlich vor in seinem roten Livree mit den goldenen Epauletten.
»Ich gebe Ihnen die 16«, sagte er und stieg vor ihr die Treppe hinauf. Er hätte mit ihr den Aufzug benutzen können, aber er wollte die verlegene Nähe vermeiden, die sich in der engen Kabine unweigerlich ergeben hätte. Das Hotel verfügte über einen engen und mittlerweile über 50 Jahre alten Lift, der maximal drei Personen Platz bot, die sich eng aneinanderdrängen mussten, während sich die verbrauchten Falttüren unter lautem Zischen schlossen und nach ruckender Fahrt wieder öffneten. Der Portier hatte in früheren Zeiten während seiner Dienste in vornehmen Häusern die ankommenden Gäste wie selbstverständlich im Aufzug fahrend zu ihren Zimmern begleitet, und es war ihm stets ein Leichtes gewesen, mit höflicher und unverbindlicher Konversation die Momente des erzwungenen Nebeneinanders zu bestehen. Doch dieser Frau gegenüber konnte er weder schweigen noch in unverbindliches Plaudern zurückfallen. Der enge Lift wäre für ihn zur Falle geworden.
Woher sie kam und warum sie ausgerechnet in dieses Hotel ging? Das waren Fragen, deren Antworten ihn interessierten und die zu stellen er sich verbat.
Er sperrte die Tür zu Zimmer 16 auf. Ihm schlug jener muffige Geruch entgegen, der in jedem der 20 Zimmer waberte. Lüften nutzte nichts. Der Geruch stieg aus dem verfilzten Teppichboden auf, kam aus dem überalterten Mobiliar, das nie mit Pflegemitteln gereinigt und behandelt wurde, und er nistete in den staubgetränkten Vorhängen und den gilbenden Strukturfasertapeten.
Der Portier riss trotzdem das Fenster zum Innenhof auf, als könnte er damit Frische ertrotzen. Er sah einen Moment in den unattraktiven Hof, in dem im Schein einer Neonbeleuchtung der Regen lautlos aus einer bleiern wirkenden Luft auf den Boden trieb. Der Blick ging auf die verlassenen Büros eines Lageristen und auf Fenster der Häuser der Parallelstraße, von denen die meisten dunkel in die Nacht gähnten. Nur vereinzelt sah er Licht hinter den Fenstern, hier und da auch das bläuliche Flackern eines Fernsehers. Fast nie sah er Menschen, wenn er aus einem der Zimmerfenster in den Innenhof sah. Auch heute nicht.
»Brauchen Sie Zahnpasta und Zahnbürste?«, fragte er, als er sich umwandte.
Sie schüttelte den Kopf.
»Danke, ich habe mir das Nötigste vorhin noch in der Drogerie im Bahnhof gekauft. Haben Sie vielen Dank für alles!«
Sie holte die Utensilien aus ihrer Jacke, als wollte sie ihre Worte unter Beweis stellen.
»Sehe ich Sie morgen wieder?«
»Nur, wenn Sie ganz früh aufstehen. Mein Dienst geht nur bis sechs.«
»Danke noch mal!« Sie gab ihm ihre rechte Hand. Er spürte ihren festen Händedruck, sah in ihr Gesicht und wich ihrem Blick nicht aus.
»Wofür?«, fragte er und meinte es aufrichtig.
»Es wird schwierig im Leben, wenn die Konstanten wegbrechen«, sagte sie gepresst.
Er nickte und verbiss sich die Antwort, dass er wisse, was sie meinte.
»Es ist gut für heute«, schloss sie und ließ ihn an sich vorbeigehen.
Sie schob sanft die Tür ins Schloss. Der Portier ging nach unten und vergewisserte sich, dass die Glastür verschlossen und die Vordachbeleuchtung wieder ausgeschaltet war. Dann verschwand er im Büro. Die Leuchtstoffröhre flackerte und schlug leise dazu im Takt. Das Fernsehen lief noch immer. Er setzte sich in den alten speckigen Sessel, den Mantini von dem früheren Eigentümer des Hotels übernommen hatte, legte die Füße auf den Tisch neben dem Fernseher und verfolgte lustlos das Programm, wie er es immer tat, wenn er seinen Nachtdienst versah. Doch der Abend war besonders gewesen.
Kapitel 3
Stephan Knobel hatte der Feier zum 25. Jahr des Bestehens des Abiturs mit gemischten Gefühlen entgegengesehen. Von den meisten seiner früheren Mitschülerinnen und Mitschüler hatte er seit dem Ende der Schulzeit nichts mehr gesehen oder gehört, und er hatte seitdem auch das Schulgebäude, in dem die Feier stattfand, nie mehr betreten.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!