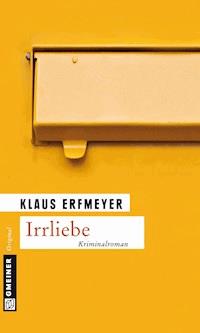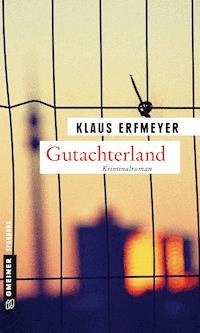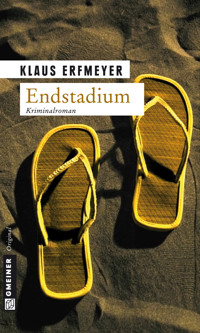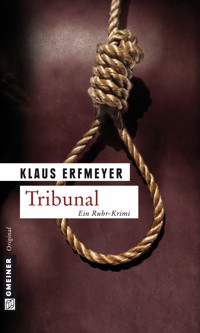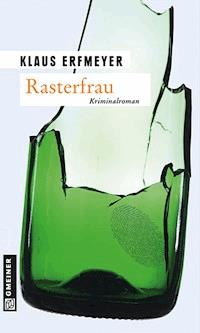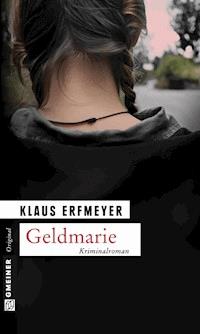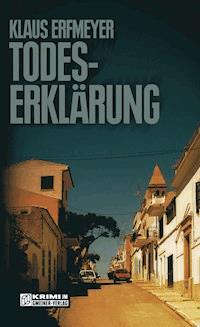
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Rechtsanwalt Stephan Knobel
- Sprache: Deutsch
Als der Dortmunder Rechtsanwalt Stephan Knobel von seinem neuen Mandanten Gregor Pakulla den Auftrag erhält, dessen verschwundenen Bruder Sebastian zu suchen, wundert er sich zunächst, warum Pakulla hierfür einen Anwalt benötigt. Aber der Fall klingt interessant: Die Geschwister sind die alleinigen Erben eines großen Vermögens. Doch ohne Sebastian kann Gregor seinen Anteil nicht kassieren - wird sein Bruder hingegen tot aufgefunden, erhält er sogar alles. Schnell wird klar, dass Gregor mehr weiß, als er zugibt. Knobel folgt Sebastians Spuren bis nach Mallorca, wo sich ihm ein bis ins Detail durchdachtes teuflisches Spiel offenbart.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 281
Veröffentlichungsjahr: 2009
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Klaus Erfmeyer
Todeserklärung
Knobels neuer Fall
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2007 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75/20 95-0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
1
Rechtsanwalt Stephan Knobel saß an jenem regenverhangenen Montagmorgen Anfang Februar seit bereits über zwei Stunden tatenlos hinter seinem Schreibtisch, als seine Sekretärin die Tür zu seinem Büro einen Spalt weit öffnete, ihren Kopf hineinsteckte und über die Gläser ihrer Lesebrille spähte. Sie sah die leere große Schreibtischplatte, dahinter die ausdruckslose Miene ihres Chefs und seine ungewöhnlich blasse Gesichtsfarbe.
»Ein neuer Mandant«, meinte sie unsicher, »er hat zwar keinen Termin, aber er sagt, es sei wichtig. – Übernehmen Sie ihn?«
Frau Klabunde trat nun ganz in sein Büro und schloss leise hinter sich die Tür.
»Herr Knobel?«
Ihr Tonfall verriet gleichermaßen Fürsorge und Neugier.
»Sie gefallen mir heute gar nicht. Ist Ihnen nicht gut?«
Sie hielt inne, hätte natürlich gerne insistiert und sich als geduldige Zuhörerin empfohlen. Stattdessen schwieg sie erwartungsvoll, hielt gebührliche Distanz und signalisierte zugleich, dass sie nicht eher gehen werde, bis sie eine befriedigende Antwort erhalten hatte. Frau Klabundes fülliger Körper stand wie eine Statue in seinem Büro.
»Es ist nichts«, log er. »Wie heißt der Mandant?«
Seine Stimme klang leise und klang gereizt.
Frau Klabunde überging seine Frage.
»Sie können mir nichts vormachen, Herr Knobel. Ich kenne Sie zwar noch nicht sehr lange, aber eine Frau hat dafür ein Gespür.«
Wie immer, wenn nach ihrem Eindruck etwas nicht stimmte, brachte sie ihr frauliches Empfinden ein, diente sich als Freundin an, ohne Freundin sein zu wollen.
Knobel nickte.
Tatsächlich hatte Frau Klabunde ein Gespür für alles, was nicht alltäglich war. Frau Klabunde hatte bereits Witterung aufgenommen, als er heute Morgen durch ihr Sekretariat geeilt, sie nur knapp begrüßt, sich jeglicher Nachfrage nach dem vergangenen Wochenende enthalten und sofort die Tür zu seinem Büro hinter sich geschlossen hatte. Doch Knobel schwieg. Sicher, er hätte so tun können wie nach jedem Wochenende. Er hätte launig in Frau Klabundes Sekretariat treten und berichten können, was er mit seiner Frau Lisa am Wochenende unternommen hatte, wie sich das sechs Monate alte Töchterchen Malin entwickelte und er hätte seinem Kurzbericht die Frage anschließen können, ob Frau Klabundes Wochenende angenehm gewesen sei. Sie hätte dies und das geantwortet. Voll wäre ihr Wochenende gewesen, wie jedes andere auch. Unverheiratete sind stets sehr aktiv, und Knobel hätte vielleicht noch ein oder zwei Details nachgefragt, pflichtschuldig ihre Antwort abgewartet und wäre mit den ritualhaften Worten Dann wollen wir mal wieder … in sein Büro gegangen.
Knobel hatte diesen Brauch heute vermieden.
Nicht, dass er diesen nicht mochte. Er hatte Frau Klabunde zu schätzen gelernt, mochte sie samt ihrer Eigenheiten und bediente ihre Erwartungen und Eitelkeiten, wie sie umgekehrt auch. Vor knapp eineinhalb Jahren war sie seine Sekretärin geworden, nachdem der Kollege Dr. Reitinger, dessen Mitarbeiterin sie gewesen war, infolge eines Herzinfarkts verstorben und Knobel innerhalb kürzester Zeit der ›Karrieresprung‹ gelungen war, zum Vizechef der Kanzlei aufzusteigen und das Büro des verstorbenen Kollegen zu beziehen. Knobels Karriere spiegelte sich in Frau Klabundes sichtbarem Wohlbehagen. Als Sekretärin des namensgebenden Partners der Kanzlei war sie selbst an herausgehobener Position angelangt. Ihre meist jüngeren Kolleginnen, die den anderen Anwälten zuarbeiteten, gerieten in ihren Schilderungen hin und wieder zu den jungen Mäusen aus den anderen Etagen, wenn sie blumig ihren eigenen Einsatz pries und mit dem Pfund ihrer langjährigen Erfahrung wucherte.
Als Knobel weiterhin schwieg, kapitulierte sie.
»Pakulla«, sagte sie, »der Mandant heißt Gregor Pakulla.«
Knobel nickte teilnahmslos.
»Einen kleinen Moment noch. Ich hole ihn gleich rein.«
Frau Klabunde verließ sein Büro
Warum hätte er ihr sagen sollen, dass Lisa ihm heute Morgen gesagt hatte, dass sie sich von ihm trennen werde. Sie habe lange gespürt, dass das Gefühl verloren gegangen sei. Und jetzt sei sie sich des Verlustes sicher. Sie habe es ihm sagen müssen, jetzt, nicht irgendwann später, in einem geeignet erscheinenden Moment. Und sie hatte hilflos gefragt:
»Wann ist für so was schon der geeignete Moment?«
Lisa hatte nervös und dennoch erleichtert gewirkt, dass sie ausgesprochen hatte, was sie belastete.
»Wir reden heute Abend«, hatte sie schulterzuckend angefügt.
Danach hatte er sich angezogen, als sei nichts gewesen, hatte das gemeinsame neue Haus in der Dahmsfeldstraße im Dortmunder Süden schweigend verlassen und war in die Kanzlei in der Prinz-Friedrich-Karl-Straße gefahren.
War etwas Großes passiert?
Knobel war nicht entgangen, dass ihr gemeinsames Leben nüchtern geworden war. Lisa hatte schon bald nach Malins Geburt wieder stundenweise in der Kanzlei ihres Vaters als Anwältin gearbeitet. Das Kind und ihre Berufe füllten ihr gemeinsames Leben, ohne dass es ihrer Gemeinsamkeit Glück bescherte.
Lisa hatte nur ausgesprochen, was er selbst empfand, und dennoch hatte ihre Nachricht in ihm ein Erdbeben ausgelöst. Die Kulisse war eingerissen. Der Tag würde ein Wendepunkt sein! Aus einem normalen Montag war ein ganz anderer – ein einzigartiger – Tag geworden! Ein Tag, an den er sich immer würde erinnern können! Die meisten Tage seines knapp 34-jährigen Lebens waren spurenlos in der Vergangenheit versunken und aus seinem Leben gefallen. Einzelne Erlebnisse aus der Kindheit und Jugend waren in lebhafter Erinnerung geblieben, aber gerade in den letzten Jahren hatte sich vieles verflüchtigt. Das Leben selbst war flüchtig geworden. Im Gegensatz dazu gab es Tage, die er wie jeder andere Mensch auch nicht nur in der Erinnerung behalten würde, sondern die er bis ins Detail rekapitulieren konnte wie etwa den 11. September 2001. Knobel erinnerte sich eigentümlich klar an alltägliche und deshalb unbedeutende Verrichtungen an diesem Tag, bevor am frühen Nachmittag die ersten Meldungen über die Anschläge im Radio gemeldet wurden. Vage Einzelnachrichten über einen möglichen Unfall bis zur diesen und die nächsten Tage beherrschenden Nachrichtenflut. Alle Einzelheiten dieses Tages waren in ihm lebendig geblieben, Einzelheiten eines einzigen Tages, denen Tausende vergessene und deshalb verloren gegangene gegenüberstanden.
Der heutige Tag, das wusste er, würde ihm im Gedächtnis bleiben.
Tage, die verändern, bleiben in Erinnerung.
Er würde sich an Lisas Worte erinnern, die nüchtern und feststellend klangen, nicht einmal zweifelnd formuliert waren und deshalb keinen Ausweg in eine gemeinsame Normalität bargen. Lisa hatte den Verlust ihrer Liebe diagnostiziert und offen ausgesprochen, was sie beide empfanden, ohne es sich gegenseitig einzugestehen. Der Befund war also nicht neu, aber er würde alles verändern.
Grübelnd darüber, dass und warum sich alles ändern würde, saß er nun seit halb neun an seinem Schreibtisch in Büro 102, rührte keine der Akten an, die auf einem Beistelltisch von Frau Klabunde sorgfältig gestapelt waren und beachtete ebenso wenig die Posteingänge, die wie immer direkt vor ihm auf der Schreibtischunterlage mit den dazugehörigen Vorgängen übersichtlich vorsortiert waren. Er hatte die Post, ohne sie eines weiteren Blickes zu würdigen, auf die Akten gelegt und von seinem Schreibtisch verbannt.
Knobel blickte auf das Foto neben dem Computerbildschirm, eine Aufnahme von ihm und Lisa mit der kleinen Malin auf ihrem Arm, aufgenommen im Spätherbst des letzten Jahres im Dortmunder Zoo. Dieses Bild, spürte er, war in die Vergangenheit gefallen. Er nahm das Foto von der Schreibtischplatte und legte es in eine der Schubladen. Knobel schämte sich für diesen schnellen Schnitt.
2
Knobel bat seinen Mandanten, Platz zu nehmen, und musterte ihn. Knobel sah dessen hagere Statur, ein schmales blasses Gesicht und Pakullas Stoppelhaarschnitt.
»Was kann ich für Sie tun, Herr Pakulla?«
Der Mandant fuhr sich unsicher durch seine blonden kurzen Haare. Sein unruhiger Blick ertastete flüchtig Knobels Büro.
»Ich bin nur zufällig auf Ihre Kanzlei gestoßen«, sagte er schließlich. »Ich bin vorhin beim Amtsgericht gewesen und habe mich entschlossen, einen Anwalt einzuschalten.«
Knobel lächelte.
»Dann haben Sie bis zu unserem Haus einige Kanzleien ausgelassen! Die Kaiserstraße, die Gerichtsstraße und alle Nebenstraßen sind ja voller Konkurrenz.«
Einladend fügte er hinzu:
»Es freut mich, dass Sie zu uns gefunden haben! Sie können sich denken, dass wir wegen der Anwaltsdichte in diesem Viertel nur selten Mandanten begrüßen dürfen, die zufällig herkommen.«
Seine schmeichelnden Worte verfehlten ihre Wirkung nicht. Herr Pakulla entspannte sich.
»Wenn man sich nicht auskennt, geht man allein nach Äußerlichkeiten«, erklärte er, »und da fällt Ihre Kanzlei natürlich auf. Schickes Jugendstilgebäude, herrschaftlich, seriös – vielleicht auch mächtig. Ganz sicher erfolgreich. So vornehm residiert hier niemand in der näheren Umgebung!«
Knobel nahm die Komplimente entgegen und merkte zugleich, dass Herr Pakulla sie kalkuliert eingestreut hatte. Mandantengespräche begannen oft mit ungelenken Worten, die die Fremdheit zwischen Anwalt und Mandant schlagartig überwinden, hastig eine Ebene der Vertrautheit planieren sollten, auf der man sich mitteilen konnte. Manchmal waren diese Mandantenworte vorauseilendes Lob, das des Anwalts vollen Einsatz gerade auch in diesem Fall einfordern sollte, manchmal auch nur ein vom Mandanten kreiertes Wunschbild, das seine Unsicherheit verdrängen und ihn in dem Glauben bestärken sollte, den richtigen Schritt getan zu haben. Doch Knobel war sich sicher, dass Gregor Pakulla mit seinen schmeichelnden Worten keine Unsicherheit vertreiben wollte. Pakulla hatte die Kanzlei Dr. Hübenthal & Knobel gezielt aufgesucht. Mächtig und erfolgreich – das waren Attribute, die ihn angezogen hatten. Pakullas hastige Blicke zu Beginn des Gesprächs waren allzu schnell verflogen. Nun saß er ruhig und ein wenig lauernd vor Knobel. Pakulla, der nach einem Termin beim Amtsgericht die Straßen im Osten der Dortmunder Innenstadt nach einer geeigneten Kanzlei abgesucht hatte, war nicht zaudernd vor dem Gebäude stehen geblieben, das auf den einen eher protzig und auf den anderen eher einschüchternd wirkte. Gregor Pakulla suchte genau diese Kulisse!
»Wir sind ein Team von Anwälten«, erklärte Knobel leidenschaftslos und in einem Tonfall, der verriet, dass er diese Worte dutzendfach zu Beginn eines Gesprächs benutzt hatte. Doch bevor er weiter ausführen konnte, warf Pakulla ein:
»Ich weiß: acht Anwälte, vier Anwältinnen. So stehts draußen auf dem Kanzleischild. Fünf davon sind Sozien, und Sie sind die Nummer Zwei der Kanzlei. – Ich habe im Wartezimmer Ihre Kanzleibroschüre gesehen.«
»Was kann ich für Sie tun, Herr Pakulla?«, wiederholte Knobel.
Sein Mandant lächelte verlegen.
»Natürlich, es ist fast ungehörig von mir, unangemeldet zu erscheinen und dann mit Gerede Ihre kostbare Zeit zu stehlen.«
Er sammelte sich.
»Es ist eigentlich kein Rechtsfall«, begann er zögerlich und registrierte dankbar Knobels aufmunterndes Nicken.
»Ich habe hier in Dortmund einen Bruder, Sebastian Pakulla. Sebastian ist drei Jahre jünger als ich, also 38. Unsere Eltern sind schon seit Jahren tot. Es gibt auch sonst keine Verwandten – außer unserer Tante, Esther van Beek. Sie ist vor rund drei Wochen gestorben. Tante Esther lebte zuletzt im Wohnstift Augustinum in Kirchhörde. Die letzten Jahre war sie blind und völlig auf fremde Hilfe angewiesen, aber sie gab sich nach wie vor so, wie jedes Kind sich seine Lieblingstante vorstellt. Ich will damit sagen, dass sie für mich nicht so etwas wie eine Lieblingstante war. Die Einzelheiten tun hier noch nichts zur Sache. Mitte Februar wäre die alte Dame 85 Jahre alt geworden. Nun, da Esther tot ist, sind wir beiden Neffen die einzigen Erben.«
Knobel hatte während Pakullas Schilderung auf einem Blatt flüchtig die Namen notiert und mit Strichen ihre Beziehung zueinander skizziert.
»Esther van Beek war die Schwester Ihres Vaters oder Ihrer Mutter?«, fragte er geschäftsmäßig.
»Esther war die einzige Schwester meines Vaters Heinrich Pakulla.«
»Und Ihre Mutter hieß …?«
Knobel blickte fragend von seiner Skizze auf.
»Edeltraud Pakulla, geborene Grabowski«, erklärte der Mandant und ergänzte, als müsse er den Namen Grabowski entschuldigen:
»Einzig unsere Tante Esther hat mit ihrer Heirat einen wirklichen sozialen Aufstieg geschafft. Sie hat kurz nach dem Krieg den holländischen Unternehmer Johann van Beek kennengelernt und sich nach Utrecht verheiratet. Vielleicht haben Sie seinen Namen schon mal gehört?«
Knobel verneinte knapp und vervollständigte seine Skizze.
»Nach Johanns Tod war Esther seine Alleinerbin und ist dann wieder nach Dortmund zurückgekommen«, fuhr Pakulla fort. »Sie ist in Holland nie richtig heimisch geworden.«
»Und Ihre Eltern sind bereits vorverstorben?«, wiederholte Knobel fragend Pakullas eigene Aussage.
»Vor Jahren schon, durch einen Unfall. – Kommorienten, wie man dazu sagt.«
Knobel stutzte. Der Begriff Kommorienten bezeichnete den zeitlich zusammenfallenden Tod mehrerer Menschen. Pakulla hatte den Begriff ohne Zweifel richtig gebraucht. Aber niemals würde man dies so sagen. Pakulla benutzte einen juristischen Fachbegriff wie beiläufig. Ihn zu benutzen erschien ebenso wenig zufällig wie Pakullas Wahl der Kanzlei.
»Und die Vorfahren Ihrer Eltern?«, fragte Knobel.
»Alle tot.«
Pakulla lehnte sich zurück und beantwortete die nächste Frage im Voraus:
»Weder mein Bruder noch ich haben Kinder oder Ehefrauen. Erbrechtlich ist es also ganz einfach: Es gibt lediglich eine Tante, deren einzige Erben mein Bruder und ich sind. Punkt.«
Knobel bemühte sich um einen milden Tonfall.
»Sie scheinen sich im Erbrecht gut auszukennen.«
»Man lernt am konkreten Fall – und das heißt im vorliegenden Fall durch das Nachlassgericht, von dem ich gerade komme.«
»Wie also kann ich Ihnen behilflich sein?«, fragte Knobel ungeduldiger.
Ein eigentlicher Fall zeichnete sich nach Pakullas Erläuterungen nach wie vor nicht ab.
»Ich habe nach Tante Esthers Tod einen Erbschein beantragt und auch erhalten. Aber handlungsfähig bin ich mit diesem Papier nicht. Ich komme nicht an Esthers Sparguthaben und ihr sonstiges Vermögen. Ganz zu schweigen von den Immobilien, die es noch in Holland gibt! – Um es kurz zu machen: Ich brauche für alle Geschäfte, also für die Erbauseinandersetzung, meinen Bruder als Miterben! Aber Sebastian ist nicht auffindbar.«
Gregor Pakulla hob ratlos die Schultern.
»Das ist Ihr Fall, Herr Rechtsanwalt: Suchen Sie meinen verschwundenen Bruder Sebastian.«
Knobel verschränkte seine Arme.
»Wir sind keine Privatdetektei, Herr Pakulla.«
Knobels Tonfall war kalt, seine Bemerkung nicht darauf bedacht, um Verständnis zu werben. Er blickte entschlossen in Pakullas Gesicht. Knobel mochte diesen Mandanten nicht. Er hatte gelernt, geschäftlich und geschäftstüchtig auch mit jenen umzugehen, die ihm persönlich nicht behagten. Doch bei Gregor Pakulla kam hinzu, dass dieser sich zu einem Zeitpunkt in Knobels Leben drängte, als ihn die morgendliche streitlose und deshalb viel ernsthaftere Trennung von Lisa bohrend beschäftigte, dazu das unangemeldete und scheinbar zufällige Erscheinen Pakullas störend wirkte und schließlich die langatmige Geschichte Pakullas nicht mehr abwarf als die Suche nach einem verschwundenen Bruder.
»Ihr Fall ist nichts für einen Anwalt!«, fasste Knobel zusammen.
»Sie sind arrogant«, gab der Mandant zurück.
Pakulla lächelte verschlagen.
»Sie wissen doch längst, dass ich extra einen Anwalt, genauer gesagt, bewusst Ihre Kanzlei aufgesucht habe und nicht einen Privatdetektiv!«
Und er fügte hinzu:
»Tante Esther hat ein Vermögen hinterlassen, es geht um richtige Werte, glauben Sie mir!«
Knobel wartete schweigend.
»Vielleicht kümmern sich in erster Linie Detektive um solche Angelegenheiten«, fuhr der Mandant fort, »aber bei Ihnen weiß ich die Angelegenheit in besseren Händen! Ich möchte nicht nur, dass Sie meinen Bruder finden, sondern dass Sie alle Dinge im Zusammenhang mit Tante Esthers Nachlass abwickeln. – Ich weiß, dass das alles mit größerem Zeit- und Arbeitsaufwand verbunden ist. Deshalb werde ich Sie nach Stundenaufwand bezahlen.«
Pakulla lehnte sich vor, griff in seine Gesäßtasche und zog ein Portemonnaie hervor.
»Schlage vor, 200 Euro die Stunde, Herr Rechtsanwalt!«, wobei er grinste und zwei 100-Euro-Scheine auf den Tisch legte.
Knobel saß noch immer mit verschränkten Armen da.
»Nun nehmen Sie sie schon!«, forderte Pakulla sanft, »wie Sie sehen, bin ich über Ihre Honorargepflogenheiten informiert. – Ich bin zu Ihnen gekommen, weil Ihre Kanzlei einen ausgezeichneten Ruf genießt.«
Knobel hob erstaunt die Augenbrauen.
»Das weiß ich von meinen Nachfragen bei den Rechtspflegern beim Dortmunder Amtsgericht. Und ich habe mir Ihre Website im Internet angesehen. Der Auftritt Ihres Unternehmens hat mich überzeugt! Sie definieren klar Ihre Konditionen und Ihre Leistungen. Was soll ich mehr sagen?«
Knobel löste sich.
Nicht, dass er Gregor Pakulla nun mehr mochte, aber sein Mandant hatte ihn überlistet. Wortlos schob er Pakulla ein Vollmachtsformular und die Mandatsbedingungen zur Unterschrift über den Schreibtisch.
»Sie werden es sich vielleicht schon gedacht haben«, fuhr der Mandant fort, während er flüchtig über die Schriftstücke blickte und sodann mit zackiger Unterschrift versah, »dass ich nicht aus Dortmund komme. Dortmund ist meine Heimat, aber nicht mehr mein Wohnsitz. Ich wohne seit 11 Jahren in Limburg. Und das ist ein Grund mehr, hier vor Ort jemanden zu haben, der sich im besten Sinne für mich einsetzt. – Und das sind Sie, Herr Knobel! Ich habe nicht die Zeit und nicht die Lust, hier weitere Recherchen anzustellen!«
Pakulla griff in die Innentasche seiner Jacke und zog ein Foto heraus.
»Das ist Sebastian am letzten Schultag mit seiner Abiturklasse. Sie sehen ihn in der hinteren Reihe ganz links. – Neuere Fotos habe ich nicht. Zuletzt war er in der Oesterholzstraße 16 im Dortmunder Norden gemeldet.«
Knobel wollte einhaken, aber Pakulla wehrte mit einer Handbewegung ab.
»Ich weiß, was Sie fragen wollen! – Wir haben seit einigen Jahren keinen Kontakt mehr zueinander. – Brüder entwickeln sich manchmal unterschiedlich. Sebastian ist Maler, ich bin Unternehmensberater für die Umstrukturierung von Weingütern geworden. Eine Marktlücke, die mich gut ernährt und mir immer weitere Kundschaft aus Rheingau und Pfalz zutreibt. Mehr brauchen Sie, denke ich, am Anfang nicht zu wissen!«
Pakullas Worte erklärten nichts und verlangten dennoch keine vertiefende Nachfrage. Knobel schwieg.
Er hatte den Auftrag angenommen. Gregor Pakulla raffte Vollmacht und Mandatsbedingungen zusammen und reichte sie mit den Geldscheinen über den Tisch.
»Mein Bruder wohnt nicht mehr in der Oesterholzstraße. – Wann und wohin er verzogen ist …?«
Er zuckte mit den Schultern.
»Keine Ahnung! – Zunächst ist es also ein Fall für Ihren Detektiv. – Mit wem arbeiten Sie professionell zusammen?«
»Sie werden aus dem Internet wissen, dass wir mit keinem speziellen Detektiv zusammenarbeiten«, erwiderte Knobel lakonisch.
»Gewiss, gewiss, deshalb ja meine Frage.«
Der Mandant gab sich ungeduldig.
»Aber natürlich fängt eine professionelle Kanzlei wie Ihre bei einem Auftrag wie meinem nicht damit an, hilflos das Branchenbuch zu wälzen.«
Pakullas Augen blickten angriffslustig.
»Natürlich nicht!«, beschwichtigte Knobel, ahnend, dass sein Mandant in diesem Moment nichts anderes als einen Griff zum Branchenbuch erwartet hatte. »Eine Studentin arbeitet in solchen Fällen für uns«, überraschte er und blieb vage.
»Eine Studentin?«
Pakulla schwieg einen Augenblick.
»Eine Jurastudentin?«
»Nein. Sie studiert Germanistik.«
»Also kennen Sie sie privat«, folgerte Pakulla.
»Nun ja – es soll mir egal sein.«
Er erhob sich.
»Das einzig Wichtige ist, dass die Sache bald geklärt ist. Ich möchte nicht, dass Sie Zeit vergeuden – und natürlich auch nicht mein Geld!«
»Sie müssen uns nicht beauftragen«, wandte Knobel ein und gab sich gelangweilt.
»Ich merke schon: Sie mögen mich nicht!«
Gregor Pakulla lächelte.
»Merkwürdigerweise ist es doch immer so, dass man sich für die, die man nicht richtig mag, besonders anstrengt. Man will denen gefallen, die anders sind als man selbst. Die muss man erst noch gewinnen. Es ist ein eigenartiger Ehrgeiz, der einen dann antreibt. Man will diese Menschen nicht, aber irgendwie reizt es, gerade von denen gelobt zu werden. Und natürlich achtet man peinlich genau darauf, gerade ihnen gegenüber keinen Fehler zu machen. Fehler sind immer besonders unangenehm, wenn sie einem Menschen gegenüber passieren, den man nicht mag. So was macht nackt und angreifbar. Ich glaube, Sie sind Perfektionist, Herr Knobel. Sie verzeihen sich Ihre Fehler nicht. Erst recht nicht, wenn der Fehler Sie ausliefert!«
»Sie überschätzen sich, Herr Pakulla!«
Sein Mandant deutete eine Verneigung an.
»Verzeihen Sie, Herr Knobel! Ich bin ein bisschen zu weit gegangen. Aber ich möchte, dass wir uns verstehen, und dass Sie sich wirklich für meinen Fall einsetzen. Sie sind einer der Besten. Ich habe mich erkundigt. Und für den Fall Ihres Erfolges gibt es ein saftiges Extrahonorar. Wir werden noch darüber sprechen. Ich werde mich nicht lumpen lassen, nehmen Sie mich beim Wort! – Tante Esther, ich sagte es bereits, hat viel hinterlassen, und ich will über meinen Anteil verfügen können. Nennen Sie mich raffgierig. Ich gebe zu, ich bin es. Ich spreche nur aus, was die meisten an meiner Stelle denken, aber nicht sagen würden. Ich will das Geld. Und ich möchte nicht immer wieder aus Limburg nach Dortmund anreisen und Sebastian suchen. Ich will schnellstmöglichen Erfolg.«
Gregor Pakulla sah seinem Anwalt ruhig ins Gesicht.
»Ich komme aus ärmlichen Verhältnissen, Herr Knobel. Hier in Dortmund haben wir damals in der Missundestraße am Nordmarkt gewohnt. Unsere Eltern hatten nur wenig Geld. Aber sie haben uns beiden das Abitur ermöglicht. Ich habe danach in Dortmund Wirtschaft studiert und sogar mein Diplom geschafft. Später bin ich nach Hessen gegangen. Sebastian hat nach dem Abitur ein Informatikstudium begonnen, aber nicht zu Ende geführt. Trotzdem war er in den Augen unserer Eltern immer der Bessere, der Begabtere. Alles, was Sebastian machte und plante, war stets über jeden Zweifel erhaben und fand den Gefallen unserer Eltern, wenn Sie verstehen, was ich meine!«
Knobel nickte, ohne richtig zu verstehen.
»Sebastians Leben ist leichter«, fuhr Pakulla fort, »weil er verantwortungslos ist. Er muss nie für die Konsequenzen seines Tuns einstehen. Wenn ihm etwas nicht gelingt, trennt er sich von seinen früheren Plänen und schlägt eine neue Richtung ein. Und plötzlich ist es so, als habe er nie etwas anderes vorgehabt. Er lebt seine neuen Pläne, und keiner hinterfragt seinen Kurswechsel. – Stellen Sie sich das vor: Er studiert Informatik und heute ist er Maler. Unsere Eltern haben sein Studium genauso finanziert wie meines. Doch während mein Werdegang keiner Erwähnung wert war und ich sogar als Versager galt, als ich in Dortmund beruflich nicht Fuß fassen konnte, hatten meine Eltern für meinen Bruder Verständnis. Sebastian lebt ein Leben, das mit dem Wertesystem unserer Eltern nichts gemein hat. Er lebt in den Tag hinein und verkauft sein Dasein als große Leistung. Eine seiner liebsten Formulierungen ist: Ich bin eben so. Sie müssen sich meinen Bruder Sebastian als jemanden vorstellen, der jede seiner Pleiten damit entschuldigt, dass das Leben ihm genau diesen Weg vorgezeichnet hat und er deshalb bar jeder Verantwortung ist. Das ist der tiefere Sinn, wenn ein Mensch zu seiner Rechtfertigung nichts anderes sagen kann als Ich bin eben so.«
Gregor Pakulla blickte auf seine Armbanduhr und kürzte ab.
»Ich denke, Sie verstehen mich jetzt, Herr Rechtsanwalt!«
Knobel bejahte.
»Also entsenden Sie Ihre Studentin, auf dass sie meinen kleinen und doch so großen Bruder finde!«
Pakulla zwinkerte ihm zu. »Wie war doch gleich ihr Name?«
»Wie Sie wissen, habe ich ihn bisher nicht erwähnt«, antwortete Knobel. »Sie heißt Marie Schwarz.«
»Marie!?«
Pakulla ließ den Namen nachklingen.
»Zeitlos schöner Name! – Und studiert Germanistik. Das steht doch für die schönen Dinge.«
Seine weichen Worte warben um Vertraulichkeit, doch Knobel erwiderte nichts.
»Nun gut.« Pakulla erhob sich.
»Ich muss jetzt gehen, Herr Knobel. Mein Zug fährt in einer halben Stunde. Sie können mir glauben, ich kenne den Fahrplan nach Limburg schon auswendig. – Sie melden sich, wenn Sie erste Ergebnisse haben?«
Knobel bestätigte das geschäftsmäßig, und sie trennten sich nach flüchtigem Handschlag. Er trat an das Fenster seines Büros und sah der kleinen schmächtigen Gestalt hinterher, die hastend die Straße überquerte und dann rechts in den Heiligen Weg entschwand.
3
Als sich Knobel wieder vom Fenster abwandte, war Hubert Löffke in sein Büro getreten, im rechten Mundwinkel die unvermeidliche Zigarette. Er hatte es aufgegeben, seinen Kollegen aus Büro 104 darum zu bitten, in seinem Büro nicht zu rauchen. Löffke ignorierte diese Bitten wie er keine Gelegenheit ausließ, Knobel seine Abneigung spüren zu lassen.
»Jeden Tag beginnt ein neues Match«, bemerkte Löffke seither häufiger gegenüber Knobel, was nichts anderes bedeutete, dass Knobel sich seiner Position in der Kanzlei nicht sicher sein sollte und auch nicht sicher sein konnte. Löffke würde nicht nur weiterhin in Knobels Büro rauchen, sondern gegen ihn intrigieren, bei Sekretärinnen und Anwälten Gerüchte streuen, die manchmal zu kleinen Geschwüren wuchern und manchmal im Keim ersticken würden. Knobel genoss in der Kanzlei hohes Ansehen. Deshalb mied Löffke den offenen Angriff, der zum Scheitern verurteilt sein musste. Aber er stichelte bei allen sich bietenden Gelegenheiten, stets bereit, sich wieder zurückzuziehen, wenn seine Anfeindungen nicht auf fruchtbaren Boden fielen. Der dicke Löffke war ein zäher Gegner, so alt wie Knobel, ausdauernd und nachtragend genug, um immer wieder seine Angriffe aufs Neue zu beginnen, von einer eigenartigen Lust getrieben, die ihn davor bewahrte, sich in der Rivalität mit Knobel zu verzehren. Löffke genoss die Reibung. Das machte ihn gefährlich. Knobel wusste, dass er Löffkes Provokationen nur ein Ende setzen konnte, wenn er seinem Widersacher offen entgegentrat. Doch ihm war ebenso bewusst, dass Löffke bisher keine Gelegenheit geboten hatte, ihn in der Kanzlei zu isolieren. Dr. Hübenthal schätzte Löffkes Erfolge in den von ihm betreuten Arbeitsrechtsmandaten, in denen sein grobschlächtiges Auftreten, seine Bauernschläue und sein manchmal kumpelhaftes Gebaren von Vorteil waren und die Kanzleiumsätze nachhaltig steigerten. Löffke erwarb die Gunst der anderen Anwälte und Sekretärinnen mit demonstrierter Hilfsbereitschaft, wenn er kleine Gefälligkeiten wirksam zelebrierte und sich mit gespielter Demut dem großen Ganzen, dem Unternehmen, der Kanzlei unterordnete, deren Erfolg er dienend mehren wollte. Noch mehr als dies bestachen die reichlich belegten Schlachtplatten, die er gelegentlich aus der Fleischerei seiner Schwiegereltern mitbrachte und deren schmackhafte Delikatessen er großzügig in der Kanzlei verteilte. Auch Knobel bedachte er mit gebratenen Steaks, Schinken oder Mettwürsten, und wenn Löffke die drei Etagen des Kanzleigebäudes an der Prinz-Friedrich-Karl-Straße mit dem üppig gefüllten Silbertablett durchschritt, zuerst Dr. Hübenthal in Büro 101 aufsuchte, um dem Senior den ersten Zugriff vorzubehalten, dann die anderen Sozien im Erdgeschoss, schließlich die angestellten Anwälte in den 200er und 300er Zimmern in den oberen Etagen und zwischendurch die Sekretärinnen bediente, damit sie sich nicht gegenüber den Anwälten zurückgesetzt fühlten, führte ihn sein letzter Gang zu Stephan Knobel, wobei er sich stets artig dafür entschuldigte, dass die Auswahl nun so klein geworden sei. Löffkes wulstiges Gesicht glänzte verschwitzt nach der körperlichen Anstrengung, die ihm der Marsch durch die drei Etagen der Kanzlei abverlangt hatte und Knobel fand, dass Löffke treffender einen Fleischerkittel als eine Anwaltsrobe tragen sollte, weshalb er zu Hause, wenn er von Löffke erzählte, nur von der Fleischwurst redete, aber er wusste auch, dass Löffke selbst diese Häme gezielt provoziert hatte und nur darauf wartete, dass er eines Tages in der Kanzlei abfällig über Löffkes Fleischgaben frotzelte. Knobel hütete sich vor solchen Schwächen.
Der Rauch von Löffkes Zigarette waberte ins Büro.
»Entschuldigung! Ich vergesse immer wieder, dass Sie schon lange Nichtraucher sind.«
Löffkes Augen suchten Knobels Schreibtisch ab.
»Schon Umsätze gemacht?«
Er deutete grinsend auf die 200 Euro, die dort noch lagen.
»Aber nicht ›schwarz‹ einnehmen«, lachte er scherzhaft.
»Ich dachte schon, Sie hätten kein Interesse mehr an unseren Postbesprechungen!«, fuhr er fort.
Die Postbesprechungen. Löffke hatte kurz nach Knobels Aufstieg dieses Ritual erfunden, wonach sich allmorgendlich um neun alle Anwälte im Büro des Seniors einfanden und unter dessen Vorsitz am schweren eichenen Besprechungstisch saßen, während vor dem Senior gestapelt alle Posteingänge des Tages lagen, die nun den einzelnen Sachbearbeitern zugeordnet wurden. Am Ende befand sich vor jedem Anwalt ein kleinerer oder größerer Stapel Posteingänge, und einer Anregung Löffkes folgend wurde allmorgendlich der Postkönig auserkoren, der stets derjenige war, der die meisten Eingänge auf sich vereinigen konnte. Selbstverständlich gewann Löffke meistens diesen Wettbewerb, und seine Nachfrage nach Knobels Verbleib bei der heutigen Postbesprechung ließ nur den Schluss zu, dass sein Widersacher wiederum den Sieg davongetragen hatte. Also bediente Knobel mit keinem Wort dessen Lieblingsthema. Unverrichteter Dinge wandte sich Löffke wieder der Tür zu, drehte sich im Türrahmen noch mal um und erfand einen ungelenken Reim:
»104 kämpft wie ein Stier, 102 bleibt von Arbeit frei!«, worauf er herzhaft lachte, nochmals den Rauch wolken ließ und dann die Tür von außen zuwarf.
Knobel blieb fröstelnd zurück. Unkonzentriert diktierte er eine Einwohnermeldeamtsanfrage nach dem Verbleib von Sebastian Pakulla, zuletzt wohnhaft Oesterholzstraße 16. Frau Klabunde bat er, die neue Akte Pakulla, Beratung
4
Es war noch nicht 12 Uhr, als Knobel wieder nach Hause fuhr. Löffkes Attacke hatte ihre Wirkung nicht verfehlt. Hätte sein Konkurrent nur eine Ahnung von Knobels morgendlichem folgenschweren Gespräch mit Lisa gehabt, Löffke hätte ohne Zweifel zu seiner Höchstform gefunden. Er malte sich aus, wie der Mann seine Zigarette gelöscht, Fürsorglichkeit geheuchelt und vielleicht sogar angeboten hätte, die eine oder andere Akte von Knobel zu übernehmen, um unter dem schützenden Mantel gespielter Solidarität tieferen Einblick in Knobels Arbeitsstil zu gewinnen. Löffke sammelte immer und überall Informationen, und Knobel vermutete, dass sich Löffke hin und wieder abends in sein Büro stahl und in seinen Akten blätterte. Nachdem Knobel erstmals diesen Verdacht gehegt hatte, gewöhnte er sich an, sich die genaue Lage einzelner Akten auf seinem Schreibtisch einzuprägen, wenn er sich sicher war, dass außer ihm und Löffke niemand mehr im Hause war. Am nächsten Morgen lagen die Akten zwar immer noch in der eingeprägten Reihenfolge, aber ihre Position hatte sich geringfügig verändert. Eines Tages hatte Knobel Löffke mit der beiläufigen Bemerkung gelockt, dass er eine umsatzträchtige Akte nicht richtig zu bearbeiten wisse und bereits fürchte, einen folgenschweren Fehler gemacht zu haben. Löffke hatte beiläufig und gönnerhaft geantwortet, dass in einer Sozietät auch jeder mal Fehler mache und nach zeitraubendem Abschweifen in andere Themen die erwartete Frage nicht unterdrücken können, wie denn die Akte heiße. Knobel hatte ihren Namen genannt, dabei gekonnt einen Tonfall angeschlagen, als gebe er beichtend ein Geheimnis preis und sich dann bedrückt mit den Worten verabschiedet, dass er alles zu Hause noch mal überdenken wolle.
Morgen ist auch noch ein Tag, hatte er belanglos geredet und sich für Löffkes aufmunterndes Wird alles schon werden bedankt. Am nächsten Morgen lag die Akte exakt an ihrem vorherigen Platz, doch das Haar, das Knobel sorgsam zwischen Seite 20 und 21 gelegt hatte, war verschwunden. Löffke hatte ohne Zweifel in der Akte geblättert. Aber was half ihm dieser Beweis, der nur die Richtigkeit seiner Vermutung bestätigte? Er würde seinen Beweis nicht gegen Löffke verwenden können. Dr. Hübenthal wäre entsetzt darüber, dass Knobel eine Akte als Köder ausgelegt hatte. – Und Löffke? Er würde sich zutiefst betroffen darüber zeigen, dass Knobel seine Hilfsbereitschaft missdeute, sich in eine Akte, mit der Knobel nicht zurechtkomme, einarbeiten zu wollen. Etwaige Zweifel hätte Löffke am nächsten Tag mit einer Schlachtplatte erstickt.
Am meisten beschäftigte Knobel, dass Hubert Löffke so sehr in sein Leben eingedrungen war, dass sich seine Gedanken nicht von dieser Gestalt befreien konnten, nicht einmal an einem Tag wie heute, auf dem Lisas Worte lasteten. Jetzt, auf der Rückfahrt von der Kanzlei in ihr schönes Haus in der Dahmsfeldstraße, dachte Knobel an Löffke und nicht an die anstehende Trennung von seiner Frau.
Als er nach Hause kam, spielte Lisa mit der kleinen Malin im Kinderzimmer. Sie nahm das Kind auf den Arm und blickte ihn fragend an.
»Ärger mit der Fleischwurst«, erklärte er und entledigte sich seiner Krawatte.
Warum knüpfte er nicht an das morgendliche Gespräch an, bekannte sich nicht dazu, dass jetzt nichts so wichtig sei wie ein Gespräch über ihre in Scherben zerbrochene Beziehung? Wie unpassend war in diesem Moment der Begriff Fleischwurst, von beiden als lästerliche Bezeichnung für Löffke gewählt, als sie sich, noch vor Lisas Schwangerschaft, einen schönen Abend gemacht, Wein getrunken, sich so gut wie selten unterhalten und anschließend miteinander geschlafen hatten.
Ein Abend, an dem der eine Gedanke den anderen gebar, ein Wort das andere gab und sie sich schließlich still streichelten, einander fühlten. Der bis dahin gewucherte Zweifel war mit einem Mal wie weggeblasen, eine verloren geglaubte Realität schien wieder eine Chance in ihrem Leben zu bekommen. Aus diesem Glück heraus waren Zukunftsideen geboren worden, bunte Mosaiken, die sich an diesem Abend zu einem Ganzen fügten, das nach einem Morgen gierte, als werde es immer so weitergehen. Ein Abend, an dem Glück und Zufriedenheit überliefen und die vage Hoffnung keimte, dass dieses Glück in ihre Zukunft führe.
»Löffke ist ein gefährlicher Gegner«, antwortete sie.
Ihre Antwort befreite ihn. Sie ließ sich darauf ein, diesen Montag wieder zum Alltag werden zu lassen. Knobel spürte, dass er mit Lisa jetzt auch über den neuen Mandanten Pakulla hätte reden können, und sie hätte sich nach den Einzelheiten des Falles erkundigt, wie immer, wenn er ihr das Nachfragen nahe legte. Wie oft schon waren sie an kritische Stellen geraten, in denen sich ein Schweigen wie ein gähnender Abgrund auftat? Wie oft hatten sie in solchen Augenblicken über ihre Arbeit eine Brücke gefunden, die sie manchmal holprig und manchmal weich und bequem eine Ebene finden ließ, auf der sie sich aufhalten konnten, ohne dass dort irgendein Zauber zu finden gewesen wäre, der ihre Seelen wärmte oder ihre Herzen berührte. Wie sehr war das Kind auch die Verwirklichung des Wunsches gewesen, hier eine Lücke zu schließen, die starr zwischen ihnen blieb.
»Das Kind rettet!«, hatte er einmal gesagt und fühlte sich unversehens an die alte Frau erinnert, die in grauer Kutte über den Dortmunder Westenhellweg lief und ein Schild mit der Aufschrift Jesus rettet trug. Das Kind hatte nicht gerettet! Malin schaute ihn friedlich mit großen Augen an. Er streichelte seiner Tochter über den Kopf und berührte Lisa sanft an der Schulter.
»Wir haben doch alles«, sagte er schließlich und wollte einiges von dem aufzählen, was sie in kurzer Zeit erreicht hatten. Ein Kind, ein schönes Haus im Dortmunder Süden, keine finanziellen Sorgen. Nicht, dass das Materielle alles wäre.
»Ja, alles«, antwortete sie und küsste Malin auf die Stirn. Der Tag draußen war schön geworden. Der Regen hatte sich verflüchtigt. Ein kalter Wintermorgen. Sonne, die das weite Wohnzimmer erfüllte. Möbel und Accessoires, warm und wohnlich, Symbole, die für Leichtigkeit standen. Lisas schwere Worte wollten jetzt nicht wiederkehren. Trennungen bespricht man nicht tags-über. Gespräche, die beschließen, fügen sich nicht in den laufenden Tag.
»Lass uns noch mal nachdenken!«, meinte er, und sie nickte.
Knobel verließ das Haus zu einem langen Spaziergang durch die Bittermark, trank schließlich in dem biederen Waldhotel Hülsenhain ein Bier und sah den westlichen Teil Dortmunds weit hinten im Tal, Kraftwerke im Hintergrund und einen misslungenen Tag hinter sich. Spitze Pfeile seines Erzfeindes Löffke, ein neuer Mandant, den er nicht und der ihn nicht mochte und das Erdbeben mit Lisa, das bald die endgültige Trennung als Nachbeben nach sich ziehen würde. So friedlich, wie sie einander heute Mittag gegenüberstanden, waren sie meistens. In den schlimmsten Momenten waren sie friedlich. Sie stritten nicht, sie schlugen keine Türen, fluchten nicht, verwünschten nicht, liebten nicht. Sie wünschten sich, sich zu lieben. Sie verstanden sich gut. Doch das Verstehen klebte zwischen ihnen wie eine zähe Paste, die keinen entließ und jeden an seinem Glück hinderte.