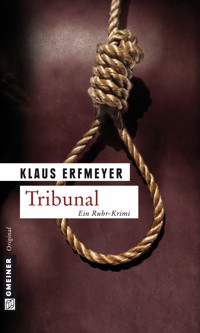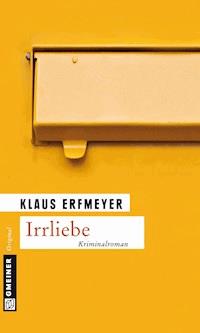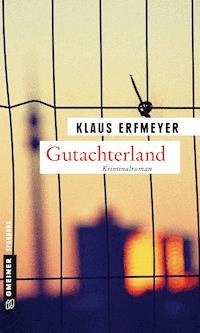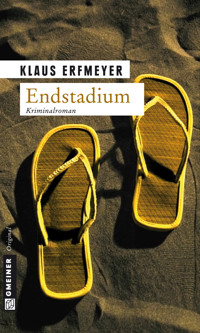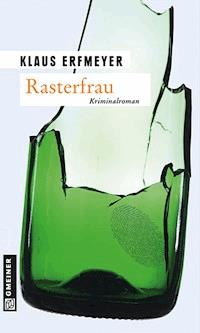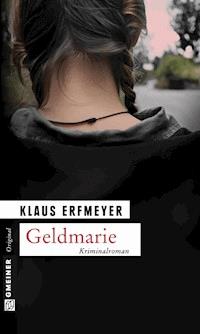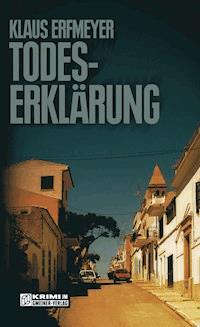1.
Dortmund. Ortsteil Syburg. Stephan Knobel folgte konzentriert Löffkes Wagen. Er seufzte. Warum hatte er sich überhaupt auf diese Sache eingelassen? Weil Marie dazu geschwiegen hatte? Die Straße wurde schmal und führte in engen Kurven steil hinunter ins Tal. Irgendwo hier in der Nähe, noch auf Dortmunder Stadtgebiet, sollte das Haus des Psychologen Paul Bromscheidt liegen. Bromscheidt hatte Stephans Sozius Löffke vor einigen Tagen in der Kanzlei angerufen, um ihn für einen Publikationsbeitrag zum Kulturhauptstadtprojekt zu gewinnen. Es gehe um ›Justiz und Gewissen‹, und so, wie sich Löffke aufgeplustert hatte, schien man ja geradezu darauf gewartet zu haben, sich auch in der kulturellen Öffentlichkeit seiner überragenden Kompetenz zu versichern.
»Bromscheidt wird alle Fragen beantworten«, hatte Löffke kryptisch knapp beschieden und ein Treffen arrangiert.
Offensichtlich witterte Löffke mit der Publikation die Chance zur ruhmreichen Denkmalspflege in eigener Angelegenheit. Dabei fehlte ihm zum Schreiben durchaus das Talent. Er pflegte weiß Gott keinen ausgefeilten Sprachstil. Seine anwaltlichen Schriftsätze waren oft ungeschliffen und wirkten wie aus Blech getrieben. Er schrieb, wie er war: polternd und barsch, ungeniert und manchmal beleidigend. Stephan wusste, dass er und mehr noch Marie als nunmehr examinierte Germanistin Löffke in dieser Hinsicht weit überlegen waren. Stephan und Marie würden also das leisten müssen, was Hubert Löffke selbst nicht vermochte: mit geschliffener Wortwahl jenen journalistischen Glanz zu erzielen, mit dem sich Löffke anschließend zu brüsten beabsichtigte. Im Schmücken mit fremden Federn war er immer schon führend gewesen. Klar: Hinter seiner leutseligen Einladung stand nichts anderes als die Sicherstellung eines parasitären Vorteils zu seinen Gunsten. Das Einzige, was Stephan im Moment tröstete, war, dass es eine gewisse Waffengleichheit insofern gab, als Löffke nicht wusste, dass er mit dem Gedanken spielte, die sich abzeichnende Zusammenarbeit zum Prüfstein der Fortführung der Sozietät mit Löffke zu machen. Zu oft hatte es zwischen ihnen schon Streitigkeiten im Gefolge intriganter Strategien gegeben, als dass er auf eine Partnerschaft noch hoffen durfte, die diesen Namen verdiente. Das Einzige, was Stephan daran hinderte, sich anderweitig zu orientieren, war die Tatsache, dass ihm die Arbeit in der Kanzlei allen Widrigkeiten zum Trotz nach wie vor Freude machte.
Endlich hielt Löffke vor ihnen. Vom Wind getriebene Schneeflocken wirbelten freudetrunken im Scheinwerferlicht. Ansonsten herrschte zu beiden Seiten der Straße tiefe Dunkelheit. Im Wagen vor ihnen wurde die Innenbeleuchtung eingeschaltet. Hatte Löffke sich verfahren? Löffke und seine Ehefrau Dörthe waren nur schemenhaft zu erkennen. Beide schienen sich über eine Karte zu beugen. Hinter ihnen saßen die Eheleute Frodeleit, Freunde der Löffkes. Von ihnen wusste Stephan lediglich, dass Achim Frodeleit ein früherer Referendarkollege von Hubert Löffke war, der nach dem Assessorexamen die Richterlaufbahn eingeschlagen hatte und mittlerweile vor seiner Beförderung zum Vorsitzenden Richter am Oberlandesgericht stand. Frodeleit sei eine juristische Granate, habe er, so Löffke, Bromscheidt ungeschminkt versichert, ein Partner, mit dem sie brillieren könnten.
Löffke fuhr weiter. Nach etwa 200 Metern bog er unvermittelt links ab und passierte ein kunstfertig gearbeitetes schmiedeeisernes Tor, das zu einer hell erleuchteten kastenartigen Villa im Bauhausstil führte, die in der Dunkelheit wie ein marmorner Klotz erschien.
Paul Bromscheidt führte seine Gäste in ein geräumiges Wohnzimmer.
Sie setzten sich an einen langen, filigran wirkenden Esstisch, Bromscheidt vor Kopf, Löffkes und Stephan links, Frodeleits und Marie rechts von ihm.
»Willkommen in meinem Haus«, begrüßte Bromscheidt sie lächelnd. »Sie sehen, ich habe eine gewisse Vorliebe für Transparenz und Weite. Ich hoffe, Sie fühlen sich wohl in meinen Hallen.«
Er warf Marie einen Blick zu. »Sie sind mit Herrn Knobel befreundet?«
»Frau Schwarz ist Herrn Knobels Lebensgefährtin«, glaubte Löffke erläutern zu müssen. »Sie ist Germanistin und bewirbt sich derzeit um eine Stelle an einem Dortmunder Gymnasium. Ich berichte doch korrekt, Kollege Knobel?«
Stephan bejahte.
»Sehr schön«, nickte Bromscheidt.
»Gestatten Sie, dass ich Ihnen Herrn Frodeleit vorstelle?«, preschte Löffke übereifrig vor. »Er ist zugleich Freund und Kollege und steht zurzeit vor einem großen Karrieresprung!«
Löffkes Augen leuchteten verzückt, als falle der Glanz des Freundes auf ihn selbst zurück.
»Es kommt nur ein Buchstabe hinzu«, wandte Frodeleit ein.
»Er wird zum Vorsitzenden Richter am Oberlandesgericht befördert«, stellte Löffke richtig.
»In der dienstlichen Bezeichnung rücke ich lediglich vom ROLG zum VROLG vor«, wiegelte Frodeleit gespielt bescheiden ab.
Bromscheidt, der Gastgeber, war Anfang 50 und auffallend schlank, fast dürr. Sein kahler Kopf wirkte käsig weiß. Er hatte hellblaue wache Augen, einen schmalen Mund und ein makelloses Gebiss. In seiner schlichten schwarzen Jeanshose, einem weißen T-Shirt und dem schwarzen Jackett wirkte er äußerst gepflegt und zugleich intellektuell.
»Darf ich fragen, was Sie schon von unserer Idee wissen?«, erkundigte sich Bromscheidt freundlich bei Stephan.
»Nicht viel«, gestand dieser. »Herr Löffke sagte, es gehe um ein kulturelles Projekt zum Thema ›Justiz und Gewissen‹.«
»Justiz und Gewissen«, wiederholte Bromscheidt lächelnd. »Ja, so kann man die Überschrift nennen. – Ich muss gestehen, dass ich das Projekt noch nicht im Detail durchdacht habe. Es ist bislang lediglich eine Idee, die ich mit Ihnen ausgestalten und realisieren möchte. In meinem Kopf kreisen seit Langem die Gedanken darum. Aber bis daraus etwas Konkretes wird, bedarf es noch einiger Arbeit. – Denken Sie daran, mitzuarbeiten? Ich freue mich natürlich, wenn ich Mitstreiter für unsere Idee gewinnen kann.«
»Bislang wissen wir so gut wie nichts. Also können wir nichts dazu sagen«, wandte Marie ein.
»Natürlich nicht! Ich überfordere Sie ja förmlich«, entschuldigte sich Bromscheidt. »Sehen Sie, die Kulturhauptstadt Essen bietet eine Chance für die ganze Region. Ein Jahr lang wird das Ruhrgebiet im Zentrum des kulturellen Interesses stehen. Das ist eine, wie ich meine, vorzügliche Gelegenheit, Themen zu transportieren, denen sonst zu wenig Aufmerksamkeit gewidmet wird. Justiz und Gewissen ist eine Thematik, die man sicher nicht auf der Agenda erwartet. Es könnte ein Highlight werden.«
»Es klingt ein wenig altlastig, wenn ich mir diese Bemerkung erlauben darf«, sagte Achim Frodeleit, ein hagerer, hoch aufgeschossener, sportlicher Typ mit sonnengebräuntem Teint und kurz geschorenem Haar. »Vom Titel her habe ich, ehrlich gesagt, allerdings leichte Zweifel. Nicht nur, weil das Thema sehr speziell ist, sondern weil es arg in die Vergangenheit zu greifen scheint. Finden Sie nicht, dass es eher ein rechtsgeschichtliches als kulturelles Thema ist?«
»Sie meinen, es sei ein Thema der Vergangenheit?«, fragte Bromscheidt.
»Im Rahmen einer Kulturveranstaltung: ja«, meinte Frodeleit. »Dabei verkenne ich natürlich nicht, dass gerade bei Juristen die deutsche Vergangenheit in weiten Teilen nicht aufgearbeitet ist. Juristen waren und sind stets eine tragende Säule aller gesellschaftlichen Systeme. Das gilt gerade für das unsägliche Dritte Reich. Wir kennen doch alle die unheilvollen Leitgestalten des Unrechtsstaates.«
»Ich suche eher eine Brücke in die Gegenwart«, korrigierte Bromscheidt. »Und gerade dieser Brückenschlag scheint mir die entscheidende Herausforderung zu sein. – Sehen Sie: Ich möchte das Projekt psychologisch angehen. Meine Frage lautet: Woher kommt der Unrechtsjurist? Meine These ist: Es hat diesen Typus immer gegeben und es wird ihn immer geben. Die jeweilige Staatsform bringt diese Menschen nicht hervor. Sie zeugt nicht den Unrechtsjuristen, sondern sie kann ihm allenfalls den Rahmen bieten, in dem er sich entfalten kann. Recht und Unrecht sind wesentliche Bestandteile der Kultur. Ich meine, dass das Gewissen des einzelnen Richters wesentlich dafür verantwortlich ist, Recht und Unrecht innerhalb der Gesellschaft auszuprägen. Das Dritte Reich wird stets als Ausnahmesituation verstanden, gewissermaßen als ein dämonisches Phänomen, das schlimme Auswüchse in allen Bereichen begründet und gefördert hat. Meine These aber ist, dass das Dritte Reich nur äußerlich sichtbar gemacht hat, was in den Menschen über die Zeiten hinweg steckte.«
Frodeleit schüttelte energisch den Kopf, doch Bromscheidt redete unbeirrt weiter. »Im Kern hat das Dritte Reich den Teufeln nur die Gelegenheit geboten, ihre menschliche Maske fallen zu lassen. Das impliziert aber, dass es die Teufel weiterhin gibt. Das ist mein Thema. Dafür brauche ich Ihren Rat und in juristischen Belangen Ihre fachkundige Unterstützung.«
Marie und Stephan hörten erstaunt zu. Nach nur wenigen Augenblicken hatte Bromscheidt das Gespräch in eine komplizierte Thematik vertieft.
»Aber es gibt doch schon so viel zum Dritten Reich«, protestierte Dörthe Löffke. »Irgendwann hat man es doch satt.«
»Es wird ganz wissenschaftlich werden«, beschwichtigte ihr Mann, um die unversehens wuchernden Zweifel zu ersticken, die das Projekt schon zu gefährden schienen, bevor es überhaupt klare Konturen gewann.
Bromscheidt erhob sich. »Darf ich Ihnen einen Wein anbieten? Einen Rotwein? – Vielleicht einen Montepulciano? Dazu etwas Gebäck?«
Löffke war entzückt. Ein Gastgeber, der seine Vorliebe für Weine bediente, musste ein guter Gastgeber sein. Löffke liebte abendliche Fachgespräche bei einem Glas Rotwein. Wie oft sehnte er auf mehrtägigen Seminaren den Abend herbei, um nach stundenlangem Ausharren bei langweiligen Referaten in eine befreiende Weinseligkeit einzutauchen, in der er sich entfalten und plaudernd mit allen Themen jonglieren konnte. Löffke lebte für die Abende, trank sich in die Nacht und verließ häufig als Letzter die Bar.
»Sie kennen sich aus«, schwärmte er. »Woher wissen Sie, dass ich gerade diesen Rotwein so gern trinke?«
»Es geht nicht nur um Sie«, belehrte Bromscheidt sanft. »Es war nur ein Vorschlag. Der Rotwein passt in diese Jahreszeit. Januar. Dunkelheit, Regen und Wind, heute sogar mit etwas Schnee dabei. Da sucht man die Behaglichkeit. – Trinken Sie, was Sie mögen! Ich werde bemüht sein, Ihre Wünsche zu erfüllen.«
Man blieb beim Rotwein. Löffke bestimmte, dass Dörthe anschließend fahren sollte; sie und Stephan wählten Saft.
»Aber Sie werden einen Freisler keinen Juristen nennen wollen«, hob Frodeleit erneut an.
»Sehen Sie!« Bromscheidt setzte sich wieder, füllte bedächtig sein Glas und stellte die Weinflasche auf den Tisch. »Um solche Fragen geht es. Roland Freisler war ein exzellenter Jurist. Einerseits war er die lärmende Gestalt, die in menschenverachtender Art und Weise Prozesse vor dem Volksgerichtshof zelebrierte. Auf der anderen Seite hat Freisler das getan, womit sich Juristen immer wieder gern schmücken; ich spreche von der Publikation zahlreicher juristischer Aufsätze und Abhandlungen. Dort hat er immer wieder unter Beweis gestellt, dass er sauber subsumieren und schlussfolgern konnte. Und wenn Sie heute seine Beiträge lesen, dann begegnen Sie einem weitaus nüchterneren Freisler, der scheinbar ausgewogen und in der Argumentation zwingend juristische Probleme analysierte. Das ist ein ganz anderer Freisler als dieser demagogische Teufel, den wir kennen. Juristen, wenn Sie mir die Bemerkung gestatten, sind eine gefährliche Spezies, immerhin sind sie die Zahnräder jeglicher staatlicher Maschinerie.«
Bromscheidt hatte Frodeleit ins Visier genommen. Doch statt seiner parierte Frodeleits Frau. »Ich finde trotzdem: Irgendwann muss mal Schluss sein. Dörthe hat es schon gesagt.«
»Ob es so ist, wird ein Thema unseres Projekts sein«, erwiderte Bromscheidt versöhnlich und hob sein Glas. »Jedenfalls kann ich mir sehr gut eine fruchtbare Zusammenarbeit vorstellen, in die wir uns alle einbringen: Herr Löffke als engagierter Anwalt, Herr Frodeleit als ein schon durch seine Karriere ausgewiesener Richter und Herr Knobel als – ja, als was …?«
»Als Protokollant – gemeinsam mit Marie«, schlug Stephan vor.
»Wollen Sie wirklich mit dabei sein? Mir scheint, als würden Herr Löffke und Herr Frodeleit schon zentrale Plätze besetzen. Nicht, dass Sie sich überflüssig fühlen.«
»Herr Knobel wird das Projekt wissenschaftlich begleiten«, schlug Löffke vor.
Stephan merkte, dass sich im Kopf seines bulligen Kollegen ein Mosaik zusammenfügte, das ihn und Bromscheidt als Schöpfer und Leiter des Projekts, Frodeleit als wissenschaftlichen Assistenten und ihn und Marie als bloße Schreiberlinge ausweisen würde.
Löffke erhob sich und trat an die große Fensterfront. »Das ist ja geil!«, begeisterte er sich. »Kommen Sie mal!« Er schwenkte verzückt sein Rotweinglas.
Elektrisiert standen die anderen auf und traten bis auf Bromscheidt neugierig ans Fenster.
Unter ihnen erstreckte sich ein etwa 30 Meter langer und fünf Meter breiter beleuchteter Swimmingpool azurblau funkelnd in die Dunkelheit. Aus dem Wasser stiegen Dampffahnen wie wolkige Girlanden auf.
»Das Becken hat eine praktische Form«, fand Verena. »Wir hätten unseren Pool auch so anlegen sollen, Achim! Dann müsste man nicht ständig wenden.«
»Ich heize und beleuchte den Pool in dieser Jahreszeit nur, weil er im Dunkeln so mystisch aussieht«, erklärte Bromscheidt vom Tischende. »Leider kann meine Frau wegen ihrer Behinderung das Becken nicht mehr nutzen. Aber es freut mich, dass Ihnen das Schauspiel gefällt. Wie Sie sehen, geize ich nicht mit Energie. Das ganze Haus ist hell erleuchtet. Umweltpolitisch ist das Verschwendung, ich weiß. Aber ich liebe einfach das Licht und die Atmosphäre, die es schafft.«
»Ein teures Hobby«, stellte Löffke fest.
Sie setzten sich wieder.
»Mir ist immer noch nicht klar, worum es wirklich geht«, knüpfte Marie wieder ans Thema an. »Sollen denn einzelne Juristen porträtiert werden?«
»Im Ergebnis könnte es durchaus so sein«, nickte Bromscheidt. »Das heißt, wir stellen Juristenkarrieren, vielleicht auch einzelne bis in die Gegenwart reichende Prozesse vor und verknüpfen sie jeweils mit der Frage, wie der beteiligte Richter dabei mit seinem Gewissen umgegangen ist. Damit leisten wir einen entscheidenden Beitrag zur Rechtskultur innerhalb des gesamten Kulturkontexts. Wenn man dies ansprechend und spannend darstellt, wird es die Menschen interessieren, ja sogar begeistern.«
»Rechtsfälle aus der Gegenwart?«, fragte Frodeleit. »Das kann aber heikel werden.«
»Es sollen natürlich auch positive Beispiele geschildert werden«, erklärte Bromscheidt. »Wir stellen sowohl Richter vor, die sich für den Einzelnen einsetzen, aber auch solche, die gegen ihn entscheiden. Nehmen Sie zum Beispiel einen Ausländer, der in sein Heimatland abgeschoben wird, dort in die Fänge der Diktatur gerät und unter der Folter stirbt. Solche Fälle gibt es doch. Ich möchte die Juristen, die diese Entscheidung zu verantworten haben, in den Vordergrund stellen und nicht die Urteile selbst.«
»Sehr heikel«, wiederholte Frodeleit nachdenklich.
»Dabei sollten wir keinesfalls werten«, fuhr Bromscheidt fort, »sondern die Wertung dem Betrachter überlassen. – Verstehen Sie, was ich meine?«
»Durchaus. Aber Ihnen ist doch bewusst, dass man dabei auch sehr schnell den Kollegen zu nahe treten kann?«
»Das wollen wir ja, Herr Frodeleit. Damit schaffen wir Nähe und geben der Justiz Gesichter. Wir wollen sowohl den Menschen unter der Robe zeigen, der mit seinen Urteilen Schicksalssprüche formuliert, als auch den Menschen vor der Robe, der von dem Schicksalsspruch betroffen ist. Dabei wollen wir uns nur auf das Ruhrgebiet konzentrieren. Seien Sie unbesorgt: Dort werden sich genügend Fälle und Personen finden lassen, an denen sich das Thema ›Justiz und Gewissen‹ exemplifizieren lässt. Meinen Sie nicht?«
»Durchaus«, stimmte Frodeleit gedankenversunken zu.
»Du musst an deinen Vorsitz denken«, warnte Verena. »Setz die Früchte deiner Arbeit nicht aufs Spiel!«
»Wenn wir verantwortlich und gewissenhaft arbeiten, werden wir einen Beitrag leisten, über den man noch lange reden wird«, betonte Bromscheidt. »Denn damit besetzen wir ein Thema, das in die Tiefe geht. Das sollten Sie nicht vergessen! Gerade unsere personelle Zusammensetzung ist eine Garantie für Qualität, Herr Frodeleit! Selbstredend soll niemand verunglimpft werden. Davor schützt uns schon allein unsere große Verantwortung, sensibel an die Sache heranzugehen.«
»Es ist durchaus eine ehrenvolle Aufgabe, Verena«, unterstrich Löffke. »Schließlich liegt es an uns, was wir daraus machen. Und vergiss nicht die Reputation deines Mannes, die durch die Ausstellung sicher keineswegs geringer wird.«
»Wie sind Sie eigentlich auf Herrn Löffke gekommen?«, fragte Frodeleit Bromscheidt.
»Nun, die Kanzlei genießt einen vorzüglichen Ruf«, erklärte Bromscheidt. »Sie wird hin und wieder auch in den Medien erwähnt und nimmt unter der Vielzahl der Kanzleien offensichtlich eine führende Position ein. Deshalb fasste ich mir ein Herz und sprach einen Anwalt aus der Kanzlei direkt an. Dass ich gerade auf Herrn Löffke stieß, war Zufall. Ich hätte auch mit Ihnen sprechen können, Herr Knobel. Ich glaube, Sie stehen Ihrem Kollegen in nichts nach.«
»Es ist schon in Ordnung so«, sagte Löffke. »Das Projekt trägt unseren Namen.«
»Nehmen Sie Herrn Knobel doch dazu!«, schlug Bromscheidt vor. »Die Publikation wird ja ein wesentlicher Beitrag.«
»Aber dann wird der Name zu lang«, wandte Löffke ein.
Stephan lächelte.
»Es kommt mir nicht darauf an. Und Marie auch nicht. Aber für Marie wäre es gut, wenn sie aus der Publikation beispielsweise einen Artikel fertigen und einer Zeitung anbieten könnte. Das würde ihr bei ihren Bewerbungen als Germanistin helfen. Irgendetwas muss auch für uns rumkommen.«
Löffke nickte dankbar.
»Drei Namen auf der Publikation sind genug. So etwas können sich die Leser noch merken. Und im Vorwort gibt es einen kräftigen Dank für Frau Schwarz und Herrn Knobel. Was Sie dann daraus machen, ist Ihre Sache. – Ich glaube, das ist die beste Lösung.«
»Es ist natürlich ein schöner Zufall, dass Sie gleich Ihren kompetenten Freund mit einbringen können«, fuhr Bromscheidt fort. »Herr Löffke hat von Ihnen ja geradezu geschwärmt. Ehrlich gesagt hatte ich gar nicht zu hoffen gewagt, über Herrn Löffke gleich mit einem Richter in Kontakt zu kommen, der unsere Arbeit gewissermaßen aus der Innensicht sachkundig begleiten kann. Ich gestehe, ich finde diese Konstellation großartig.«
»Ich auch«, pflichtete Löffke eilig bei. »Es ist eine einmalige Gelegenheit.«
Frodeleit schwieg, aber sein Unbehagen blieb spürbar.
Bromscheidt ließ sich nicht beirren.
»Wie Herr Löffke mir mitteilte, haben Sie sich im Referendariat kennengelernt. – Eine langjährige Freundschaft also.«
»Mir lag immer der Anwaltsberuf näher und Achim der Richterdienst«, sprang Löffke für seinen zögernden Freund ein. »Jeder hat seinen Weg gemacht.«
Bromscheidt nickte verständig.
»Ehrlich gesagt, wissen wir von Ihnen noch nicht viel«, meldete sich Marie, ihren Blick auf Bromscheidt geheftet. »Ich habe Sie zum Beispiel nicht im Internet gefunden.«
»Ja, ich weiß, es ist fast schon eine Kunst, dort nicht gefunden zu werden«, stimmte Bromscheidt lächelnd zu. »Aber es ist erklärlich. Ich lebe erst seit einem halben Jahr wieder hier. Zuvor habe ich viele Jahre in Südeuropa an einem wissenschaftlichen Institut gearbeitet. Jetzt hat es mich wieder in die Heimat gezogen, und hier werde ich auch bleiben. Ich plane etliche Projekte und werde auch eine Praxis eröffnen. Wirtschaftlich brauch ich das alles nicht. Ums Geld geht es mir nicht. Mich treibt allein mein wissenschaftliches Interesse.«
»Wer eine kleine dampfende Lagune im Garten unterhält, braucht wirklich kein Geld«, lachte Löffke.
»Es ist ein schöner Luxus«, gab Bromscheidt zu. »Man soll sich die schönen Dinge gönnen, solange man sie sich noch leisten kann. Ich tue es! – Wer weiß, wann alles vorbei ist?«, sagte er und richtete seinen Blick wieder auf die Person, die im Mittelpunkt seines Interesses zu stehen schien.
»Herr Frodeleit, ich möchte Ihr Unbehagen nicht beiseite drängen. Sie sollen sich auf keinen Fall verpflichtet fühlen, wenn Sie, aus welchen Gründen auch immer, Bedenken haben. Aber andererseits möchte ich jede Chance nutzen, für unsere Idee zu werben und Sie zu überzeugen. Es wäre für das Projekt zweifellos ein Gewinn, Sie bei uns zu wissen. Ich darf wiederholen: Es geht nicht um Kollegenschelte! Sie sollen keine Richterinnen oder Richter bloßstellen.«
»Du bekommst den Vorsitz erst Mitte dieses Jahres«, erinnerte ihn Verena. »Gefährde nicht, wofür du so lange gearbeitet hast.«
Bromscheidt warf ihr einen verschliffenen Blick zu und entgegnete mit samtpfotiger Stimme, die die scharfen Krallen ihres Besitzers nur allzu leicht vergessen ließ: »Ich bin mir sicher, dass der Vorsitz Ihres Mannes in jeder Hinsicht mehr als verdient ist. Mit Ihnen wird zweifellos ein fachlich und persönlich profilierter Mensch herausgehoben, der sich im besten Sinne für Recht und Gerechtigkeit einsetzt. Gerade deswegen wären Sie ja ein Gewinn für uns! Ihr Gewissen und Ihr Rechtsbewusstsein sind förmlich der notwendige Filter für die Arbeit, die Herr Löffke und ich leisten werden. Sie, lieber Herr Frodeleit, werden unser Supervisor sein, der als Einziger wegen seiner erfahrungsgesättigten Souveränität die getroffenen Entscheidungen als richtig oder falsch beurteilen kann. Dadurch werden Sie Ihre Reputation ganz ohne Frage noch untermauern können! – Ich möchte Ihnen etwas vorschlagen«, sagte Bromscheidt und sah auf seine Armbanduhr. »Wir haben jetzt kurz nach 21 Uhr. Lassen Sie uns die Gelegenheit nutzen, gemeinsam noch zur Alten Steinwache in der Innenstadt zu fahren. Ich stelle mir vor, die Ausstellung dort durchzuführen und regelmäßig von ausgewählten Experten Vorträge zum Thema halten zu lassen. Bekommen Sie ein Gefühl für diese Räume zu. Atmen Sie etwas von dem Thema ein. Gerade die Alte Steinwache als berüchtigter Verhör- und Gefängnisbau der Nazizeit verkörpert wie kaum ein anderes Gebäude in Dortmund die unheilvolle Vergangenheit der Justiz. Dieser Platz ist geradezu exemplarisch geeignet, um auf die Themenstellung mit historischer Aktualität anzuknüpfen.«
»Um diese Uhrzeit noch?«, fragte Verena misslaunig und warf einen fragenden Blick zu Löffke. »Was meint ihr?«
»Wir haben Urlaub«, stellte Löffke fest. »Selbstverständlich haben wir Zeit.«
Er spürte, dass sein Freund Frodeleit durchaus geneigt war, an dem Projekt mitzuarbeiten. Bromscheidts schmeichelnde Worte hatten ihre Wirkung nicht verfehlt. Der Besuch in der Alten Steinwache würde ihn vermutlich gänzlich überzeugen können. Jetzt abzubrechen würde Verena Gelegenheit geben, Achim zu verunsichern und ihn absagen zu lassen. Wie oft hatte Löffke in den gemeinsam verbrachten Urlauben erlebt, dass Verena mit ihrem Pessimismus gemeinsame Pläne torpedierte und schlechte Stimmung verbreitete? Was leistete sie schon? Nach der Heirat arbeitete sie doch nur noch halbtags als Reiseverkehrskauffrau. – Die Frodeleits waren kinderlos geblieben, was die Ehe zwischenzeitlich in Krisen und insbesondere Verena in gelegentliche Depressionen gestürzt hatte. Achim Frodeleit, der seine Richterkarriere ungebremst nach vorn trieb, hatte seine Frau zu verschiedensten Freizeitaktivitäten animiert. Allerdings mit nur mäßigem Erfolg. Schließlich waren sie gemeinsam einem Golfclub beigetreten, der beiden Gelegenheit bot, soziale Kontakte zu knüpfen, die sie als wertvoll empfanden und sie in dem Glauben bestärkten, gesellschaftlich angekommen zu sein. Auch die Löffkes waren dem Club beigetreten.
Löffke hatte seine Frau Dörthe im schwiegerelterlichen Fleischerfachgeschäft im Kreuzviertel kennengelernt, das nur 100 Meter entfernt von seiner ehemaligen Studentenwohnung lag. Sie hatte Einzelhandelskauffrau gelernt und nach ihrer Lehre im Geschäft der Eltern zu arbeiten begonnen. Löffke fand sofort Gefallen an der hübschen und drallen jungen Frau, die es verstand, die Kunden flott und geschäftstüchtig zu bedienen, wobei sie, wenn sie sich über die Thekenauslage beugte, einen tiefen Blick in ihr Dekolleté gewährte. Löffke liebte diesen Einblick. Schon allein deswegen kaufte er ausschließlich in dieser Fleischerei ein – selbst dann, wenn es nicht nötig war.
Löffke und Frodeleit hatten ihre Frauen etwa zur gleichen Zeit geheiratet. Das war kurz nach dem gemeinsamen Referendariat gewesen und jetzt schon 19 Jahre her. Auch Löffkes Ehe war kinderlos geblieben. Als alle medizinischen Versuche erfolglos blieben, eiferte Dörthe ihrem Mann nach und frönte einer ungehemmten Esslust. Während die Löffkes immer weiter zunahmen, blieben Verena und Achim Frodeleit sportlich und schlank.
»Wir sollten fahren«, drängte Löffke.
»Ich habe einen großen Wagen, in den alle hineinpassen«, sagte Bromscheidt. »Ich schlage vor, dass wir gemeinsam in die Stadt fahren und anschließend hierher zurückkommen. Sie wohnen doch alle im Dortmunder Süden und können bequem von hier aus wieder nach Hause fahren.«
»Für uns wäre es ungünstig«, wandte Stephan ein.
Bromscheidt hob die Augenbrauen. »Wohin müssen Sie?«
»In die Brunnenstraße«, antwortete Marie.
»Dann fahren wir erst zu Ihnen, damit Sie zu Hause Ihr Auto abstellen, bevor wir anschließend gemeinsam zur Alten Steinwache fahren. Hinter dem Bahnhof gibt es kaum Parkplätze. Auch um diese Zeit nicht. Wir haben Donnerstag. Es ist viel Betrieb in den Kinos nebenan.«
»Haben Sie nicht zu viel Rotwein getrunken, Herr Bromscheidt?«, fragte Frodeleit besorgt.
»Ein Glas. Ich denke, das geht.«
»Du bist im Moment mal kein Richter«, mahnte Löffke seinen Freund. »Binde dir einfach ein Tuch um deine Justitia-Augen!«