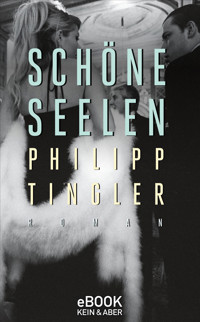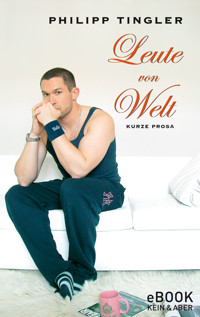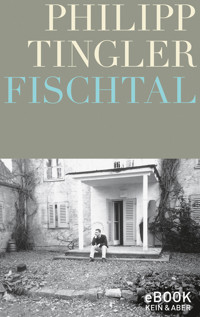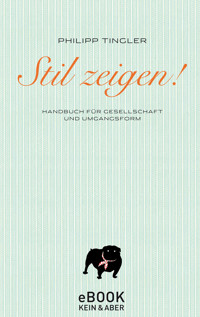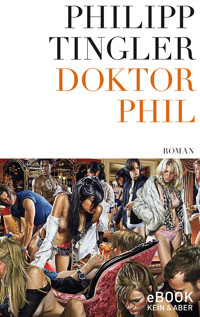11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kein & Aber
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Für Franziska ist es das wichtigste Abendessen ihres Lebens. Oder wenigstens in diesem Jahr. Ihre Karriere hängt davon ab – und die läuft nicht so ganz nach Plan in letzter Zeit. Das stresst Franziska ebenso wie der bevorstehende Besuch ihres Bruders. Wenigstens ist in ihrer Ehe alles in Butter. Oder nicht? Jedenfalls steht ein wichtiges Abendessen an, doch dann platzt Conni Gold ins Haus. Die Freundin von Felix, die niemals ein Blatt vor den Mund nimmt – und gar nichts mehr läuft nach Plan.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 179
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
INHALT
» Über den Autor
» Über das Buch
» Buch lesen
» Impressum
» Weitere eBooks des Autors
» Weitere eBooks von Kein & Aber
» www.keinundaber.ch
ÜBER DEN AUTOR
Philipp Tingler, geboren in Berlin (West), ist mehrfach ausgezeichneter Schriftsteller und hat bei Kein & Aber u.a. die Romane Fischtal und Doktor Phil veröffentlicht. Er ist außerdem Kritiker im Literaturclub des Schweizer Fernsehens SRF und viel gelesener Kolumnist. Philipp Tingler lebt in Zürich.
ÜBER DAS BUCH
Für Franziska ist es das wichtigste Abendessen ihres Lebens. Oder wenigstens in diesem Jahr. Ihre Karriere hängt davon ab. Und die läuft nicht so ganz nach Plan in letzter Zeit. Das stresst Franzi ebenso wie der bevorstehende Besuch ihres Bruders. Wenigstens ist in ihrer Ehe alles in Butter. Oder nicht? Wichtiges Abendessen jedenfalls. Und dann platzt Conni Gold ins Haus. Sie ist die Freundin, die Franzi nie haben wollte. Und nichts mehr geht nach Plan.
Dieses Buch istFran Lebowitz gewidmet
Tag I
DIE FALSCHEN KIRSCHEN
»Felix, das ist der wichtigste Abend meines Lebens!«
»Du übertreibst.«
»Nein, du übertreibst! Wegen ein paar Kirschen! Heute sollte es nur um mich gehen.«
»Zissel«, sagte Felix zu seiner Frau und drehte sich dabei um die eigene Achse, zwischen zwei Säulen, denn das Gespräch wurde telefonisch geführt und er stand am Rande eines belebten Theaterfoyers, »du musst dir keine Sorgen machen. Ich bringe Maraschino-Kirschen mit. Alles wird gut.«
»Wenn das so einfach wäre.«
»Das ist so einfach.«
»Mir ist noch eingefallen: Was machen wir, wenn sie kein Fleisch essen?«
»Ich esse sogar Fleisch im Flugzeug.«
»Ich weiß, dass du Fleisch isst. Ich rede von unseren Gästen.«
»Verzeihung«, erwiderte Felix, »die Verbindung ist schlecht.«
Dabei blickte er versehentlich direkt ins Gesicht einer Dame, die wohl im Publikum gesessen hatte und sich anschickte, das Theater zu verlassen. Sie trug eine Art Cape über dem Arm, und ihre Haut spannte sich dünn und trocken, beinahe durchsichtig, über den Wangenknochen.
»Hallo Felix? Bist du noch da? Ich meine die Gäste. Wenn die kein Fleisch essen. Was dann?«
»Für diesen Fall haben wir eine fleischlose Alternative.«
»Wo?«
»Wie wo?«
»Felix«, sagte Franziska, und sie sprach dabei den Namen ihres Mannes aus, als hätte er nur eine Silbe, »kannst du dich bitte konzentrieren. Dieses Abendessen ist sehr wichtig für mich. Für uns. Ich bin davon überzeugt, genau heute Abend an einem dieser entscheidenden Punkte im Leben angekommen zu sein, in denen sich der Weg in die Zukunft gabelt: letzte Chance oder der Abzweig ins ewige Mittelmaß.«
»Ich habe ein super Gefühl bei der Sache.«
»Ich nicht. Mir ist gar nicht wohl.«
»Kriegst du Kopfschmerzen?«
»Nein, es ist mehr so – innerlich. So ein unbestimmtes Gefühl in den Eingeweiden, dass meine gesamte weitere Karriere von diesem heutigen Abendessen abhängt, und wenn das fehlschlägt, kann ich mir ebenso gut die Zunge bleichen lassen und einen Stand für Kaschmirschals in irgendeinem Einkaufszentrum aufmachen. Bei den Rolltreppen.«
»Wieso die Zunge bleichen?«
»Das habe ich auf Netflix gesehen.«
»Alles wird gut werden, Zissel. Du musst dir überhaupt keine Sorgen machen. Null.«
Tatsächlich war das bis jetzt kein so guter Tag für Felix gewesen. Beim Verlassen des Hauses war er beinahe von einem Elektro-Rollstuhl überfahren worden. Am Mittag hatte er auf der Bühne ein Matinee-Gespräch mit einem berühmten Philosophen geführt, der neuerdings für gewisse Ansichten ins Gerede gekommen war. Anschließend stand man beisammen im Foyer des Theaters, mit der Chefdramaturgin, dem Intendanten und einigen Gästen, und sprach über die sehr zweischneidige Mode, Wohnungen mit ganzwändigen Fenstern auszustatten. Mitten in diesem Gespräch erschien eine Dame gesetzteren Alters, die aussah wie ein sterbendes viktorianisches Kind, und empfahl Felix einen ihm vollständig unbekannten Autor zur Besprechung im Buchclub, jener traditionsreichen Fernsehsendung, in der er regelmäßig in einer Runde von Kritikern über Neuerscheinungen auf dem Literaturmarkt debattierte. Der Autor, den die Dame empfahl und für chronisch unterschätzt hielt und also dringend im Fernsehen besprochen sehen wollte, lebte augenblicklich in Berlin (natürlich, sagte sie) und habe überhaupt kein Geld. Natürlich. So seufzte sie, indes weniger unglücklich als vielmehr, um der Unabänderlichkeit eines zutiefst ungerechten Weltenlaufs ein Siegel aufzudrücken, also letztlich ganz zufrieden. Was Felix, der genug Geld hatte, sich einen Lüpertz an die Wand zu hängen, missfiel. Ihn verstimmte stets die Unterstellung von Brotlosigkeit der Kunst. Sie gab sich als Mitgefühl, schien ihm aber in Wahrheit der letzte Trost von prosaischen Existenzen zu sein.
Jedoch war das Ganze belanglos, solche Anfragen für die wohlwollende Berücksichtigung bestimmter Titel oder Autoren wurden oft an Felix herangetragen, entweder von den Verlagen oder Autoren selbst in mehr oder weniger diplomatischer Form oder, wie hier, von wohlmeinenden selbst ernannten Emissären der Kunst. Das passierte regelmäßig und wurde von Felix mit höflichem Interesse und ein paar Rückfragen beantwortet und damit ebenso regelmäßig erledigt.
So weit also nichts Besonderes. Und Felix entfernte sich für einen Moment aus der Gegenwart, indem er, wie das die meisten Menschen tun, gedanklich in die Zukunft schritt, die unmittelbare Zukunft, heute Abend. Ein Abendessen wartete auf ihn. Dieses Essen war vor allem: ein Termin. Gerade als Felix sich mit der Frage beschäftigte, ob die nackte Anzahl von Terminen in seinem Leben zugenommen habe und ob dies gut oder schlecht sei, näherte sich ein Herr. Etwas Bleiches und Verschrecktes umgab ihn, er schien überaus nervös zu sein. Ob er nun aus dem Innern des Theatersaals hervorgetreten oder erst nach der Veranstaltung unversehens über die Freitreppe heran und hinauf bis in die Wandelhalle gelangt war, blieb ungewiss. Felix, ohne sich sonderlich in die Frage zu vertiefen, neigte zur ersteren Annahme. Mäßig hochgewachsen, im letzten Lebensdrittel angekommen, mager, bartlos und auffallend stumpfnasig, gehörte der Herr zum rothaarigen Typ und besaß dessen milchige und sommersprossige Haut. Sein Teint war empfindlich, wie bei den meisten Rothaarigen, und überdies in unzählige wilde Knitterfalten aufgesplittert, als ob jemand versucht hätte, ein zerknülltes Stück Backpapier gewaltsam wieder glatt zu streichen. In der linken Hand hielt er einen mit eiserner Spitze versehenen Stock, den er bei jedem Schritt schräg gegen den kalten Marmorboden des Vestibüls stemmte, in welchem übrigens, wiewohl durchlüftet und belebt, plötzlich eine etwas multrige und stockige Atmosphäre herrschte. Viel Staub, der sich in den Lichtzungen der hohen Fenster verdichtete. Unangenehm.
Geduckten Hauptes blickte der Mensch unter fortgesetztem Blinzeln seiner rot bewimperten Augen Felix von unten herauf an, um ihm nach kurzem Verharren abrupt ein Kuvert zu überreichen, »ein kleines Andenken für Sie«, und damit war er auch schon verschwunden.
Felix befand sich in Gesellschaft und konnte daher den Inhalt des Umschlags seinerseits nur sehr flüchtig bemustern – doch das war bereits ausreichend. Er enthielt zwei Bleistiftzeichnungen, die offenbar Porträts von ihm darstellen sollten, allerdings eine stark entgleiste Version von ihm abbildeten, fürchterlich, und dass die Sache offenbar gar nicht fürchterlich gemeint war, machte es irgendwie noch schlimmer. Felix kam ein Grauen an.
Indessen sprach man in der Runde über den Zustand des Kulturlebens im Allgemeinen und seiner öffentlichen Förderung im Besonderen. Felix war gerade dabei, zu begründen, warum sämtliche Literaturpreise ohne kulturellen Schaden abgeschafft werden könnten, als sein Telefon vibrierte.
»Amarena-Kirschen«, sagte Franziska.
»Wie bitte?«
»Amarena-Kirschen sind nicht das Gleiche wie Maraschino-Kirschen. Nicht im Entferntesten, Felix.«
»Gut. Gut zu wissen.«
»Kannst du bitte auf deinem Weg nach Hause noch Amarena-Kirschen mitbringen? Ich habe zum Nachtisch diese Brandy-Eiscreme eingeplant. Dazu passen die hervorragend.«
»Ich bin kein großer Freund von Amarena-Kirschen.«
»Seit wann das denn?«
»Schon immer.«
»Tu es für mich.«
»Natürlich. Ich werde pünktlich sein. Alles wird super werden, Zissel.«
Während Felix dieses Telefonat führte, hatte er sich nicht weit aus der Runde entfernt, war nur drei oder vier Schritte zurückgetreten, in eine kühlere Nische aus Marmor. Diametral ihm gegenüber aber, also ebenfalls am Rande der Runde, stand eine Frau, die sich durch eine asymmetrische Frisur mit Raspelpony und mattgrün gefärbter Strähne als unkonventionelle Angehörige einer alternativen Lebenswelt auswies. Ihre Trägerin fühlte sich erkennbar unwohl, so ausgestellt im Strome des Publikums, doch irgendetwas schien ihr zu verbieten, sich zu entfernen, offenbar hatte sie ein Anliegen, einen Entschluss gefasst. Weshalb Felix ihr, nachdem er sich von Franziska am Telefon verabschiedet hatte und zurück in die Runde getreten war, einen aufmunternden Blick zuwarf.
»Darf ich Ihnen etwas sagen«, stieß die Frau hierauf hervor, alle übrigen Gäste ignorierend und unter Verzicht auf die üblichen Höflichkeitsfloskeln, »– ich muss Ihnen was sagen!«
Sie bebte ein wenig. Ihr Atem ging flach. Offenbar hatte sie allen Mut zusammengesammelt.
»Nur zu«, erwiderte Felix.
»Also«, begann die Frau, ein wenig umständlich, und hielt während des Sprechens die Augen geschlossen, als fände sie die Worte so besser, »ich habe gelernt, dass man als Gastgeber auf der Bühne sich selbst zurücknehmen und nicht den Gast in den Schatten stellen sollte.«
Anschließend heftete sie ihren Blick auf Felix’ Schlüsselbein, was diesem nicht angenehm war, als würde ein zu niedriges Maß an ihn angelegt. Er hingegen sah ihr direkt ins Halbprofil, sah flaumige Gesichtsbehaarung, in die sich kleine Reste des veganen Make-ups verkrümelt hatten.
»Aha«, antwortete Felix, »und – wo haben Sie das gelernt?«
Dies nun brachte die mattgrüne Strähne völlig aus der Fassung. Ihre gesamte zusammengesuchte Courage verpuffte.
»Das hätte ich mir ja denken können!«, rief sie. »Das hätte ich mir ja denken können, dass da so eine spitzfindige Antwort von Ihnen kommt!«
Die gesamte Runde schaute auf die Strähne. Die signalisieren sollte, dass ihre Trägerin irgendwo unkonventionell war, im Grunde ihres Herzens.
»Ich frage nur«, erklärte Felix, »denn vielleicht haben Sie ja eine Moderatorinnenschule besucht oder so was.«
»Ich habe das … so allgemein gelernt … im Leben!«, entgegnete die Strähne, indem sie sich auch schon in Bewegung setzte, eilig dem Ausgang zustrebend, – »und Sie hätten mich noch eine Stunde da in der Ecke stehen lassen!«
Im Zug saß Felix zwischen höheren Bundesbeamten und Unternehmensberatern und einigen kreativen Digitalunternehmern, die von Präsentationen kamen. Es herrschte die lebensgewisse Betriebsamkeit der Ersten Klasse, wie ein stilles Einverständnis zwischen den Reisenden, die überhaupt in schönstem Einvernehmen mit aller Welt zu leben schienen – oder jedenfalls mit einer Welt, wo Frohmut und Tatendrang herrschten, Tüchtigkeit, Rhythmus und Siegersinn. Bei einigen Herrschaften allerdings machte sich mäßiges, aber unschönes Übergewicht bemerkbar. Ihre Frische und Regsamkeit waren womöglich nur Oberfläche, eine feine, zitternde Membran, der ein Nichts zum Durchlöchern genügte. Egal, welche Epoche der menschlichen Kulturgeschichte man inspizierte, solche Menschen hatte es immer gegeben, und es gab diesen Typus auch jetzt, auch heute, in der spätmodernen Wellness- und Identitätsgesellschaft, denn es ist ja nicht so, als wäre das Leben in seinen Typenschöpfungen unbegrenzt verschwenderisch. Keine Rede. Alte Formen werden wieder benutzt, frühere Versuche wiederaufgenommen. Es gibt ein paar Sorten Mensch, nicht mehr als ungefähr zwei Handvoll ewiger Muster, und diese Kategorien sind regelmäßig weiter voneinander entfernt als, sagen wir, Flachlandtapir und Tiefseemeduse.
Felix stellte fest, dass er mit seinem handpikierten italienischen Anzug, den englischen Schuhen und der tiefseetauglichen Armbanduhr vom Genfer See sehr gut in diesen Wagen passte und alle Insignien jener Kaste ausstellte, was, wie jede Zugehörigkeit, etwas Behagliches und Angenehmes hatte, in seinem Falle zusätzlich versüßt durch die innere Gewissheit, eben durchaus nicht dazuzugehören. Nichts weniger als das. Das hätte er sich verbeten.
Es liegt ein eigener Reiz darin, äußerlich in die Gesellschaft zu passen, aber innerlich doch ganz woanders zu stehen, dachte Felix, und dann dachte er: Ich muss mir das aufschreiben.
Denn Frische und Einfalt waren seine Sache nicht; sehr wohl aber eine gewisse Sehnsucht nach der menschlichen Sphäre, eine feine Melancholie dem Bedingten und Schönen gegenüber, und als Felix in seiner Selbstvergewisserung so weit gekommen war, vibrierte sein Telefon erneut. Das war nichts Außergewöhnliches. Alle waren hier am Telefon. Die ganze Zeit.
»Was hältst du von Duftkerzen?«, fragte seine Frau.
»So im Allgemeinen?«
»Nein. Für heute Abend. Ich hatte überlegt, ein paar aufzustellen, aber vielleicht sind sie zu … belastend. Zu intrusiv.«
»Zu intrusiv.«
»Ist das eine Antwort? Oder wiederholst du jetzt einfach alles, was ich sage?«
»Zissel, was ist los mit dir? Es ist doch bloß ein Abendessen.«
»Es ist nicht bloß ein Abendessen. Es ist ein Testessen. Ich muss gehen. Ich muss noch meine Schluppenbluse aus der Reinigung holen.«
»Schluppenbluse?«
»Mach mich nicht irre. Bis später.«
Felix legte sein Telefon aus der Hand und bemerkte im selben Moment, dass ein Herr im Durchgang zwischen den Wagen eingesperrt war. Die Türen des Durchgangs öffneten sich per Lichtschranke, dafür musste man mit der Hand oben rechts schräg neben dem Kopf herumfuchteln, dies war dem Herrn offensichtlich nicht bekannt. Er trug eine Aktentasche, die bessere Tage gesehen hatte, und drehte sich unschlüssig im Raume zwischen den verglasten Türen. Felix befreite ihn.
»Danke vielmals«, sagte der Herr.
Dann stieg eine Schulklasse ein. In die Erste Klasse. Das war nur in diesem Land möglich.
Franziska hatte den Dekan der soziologischen Fakultät und dessen Gattin eingeladen. Das Abendessen war wichtig, weil eine Stiftungsprofessur neu zu besetzen war, für die Franziska infrage kam. Für ihren Geschmack war sie schon viel zu lange Assistenzprofessorin am Institut für Angewandte Soziologie.
»Wie lief alles bei dir?«, fragte sie zur Begrüßung, als Felix nach Hause kam.
»Urgh«, antwortete er. »Es war etwas anstrengend, alles in allem. Und um das zu beweisen, habe ich hier ein paar Zeichnungen, auf denen ich aussehe wie Rainer Werner Fassbinder mit Erdnussallergie.«
»Korrekt«, erwiderte Franziska bei Betrachtung der Porträts.
»Und dann diese Frau … aus dem Publikum … die sich beschwert hat, ich würde zu viel über mich reden.«
»Das mache ich doch auch immer.«
»Wir sind ja auch verheiratet.«
»Solltest du nicht längst daran gewöhnt sein? Du trittst in einer landesweit ausgestrahlten Büchersendung auf. Ältere Leute mit Neigung zur Beschwerde sind doch da das Kernpublikum.«
»Das heißt jetzt Granfluencer.«
»Wie bitte?«
»Manchmal«, sagte Felix, »manchmal habe ich das Gefühl, ich habe den falschen Beruf. Weißt du, was ich meine? Manchmal habe ich das Gefühl, dass es schließlich nur noch um Betrieb geht; darum, das Rad, worin der Hamster läuft, immer komfortabler auszustatten.«
»Ich weiß, was du meinst.«
»Und der Hamster ist längst tot.«
»Ja.«
»Noah hat das Boot verpasst.«
»Uh-huh.«
»Ein sinkender Dampfer mit ein paar Lichtern …«
»Ja-ha, danke, ich habs verstanden! Was erwartest du? Was soll ich sagen? Ich schichte augenblicklich Canapés zu Pyramiden, um jemanden, den ich kaum kenne, davon zu überzeugen, dass mein Geist so groß und frisch sei, dass er eine Professur besetzen sollte.«
»Apropos frisch: Weißt du noch, wie ich letzte Woche auf diesem Ethik-Podium saß und neben mir so ein PR-Mensch mit Schmerbauch, zweifarbigen Wildleder-Budapestern und dermaßen starker Halitosis, dass ich in die andere Richtung atmen musste? Das war auch so ein Moment.«
»Versuch nicht, mich zu übertrumpfen.«
»Das sagst du nur, weil du nicht gewinnen kannst.«
»Du hast diesen unschönen Hang, aus allem einen Wettbewerb zu machen.«
»Das liegt daran, dass ich als Kind nur ein Damenfahrrad hatte.«
»Okay«, seufzte Franziska, »du hast gewonnen.«
Felix küsste sie auf die Schläfe.
Dann fragte er: »Was essen wir?«
»Ich habe Pot-au-feu vorbereitet. Es ist rustikal und trotzdem raffiniert. Irene hat mir angeboten, zu helfen, aber ich dachte, es zeigt mehr Einsatz, wenn ich es selbst mache.«
»Oh, die Rollenbilder des letzten Jahrhunderts.«
»Und zum Nachtisch«, fuhr seine Frau fort, ihn überhörend, »gibt es Tarte Tatin. Das liebt einfach jeder.«
Mit Irene war Irene Roschke gemeint, das Original, das bei Felix und Franziska zur Haushaltsführung angestellt war und soeben im Türrahmen auftauchte.
»Ick jehe dann ma«, sagte Irene, »Tisch is jedeckt, und ick habe den Vorrat an Eis uffjestockt. – Ach, lieben Se nich ooch dit Jefühl? Dit Jefühl direktemang vorm Beginn einer Party, wenn allet möglich scheint?«
»Haben Sie getrunken?«, fragte Felix. »Ich habe den Eierlikör markiert.«
»Sehr lustig, wa«, erwiderte Irene, »Sie sollten Schriftsteller werden.«
Die Türe fiel hinter ihr ins Schloss.
»Ich werde mich noch schnell umziehen«, sagte Felix.
In diesem Moment klingelte es.
»Irene hat wahrscheinlich wieder den Schlüssel vergessen.«
»Nein!«, erwiderte Franziska und krallte sich in seinen Unterarm. »Das sind sie! Sie sind zu früh! Hilf mir!«
Felix gab ihr einen knallenden Kuss auf die Stirn.
»Du bist unschlagbar unter Druck«, sagte er.
Dann öffnete er die Tür. Vor ihm stand eine Frau, die ungefähr so alt war wie er selbst. Hierbei handelte es sich um eine intuitive Schätzung aufgrund von Felix’ gesellschaftlicher Erfahrung; im Gesicht der Frau war der Lauf der Zeit nur in engen Grenzen zugelassen worden. Sie war teuer und diskret angezogen, bis auf die Schuhe: Ballerina-Pumps mit ziemlich auffälligem Besatz in Form von kleinen goldenen Bienenstöcken.
»Sie wollen sicher zu Kauffmanns«, sagte Felix, »das sind die Nachbarn über uns. Würden Sie den Kauffmanns freundlicherweise ausrichten, dass sie endlich ein Namensschild anbringen möchten, danke.«
»Felix«, sagte die Frau, »ich bins. Cornelia.«
So trat Conni auf den Plan.
Cornelia Gold, die Felix von seinen Studientagen an der London School of Economics kannte, seit jeher nur Conni genannt und seit über zwanzig Jahren nicht mehr gesehen hatte.
»Ich bin hier zu Besuch«, erklärte Conni nach einer Umarmung, bei der Felix einen Hauch Bel Respiro inhalierte, »ich besuche meinen Vater. Ich lebe in New York, seit Jahren. Weißt du das eigentlich? Außerdem habe ich gerade bei Goldman Sachs gekündigt. Jedenfalls habe ich dich im Fernsehen gesehen, in dieser Büchersendung, und dann habe ich John angerufen, du erinnerst dich doch an John, John Campbell, und John gab mir diese Adresse, und weil ich morgen zurück nach New York fliege, dachte ich, ich komme einfach spontan vorbei. Du hast immer noch diese exquisite Knochenstruktur, wie schön.«
»Conni!«, sagte Felix, was eher einer Feststellung denn einer Begrüßung gleichkam.
»Ja. Richtig.«
»Komm rein. Darf ich dir meine Frau Franziska vorstellen?«
»Es ist mir ein Vergnügen«, sagte Conni, »oh, Franziska, ich liebe deine Strandhaare! Du hast doch nichts dagegen, wenn ich dich duze.«
»Nicht im Geringsten«, erwiderte Franziska leicht verwirrt.
»Willst du zum Essen bleiben?«, fragte Felix, wofür er einen schwer zu interpretierenden Blick seiner Ehefrau kassierte, der eine in ihm keimende Verunsicherung verstärkte. Er wusste selbst nicht genau, wieso er das gefragt hatte, normalerweise würde er so was immer vorher irgendwie mit Franziska abstimmen. Es schien nun aber, als habe dieser Tag eine andere Seite in ihm entflammt, Sehnsucht ins Ferne und Neue, diese Begierde nach Befreiung, Entbürdung und Vergessen …
»Ich esse eigentlich nur noch selten«, antwortete Conni, »aber warum nicht? Schließlich fliege ich erst morgen Abend zurück. Habt ihr was zu trinken?«
In diesem Moment klingelte es erneut. Vor der Tür standen der Dekan und seine Gattin. Die beiden sahen zusammen aus wie die Zahl 10. Der Dekan war die Null. Ein überaus rundlicher, quellender Mann mit hängenden Schultern, geblähtem Halse, zurückweichendem Haaransatz, schlappendem Kehllappen und schweren Ohrläppchen, ein fettes rosa Gependel. Seine Frau der genaue Gegenpart: So mager, dass man eine Doktrin dahinter vermutete; es war offenbar ein rigider Diätplan gewesen, der hier jene physiognomische Durchbildung übernommen hatte, welche sonst das Werk eines entbehrungsreichen, bewegten Lebens ist. Sie trug ein Etuikleid aus blassgelber Cuiteseide mit ungewöhnlich tiefem Dekolleté, das den Blick auf zwei oder drei dickgliedrige funkelnde Goldketten freigab, die schwer auf der Mündung des Schlüsselbeins lagen. Der Hals darüber wirkte verfallen und sehnig, und wie unter einer fremden, heißeren Sonne verdorrt erschien auch das Gesicht mit seinen kuriosen Faltenbündeln um die Augen. Das augenscheinlich etwas widerborstige Haar bedeckte in schräger Welle einen Teil der Stirn bis zur Braue. Die Nase war groß, fade und fest modelliert, der Raum zwischen ihr und dem schmalen, gräulich wirkenden, völlig ungeschminkten Munde sehr unbedeutend.
»Herr und Frau Kühn«, sagte Franziska zur Begrüßung, »was für eine Freude. Haben Sie gut hierher gefunden?«
»Keine Ahnung«, erwiderte der gräuliche Mund. »Wir sind mit dem Taxi gekommen. Und ich heiße nicht Kühn. Ich habe meinen Namen behalten. Schulz.«
»Wie wundervoll«, sagte Conni, »den hätte ich auch behalten.«
»Darf ich Ihnen Cornelia Gold vorstellen? Eine alte Studienfreundin meines Mannes. Cornelia ist überraschend aus New York gekommen und wird heute Abend mit uns essen.«
»Wie wundervoll«, behauptete nun ihrerseits Frau Schulz. Wozu sie ein Lächeln herstellte. Doch als ihr Blick bis zu den Bienenkörben auf Connis Pumps hinabgewandert war, bemerkte Felix, wie diese gedrillte Freundlichkeit den Bruchteil einer Sekunde zu früh in sich zusammenfiel. Und bereits in diesem Bruchteil entlarvte sich jene konventionelle Liebenswürdigkeit als eine Art Versteck, aus dem jählings Entsetzliches hervorbrechen konnte.
»Meine Frau ist ein sehr geselliger Charakter«, stellte Dekan Kühn fest. Das sollte wohl eine Art Scherz sein. Offenbar hatte der Dekan sich irgendwann im Laufe seines Lebens eine Art Gebrauchs-Sarkasmus zugelegt, ungefähr so wie man einen Stein aufhebt, und trug diesen nun mit sich herum. Wenn er ihn vorzeigte, setzte er anschließend eine kleine Kunstpause, um die Wirkung abzuwarten, und als diese nun unter seinen Erwartungen blieb, lachte er selbst überaus jovial und mit einer Spur Geringschätzung. Bei seinem Lachen, das weder ansteckend noch einnehmend war, handelte es sich um immer denselben einzigen kehlig-tiefen Laut, der in erratischen Abständen ausgestoßen wurde.
»Cognac, Pernod, Calvados?«, fragte Felix.
»Ja«, erwiderte Conni, »am besten in genau dieser Reihenfolge.«
»Sie trinken wohl gern«, erkundigte sich Frau Schulz. Genau genommen handelte es sich weniger um eine Erkundigung als um eine Rüge.
»Nun«, erwiderte Conni, »ich will das mal wie folgt beantworten: Nach mir ist ein Cocktail benannt.«
»Wie interessant.«
»Streng genommen ist es allerdings kein Cocktail. Eher eine beliebige Flasche Wein in einem dieser riesigen Gläser, wie man sie in Napa Valley kaufen kann. Das ist der Conni Gold.«
»Das klingt nach Würde und Präsenz«, sagte Felix.
»Und zur Not kann man auch auf das Glas verzichten«, ergänzte Conni.
»Wie praktisch«, resümierte Franziska. »Vielleicht könnten wir dieses Thema später weiter besprechen. Oder vielleicht auch nie.«
»Wir haben Ihnen etwas mitgebracht«, sagte der Dekan und überreichte Franziska ein etwas kritikwürdig eingewickeltes Geschenk.