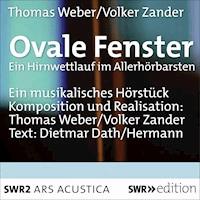Raum und Kraft – Teil 1 – Band 214e in der gelben Buchreihe – bei Jürgen Ruszkowski E-Book
Hermann von Helmholtz
11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: gelbe Buchreihe
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Der deutsche Physiologe, Physiker und Universalgelehrte Hermann von Helmholtz hielt zu unterschiedlichen Themen Vorträge, etwa über das Denken in der Medizin, über die Wechselwirkung der Naturkräfte und die darauf bezüglichen neuesten Ermittlungen der Physik, über die physiologischen Ursachen der musikalischen Harmonie, Optisches über Malerei, über den Ursprung und die Bedeutung der geometrischen Axiome, über Goethes Vorahnungen kommender naturwissenschaftlicher Idee, die in diesem Buch zusammen mit seiner Biographie und mit vielen Bildern und Zusatzinformationen neu veröffentlicht werden. – Rezession: Ich bin immer wieder begeistert von der "Gelben Buchreihe". Die Bände reißen einen einfach mit. Inzwischen habe ich ca. 20 Bände erworben und freue mich immer wieder, wenn ein neues Buch erscheint. oder: Sämtliche von Jürgen Ruszkowski aus Hamburg herausgegebene Bücher sind absolute Highlights. Dieser Band macht da keine Ausnahme. Sehr interessante und abwechslungsreiche Themen aus verschiedenen Zeit-Epochen, die mich von der ersten bis zur letzten Seite gefesselt haben! Man kann nur staunen, was der Mann in seinem Ruhestand schon veröffentlicht hat. Alle Achtung!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 259
Ähnliche
Hermann von Helmholtz
Raum und Kraft – Teil 1 – Band 214e in der gelben Buchreihe – bei Jürgen Ruszkowski
Band 214e in der gelben Buchreihe
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Vorwort des Herausgebers
Die Autoren
Hermann von Helmholtz und Heinrich Hertz: Raum und Kraft
Zur Einführung
Hermann von Helmholtz: Über das Streben nach Popularisierung der Wissenschaft
Die Tatsachen in der Wahrnehmung
Antwortrede, gehalten beim Empfang der Graefe-Medaille
Das Denken in der Medizin
Über die Wechselwirkung der Naturkräfte und die darauf bezüglichen neuesten Ermittlungen der Physik
Über die physikalischen Ursachen der musikalischen Harmonie
Die maritime gelbe Buchreihe
Weitere Informationen
Impressum neobooks
Vorwort des Herausgebers
Vorwort des Herausgebers
Von 1970 bis 1997 leitete ich das größte Seemannsheim in Deutschland am Krayenkamp am Fuß der Hamburger Michaeliskirche.
Dabei lernte ich Tausende Seeleute aus aller Welt kennen.
Im Februar 1992 entschloss ich mich, meine Erlebnisse mit den Seeleuten und deren Berichte aus ihrem Leben in einem Buch zusammenzutragen. Es stieß auf großes Interesse. Mehrfach wurde in Leser-Reaktionen der Wunsch laut, es mögen noch mehr solcher Bände erscheinen. Deshalb folgten dem ersten Band der „Seemannsschicksale“ weitere.
* * *
2023 Jürgen Ruszkowski
Ruhestands-Arbeitsplatz
Hier entstehen die Bücher und Webseiten des Herausgebers
* * *
Die Autoren
Die Autoren
Hermann von Helmholtz
https://www.projekt-gutenberg.org/autoren/namen/helmholt.html
Hermann Ludwig Ferdinand Helmholtz, ab 1883 von Helmholtz, * 31. August 1821 in Potsdam – † 8. September 1894 in Charlottenburg bei Berlin, war ein deutscher Mediziner, Physiologe und Physiker. Als Universalgelehrter leistete er wichtige Beiträge zur mathematischen Theorie der Optik, Akustik, Elektrodynamik, Thermodynamik und Hydrodynamik.
* * *
Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz wurde am 31. August 1821 in Potsdam geboren und starb am 08. September 1894 in Charlottenburg. Er war ein deutscher Physiologe und Physiker. Als Universalgelehrter war er einer der vielseitigsten Naturwissenschaftler seiner Zeit.
* * *
Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz (1821-1894), deutscher Physiologe und Physiker
https://www.helmholtz-bi.de/unsere-schule/schulgeschichte/biografie-hermann-von-helmholtz/
Helmholtz war einer der vielseitigsten Naturwissenschaftler seiner Zeit; seine wissenschaftlichen Ergebnisse auf den Gebieten der Physiologie, Optik, Akustik und Elektrodynamik lieferten grundlegende, erkenntnistheoretische Fortschritte im 19. Jahrhundert.
Helmholtz wurde am 31. August 1821 als Sohn eines Gymnasiallehrers in Potsdam geboren. Ab 1838 besuchte er das Friedrich-Wilhelm-Institut für Medizin in Berlin und war Schüler des Physiologen Johannes Müller.
Johannes Peter Müller, * 14. Juli 1801 in Koblenz; † 28. April 1858 in Berlin, war ein deutscher Mediziner, Physiologe und vergleichender Anatom bzw. Zoologe sowie Meeresbiologe und Naturphilosoph. Er befasste sich vor allem mit der Nerven- und Sinnesphysiologie, baute die Reflexlehre weiter aus und gilt als der bedeutendste deutsche Physiologe des 19. Jahrhunderts.
Helmholtz vertrat die Auffassung, dass physiologische und auch anorganische Parameter beobachtbar sind und mit Mitteln der Mechanik erfasst und gemessen werden können. Diese Auffassung bildete die Grundlage für seine späteren Forschungen und die darauf beruhenden Erkenntnisse.
Während seiner Dienstzeit als Militärarzt verfasste Helmholtz 1847 seine Arbeit „Über die Erhaltung der Kraft“, in der er die Wärmeproduktion und Muskelkontraktion des Muskels beschreibt und auf physikalische und chemische Kräfte zurückführt. Bei seinen Untersuchungen an Nervenfasern von Fröschen gelang es ihm als erstem Naturwissenschaftler, die Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Nervenleitung zu messen. Von 1856 bis 1866 wandte er sich als Professor für Anatomie Fragen der Sinnesphysiologie zu. Als Ergebnis seiner ausführlichen Untersuchungen veröffentlichte Helmholtz das mehrbändige Handbuch der Physiologischen Optik, das jahrzehntelang ein Standardwerk zur Physiologie und Physik des Gesichtssinnes blieb. Im Zuge seiner Forschung erfand er den Augenspiegel, mit dessen Hilfe man in das Innere des Auges blicken kann, und erweiterte die Theorie des Farbensehens.
Augenspiegel
Aufgrund seiner Untersuchungen zur Akustik formulierte er die Resonanztheorie des Hörens, der zufolge bestimmte Organe des Innenohres als Resonanzkörper zur Weiterleitung der Schallwellen dienen. Die Resultate sind in dem 1863 erschienenen Werk Lehre von den Tonempfindungen als Grundlage für die Theorie der Musik veröffentlicht. Durch dieses Werk widerlegte er ebenso wie in dem Handbuch der Physiologischen Optik den Vitalismus, indem er beispielsweise die Wahrnehmung von Musik durch die mechanische Aufnahme und Weiterleitung von Schallwellen durch das Ohr erklärt.
Herrmann von Helmholtz 1881
Seit 1870 war Helmholtz an der Universität Berlin Professor für Physik. Er wandte sich auch rein physikalischen Forschungen wie der Elektrodynamik zu, die er auf wenige mathematische Prinzipien zu reduzieren suchte. Auf dem Gebiet der Meteorologie wandte er ebenfalls den mechanistischen Ansatz an, wobei er auf seine früheren Entdeckungen der Bewegung von Wellen und der Energieübertragung aufbauen konnte. Helmholtz starb am 8. September 1894 in Berlin. Der entscheidende Erkenntniszuwachs, für den Helmholtz in seinem Jahrhundert gesorgt hatte, war schon bald durch die Entdeckung der Röntgenstrahlung und der Radioaktivität sowie durch die Formulierung der Relativitätstheorie, welche die Physik revolutionierten, überholt.
* * *
Heinrich Hertz
Heinrich Rudolf Hertz, * 22. Februar 1857 in Hamburg; † 1. Januar 1894 in Bonn, war ein deutscher Physiker. Er konnte 1886 als Erster elektromagnetische Wellen im Experiment erzeugen und nachweisen und gilt damit als deren Entdecker.
https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Hertz
* * *
Julius Robert Mayer
Julius Robert Mayer, * 25. November 1814 in Heilbronn; † 20. März 1878 ebenda, war ein deutscher Arzt und physiologisch forschender Mediziner.
https://en.wikipedia.org/wiki/Julius_von_Mayer
* * *
Hermann von Helmholtz und Heinrich Hertz: Raum und Kraft
Hermann von Helmholtz und Heinrich Hertz: Raum und Kraft
https://www.projekt-gutenberg.org/helmholt/raumkraf/raumkraf.html
Aus der Werkstatt genialer Naturforscher
Eine Auswahl aus den gemeinverständlichen Vorträgen und Aufsätzen
Eingeleitet und erläutert von
Dr. E. Wildhagen
* * *
Teil 1
Zur Einführung
Zur Einführung
„Sehr häufig bin ich gefragt worden, auf welche Weise ich zuerst zu den im Folgenden beschriebenen Versuchen geführt worden bin.“ Dieser Satz, mit dem Heinrich Hertz seine gesammelten Aufsätze über die Ausbreitung der elektrischen Kraft einleitet, könnte zugleich auch die allgemeine Überschrift zu diesem Band sein, in dem versucht ist, einen allgemeinverständlichen Ausschnitt aus dem Schaffen von Helmholtz und Hertz zu geben.
Ein langer, schwieriger Weg, auf dem der deutsche Genius wie kein andrer bahnbrechend gewirkt hat, führt von den ersten unbeholfenen Versuchen, durch die Einführung der Erfahrung als Erkenntnisquelle die mittelalterlichen Denkmethoden zu überwinden, zu unserm Weltbild.
Das deutsche Geistesleben im Anfang des vorigen Jahrhunderts stand noch ganz unter dem Zeichen der reinen Philosophie. Das war nach der Umwälzung des Denkens durch den Titanen Kant wohl verständlich.
Immanuel Kant, * 22. April 1724 in Königsberg (Preußen); † 12. Februar 1804 ebenda, war ein deutscher Philosoph der Aufklärung sowie unter anderem Professor der Logik und Metaphysik in Königsberg. Kant zählt zu den bedeutendsten Vertretern der abendländischen Philosophie.
Kant hatte zwar der Erfahrung eine wichtige Aufgabe zugewiesen, aber andererseits auch die Selbstherrlichkeit des apriorischen Denkens begründet. Raum und Zeit wurden als Formen unserer Anschauung definiert. Alle Erscheinungen in Raum und Zeit sollten sich den Gesetzen unseres apriorischen Denkens fügen, wie es in Geometrie und Algebra sich äußert, zu denen als weitere apriorische Denkform die Kausalität hinzutrat. Der Verlockung zu einer schrankenlosen Ausnutzung des apriorischen Denkens, auch in der Erklärung der Natur, war trotz des Gegenbeispiels, das Kant mit seiner „Naturgeschichte des Himmels“ gegeben hatte, eine ganze Generation kühner Philosophen erlegen, und ihre im leeren Raum schwebenden Weltgebäude nahmen das Interesse der Gebildeten weit mehr in Anspruch als die schon damals recht reiche exakte Naturwissenschaft. Mit einer uns heute unverständlichen Überheblichkeit meinte die Philosophie des reinen Denkens auf die Erfahrung herabblicken zu dürfen. Man glaubte, mit großen naturphilosophischen Systemen der Natur Gesetze vorschreiben und damit den langwierigen Weg einer Erforschung durch Beobachtung und Experiment sparen zu können.
Die Neigung zum Geistigen philologisch-philosophischen Gepräges fand von einer anderen Seite her eine wesentliche Stützung. Gerade auf deutschem Boden, von Franz Bopp, war zu Beginn des Jahrhunderts die vergleichende Sprachwissenschaft begründet worden.
Franz Bopp, * 14. September 1791 in Mainz; † 23. Oktober 1867 in Berlin, war ein deutscher Sprachwissenschaftler und Sanskritforscher.
Brüder Wilhelm (1785–1863) und Jacob (1786–1859) Grimm
(Siehe die Bände 183e und 184e in dieser gelben Buchreihe!)
Die Brüder Grimm, um nur ein Beispiel herauszugreifen, hatten dem wissenschaftlich interessierten Geist durch die Wiedererschließung des deutschen Altertums reiche Nahrung gegeben.
Diese von der Romantik getragene geisteswissenschaftliche Richtung, die in Hegel ihren Höhepunkt erreichte, behauptete ihren unbedingten Vorrang bis in die Mitte des Jahrhunderts hinein.
Georg Wilhelm Friedrich Hegel, * 27. August 1770 in Stuttgart; † 14. November 1831 in Berlin, war ein deutscher Philosoph, der als wichtigster und letzter Vertreter des deutschen Idealismus gilt.
Als Helmholtz 1849 Professor der Physiologie in Königsberg wurde, riet ihm noch ein wohlmeinender Kollege, wie er in dem Aufsatz „Das Denken in der Medizin“ schildert, die experimentelle Seite seiner Disziplin einem Assistenten zu überlassen, da es sich für einen Ordinarius nicht zieme, aus der Region reinen Denkens in die profane Erfahrung herabzusteigen. Helmholtz stellte dieser Anschauungsweise mit größter Folgerichtigkeit die induktive Methode als einzige Grundlage der Naturwissenschaft entgegen. Die Notwendigkeit einer ständigen Verteidigung des wissenschaftlichen Eigenwertes der Naturforschung zwang ihn dazu, von seiner Wissenschaft her in die Gefilde der Philosophie vorzustoßen, um im fruchtbarsten Wettkampf mit den Fachphilosophen die erkenntnistheoretischen und methodologischen Grundlagen seines Forschens aufzuweisen und zu einem selbständigen in sich geschlossenen Weltbild auszugestalten. So ist der Aufsatz „Die Tatsachen in der Wahrnehmung“ von höchster Bedeutung auch für die Geschichte der Philosophie.
Dass Helmholtz angesichts seiner überragenden Stellung in der internationalen wissenschaftlichen Welt davon absehen konnte, wie es jetzt wieder zuweilen geschieht, dem Laien gegenüber immer nur den praktischen Wert wissenschaftlicher Entdeckungen zu betonen, dass er immer wieder gerade den hohen ethischen Zug des reinen Strebens nach der Wahrheit hervorhob, verleiht seinen Äußerungen über seine Zeit hinaus besonderen Wert.
* * *
Man hat sich in Deutschland daran gewöhnt, die Darstellungsweise unserer Wissenschaftler als schwerfällig und schwerverständlich zu kritisieren und den leicht fasslichen Stil etwa der französischen Gelehrten ihr entgegenzuhalten. Das ist eines der ungerechtesten Vorurteile. Die Geschichte der deutschen Wissenschaft ist reich an Meisterwerken darstellender Prosa. Gewiss ist es schwer, das Ringen Kants um Klarheit an den Grenzen menschlichen Erkenntnisvermögens zu verfolgen. Aber selbst ihm tut man unrecht; seine „Kritik der Urteilskraft“ ist lichtvoll und klar, ganz zu schweigen von seinen kleineren Schriften, etwa der „Naturgeschichte des Himmels“ oder „Vom ewigen Frieden“. Gerade unsere großen Forscher haben mit wenigen Ausnahmen neben ihren nur für den engeren Fachkreis bestimmten Werken, die nicht Schönheit auf Kosten von Exaktheit und Gründlichkeit erkaufen durften, in Vorbildlichem Stil geschrieben. Unter ihnen steht Helmholtz an erster Stelle. Es gibt kaum etwas Eleganteres in deutscher Prosa als seine zierliche Antwortrede nach Empfang der Graefe-Medaille, und wenig rein literarische Betrachtungen dürften seinen Aufsatz über Goethes Vorahnungen kommender naturwissenschaftlicher Entdeckungen an Tiefe, philosophischen Gehalt und Schönheit der Form übertreffen. Mit großer Klarheit vermag er selbst verwickelte Gedankengänge dem Verständnis auch des Nichtwissenschaftlers näherzubringen. Dazu befähigt ihn vor allem die große Anschaulichkeit seines Denkens. Es grenzt ans Wunderbare, wie er es versteht, in seinem Vortrag über die Axiome (Ein Axiom (von griechisch ἀξίωμα axíoma, „Forderung; Wille; Beschluss; Grundsatz; philos. (...) Satz, der keines Beweises bedarf“, „Wertschätzung, Urteil, als wahr angenommener Grundsatz“) der Geometrie nichteuklidische Raumgebilde in anschauliche Bestandteile aufzulösen. Beim Lesen kann man ihm nachempfinden, welche Freude es ihm bereitet, geometrische Theorien, die nach landläufiger Meinung das Fassungsvermögen des Nichtmathematikers weit übersteigen, Kant zum Trotz, durch Mittel unserer sinnlichen Anschauung jedermann zugänglich zu machen.
Das gleiche gilt von Heinrich Hertz. Sein nach äußerster Einfachheit strebender Stil spiegelt die Klarheit und Folgerichtigkeit seiner schöpferischen Gedanken. Das beste Beispiel dafür ist seine Einleitung zu den Versuchen über die Ausbreitung der elektrischen Kraft, in der es ihm gelingt, ohne Mathematik den möglichen Wirklichkeitsgehalt der Maxwellschen Gleichungen gemeinverständlich darzustellen.
* * *
Heute ist es dem einzelnen ganz unmöglich, auch nur ein größeres Teilgebiet eines wissenschaftlichen Faches in allen Einzelheiten zu überblicken. Helmholtz war das letzte große Genie, das, wie zwei Jahrhunderte vor ihm Leibniz, die gesamte exakte Naturwissenschaft seiner Zeit von der Mathematik über Physik, Chemie, Astronomie, Geologie bis zur Physiologie und Medizin beherrschte.
Gottfried Wilhelm Leibniz, * 1. Juli 1646 in Leipzig, Kurfürstentum Sachsen; † 14. November 1716 in Hannover, Kurfürstentum Braunschweig-Lüneburg, war ein deutscher Philosoph, Mathematiker, Jurist, Historiker und politischer Berater der frühen Aufklärung.
Jede dieser Wissenschaften erfuhr mehr oder weniger entscheidende Förderung durch ihn, alle fügten sich auch bei fortschreitender Entwicklung in seine fest begründete Weltanschauung.
Gegenüber seiner reichen Vielseitigkeit beschränkt sich das Lebenswerk seines früh vollendeten Schülers Heinrich Hertz, des Entdeckers der elektrischen Wellen und Begründers unseres Funkwesens, auf einige Sondergebiete der Physik. Gleichwohl erheben ihn seine Leistungen in die Reihe der begnadeten wissenschaftlichen Genien.
Neben diesen beiden Gestirnen am Himmel der Physik ist der Ruhm Julius Robert Mayers, des Entdeckers des Gesetzes von der Erhaltung der Energie fast verblichen. Als Außenseiter hatte er es schwer sich durchzusetzen, besonders da Helmholtz wenige Jahre später ebenfalls selbständig dieses fundamentalste Naturgesetz fand und zu seiner Überraschung erst später erfuhr, dass dieser unbekannte Arzt ihm zuvorgekommen war.
* * *
In seiner Mechanik unternahm Hertz einen letzten großartigen Versuch, die Einheitlichkeit und Einheit des physikalischen Weltbildes auf der Grundlage und mit den Mitteln der sogenannten „klassischen“ Mechanik zu sichern. Damit schloss er eine lange ungemein fruchtbare Epoche einer wissenschaftlichen Betrachtungsweise ab, in der neben vielen andern Kopernikus, Galilei, Kepler, Leibniz, Newton, Kant, J. R. Mayer und Helmholtz durch immer schärfere Fassung der Begriffe Masse, Kraft und Bewegung und ihre raumzeitliche Ordnung eine dem Stand der jeweiligen Erfahrung angemessene und ausreichende Beschreibung der Erscheinungen zu geben sich bemüht hatten.
Nikolaus Kopernikus, * 19. Februar 1473 in Thorn – † 24. Mai 1543 in Frauenburg; eigentlich Niklas Koppernigk, latinisiert Nicolaus Cop[p]ernicus, polonisiert Mikołaj Kopernik
Galileo Galilei, * 15. Februar 1564 in Pisa; † in Arcetri bei Florenz, war ein italienischer Universalgelehrter.
Er war Philosoph, Physiker, Mathematiker, Ingenieur, Astronom und Kosmologe. Viele seiner Entdeckungen – vor allem in der Mechanik und der Astronomie – gelten als bahnbrechend.
Johannes Kepler, * 27. Dezember 1571 in Weil der Stadt; † 15. November 1630 in Regensburg, war ein deutscher Astronom, Physiker, Mathematiker und Naturphilosoph.
Gottfried Wilhelm Leibniz, *1. Juli 1646in Leipzig, Kurfürstentum Sachsen – † 14. November 1716 in Hannover, Kurfürstentum Braunschweig-Lüneburg, war ein deutscher Philosoph, Mathematiker, Jurist, Historiker und politischer Berater der frühen Aufklärung.
Isaac Newton, * 4. Januar 1643 in Woolsthorpe-by-Colsterworth in Lincolnshire – † 20. März 1726 in Kensington, war ein englischer Physiker, Astronom und Mathematiker an der Universität Cambridge und Leiter der Royal Mint.
Noch 1893, kurz vor seinem Tod, kann Hertz schreiben: „Alle Physiker sind einstimmig darin, dass es die Aufgabe der Physik sei, die Erscheinungen der Natur auf die einfachen Gesetze der Mechanik zurückzuführen.“ Der nächste Satz bringt bereits die Einschränkung: „Welches aber diese einfachen Gesetze sind, darüber herrscht nicht mehr die gleiche Einstimmigkeit.“
Diese Einstimmigkeit herrscht heute weniger denn je. Die so fest scheinende Grundlage der „klassischen“ Mechanik, die Geltung des Kausalitätsbegriffs und der euklidischen Geometrie für unsere Naturerkenntnis, ist erschüttert. Die „prästabilierte Harmonie“ zwischen unserem reinen, apriorischen Denken und der wirklichen Welt, wie sie in Kants „Kritik der reinen Vernunft“ dem Stand der Wissenschaft seiner Zeit entsprechend ihre klarste Prägung fand, muss jetzt nach mehr als hundertjähriger Geltung in einer höheren Schicht des Erkennens gesucht werden. Der Kausalitätsbegriff in seiner strengen Fassung verliert für die Betrachtungsweise der neuesten Physik seinen erfüllbaren Sinn und ist der statistischen Gesetzmäßigkeit, die mit Wahrscheinlichkeitsregeln arbeitet, gewichen. Die euklidische Geometrie gilt als geeignetes Darstellungsmittel nur noch annäherungsweise in mittleren Größenverhältnissen. Im Kosmischen wie in der Welt des Kleinsten, in der Astronomie wie in der Atomphysik erfüllen nichteuklidische Raumvorstellungen, wie sie Helmholtz als erster in der Erscheinungswelt anzuwenden versuchte, besser den Zweck einer ökonomischen Beschreibung des Wirklichen. Die gewaltigste Umwälzung der naturwissenschaftlichen Grundbegriffe, die stärker als alle anderen Neuerungen zugleich eine Umstellung des Denkens erfordert, ist die Erkenntnis, dass der in zwei Jahrtausenden entwickelte Begriff der Kontinuität für das reale Geschehen nicht gültig ist, dass vielmehr die Energie in Elementarquanten wirkt. Diese im Jahr 1900, wenige Jahre nach dem Tod von Helmholtz und Hertz von Max Planck begründete „Quantentheorie“ führte eine neue allgemeine Konstante in die Physik ein und war der Anfang einer ungemein fruchtbaren Entwicklung, aus der sich das Plancksche Strahlungsgesetz und die Bohrsche Quantentheorie des Atoms als erste fundamentale Einzelleistungen abheben.
So bildet die Mechanik von Hertz den letzten großen Ausklang des neunzehnten Jahrhunderts. Schon einmal in der Geschichte der Naturerkenntnis hatte man versucht, eine zu eng gewordene Anschauung durch immer neue Erweiterungen, durch immer künstlichere Betrachtungsweisen zu stützen, als das vorkopernikanische Weltsystem in einer letzten großartigen Fassung durch Tycho de Brahe seinen stärksten Verteidiger fand.
Max Karl Ernst Ludwig Planck, * 23. April 1858 in Kiel, Herzogtum Holstein; † 4. Oktober 1947 in Göttingen, war ein deutscher Physiker auf dem Gebiet der theoretischen Physik. Er gilt als Begründer der Quantenphysik.
Tycho de Brahe, * 14. Dezember 1546 auf Schloss Knutstorp, Schonen, damals Dänemark; † 24. Oktober 1601 in Prag oder in Benátky bei Prag, Königreich Böhmen, war ein dänischer Adeliger und einer der bedeutendsten Astronomen.
Aus seinen vergeblichen komplizierten Bemühungen, durch Zyklen und Epizyklen die scheinbare Unregelmäßigkeit der Planetenbahnen zu erklären, hat Kepler seine klaren und einfachen Rechnungen abgeleitet. In ähnlicher Weise zeigte gerade der konsequenteste Versuch, alle Naturerscheinungen auf mechanische Gesetzmäßigkeiten zurückzuführen, die Unzulänglichkeiten und Begrenztheiten der mechanischen Theorie. Es ist Hertz nicht gelungen, „die nächste und in gewissem Sinne wichtigste Aufgabe unserer bewussten Naturerkenntnis, dass sie uns befähige, zukünftige Erfahrungen vorauszusehen, um nach dieser Voraussicht unser gegenwärtiges Handeln einrichten zu können“, zu lösen. Seine erkenntnistheoretischen Gedanken, mit denen er sein letztes großes Werk einleitet, werden gleichwohl in ihrer überirdischen kristallenen Klarheit in der Geschichte der Wissenschaft ihren unvergänglichen Wert behaupten. Sie bilden, über die methodologischen Anschauungen von Helmholtz teilweise hinausgehend, die moderne Fortsetzung zu dem Streben Kants nach klarster, nüchternster Abwägung der Gültigkeit und Reichweite unserer wissenschaftlichen Begriffsbildung. So durften sie neben den das ganze Weltbild des neunzehnten Jahrhunderts umfassenden Gedanken Helmholtz' nicht fehlen in diesem Band, der in den besten Beispielen einen Querschnitt durch den geistigen Gehalt der heroischen Epoche unserer modernen Naturwissenschaft geben soll. Beide, Helmholtz wie Hertz, ragen als schöpferische Persönlichkeiten aus ihrer Zeit heraus in die neueste vielgestaltige Entwicklung hinein.
* * *
Hermann von Helmholtz: Über das Streben nach Popularisierung der Wissenschaft
Hermann von Helmholtz: Über das Streben nach Popularisierung der Wissenschaft
Das auch in Deutschlands gebildeteren Kreisen erwachende und sich immer lebhafter äußernde Verlangen nach naturwissenschaftlicher Belehrung halte ich nicht bloß für ein Haschen nach einer neuen Art von Unterhaltung oder für leere und fruchtlose Neugier, sondern für ein wohlberechtigtes geistiges Bedürfnis, welches mit den wichtigsten Triebfedern der gegenwärtigen geistigen Entwicklungsvorgänge eng zusammenhängt. Nicht dadurch allein, dass sie gewaltige Naturkräfte den Zwecken des Menschen unterworfen und uns eine Fülle neuer Hilfsmittel zu Gebot gestellt haben, sind die Naturwissenschaften von dem allererheblichsten Einfluss auf die Gestaltung des gesellschaftlichen, industriellen und politischen Lebens der zivilisierten Nationen geworden; und doch wäre schon diese Art ihrer Wirkungen wichtig genug, dass der Staatsmann, Historiker und Philosoph ebenso gut wie der Techniker und Kaufmann wenigstens an den praktisch gewordenen Ergebnissen derselben nicht teilnahmslos vorübergehen kann. Viel tiefer gehend noch und weiter tragend, wenn auch viel langsamer sich entfaltend ist eine andere Seite ihrer Wirkungen, nämlich ihr Einfluss auf die Richtung des geistigen Fortschreitens der Menschheit. Es ist schon oft gesagt und auch wohl den Naturwissenschaften als Schuld angerechnet worden, dass durch sie ein Zwiespalt in die Geistesbildung der modernen Menschheit gekommen sei, der früher nicht bestand. In der Tat ist Wahrheit in dieser Aussage. Ein Zwiespalt macht sich fühlbar; ein solcher wird aber durch jeden großen neuen Fortschritt der geistigen Entwicklung hervorgerufen werden müssen, sobald das Neue eine Macht geworden ist und es sich darum handelt, seine Ansprüche gegen die des Alten abzugrenzen.
Der bisherige Bildungsgang der zivilisierten Nationen hat seinen Mittelpunkt im Studium der Sprache gehabt. Die Sprache ist das große Werkzeug, durch dessen Besitz sich der Mensch von den Tieren am wesentlichsten unterscheidet, durch dessen Gebrauch es ihm möglich wird, die Erfahrungen und Kenntnisse der gleichzeitig lebenden Individuen, wie die der vergangenen Generationen, jedem einzelnen zur Verfügung zu stellen, ohne welches ein jeder, wie das Tier, auf seinen Instinkt und seine eigene einzelne Erfahrung beschränkt bleiben würde. Dass Ausbildung der Sprache einst die erste und notwendigste Arbeit der heranwachsenden Volksstämme war, so wie noch jetzt die möglichst verfeinerte Ausbildung ihres Verständnisses und ihres Gebrauchs die Hauptaufgabe der Erziehung jedes einzelnen Individuums ist und immer bleiben wird, versteht sich von selbst. Ganz besonders eng knüpft sich die Kultur der modernen europäischen Nationen geschichtlich an das Studium der klassischen Überlieferungen und dadurch unmittelbar an das Sprachstudium an. Mit dem Sprachstudium hing zusammen das Studium der Denkformen, die sich in der Sprache ausprägen. Logik und Grammatik, das heißt nach der ursprünglichen Bedeutung dieser Worte, die Kunst zu sprechen und die Kunst zu schreiben, beide im höchsten Sinn genommen, waren daher die natürlichen Angelpunkte der bisherigen geistigen Bildung.
Wenn nun auch die Sprache das Mittel ist, die einmal erkannte Wahrheit zu überliefern und zu bewahren, so dürfen wir doch nicht vergessen, dass ihr Studium nichts davon lehrt, wie neue Wahrheit zu finden sei. Dementsprechend zeigt die Logik wohl, wie aus dem allgemeinen Satz, der den Major eines Schlusses bildet, Folgerungen zu ziehen seien; wo aber ein solcher Satz herkomme, darüber weiß sie nichts zu berichten. Wer sich von seiner Wahrheit selbständig überzeugen will, der muss umgekehrt mit der Kenntnis der Einzelfälle beginnen, die unter das Gesetz gehören, und die später, wenn dieses fertiggestellt ist, freilich auch als Folgerungen aus dem Gesetz aufgefasst werden können. Nur wenn die Kenntnis des Gesetzes eine überlieferte ist, geht sie wirklich der der Kenntnis der Folgerungen voraus, und in solchem Fall gewinnen dann die Vorschriften der alten formalen Logik ihre unverkennbare praktische Bedeutung.
Alle diese Studien führen uns also nicht selbst an die eigentliche Quelle des Wissens, stellen uns nicht der Wirklichkeit gegenüber, von der wir zu wissen verlangen. Es liegt sogar eine unverkennbare Gefahr darin, dass dem einzelnen vorzugsweise solches Wissen überliefert wird, von dessen Ursprung er keine eigene Anschauung hat. Die vergleichende Mythologie und die Kritik der metaphysischen Systeme wissen viel davon zu erzählen, wie bildlicher Wortausdruck später in eigentlicher Bedeutung genommen und als uranfängliche geheimnisvolle Weisheit gepriesen worden ist.
Also bei aller Anerkennung der hohen Bedeutung, welche die fein durchgearbeitete Kunst, das erworbene Wissen anderen zu überliefern, und wiederum von anderen solche Überlieferung zu empfangen, für die geistige Entwicklung des Menschengeschlechts hat und bei aller Anerkennung der Wichtigkeit, welche der Inhalt der klassischen Schriften für die Ausbildung des sittlichen und ästhetischen Gefühls, für die Entwicklung einer anschaulichen Kenntnis menschlicher Empfindungen, Vorstellungskreise, Kulturzustände hat, müssen wir doch hervorheben, dass ein wichtiges Moment dem ausschließlich literarisch-logischen Bildungswege abgeht. Dies ist die methodische Schulung derjenigen Tätigkeit, durch welche wir das ungeordnete, vom wilden Zufall scheinbar mehr als von Vernunft beherrschte Material, das in der wirklichen Welt uns entgegentritt, dem ordnenden Begriff unterwerfen und dadurch auch zum sprachlichen Ausdruck fähig machen. Eine solche Kunst der Beobachtung und des Versuchs finden wir bis jetzt fast nur in den Naturwissenschaften methodisch entwickelt; die Hoffnung, dass auch die Psychologie der Individuen und der Völker, nebst den auf sie zu basierenden praktischen Wissenschaften der Erziehung, der gesellschaftlichen und staatlichen Ordnung zum gleichen Ziele gelangen werde, scheint sich vorläufig nur auf eine ferne Zukunft richten zu dürfen.
Diese neue Aufgabe, von der naturwissenschaftlichen Forschung auf neuen Wegen verfolgt, hat schnell genug neue, in ihrer Art unerhörte Erfolge als Beweis dafür gegeben, welcher Leistungen das menschliche Denken fähig ist, wo dasselbe den ganzen Weg von den Tatsachen bis zur vollendeten Kenntnis des Gesetzes unter günstigen Bedingungen seiner selbst bewusst, und selbst alles prüfend zurücklegen kann. Die einfacheren Verhältnisse, namentliche der unorganischen Natur, erlauben eine so eindringende und genaue Kenntnis ihrer Gesetze zu erlangen, eine so weit reichende Deduktion der aus diesen fließenden Folgerungen auszuführen, und diese wiederum durch so genaue Vergleichung mit der Wirklichkeit zu prüfen und zu bewahrheiten, dass mit der systematischen Entfaltung solcher Begriffsbildungen (zum Beispiel mit der Herleitung der astronomischen Erscheinungen aus dem Gesetze der Gravitation) kaum ein anderes menschliches Gedankengebäude in Bezug auf Folgerichtigkeit, Sicherheit, Genauigkeit und Fruchtbarkeit zugleich möchte verglichen werden können.
Ich erinnere an diese Verhältnisse hier nur, um hervorzuheben, in welchem Sinn die Naturwissenschaften ein neues und wesentliches Element der menschlichen Bildung von unzerstörbarer Bedeutung auch für alle weitere Entwicklung derselben in der Zukunft sind, und dass eine volle Bildung des einzelnen Menschen, wie der Nationen, nicht mehr ohne eine Vereinigung der bisherigen literarisch-logischen und der neuen naturwissenschaftlichen Richtung möglich sein wird.
Nun ist die Mehrzahl der Gebildeten bisher nur auf dem alten Weg unterrichtet worden und ist fast gar nicht in Berührung mit der naturwissenschaftlichen Gedankenarbeit gekommen, höchstens ein wenig mit der Mathematik. Männer von diesem Bildungsgang sind es vorzugsweise, die unsere Staaten lenken, unsere Kinder erziehen, Ehrfurcht vor der sittlichen Ordnung aufrecht halten, und die Schätze des Wissens und der Weisheit unserer Vorfahren aufbewahren. Dieselben sind es nun auch, welche die Änderungen im Gang der Bildung der neu aufwachsenden Generation organisieren müssen, wo solche Änderungen nötig sind. Sie müssen dazu ermutigt oder gedrängt werden durch die öffentliche Meinung der urteilsfähigen Klassen des ganzen Volkes, der Männer, wie der Frauen.
Abgesehen also vom natürlichen Drang jedes warmherzigen Menschen, auch andere zu dem, was er als wahr und richtig erkannt hat, hinzuleiten, wird für jeden Freund der Naturwissenschaften ein mächtiges Motiv, sich an solcher Arbeit zu beteiligen, in der Überlegung liegen, dass die Weiterentwicklung dieser Wissenschaften selbst, die Entfaltung ihres Einflusses auf die menschliche Bildung, und, insofern sie ein notwendiges Element dieser Bildung sind, sogar die Gesundheit der weiteren geistigen Entwicklung des Volkes davon abhängt, dass den gebildeten Klassen Einsicht in die Art und die Erfolge der naturwissenschaftlichen Forschung so weit gegeben wird, als es ohne eigene eingehende Beschäftigung mit diesen Fächern überhaupt möglich ist. Dass übrigens das Bedürfnis nach einer solchen Einsicht auch von denen gefühlt wird, welche unter überwiegend sprachlichem und literarischem Unterricht aufgewachsen sind, zeigt die große Menge populärer naturwissenschaftlicher Bücher, welche alljährlich erscheinen, und der Eifer, mit dem allgemein verständliche Vorlesungen naturwissenschaftlichen Inhalts besucht werden.
Es liegt aber in der Natur der Sache, dass der wesentliche Teil dieses Bedürfnisses, der tiefen Lage seiner Wurzeln entsprechend, nicht leicht zu befriedigen ist. Zwar, was die Wissenschaft als feststehendes Resultat einmal abgesetzt und fertig durchgearbeitet hat, das kann auch von verständigen Kompilatoren zusammengestellt und in die passende Form gebracht werden, so dass es ohne weitere Vorkenntnisse des Lesers bei einiger Ausdauer und Geduld von diesem verstanden werden mag. Aber eine solche auf die tatsächlichen Ergebnisse beschränkte Kenntnis ist es nicht eigentlich, um was es sich handelt. Ja solche Bücher lenken bei bester Absicht leicht in falsche Bahnen. Sollen sie nicht ermüden, so müssen sie die Aufmerksamkeit des Lesers meist durch Anhäufung von Kuriositäten festzuhalten suchen, wodurch das Bild von der Wissenschaft ein ganz falsches wird; man fühlt das oft heraus, wenn man die Leser von dem erzählen hört, was ihnen wichtig erschien. Dazu tritt noch die Schwierigkeit, dass das Buch nur Wortbeschreibungen, höchstens mehr oder weniger unvollkommene Abbildungen von den Dingen und Vorgängen, die es behandelt, geben kann. Die Einbildungskraft des Lesers wird dadurch einer viel stärkeren Anstrengung bei viel ungenügenderen Resultaten unterworfen, als die des Forschers oder Schülers, der in Sammlungen und Laboratorien die lebendige Wirklichkeit der Dinge vor sich sieht.
Mir scheint aber, dass nicht sowohl Kenntnisse der Ergebnisse naturwissenschaftlicher Forschungen an sich dasjenige ist, was die verständigsten und gebildetsten unter den Laien suchen, als vielmehr eine Anschauung von der geistigen Tätigkeit des Naturforschers, von der Eigentümlichkeit seines wissenschaftlichen Verfahrens, von den Zielen, denen er zustrebt, von den neuen Aussichten, welche seine Arbeit für die großen Rätselfragen der menschlichen Existenz bietet. Von diesem allem ist in den rein wissenschaftlichen Abhandlungen unseres Gebietes kaum je die Rede; im Gegenteil, die strenge Disziplin der exakten Methode bringt es mit sich, dass in den mustergültigen Arbeiten nur von sicher Ermitteltem gesprochen wird, oder höchstens von Hypothesen, gleichsam Fragestellungen an die weitere Forschung. Ob ein Mann der Wissenschaft sagt: „Ich weiß“ oder „Ich vermute“, gilt dem größeren Teil selbst der unterrichteteren Leser ziemlich gleich; sie fragen nur nach dem Resultat und der Autorität, von der es gestützt wird, nicht nach der Begründung oder den Zweifeln. Darum gebietet natürliche Vorsicht dem ernsten Forscher in dieser Beziehung die größte Strenge.
Auch ist nicht zu verkennen, dass die besondere Disziplin des wissenschaftlichen Denkens, welche zur möglichst abstrakten und scharfen Fassung der neugefundenen Begriffe und Gesetze, zur Läuterung von allen Zufälligkeiten der sinnlichen Erscheinungsweise nötig ist, so wie das damit verbundene Verweilen und Einleben in einen dem allgemeinen Interesse fernliegenden Gedankenkreis keine günstigen Vorbereitungen für eine allgemein fassliche Darstellung der gewonnenen Einsichten vor Zuhörern sind, die einer ähnlichen Disziplin nicht unterlegen haben. Für diese Aufgabe ist vielmehr ein gewisses künstlerisches Talent der Darstellung, eine gewisse Art von Beredsamkeit notwendig. Der Vortragende oder Schreibende muss allgemein zugängliche Anschauungen finden, mittelst deren er neue Vorstellungen in möglichst sinnlicher Lebendigkeit hervorruft und an diesen dann auch die abstrakten Sätze, die er verständlich machen will, konkretes Leben gewinnen lässt. Es ist dies eine fast entgegengesetzte Behandlungsweise des Stoffes, als in den wissenschaftlichen Abhandlungen, und es ist leicht erklärlich, dass sich selten Männer finden, die zu beiderlei Art geistiger Arbeit gleich geschickt sind.
Es gibt zwei Wege, den gesetzlichen Zusammenhang der Natur aufzusuchen, den der abstrakten Begriffe und den einer reichen experimentierenden Erfahrung. Der erste Weg führt schließlich mittelst der mathematischen Analyse zur genauen quantitativen Kenntnis der Phänomene; aber er lässt sich nur beschreiten, wo der zweite schon das Gebiet einigermaßen aufgeschlossen, d. h. eine induktive Kenntnis der Gesetze mindestens für einige Gruppen der dahin gehörigen Erscheinungen gegeben hat, und es sich nur noch um Prüfung und Reinigung der schon gefundenen Gesetze, um den Übergang von ihnen zu den letzten und allgemeinsten Gesetzen des betreffenden Gebietes und um die vollständige Entfaltung von deren Konsequenzen handelt. Der andere Weg führt zu einer reichen Kenntnis des Verhaltens der Naturkörper und Naturkräfte, bei welcher zunächst das Gesetzliche nur in der Form, wie es die Künstler auffassen, in sinnlich lebendiger Anschauung des Typus seiner Wirksamkeit erkannt wird, um sich dann später in die reine Form des Begriffs herauszuarbeiten. Ganz voneinander lösen kann man beide Seiten der Tätigkeit des Physikers niemals, wenn auch die Verschiedenheit der individuellen Begabung den einen geschickter zur mathematischen Deduktion, den andern zur induktiven Tätigkeit des Experimentierens macht. Löst sich aber der erstere ganz von der sinnlichen Anschauung ab, so gerät er in Gefahr, mit großer Mühe Luftschlösser auf unhaltbare Fundamente zu bauen, und die Stellen nicht zu finden, an denen er die Übereinstimmung seiner Deduktionen mit der Wirklichkeit bewahrheiten kann; dagegen würde der letztere das eigentliche Ziel der Wissenschaft aus den Augen verlieren, wenn er nicht darauf hinarbeitete, seine Anschauungen schließlich in die präzise Form des Begriffs überzuführen.
Die erste Entdeckung bisher unbekannter Naturgesetze, das heißt also neuer Gleichförmigkeiten in dem Ablauf anscheinend unzusammenhängender Vorgänge, ist eine Sache des Witzes (dies Wort in seiner weitesten Bedeutung genommen) und wird fast immer nur durch die Vergleichung reicher sinnlicher Anschauungen gelingen; die Vervollständigung und Reinigung des Gefundenen fällt nachher der deduktiven Arbeit der begrifflichen und zwar vorzugsweise mathematischen Analyse anheim, da es sich schließlich immer um Gleichheit von Quantis handelt.