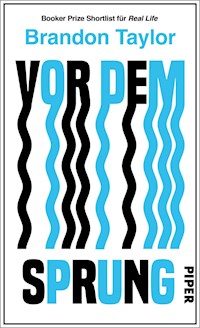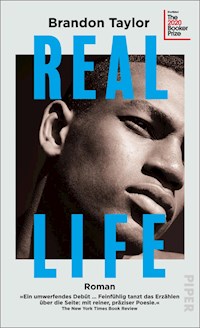
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 18,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Über die Sprengkraft der Diskriminierung Ein Spätsommerabend bei Freunden, man plaudert und sagt: Wallace könne froh sein, es als einziger Afroamerikaner an der Uni zum Biochemie-Doktoranden gebracht zu haben. Und wer bitte werde noch diskriminiert, weil er Männer liebe? Was Wallace nicht erwidert: Wie es ist, der einzige schwarze Körper in einem weißen Raum zu sein. Keine Sprache zu haben für das, was ihn ausmacht, kein Gegenüber, das die täglichen Hiebe und Stiche kennt. In diesem Sommer will er sein Leben hinter sich lassen. Mit großer Subtilität legt Brandon Taylor eine Gefühlsschicht nach der anderen frei. Ein aufwühlend intimer, ein gewaltiger Roman! »Es ist, als würden sie sagen, du sollst mit all deinen Erfahrungen kommen und ganz du selbst sein. Aber wenn du dann an ihrem Tisch sitzt, als queere schwarze Person aus dem Arbeitermilieu der Südstaaten, wollen sie auf einmal nicht mehr, dass du über bestimmte Dinge sprichst, weil du damit alle Regeln ihrer Welt brechen würdest.« Brandon Taylor im Interview mit Maddie Sofia, NPR »Ein umwerfendes Debüt … Feinfühlig tanzt das Erzählen über die Seite: mit reiner, präziser Poesie.« The New York Times Book Review »Taylor thematisiert unter anderem Einsamkeit, Begehren und – vor allem anderen – den Versuch, sich einer Sache zu verschreiben, Sinn und Glück aus ihr für das eigene Leben zu ziehen.« Time Magazine »›Real Life‹ verdeutlicht auf ergreifende Weise, welcher Widerspruch aufklafft, sobald man sich in einer Institution nicht akzeptiert und verstanden fühlt, die aggressiv ihre eigene unbefleckte Progressivität bewirbt.« The Guardian »In einer zarten, intimen und eigensinnigen Sprache lotet Taylor aus, was Race, Sexualität und Begehren bedeuten.« Newsweek »Mal bitter, mal zart schreibt sich dieser fein gewirkte Roman in die schwule Literatur ein. Aber damit nicht genug, Wallace' Stimme trägt mit ihrer erfrischenden Nuanciertheit und ihrem Sinn fürs Mikroskopische auch zur Debatte um Black Lives Matter bei.« Financial Times »Ein bestechender Entwicklungsroman!« O: The Oprah Magazine
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher: www.piper.de/literatur
© Brandon Taylor, 2020
Published by agreement with Riverhead Books,
an imprint of Penguin Publishing Group,
a division of Penguin Random House LLC
© Piper Verlag GmbH, München 2021
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
Inhalt
Cover & Impressum
Zitat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Dank
So erbte ich Monde der Enttäuschung, und Nächte voller Mühsal wurden mir zuteil.
Hiob 7,3
1
Einige Wochen nach dem Tod seines Vaters beschloss Wallace an einem kühlen Abend im Spätsommer, sich doch noch mit seinen Freunden am Pier zu treffen. Weiße Wellen dellten die Oberfläche des Sees wie kleine Grübchen. Die letzten böigen Sommertage galt es voll auszukosten, denn schon bald würde das Wetter kippen und ungemütlich werden. Weiße Menschen hatten sich überall auf den zum See hin abfallenden Terrassen verteilt, rissen den Mund auf und warfen einander ihr Lachen ins Gesicht. Oben am Himmel glitten die Möwen mühelos dahin.
Wallace stand auf einer der höher gelegenen Terrassen, blickte ins Gedränge hinunter und versuchte, inmitten all der weißen Grüppchen das richtige zu finden. Noch konnte er einfach gehen und den Abend zu Hause verbringen. Dass er sich zuletzt mit seinen Freunden am See getroffen hatte, war Jahre her, ein Umstand, der ihn in Verlegenheit brachte, weil er nach einer Erklärung verlangte, die Wallace nicht hatte. Möglicherweise hing es mit seiner Angst vor Menschenmengen zusammen, mit der unmittelbaren Nähe fremder Körper, oder mit den Vögeln, die am Himmel kreisten und auf der Suche nach Futter auf die Tische hinunterschossen. Manche hüpften zwischen den Füßen der Leute herum, als feierten sie dort unten ihre eigene Party. Die Bedrohungen lauerten an allen Ecken. Hinzu kam der Lärm – das Gebrüll, mit dem die Leute einander vergeblich zu übertönen versuchten, die schlechte Musik, die Kinder und die Hunde, die Ghettoblaster der Studenten unten am Seeufer, die Autoradios auf der Straße, die ganze kreischende Masse Hunderter kollidierender Leben.
Der Lärm schien Wallace etwas Befremdliches, noch nicht näher Bestimmtes abzuverlangen. Plötzlich entdeckte er die vier an einem der weinroten Holztische direkt unten am Wasser, genauer gesagt entdeckte er Miller, der ungewöhnlich groß und nicht zu übersehen war. Dann erkannte er Yngve und Cole, die einfach nur groß waren, und zuletzt Vincent, der knapp unter dem Durchschnitt hängen geblieben war. Miller, Yngve und Cole sahen aus wie drei helle, stolze Hirsche, wie Vertreter einer ganz eigenen Spezies, und wäre man in Eile, hätte man sie glatt für Brüder halten können. Wie Wallace und der Rest der Clique waren auch sie in diese Stadt im Mittleren Westen gekommen, um in Biochemie zu promovieren. Ihr Jahrgang war so klein wie schon seit Langem nicht mehr, und der erste mit einem schwarzen Doktoranden seit über drei Jahrzehnten. In weniger gelassenen Momenten redete Wallace sich ein, dass diese beiden Dinge zusammenhingen; dass erst das nachlassende Interesse und die geringe Bewerberzahl seine Zulassung ermöglicht hatten.
Er war kurz davor, einfach kehrtzumachen – unschlüssig, ob er die Gesellschaft der anderen, die ihm eben noch so notwendig erschienen war, wirklich ertragen könnte –, als Cole den Kopf hob und ihn bemerkte. Obwohl Wallace in seine Richtung schaute, fuchtelte er mit den Armen und machte sich noch größer, um bloß nicht übersehen zu werden. Es gab kein Zurück mehr. Wallace hob die Hand und winkte.
Es war Freitag.
Wallace stieg die bröckelnden Betonstufen hinunter, und es stank immer heftiger nach Seewasser und Algen. Er folgte der Krümmung der Stützmauer und kam an den aufgebockten Booten und der Stelle vorbei, wo dunkle Steine aus dem Wasser ragen, und am langen Pier, der sich über den Wellen erstreckt und voller lachender Menschen war. Im Gehen betrachtete er den riesigen grünlichen See und die darauf kreuzenden Boote, deren vom Wind geblähte Segel sich weiß und selbstbewusst vom weiten, bewölkten Himmel abhoben.
Es war perfekt.
Es war wunderschön.
Es war ein ganz normaler Abend im Spätsommer.
Eine Stunde zuvor war Wallace noch im Labor gewesen. Den ganzen Sommer lang hatte er Nematoden gezüchtet, eine ebenso langweilige wie anspruchsvolle Arbeit. Nematoden sind mikroskopisch kleine Würmer, die im Erdreich vorkommen und etwa einen Millimeter groß werden. Wallace’ Aufgabe war es, vier unterschiedliche Nematodenstämme zu kultivieren und in einem zweiten Arbeitsschritt untereinander zu kreuzen. Die gezielte Beschädigung des Erbguts und die anschließende Reparatur – Regulation und Steuerung der Genexpression, Markierung eines Proteins, Entfernen oder Hinzugeben bestimmter Abschnitte des genetischen Materials – führten zu erwünschten Mutationen, die wiederum von einer Generation zur nächsten weitergegeben wurden, wie eine Zahnlücke oder Sommersprossen oder Linkshändigkeit. Nach simplen, aber sorgfältig durchzuführenden Berechnungen wurden die Modifikationen mit denen anderer Stämme kombiniert. Manchmal brauchte es dazu einen Marker oder einen Balancer. Nach einer Manipulation des Nervensystems bewegten die Tiere sich plötzlich rollend statt schlängelnd fort, eine Mutation in der Cuticula erzeugte Nematoden so dick wie kleine Keksröllchen. Und immer bestand die heikle Aussicht, dass die Männchen zu empfindlich sein könnten oder kein bisschen an Fortpflanzung interessiert. Im letzten Schritt wurden die Würmer aufgelöst und das genetische Material extrahiert. Nicht selten stellte sich nach wochenlanger sorgfältiger Zucht und Beobachtung mehrerer Generationen heraus, dass die Mutation verloren gegangen war. Es folgte eine fiebrige Suche, und Wallace verbrachte Tage oder Wochen damit, die alten Petrischalen zu überprüfen und die Abweichung unter Tausenden von wimmelnden Nachkommen erneut zu finden. Die auflodernde, fast wahnhafte Erleichterung, wenn er im letzten Moment doch noch den goldenen Nematoden aus der Masse der zappelnden Tiere fischte; und dann begann der langsame, stetige Zuchtprozess von vorn, das Hüten der erwünschten Chromosomen und das Ausschalten der unerwünschten, bis endlich die ersehnte Variante herauskam.
Wallace hatte viele schöne Sommertage durchgearbeitet, und doch war es ihm nicht gelungen, den entscheidenden Stamm zu kultivieren. Eine Stunde zuvor hatte er im Labor seine Tabletts mit den Agarplatten aus dem Brutschrank geholt. Seit drei Tagen wartete er darauf, dass eine Generation in die nächste überging, so angespannt, wie er seit Monaten auf das Endergebnis wartete. Er würde die Babys einsammeln und die feinen, fast unsichtbaren Würmchen voneinander trennen, bis er schließlich seine Dreifachmutation gefunden hätte. Aber als er nach seinen Nematoden sah, wirkte die glatte blaugrüne Oberfläche des Agar, das in seiner weichen Festigkeit der menschlichen Haut auf unheimliche Weise ähnelte, gar nicht mehr so glatt.
Ganz im Gegenteil, dachte er, sie war aufgewühlt.
Nein, nicht aufgewühlt. Wallace kannte das korrekte Wort.
Verunreinigt.
Schimmel und Staub türmten sich wie bei der grausigen Nachstellung eines Vulkanausbruchs – ganze Zivilisationen von Asche und Ruß bedeckt und zu porösem weißem Stein erstarrt. Ein weicher Pelz aus grünen Sporen überzog die Nährflüssigkeit, darunter verbarg sich der schleimige Bakterienfilm. Die Oberfläche des Agars sah aus, als hätte sie jemand mit einem groben Pinsel zerkratzt. Wallace überprüfte alle Schalen auf allen Plastiktabletts, und ausnahmslos jede wies Spuren des Grauens auf. Die bakterielle Verunreinigung war so weit fortgeschritten, dass sie durch die Deckel austrat wie Eiter aus einer Wunde und ihm über die Finger lief. Nicht zum ersten Mal fand er seine Petrischalen verunreinigt und verschimmelt vor. Im ersten Laborjahr war ihm das regelmäßig passiert, später dann waren seine Technik besser und seine Sorgfalt größer geworden. Später hatte er gelernt, aufmerksam und vorsichtig zu sein. Er hatte an sich gearbeitet. Er wusste, wie man einen Stamm am Leben hält.
Nein, dieses Gemetzel hatte mit bloßer Nachlässigkeit nichts zu tun. Außerdem wirkte es alles andere als zufällig, eher wie die Rache eines kleinlichen Gottes. Wallace stand da, schüttelte den Kopf und lachte leise in sich hinein.
Er lachte, weil das Ganze auf eine schwer zu fassende Art lustig war. Ein unerwarteter Witz, der sich aus einer völlig willkürlichen Verkettung von Umständen ergab. Nach vier Jahren Laborarbeit hatte er in den vergangenen Monaten zum ersten Mal das Gefühl gehabt, kurz vor einem großen Durchbruch zu stehen. Er hatte sich der Ahnung einer Erkenntnis angenähert, die Konturen der ihr innewohnenden Fragestellung erspürt, das Ausmaß ihrer Tragweite. Er war mit dieser sich stetig entwickelnden Erkenntnis aufgewacht, und sie hatte ihn durch die vielen eintönigen Stunden begleitet, durch das Zähneknirschen und den dumpfen Schmerz, wenn er um neun aufstand und wieder zur Arbeit ging, obwohl er erst um fünf eingeschlafen war. Er hatte sie so deutlich vor Augen gehabt wie ein schwebendes Staubkorn im gleißenden Licht der hohen Laborfenster – die Hoffnung, einen kurzen Moment absoluter Klarheit zu erleben.
Und was war ihm davon geblieben? Ein Haufen absterbender Nematoden. Als er vor drei Tagen nach ihnen gesehen hatte, waren sie noch schön und perfekt gewesen. Er hatte sie in die laue Dunkelheit des Brutschranks zurückgestellt und in Ruhe gelassen. Hätte er sie vielleicht einen Tag früher überprüfen sollen? Nein, selbst das wäre zu spät gewesen.
Er hatte in diesem Sommer so große Hoffnungen gehegt. Er hatte geglaubt, endlich etwas Sinnvolles zu tun.
In seinem Posteingang dann die gleiche Mail wie an jedem Freitag: Los, treffen wir uns am Pier, wir sichern einen Tisch.
An dem Abend hatte er nichts Besseres vorgehabt. Im Labor gab es nichts mehr zu tun. Die kontaminierten Schalen waren nicht zu retten. Ihm würde nichts anderes übrig bleiben, als noch einmal von vorn anzufangen, aber in jenem Augenblick hatte er nicht die Kraft, frische Schalen aus dem Regal zu holen und vor sich auszubreiten wie Spielkarten. Er hatte nicht die Kraft, das Mikroskop einzuschalten und sich an die komplizierte Rettung des Stammes zu machen, falls die Zersetzung nicht ohnehin schon zu weit fortgeschritten war. Er war nicht bereit zu erfahren, ob er zu spät kam.
Er hatte nicht die Kraft.
Stattdessen war er zum See gegangen.
Die fünf saßen in angespanntem, betretenem Schweigen beisammen. Wallace fühlte sich, als hätte sein überraschendes Erscheinen für eine Unterbrechung gesorgt, als lenkte seine Anwesenheit den ursprünglichen Lauf der Dinge in eine neue Richtung. Er saß gegenüber von Miller, direkt an der Mauer. Hinter Miller bedeckte ein Schleier aus zarten Ranken den Beton, in dessen dunklen Ritzen die Insekten wimmelten. Der Tisch verlor seine rostrote Farbe wie ein räudiger Hund sein Fell. Yngve zupfte graue Holzsplitter aus den kahlen Stellen und schnippte sie hinüber zu Miller, der es entweder nicht bemerkte oder sich nicht darum kümmerte. Miller wirkte immer ein bisschen verärgert; leicht hochgezogene Oberlippe, leerer Blick, verengte Augen. Wallace fand das abschreckend, aber irgendwie auch liebenswert. An diesem Abend wirkte Miller jedoch einfach nur gelangweilt und müde, wie er dasaß und das Kinn in die Hand stützte. Er und Yngve kamen vom Segeln, beide trugen sie die beige Rettungsweste offen über dem Hemd. Die Gurte von Millers Weste hingen so schlaff herab, als gelte es, den Kopf einzuziehen, seine zerzausten Locken waren noch feucht. Yngve, der kräftiger und sportlicher war als Miller, hatte ein herzförmiges Gesicht und kleine, spitze Zähne. Er ging immer leicht nach vorn gebeugt. Wallace beobachtete, wie die Muskeln in Yngves Unterarmen sich verspannten, während er einzelne Fasern aus dem verwitterten Holz zupfte, zu Kügelchen zusammenrollte und mit dem Daumen wegschnippte. Eines nach dem anderen landete auf Millers Weste oder in seinen Haaren, aber Miller zuckte nicht einmal. Yngve bemerkte, wie Wallace ihn ansah, und zwinkerte, als gäbe es hier einen Insiderwitz zu verstehen.
Cole und Vincent saßen neben Wallace, dicht zusammengerückt wie Betende auf einem sinkenden Schiff. Cole streichelte Vincents Fingerknöchel. Vincent hatte sich die Sonnenbrille auf die Stirn geschoben, was sein Gesicht kleiner und ihn wie ein hilfloses Haustier wirken ließ. Wallace hatte ihn seit Wochen nicht mehr gesehen, nicht seit der Grillparty, die Vincent und Cole am 4. Juli ausgerichtet hatten. Das war jetzt, wie Wallace erschreckt feststellte, schon über einen Monat her. Vincent arbeitete im Finanzwesen und wachte über geheimnisvolle Reichtümer wie ein Klimaforscher über die Bewegung der Gletscher. In diesem Teil des Landes stand Reichtum entweder für Rinder und Mais oder für Biotech; nachdem der Mittlere Westen Amerika über Generationen hinweg mit Weizen, Milch und Geflügel versorgt hatte, brachte er nun eine neue Industrie hervor, die Geräte und Apparate produzierte, um mit ihnen Organe, Seren und Pflaster aus genetischem Brei zu züchten. Es handelte sich um eine neue Art von Landwirtschaft, wie auch Wallace’ Arbeit eine neue Art von Viehzucht war. Am Ende aber taten sie, was die Menschen schon immer getan hatten, und alle Unterschiede zu früheren Zeiten waren nur bedeutungslose Details.
»Ich habe Hunger«, sagte Miller und legte unvermittelt die Arme auf den Tisch, Handflächen nach oben. Fast streifte er Wallace’ Ellbogen, Wallace zuckte zusammen.
»Miller, du hast da auf deinem Platz gesessen, als ich das Bier bestellt habe«, sagte Yngve. »Du hättest den Mund aufmachen können. Eben meintest du noch, du hättest keinen Hunger.«
»Hatte ich auch nicht. Schon gar nicht auf Eis. Ich brauche was Richtiges. Vor allem, wenn wir jetzt weitertrinken. Außerdem waren wir den ganzen Tag in der Sonne.«
»Was Richtiges«, wiederholte Yngve und schüttelte den Kopf. »Na so was. Was möchtest du denn, Miller, Spargel? Ein paar Sprossen? Was Richtiges. Was soll das überhaupt sein?«
»Du weißt, wie ich das meine.«
Vincent und Cole husteten verstohlen und stützten die Ellbogen auf. Die Tischplatte neigte sich unter ihrem Gewicht. Würde sie die beiden halten? Wallace drückte sich gegen die Latten und beobachtete, wie das Holz sich unter dem Druck der dunklen, dünnen Nägel verbog.
»Ach ja, weiß ich das?«, gluckste Yngve. Miller verdrehte stöhnend die Augen. Ihre lässig hingeworfenen Sticheleien machten Wallace ein bisschen traurig; es war die Art von Traurigkeit, die man vor sich selbst verleugnen kann, bis man eines Tages aufwacht und merkt, sie war immer da und hat gelauert.
»Ich will nur was zu essen, das ist alles. Kein Grund, gleich gemein zu werden«, sagte Miller lachend, aber da war eine Härte in seiner Stimme. Was Richtiges. Wallace hatte richtiges Essen zu Hause, und er wohnte ganz in der Nähe. Er könnte, dachte er plötzlich, Miller zu sich einladen und ihn füttern wie ein streunendes Tier. Hey, ich habe noch ein Schweinekotelett von gestern Abend übrig. Er könnte Zwiebeln anbraten, das Kotelett aufwärmen. Er könnte etwas von dem Brot mit der knusprigen Kruste abschneiden, das er in der Bäckerei an der Ecke gekauft hat, er könnte es in Eier und Milch tunken und in der Pfanne frittieren. Wallace sah alles genau vor sich: eine Mahlzeit aus Resten, die er im Handumdrehen in einen herzhaften heißen Snack verwandeln würde. Es war einer dieser Momente, in denen alles möglich schien. Aber dann war der Moment vorbei – wie ein Schatten, der über den Tisch huschte.
»Ich kann schnell heimgehen und was holen, wenn du willst. Oder dir irgendwas kaufen«, sagte Wallace.
»Nein, ist schon in Ordnung. Ich brauche nichts.«
»Sicher?«, fragte Wallace.
Miller zog die Augenbrauen hoch. Seine Skepsis fühlte sich wie eine Ohrfeige an.
Obwohl sie sich fast täglich sahen, waren sie nicht auf eine Weise befreundet, die solche Nettigkeiten zugelassen hätte. Sie hockten ständig aufeinander – an der Eiswürfelmaschine, in der Teeküche, wo sie in traurigen, kurzen Mittagspausen verwaiste Teller und Schüsseln aus dem Regal holten, oder im Kühlraum, wo die empfindlichen Reagenzien lagerten, auf der Herrentoilette mit den scheußlichen lila Kacheln – sie waren wie schlecht gelaunte Cousins und bekämpften einander wie Feinde, die zu höflich oder zu faul sind, um echte Gewalt anzuwenden und wirklichen Schaden anzurichten. Auf der Weihnachtsfeier hatte Wallace einen unbedachten Kommentar zu Millers Outfit abgegeben, er hatte vom »Trailerparkschick des Mittleren Westens« gesprochen. Alle hatten gelacht, auch Miller, aber in den folgenden Monaten war er bei jeder Gelegenheit darauf zurückgekommen: »Oh, da bist du ja, Wallace. Sicher hat unser Modezar auch was dazu zu sagen?« Dieses Blitzen in seinen Augen, das kühle, schiefe Lächeln.
Im April hatte Miller es ihm dann heimgezahlt. Wallace war zu spät zu einem Seminar erschienen und musste ganz hinten stehen. Sie kamen beide von einer Veranstaltung, in der sie als Tutoren aushalfen; der Dozent hatte überzogen, und Miller war früher gegangen, während Wallace dageblieben war, um die Fragen der Studierenden zu beantworten. Nun standen sie mit dem Rücken an der holzvertäfelten Wand und verfolgten einen PowerPoint-Vortrag. Der Gastdozent galt als Koryphäe auf dem Gebiet der Proteomik, der Hörsaal war überfüllt. Insgeheim freute Wallace sich, dass auch Miller keinen Sitzplatz mehr bekommen hatte, aber da beugte Miller sich zu ihm herunter, sodass Wallace seinen Atem feucht und warm am Ohr spüren konnte, und flüsterte: »Ich dachte, ihr dürft jetzt immer ganz vorn sitzen, du und deine Leute?« Eigentlich hatte Wallace, als er so dicht neben Miller stand, wider Willen ein Kribbeln gespürt, aber plötzlich schlug das Gefühl in etwas vollkommen anderes um. Die rechte Hälfte seines Körpers wurde taub und heiß zugleich. Miller blickte zu ihm hinunter und musste es ihm vom Gesicht abgelesen haben: Auch so etwas ließ ihre Freundschaft nicht zu. Wallace’ Hautfarbe gehörte ganz bestimmt nicht zu den Dingen, über die sie Witze machen konnten. Später, im Gedrängel um Gratiskaffee und trockene Kekse, hatte Miller noch versucht, sich zu entschuldigen, aber Wallace hatte auf Durchzug geschaltet. Wochenlang war er Miller aus dem Weg gegangen. Zwischen ihnen machte sich ein unterkühltes Schweigen breit, wie es nur zwischen Menschen vorkommt, die einander nahe sein sollten, es aufgrund eines frühen, entscheidenden Fehltritts aber nicht sein können. Später bereute Wallace es sehr, sie in diese Sackgasse hineinmanövriert zu haben, denn inzwischen tauschten sie sich nicht einmal mehr über die gewohnten Themen aus. Sie waren jeweils die Ersten in ihrer Familie gewesen, die aufs College gingen; nach dem Umzug in den Mittleren Westen hatten sich beide von der neuen Großstadt einschüchtern lassen; sie gehörten derselben Clique an, waren aber immer Außenseiter geblieben, die dem Leben nichts Leichtes abgewinnen konnten. Und da saßen sie nun.
Millers verdutztes Schweigen und das dunkle Misstrauen in seinem Gesicht waren Antwort genug.
»Dann eben nicht«, sagte Wallace leise. Miller ließ den Kopf auf die Tischplatte sinken und stöhnte übertrieben.
Cole, der netter war als sie alle und sich derlei Gesten erlauben konnte, streckte die Hand aus und fuhr Miller durchs Haar. »Komm, auf geht’s.« Miller grunzte, schwang die langen Beine unter dem Tisch hervor und erhob sich. Cole küsste Vincent auf Wange und Schulter, und Wallace lief ein kalter Schauder der Eifersucht über den Rücken.
Am Nachbartisch, hinter Yngve, saß eine Fußballmannschaft in billigen Polyestershorts und weißen T-Shirts mit selbst aufgemalten Nummern. Anscheinend stritten sie über Frauentennis. Alle waren sportlich und gebräunt, ihre Trikots mit Dreck und Gras beschmiert. Ein Spieler mit Regenbogenstirnband zeigte aufgebracht auf einen anderen und brüllte ihn auf Spanisch oder vielleicht Portugiesisch an. Wallace fragte sich, worum es ging, aber für diese fremden Doppelvokale und fragmentierten Konsonanten reichten seine sieben Jahre Schulfranzösisch nicht aus.
Yngve saß über sein Handy gebeugt, das Gesicht vom Display erleuchtet. Sein Profil zeichnete sich in der Dämmerung deutlich ab. Die Dunkelheit kroch über den Himmel wie ein sich langsam ausbreitender Fleck, der See schimmerte metallisch und unheilvoll. Es war der Moment kurz nach der blauen Stunde, wenn der Sommerabend sich langsam abkühlt und beruhigt. Der Wind roch ein wenig salzig, fast so, als wäre die Luft elektrisch aufgeladen.
»Wir haben dich in diesem Sommer nicht oft gesehen«, begann Vincent. »Wo hast du dich versteckt?«
»Zu Hause, schätze ich. Aber ich wusste nicht, dass ich mich verstecke.«
»Neulich hatten wir Roman und Klaus zu Besuch. Hat Cole dir davon erzählt?«
»Ehrlich gesagt habe ich die Jungs in dieser Woche gar nicht gesehen. Habe gerade höllisch viel zu tun.«
»Na ja, es war auch nichts Besonderes. Nur ein Abendessen. Du hast nicht viel verpasst.«
Warum davon anfangen, dachte Wallace, wenn es nichts Besonderes war? Zu ihrer Grillparty hatte er sich schließlich auch aufgerafft, oder? Auf einmal fiel ihm ein, dass Vincent schon beim letzten Mal betont hatte, wie schön es doch sei, Wallace zu sehen. Er mache sich in letzter Zeit wirklich zu rar, gehe viel zu selten mit ihnen aus, interessiere sich zu wenig für seine Freunde. »Es ist, als gäbe es dich gar nicht mehr«, hatte Vincent gesagt. Die Ader an seiner Stirn war unter seinem Lachen angeschwollen, und Wallace hatte sich in seelenruhiger Grausamkeit gewünscht, sie möge platzen. Cole, Yngve, Miller und Emma lief er im Gebäude der Biowissenschaften fast jeden Tag über den Weg. Dann grüßten sie sich mit einem knappen Nicken oder einem Winken, nahmen einander auf alle möglichen Arten zur Kenntnis. Doch es stimmte, er ging nicht mehr so oft mit den anderen aus und mied ihre Lieblingsbars. Anders als früher zwängten sie sich auch nicht mehr in zwei Autos, um Äpfel zu pflücken oder am Devil’s Lake Wandern zu gehen. Wallace hielt sich zurück, weil er das Gefühl hatte, eigentlich nicht erwünscht zu sein. Nie stand er im Mittelpunkt, und er redete eigentlich nur, wenn jemand Mitleid bekam und ihm ein paar Brocken Small Talk vor die Füße warf. Und doch stellte Vincent sich hin und tat so, als würde Wallace aus freien Stücken auf die gemeinsame Freizeit verzichten. Als trügen sie alle keine Schuld daran.
Wallace lächelte gequält. »Klingt so, als wäre es ein lustiger Abend gewesen.«
»Und letzte Woche waren Emma und Thom da. Wir haben ein kleines Mittagessen am Pool veranstaltet und sind dann rüber in den Hundepark gegangen. Scout ist wirklich riesig geworden!« Die Ader an Vincents Stirn schwoll erneut an, und plötzlich stellte Wallace sich vor, einen Daumen daraufzulegen und mit aller Kraft zuzudrücken. Er stieß ein kehliges, zustimmendes Grunzen aus, als wollte er sagen: Wer hätte das gedacht?
»Wo bleiben eigentlich Emma und Thom? Ich dachte, die beiden wollten heute auch kommen?«, fragte Yngve.
»Sie lassen Scout waschen.«
»Wie lange dauert es denn bitte, seinen Hund waschen zu lassen?«, fragte Yngve mit gespielter Empörung.
»Kommt drauf an«, antwortete Vincent mit einem Lachen und sah Wallace an, der sich für kaum etwas zu schade war, wohl aber für Witze über Hundescheiße, und sich deshalb einfach nur räusperte. Vincent trommelte mit den Fingern auf den Tisch. »Okay, im Ernst, wo hast du gesteckt, Wallace? Hast du es nicht mehr nötig, mit deinen Freunden abzuhängen?«
Was für eine blöde Frage. Sogar Yngve machte große Augen. Wallace brummte vor sich hin, als müsste er überlegen. Er wartete darauf, dass sein Ärger und das Gefühl der Demütigung nachließen. Vincent sah ihn geduldig und erwartungsvoll an. In seiner Sonnenbrille spiegelte sich das Treiben am Nachbartisch: Die Fußballer hatten begonnen, einander anzurempeln, ihre weißen Trikots leuchteten wie helle, sich übereinander schiebende Rechtecke in einem kubistischen Gemälde.
»Ich war im Labor«, erklärte Wallace. »Eigentlich habe ich nichts anderes gemacht.«
»Du Märtyrer«, sagte Vincent. »Das wird dann wohl das Thema für den Rest des Abends? Die Heilige Jungfrau vom ewigen Labor.«
»Wir reden nicht immer über das Labor«, widersprach Yngve, aber Wallace musste lachen, auch wenn der Witz natürlich auf seine Kosten ging. Vincent hatte recht: Sie redeten praktisch nur über das Labor. Egal, welches Thema sie anschnitten, irgendwie nahm das Gespräch immer wieder denselben Verlauf: Ihr werdet es nicht glauben, aber neulich habe ich eine Säule laufen lassen und schon vor der letzten Spülung eluiert. Jemand hat die Pipettenspitzen nicht aufgefüllt, und ratet mal, wer deswegen stundenlang am Autoklaven stehen musste? Ist es wirklich zu viel verlangt, dass die meine Pipette wieder dahin zurücklegen, wo sie sie gefunden haben? Die kommen einfach rein, nehmen sich, was sie brauchen, und bringen nichts zurück. Wallace konnte Vincents Frust verstehen. Vincent war in ihrem zweiten Jahr in die Stadt gezogen, um in Coles Nähe zu sein. Und hatte seine Einweihungsparty ausgerechnet in der Woche geschmissen, in der sie auf ihre Prüfungsergebnisse warten mussten. Statt billiges Bier zu trinken und die elegante Sitzecke aus Chrom und Leder zu bewundern, hatten sie die Köpfe zusammengesteckt und über den Prüfungsbogen 610 getuschelt, an dessen Schluss eine unerwartete Helixfrage aufgetaucht war, und über den 508er: Änderung der freien Energie unter unterschiedlichen osmotischen Bedingungen. Für die Lösung hatte Wallace fünf Bögen Papier vollschreiben und Gleichungen hervorkramen müssen, die er seit dem Grundstudium nicht mehr gebraucht hatte. Am Ende hatte Vincent allein den Weihnachtsbaum geschmückt, während sie einander ihr Leid klagten. Wallace hatte Mitleid mit ihm gehabt. Aber dieser Reflex, ständig auf das Labor zurückzukommen, trat immer wieder auf. Denn solange sie über die Wissenschaft sprachen, mussten sie sich mit keinem anderen Problem auseinandersetzen. Es war, als hätte das Promotionsstudium ihre alten Persönlichkeiten ausgelöscht.
Zumindest für Wallace war das Sinn und Zweck der Sache gewesen. Trotzdem hatte er gerade in diesem Sommer etwas Neues gefühlt: Auf einmal wollte er mehr. Ja, er war immer noch unglücklich, aber zum ersten Mal in seinem Leben schien dieses Unglück nicht naturgegeben zu sein. Manchmal sehnte er sich danach, dem Drang nachzugeben, ihm einfach blind zu vertrauen. Dieses Leben hinter sich zu lassen und in die weite, unberechenbare Welt hinauszugehen.
»Ich arbeite auch viel, aber ich rede nicht ständig darüber. Weil ich weiß, dass es euch langweilen würde«, sagte Vincent.
»Weil du einfach nur einen Job hast. Das ist … Was wir machen, ist etwas völlig anderes«, sagte Yngve.
»Ihr kennt doch nur dieses eine Thema, weil ihr nichts habt, worauf ihr stolz sein könnt«, antwortete Vincent. Wallace stieß einen leisen Pfiff aus. Die Stimmen am Nachbartisch schwollen weiter an, wurden schriller und lauter. Gelegentlich schrie jemand vor Freude, vielleicht auch vor Wut. Die Fußballer beugten sich über ein Handy, so viel konnte Wallace erkennen, anscheinend verfolgten sie ein Spiel. Hin und wieder tat sich zwischen den Körpern eine Schneise auf, und er konnte das helle Display sehen, nur einen Augenblick lang, bevor die Lücke sich wieder schloss.
»Es gibt mehr im Leben als Stipendien und Jobs«, sagte Vincent. Auch auf dem See wurde gelärmt und gejohlt. Wallace schaute aufs Wasser hinaus, wo die dunklen Felsen sich über ihr noch dunkleres Spiegelbild beugten. Von den Booten, die aufs Ufer zusteuerten, schallte Musik herüber, doch die Lieder vermengten sich zu einem Rauschen, wie das undefinierbare Knistern und Knacken zwischen zwei Funksprüchen.
»Ich bin mir nicht sicher, ob du recht hast, Vincent«, sagte Wallace. Yngve grunzte zustimmend, aber Wallace bezweifelte, dass sie wirklich dasselbe meinten. Wie auch? Yngves Vater war Chirurg, seine Mutter unterrichtete Geschichte an einer Hochschule. Yngve war in dieser Welt der Stipendien und Jobs groß geworden. Zu behaupten, dass es jenseits von ihr nichts gab, hieß für Wallace, dass sein Leben auf dem Spiel stünde, sollte er eines Tages seinen Platz darin verlieren. Plötzlich fragte er sich, ob er zu schnippisch geklungen hatte, doch gerade, als er sich bei Vincent entschuldigen wollte, kamen Cole und Miller zurück. Die blassen Innenseiten von Millers Schenkeln leuchteten im Dunkeln. Im Vergleich zum Rest seines Körpers wirkte die Haut dort glatt und unschuldig. Seine Shorts waren zu kurz, die Gurte der Rettungsweste schlugen ihm gegen die nackten Beine. Cole hatte einen watschelnden, ungelenken Gang, wie ein Welpe in Spiellaune. Sie trugen weiße Popcorntüten auf dem Arm und eine große Plastikschale voller Nachos, die von schleimigem, gummiartigem Käse überzogen und großzügig mit Jalapeños bestreut waren. Beim Hinsetzen stieß Miller ein »Uff« aus. Sie hatten auch Tacos gekauft, von denen sich Yngve sofort einen schnappte.
»O ja«, rief er und bebte vor Freude. »Ja, ja, ja! Das ist es, Jungs!«
»Ich dachte, du hast keinen Hunger«, sagte Miller.
»Habe ich nie behauptet.«
Cole stellte einen kleinen Becher Vanilleeis vor Vincent hin. Sie küssten sich. Wallace schaute schnell weg. Irgendwie fühlte es sich übergriffig an, sie dabei zu beobachten.
»Möchtest du auch?«, fragte Cole und bot ihm Nachos und Popcorn an. Er bot Wallace Essen an, wie Wallace es Miller hatte anbieten wollen.
Wallace schüttelte langsam den Kopf, spürte die Wärme in seinen Wangen aufsteigen. »Nein, danke.«
»Greif zu«, sagte Miller, und Wallace bildete sich ein, das Gewicht zu spüren, das von Millers Blick ausging. Die Hitze. Er merkte es, wenn er beobachtet wurde, wenn ein Raubtier ihn fixierte.
»Bleibt es bei morgen?«, fragte Cole und strich eine weiße Serviette auf dem Tisch glatt.
»Ja«, antwortete Wallace.
Das Fett des Tacos durchtränkte die Serviette, bis das Holz des Tisches durch die hauchdünnen Lagen sichtbar wurde. Cole runzelte die Stirn, legte eine zweite Serviette unter und dann noch eine. Das Aroma ihres Essens mischte sich mit der fauligen Süße des Sees. Es roch nach verrottenden Pflanzen.
»Was ist denn morgen?«, fragte Vincent.
»Tennis«, sagten Cole und Wallace wie aus einem Mund.
Vincent schnaubte. »Warum frage ich überhaupt?«
Cole küsste Vincent auf die Nasenspitze. Miller zog die Plastikfolie von den Nachos. Wallace knetete seine Hände unter dem Tisch so fest, dass die Gelenke laut knackten.
»Ich komme vielleicht ein wenig später«, sagte Cole.
»Das macht nichts. Ich habe noch ein bisschen was zu tun.« Dabei war es mehr als nur ein bisschen. Ihm wurde schon bei dem Gedanken schlecht. All die Mühe war umsonst gewesen. Es würde ihn sehr viel Zeit kosten, den Schaden zu beheben, und am Ende würde es ihm vielleicht nicht einmal gelingen. Er hatte gut daran getan, das Ganze vorerst beiseitezuschieben und nicht mehr daran zu denken. Eine Welle der Übelkeit überkam ihn. Er schloss die Augen, alles um ihn herum schien sich in langsamen, dunklen Bahnen zu drehen. Was bist du doch dumm, dachte er. So unfassbar dumm. Er hatte tatsächlich gehofft, dass die Dinge sich zum Guten wenden würden, dass er endlich an der Reihe wäre und auch einmal Glück haben würde. Jetzt hasste er sich selbst für so viel Naivität.
»Ja, genau deswegen komme ich später«, sagte Cole und lachte. Wallace öffnete die Augen. Da war ein metallischer Geschmack in seinem Mund, nicht nach Kupfer oder Blut, sondern anders, irgendwie silbrig.
»Du willst morgen arbeiten?«, fragte Vincent. »Wir machen Pläne, und du arbeitest?«
»Nur ein bisschen.«
»Morgen ist Samstag.«
»Und heute ist Freitag, und gestern war Donnerstag. Es ist bloß ein Tag. Ich habe zu tun.«
»Ich arbeite nie am Wochenende.«
»Toll, möchtest du eine Medaille dafür?«, fragte Cole mit einem Hauch von Bosheit in der Stimme.
»Nein, ich brauche keine Medaille. Aber ich würde gern einmal ein freies Wochenende zusammen mit meinem Freund verbringen, noch diesen Sommer. Entschuldige!«
»Wir sind hier, oder? Nicht wahr? Ich bin hier. Du bist hier. Wir sind hier. Zusammen.«
»Du hast wirklich eine verdammt gute Beobachtungsgabe.«
»Können wir nicht einfach den letzten schönen Sommerabend genießen?«
»Wow, klar, der Sommer ist ja fast schon wieder um. Wie wundervoll.«
»Bald fängt das neue Semester an«, warf Yngve zögerlich ein. »Ihr wisst, was das bedeutet.«
»Neues Semester, neue Daten«, sagten Cole und Yngve gleichzeitig, und ein verzweifelter Optimismus brachte ihre Augen zum Glänzen. Wallace musste lächeln. Für einen Moment vergaß er sich, ließ sich von ihrer Wärme und ihrem Glauben an neue Chancen tragen. Neues Semester, neue Daten. Für sich persönlich hatte er keine Hoffnung, es war nur ein Spruch, den die Leute sagen, um sich Mut zu machen. Er pochte auf die Tischplatte.
»Toi, toi, toi.«
»Meine Güte«, sagte Vincent.
»Hey.« Cole legte den Arm um ihn, aber Vincent schüttelte ihn ab. Er ließ den Becher auf den Tisch fallen, das Eis schwappte über den Rand und verteilte sich auf dem Holz. Ein weißer Tropfen, lauwarm wie Spucke, landete auf Wallace’ Handgelenk.
»Was würdet ihr ohne die Uni bloß machen? Wenn ihr allein zurechtkommen müsstet?«, fragte Vincent. Er sah jeden von ihnen einzeln an. Miller hatte die Augenbrauen hochgezogen, Yngve wurde rot. Wallace nahm eine von Coles Servietten und wischte sich das Handgelenk ab.
»Wenn wir allein zurechtkommen müssten? Entschuldige mal, aber du bist im Finanzsektor. Nicht gerade Schwerstarbeit«, sagte Cole.
»Ich habe nie behauptet, dass ich Schwerstarbeit leiste, ich frage einfach nur, was wäre, wenn ihr allein zurechtkommen müsstet. Wenn ihr selbstständig denken und euer verdammtes Leben allein planen müsstet. Ihr wärt aufgeschmissen.«
»Ich plane mein Leben nicht? Mein Forschungsprojekt? Meine Experimente? Willst du mir sagen, dass wir unser Leben nicht zusammen geplant haben? Wir besitzen Möbel, Vincent.«
»Weil ich Möbel angeschafft habe. Als ich in die Stadt kam, hast du mit den beiden in einer Männer-WG gelebt«, sagte Vincent und zeigte auf Yngve und Miller, die keine Miene verzogen. »Euer Couchtisch war ein Sperrholzbrett auf Eimern! Mein Gott. Du hast keine Ahnung von Möbeln, geschweige denn davon, wie es ist, einen richtigen Job und eine Krankenversicherung zu haben und Steuern zu zahlen. Wir können uns nicht mal einen richtigen Urlaub leisten. Fünf Tage in Indiana – tolle Idee. Wunderbar.«
»Den letzten Sommer haben wir bei deinen Eltern in Mississippi verbracht, oder?«
»Ja, weil deine Familie Schwule hasst, Cole. Das ist der Unterschied.«
Wallace lachte auf und biss sich in der nächsten Sekunde auf die Zunge. Er schämte sich furchtbar, weil hier etwas Privates ans Licht gezerrt wurde, und doch konnte er nicht wegschauen. Cole und Vincent hatten den Streit im Spaß begonnen, als harmlose Rauferei, aber jetzt fletschten sie ganz im Ernst die Zähne. Cole war von Vincent abgerückt und Vincent von Cole. Die lange Holzbank schwankte bedrohlich, das Essen rutschte über die plötzlich schräge Tischplatte. Miller fing die Nachos auf, bevor sie hinunterfielen.
Cole warf Wallace ein Lächeln zu. »Los, Kumpel, hilf mir. Es geht um Mississippi.«
»Ich bin aus Alabama«, sagte Wallace, und Cole schloss die Augen.
»Du weißt, wie ich das meine. Ist doch ein und dasselbe.«
»Also, ich komme ja aus Indiana, und selbst ich finde es ziemlich schrecklich da«, erklärte Miller. »Vincent hat recht.«
»Genau genommen bist du aus Chicago«, sagte Cole. »Das ist nicht … Vincent kann meine Familie einfach nicht leiden.«
»Das stimmt nicht. Deine Familie ist wunderbar! Leider nur zutiefst rassistisch und absolut homophob.«
»Meine Tante ist eine Rassistin«, sagte Cole zu Wallace.
»Seine Mutter behauptet, ihre Kirchengemeinde kämpfe ums Überleben. Sag ihnen, warum, Cole.«
»Weil eine schwarze Familie eingetreten ist. Oder es versucht hat. Oder immer noch versucht?« Cole schlug sich die Hände vors Gesicht. Sein Hals war dunkelrot.
»Dann erzähl mir nicht, die wären …«
»Da, wo ich aufgewachsen bin, gab es keine Schwarzen in der Kirche«, schaltete Miller sich ein. »Jedenfalls nicht, als ich noch hingegangen bin. Indiana halt.«
»Also, meine Familie ist eigentlich nie in die Kirche gegangen«, sagte Yngve. »Es gab auch keine Schwarzen in meiner Stadt. Aber meine Großeltern lieben schwarze Menschen. Man sagt, die Schweden seien die Schwarzen Skandinaviens.«
Wallace verschluckte sich kurz an seinem eigenen Speichel. Yngve zuckte zusammen und wandte sich schnell wieder seinem Taco zu.
»Jedenfalls gibt es mehr im Leben als Pipetten und Reagenzgläser«, sagte Vincent leise. »Alles nur Spielzeug, das ihr braucht, um euch erwachsen zu fühlen.«
Cole wollte gerade etwas antworten, als Wallace zu seiner eigenen Überraschung den Mund aufmachte. »Ist doch aber wirklich albern, oder? Immer noch in der Ausbildung zu sein, meine ich. Manchmal frage ich mich, was ich hier eigentlich mache. Anscheinend ist es nicht albern, zumindest denken das viele Leute. Aber manchmal stelle ich mir vor, wie es wäre, von hier wegzugehen und was anderes zu machen. Im echten Leben, wie du es nennst, Vincent.« Er sagte das mit einem Lachen in der Stimme und sah an seinen Freunden vorbei zu den Fußballspielern hinüber, die sich beruhigt hatten und näher zusammengerückt waren. Jetzt verfolgten sie gespannt das Geschehen auf dem Handy, niemand redete mehr dazwischen, das Bier wurde ignoriert. Wallace bohrte sich die Daumen in die Kniekehlen, bis es wehtat. »Ich glaube, irgendwie hasse ich es, hier zu sein. Manchmal hasse ich es wirklich.«
Die Worte quollen aus ihm heraus wie Dampf aus einer heißen, engen Kammer in seinem Inneren, und als er fertig war, sah er sich um in der Annahme, dass keiner ihm richtig zugehört hatte. So war das immer – er erzählte etwas, und die anderen hörten höchstens mit einem Ohr zu. Aber als Wallace jetzt den Kopf hob, sah er in ihren Gesichtern eine Art zärtliche Entgeisterung.
»Oh«, sagte er leicht erschrocken. Miller aß weiter seine Nachos, Cole und Yngve kniffen die Augen zusammen. Ihre Schatten fielen über den Tisch, sie waren so nah.
»Du kannst jederzeit von hier weg, weißt du«, sagte Vincent. Wallace meinte, seine Stimme als warmen Hauch im Nacken zu spüren. »Wenn du unglücklich bist, kannst du jederzeit abhauen. Niemand zwingt dich zu bleiben.«
»Moment mal, stopp, warte, sag ihm doch so was nicht«, ging Cole dazwischen. »Wenn er geht, kann er das nicht einfach wieder rückgängig machen.«
»Das echte Leben besteht daraus, Dinge zu tun, die man nicht wieder rückgängig machen kann, Babe.«
»Na hör mal einer an. Bist du jetzt plötzlich sein Coach? Im Ernst, dein Job ist doch nur besseres Telefonmarketing.«
»Du bist so überheblich manchmal«, zischte Vincent. »Das ist wirklich erschreckend.«
Cole beugte sich vor, um Wallace direkt in die Augen zu sehen. »Wenn du von hier weggehst, wirst du dich nicht besser fühlen. Dann hättest du nämlich aufgegeben.«
»Du kannst nicht entscheiden, womit ein anderer sich besser fühlt«, sagte Vincent aufgebracht. Wallace streckte den Arm aus und legte ihm eine Hand an den Rücken. Sein T-Shirt war durchgeschwitzt, die Muskelstränge darunter zitterten wie gezupfte Saiten.
»Hey, ist schon gut«, raunte Wallace, aber Vincent nahm es kaum wahr. »Setz ihn nicht so unter Druck«, sagte er zu Cole. »Wo sind wir denn hier, in einer Sekte?«
»Wo ist eigentlich Lukas?«, fragte Yngve so laut dazwischen, dass selbst die Fußballmannschaft es mitbekam. »Weißt du irgendwas, Cole?«
»Bei Nate, glaube ich«, sagte Cole, ohne Vincent aus den Augen zu lassen. Yngve zuckte abermals zusammen. Lukas und Yngve waren seit dem ersten Jahr an der Uni mehr oder weniger ineinander verliebt, aber Yngve war hetero, weswegen Lukas irgendwann die Geduld verloren hatte; er hatte sich einen Freund gesucht, der Tiermedizin studierte. Eine ebenso seltsame wie passende Wahl, fand Wallace. Wenn Yngve auf einer Party sehr betrunken war, sagte er Sachen wie: »Mit einem Tierarzt zu schlafen, das ist praktisch Sodomie. Tiermedizin ist doch gar kein richtiges Fach.« Lukas zuckte dann einfach nur die Achseln und schwieg. Abgesehen davon hatte Yngve eine Freundin. Wallace bemitleidete alle beide. Er fand, dass sie sich unglücklicher machten als nötig.
»Kommen sie noch?«
»Nicht, wenn sie schlau sind«, sagte Vincent.
Das Eis war inzwischen zu einem weißen Brei zerlaufen. Die Mücken hatten sich aus ihrem Versteck in den Ranken an der Mauer gewagt und sich in der Dämmerung auf Nahrungssuche begeben. Wallace wedelte sie fort.
»Du hättest nicht mitkommen müssen. Du hättest zu Hause bleiben können«, sagte Cole zu Vincent.
»Das hier sind auch meine Freunde.«
»Jetzt. Jetzt sind sie deine Freunde.«
»Was hast du eben zu mir gesagt?«
Wallace sah zu Yngve hinüber, der erschrocken die Augen aufriss, und zu Miller, der so teilnahmslos wirkte, als säße er an einem anderen Tisch. Wallace nickte Cole und Vincent zu, Miller zuckte nur mit den Achseln. Kein Wunder. Eigentlich wusste Wallace, dass auch er sich besser raushalten sollte, aber er hatte ein schlechtes Gewissen. Als wäre das alles seine Schuld. Yngve stieß Miller an, durchdrang dessen Apathie jedoch nicht. Vincent atmete schwer und schnell. Die Wellen schwappten gegen den Rumpf der in Ufernähe festgemachten Boote.
»Niemand gibt auf. Niemand geht von hier weg. Wir haben jede Menge Spaß zusammen«, sagte Wallace.
»Ja, genau«, gab Vincent schnippisch zurück und schaute zu Cole. »Sei nicht so eine Heulsuse.«
»Bin ich nicht. Niemand heult«, sagte Cole und wischte sich mit den Handballen über die Augen.
»Du Armer«, meinte Yngve, streckte die Hand aus und fuhr Cole durchs Haar. »Kommst du klar?«
»Lass das«, sagte Cole, doch er klang alles andere als entschlossen. Er lachte und weinte gleichzeitig. Alle bemühten sich nach Kräften, die Tränen in seinen Augen zu ignorieren. Armer Cole, dachte Wallace, so nah am Wasser gebaut. Als er sah, wie Cole sich über die Augen wischte, spürte er ein Brennen in der Kehle.
»Ja, ich glaube, er kommt klar«, sagte Wallace. Dies waren seine Freunde, die Menschen, die ihn am besten kannten, denen er am meisten bedeutete. Erneut breitete sich die schreckliche, übervolle Stille zwischen ihnen aus, nur dass sich Wallace diesmal sicher war: Er und nur er allein war dafür verantwortlich. Er hatte den Streit angezettelt, er mit seiner großen Klappe. Das Komischste daran war – und er verstand es erst jetzt –, dass er nur einen Teil der Wahrheit ausgesprochen hatte. Ja, er spielte tatsächlich mit dem Gedanken, von hier abzuhauen, und ja, manchmal hasste er es. Aber das Szenario ganz zu Ende zu denken, so gründlich, wie man einen harten Knochen durchkaut, war etwas vollkommen anderes. Eigentlich wollte er nicht die Universität verlassen, sondern sein Leben. Diese Wahrheit schmiegte sich an ihn, drang unter seine Haut wie ein zweites, schlecht sitzendes Selbst, und jetzt, da er ihrer gewahr geworden war, würde er sie nicht mehr loswerden. Was blieb, war nur das ewige, öde Warten, diese Angst, etwas zu entscheiden und nicht mehr rückgängig machen zu können.
»Du siehst aus, als hättest du einen Geist gesehen, Wallace«, sagte Yngve. Wallace versuchte zu lächeln. Die Erkenntnis ließ seinen Atem stocken. Yngve erwiderte sein Lächeln nicht. Cole beugte sich abermals vor, um ihn anzusehen, Vincent ebenfalls. Sogar Miller schien ihn jetzt zu beobachten, verstohlen und hinter seinem Essen hervor, das er sich mit beiden Händen in den Mund stopfte.
»Mir geht es gut«, beteuerte er. »Wirklich.« Seine Kehle war wie zugeschnürt. Er bekam nicht mehr genug Luft. Er spürte, wie er den Halt verlor.
»Brauchst du einen Schluck Wasser?«, fragte Vincent.
»Nein, nein. Doch. Ich gehe schon«, krächzte Wallace und stand auf. Er ruderte mit dem Arm, weil die Welt um ihn herum mit einem Mal schwankte. Er schloss die Augen und spürte eine Hand auf seinem Unterarm. Cole wollte ihn stützen, aber Wallace machte sich los. »Hey, ist schon gut. Alles okay.«
»Ich begleite dich«, sagte Cole.
»Nein, bleib sitzen. Entspann dich.« Wallace grinste, so gut es ging, sein Zahnfleisch brannte. Plötzlich hatte er Zahnschmerzen. Er wandte sich vom Tisch ab und spürte die Blicke der anderen in seinem Rücken. Dann folgte er der Krümmung der Mauer und nahm die Treppen hinunter zum See. Er würde sich zusammenreißen und erst wieder zurückgehen, wenn er seinen Freunden einen überzeugenden Anschein von Glück präsentieren konnte.
Vom Ufer führte eine Treppe auf den trüben Grund des Sees hinunter. Sie bestand aus schroffem, unbehandeltem Stein, glatt poliert von Wellen und Fußtritten. Nur wenige Armlängen von Wallace entfernt saßen andere Menschen und beobachteten, wie der Mond aufging. Am gegenüberliegenden Ufer, noch hinter der Halbinsel, die mit Kiefern und Fichten bewachsen war und wie ein Daumen in den See ragte, standen Häuser auf hohen Stelzen. Ihre erleuchteten Fenster erinnerten an die Augen riesiger Vögel. Wenn Wallace abends am Ufer spazieren ging und durch die Büsche aufs Wasser schaute, fand er, dass die Häuser wie ein Schwarm riesiger Vögel aussahen, die sich auf der anderen Seite niedergelassen hatten. Er selbst war nie dort drüben gewesen, hatte nie einen Grund gehabt, den See zu überqueren und diesen exklusiven und abgelegenen Teil der Stadt zu besuchen.
Die letzten Boote waren hereingekommen, auf die Böcke gezogen und für die Nacht mit Planen abgedeckt worden. Die größeren wurden weiter unten aus dem Wasser geholt, am Bootshaus. Manchmal spazierte Wallace daran vorbei und in die andere Richtung, wo das Gras nicht gemäht wurde, die Baumstämme dichter standen und dicker waren. Dort gab es eine gedeckte Brücke, unter der eine Gänsefamilie wohnte. Ab und an schaute er nach unten und sah sie mit grauen, weit ausgebreiteten Flügeln über das Wasser gleiten. An anderen Tagen watschelten sie träge und selbstgewiss durch den Schatten vor den Fußballfeldern und Picknickplätzen, wie strenge Wildhüter.
Aber um diese Tageszeit waren die Gänse längst weg, die Möwen in ihre Nester zurückgekehrt, und Wallace hatte das Ufer praktisch für sich allein, abgesehen von den anderen Leuten auf der Treppe. Er schaute verstohlen zu ihnen hinüber und fragte sich, was für ein Leben sie führten, ob sie zufrieden waren oder wütend oder enttäuscht. Sie sahen aus, wie Menschen überall aussahen, weiß und in hässlicher, weit geschnittener Kleidung, mit sonnenverbrannter, trockener Haut und breiten, elastischen Mündern. Die Jüngeren, hochgewachsen und gebräunt, rempelten einander feixend an. Weiter hinten verteilte sich die Menschenmasse auf dem Pier wie Moos. Das Wasser zu Wallace’ Füßen spritzte in die Höhe und benetzte den Saum seiner Shorts. Die Steintreppe war glitschig und kühl. In seinem Rücken fing eine Band zu spielen an, die Instrumente erwachten leiernd und schrammelnd zum Leben.
Wallace schlang die Arme um die Knie und stützte das Kinn auf. Er zog die Füße aus den Leinenturnschuhen und tauchte sie bis zu den Knöcheln in den See. Das Wasser war kalt, aber nicht so kalt, wie er es erwartet oder erhofft hatte. Er spürte etwas Glattes an der Oberfläche, anders als das Wasser selbst, eher wie eine lose zweite Haut, die darauf herumrutschte. An manchen Tagen wurde ein Badeverbot verhängt, wegen der Algen, deren Neurotoxine tödlich wirken konnten. Außerdem gab es parasitäre Organismen, sie saugten sich an den Schwimmern fest und übertrugen Krankheiten, die den Körper von innen zerfraßen. Das Wasser schien harmlos, dabei konnte es ziemlich gefährlich sein. Trotzdem waren weit und breit keine Warnschilder zu sehen, denn was immer dort im See lebte, wurde den Menschen anscheinend nicht gefährlich genug. Jetzt, da Wallace direkt am Ufer saß, fand er, dass das Wasser stank wie Alkohol, beißend und irgendwie chemisch.