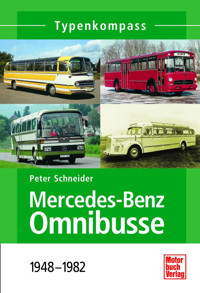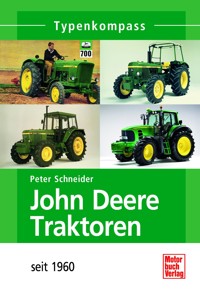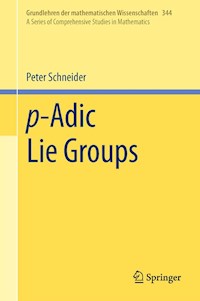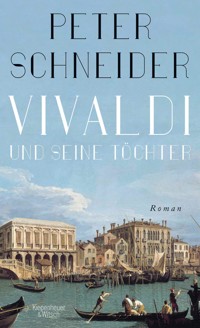9,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
»›Rebellion und Wahn‹ – das ist das Lebensbuch Schneiders und das der Generation.« Der Spiegel Peter Schneider war einer der Akteure von '68, mit Rudi Dutschke, Gaston Salvatore, Ulrike Meinhof. Als einer von ganz wenigen unter ihnen hat er damals Tagebuch geführt – ein Schatz, den er erst jetzt hebt. Die Jahre 1967/68 waren eine Zeit des Aufbruchs, die Peter Schneider und viele seiner Generation als eine zweite Geburt erlebten. Schneider blättert in seinen Tagebuch-Aufzeichnungen und setzt sich mit den Hoffnungen, Utopien und Verstiegenheiten dieser Zeit auseinander. Es ist kein nostalgischer Rückblick, der da entsteht – eher ein Streitgespräch des 68-Jährigen mit dem 68er über den Frühling vor dem Deutschen Herbst. Dabei wird Ernst gemacht mit dem Anspruch, alles Politische sei privat und umgekehrt. In Schneiders Darstellung verschränkt sich der weltweite Aufbruch von 67/68, der der Generation der Väter den Gehorsam verweigerte und eine neue Gesellschaft nach neuen Regeln erschaffen wollte, und eine Amour fou, die den Tagebuchschreiber womöglich mehr umwühlte als seine revolutionären Überzeugungen; der Widerstreit zwischen Künstlerehrgeiz und politischen Aktivismus; das Nebeneinander von Welterlösungsideen und tiefer persönlicher Verzweiflung; der Absturz einer historisch notwendigen Erneuerungsbewegung in persönliche ideologische Erstarrung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 500
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Peter Schneider
Rebellion und Wahn
Eine autobiographische Erzählung
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Peter Schneider
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Peter Schneider
Peter Schneider wurde 1940 in Lübeck geboren und wuchs in Freiburg auf. Studium der Germanistik, Geschichte und Philosophie in Freiburg und Berlin. 1967/68 avancierte er zu einem der Wortführer der 68er-Bewegung. 1973 Berufsverbot als Referendar. Schneider veröffentlichte Erzählungen, Romane, Drehbücher und Reportagen sowie Essays und Reden. Zu seinen wichtigsten Werken zählen »Lenz« (1973; KiWi 1032), »Schon bist du ein Verfassungsfeind« (1975), »Der Mauerspringer« (1982), »Vati« (1987), »Paarungen« (1992), »Eduards Heimkehr« (1999), »und wenn wir nur eine Stunde gewinnen« (2001) und »Skylla« (2005). Seit 1996 lehrt Peter Schneider als Writer in Residence an der Georgetown University in Washington DC. Er lebt in Berlin.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Die Jahre 1967/68 waren eine Zeit des Aufbruchs, die Peter Schneider und viele seiner Generation als eine zweite Geburt erlebten. Schneider blättert in seinen Tagebuch-Aufzeichnungen und setzt sich mit den Hoffnungen, Utopien und Verstiegenheiten dieser Zeit auseinander. Es ist kein nostalgischer Rückblick, der da entsteht – eher ein Streitgespräch des 68-Jährigen mit dem 68er über den Frühling vor dem Deutschen Herbst. Dabei wird ernst gemacht mit dem Anspruch, alles Politische sei privat und umgekehrt. In Schneiders Darstellung verschränkt sich der weltweite Aufbruch von 67/68, der der Generation der Väter den Gehorsam verweigerte und eine neue Gesellschaft nach neuen Regeln erschaffen wollte, und eine Amour fou, die den Tagebuchschreiber womöglich mehr umwühlte als seine revolutionären Überzeugungen; der Widerstreit zwischen Künstlerehrgeiz und politischen Aktivismus; das Nebeneinander von Welterlösungsideen und tiefer persönlicher Verzweiflung; der Absturz einer historisch notwendigen Erneuerungsbewegung in persönliche ideologische Erstarrung.
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
© 2008, 2010, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
eBook © 2012, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Covergestaltung: Barbara Thoben, Köln, nach einer Idee von Rudolf Linn, Köln
Covermotiv: © Rudolf Linn, Köln
Fonteinbettung der Schrift DejaVu nach Richtlinie von Bitstream Vera
Deja Vu: Copyright © 2003 by Bitstream, Inc. All Rights Reserved.
Alegreya: Copyright © 2011, Juan Pablo del Peral ([email protected]), with Reserved Font Name »Alegreya«
Alegreya Sans: Copyright © 2013, Juan Pablo del Peral ([email protected]), with Reserved Font Name »Alegreya Sans«
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
ISBN978-3-462-30655-2
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Motto
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
Epilog
Zitatnachweise
»Ein halbes Jahrhundert vergeht nicht umsonst. Auf dem Grund unserer Unterhaltung zweier Personen, die andere Bücher lasen und einen unterschiedlichen Geschmack hatten, wurde mir klar, daß es keine Verständigung zwischen uns gab. Wir waren zu verschieden und zu ähnlich. Wir konnten uns nicht hinters Licht führen, was das Gespräch beschwerlich macht. Jeder von uns beiden war die karikaturhafte Nachbildung des anderen. Die Situation war zu unnormal, als daß sie noch länger andauern konnte. Ihm Ratschläge zu erteilen oder mit ihm zu debattieren, war nutzlos, da es ja sein unabwendbares Schicksal war, derjenige zu werden, der ich bin.«
Jorge Luis Borges, »Der Andere«
Prolog
An einem Herbsttag des Jahres 1967 standen fünf junge Männer in einem großen, fensterlosen Zimmer in Berlin-Schöneberg um einen mit Stößen von Flugblättern bedeckten Tisch herum und tranken sich Mut für ihre nächste politische Kampagne an: Es ging um nicht weniger als um die Enteignung Axel Cäsar Springers, des größten deutschen Zeitungsverlegers, der in Berlin siebzig Prozent des Pressemarktes beherrschte. Als Büro und Headquarter diente eine jener 5-Zimmer-Wohnungen, die damals nach einem identischen Design entstanden: Sperrmüllmöbel, Rohholztüren auf Holzböcken, die als Tische dienten, chinesische Papierlampions an der Decke, Büchergestelle aus Holzbrettern auf Ziegelsteinen, Plakate und handgeschriebene Sprüche an den Wänden, darunter ein brachialer Reim, den ein mir bekannter Genosse mit einem mädchenhaften Gesicht verfaßt hatte: »Brecht dem Schütz die Gräten, alle Macht den Räten!« Bei dem Genannten handelte es sich um den Regierenden Bürgermeister Klaus Schütz.
Trotz des trüben Wetters herrschte im Büro eine ausgelassene Stimmung. Die Straßen Berlins hallten wider von Sprechchören, die die Verbrechen der USA in Vietnam anklagten, auf den verfallenen Hausfassaden erschienen fast täglich neue Slogans, die den »Sieg im Volkskrieg« ankündigten. Auf dem Rohholztisch lag der Entwurf für eine »Anleihe der Anti-Springer-Kampagne« über 1000 Mark. Text: »Der Springerkonzern schuldet dem Inhaber dieser Anleihe 1000 DM. Die Zinsen werden von den Inhabern selbst bestimmt und können durch gemeinsame Aktionen gegen das Springerhochhaus in Berlin und alle Zweigstellen des Springerkonzerns Tag und Nacht eingelöst werden.« Und dann fett gedruckt: »Zögert nicht! Die Enteignung des Springerkonzerns hat schon begonnen. Weder die internationale Konterrevolution noch ihre Läufer und Springer können gerettet werden. Brecht die Macht der Manipulateure!«
Die Revolution schien nur ein paar Straßenecken entfernt zu sein.
Als die dritte oder vierte Flasche des badischen Billigweins kreiste, warf Hans-Joachim, Spitzname »Chefchaot«, die Frage auf, wie wir uns eigentlich die »Lösung der Machtfrage« in der Stadt vorstellten.
Machtfrage? Welche Machtfrage?
Hans-Joachim hatte das Thema mit einem Lächeln in die Runde geworfen, aber seine Frage war offenbar nicht rhetorisch gemeint. Mit einem provokanten Glitzern in den Augen blickte er von einem zum anderen. Er war der politisch Erfahrenste unter uns, ein gutaussehender Endsemester mit Kurzhaarschnitt, der ein erstaunliches Charisma entfalten konnte, sobald er ein Megaphon in der Hand hielt. Der Berliner Senat sei am Ende, fuhr er fort. Ob wir wollten oder nicht – wir müßten auf den Fall vorbereitet sein, daß uns die Macht zufiele bzw. von der zutiefst ratlosen herrschenden Klasse auf dem Tablett überreicht würde.
Die Runde war verblüfft, aber absurd erschien das Szenario nicht. Bei der letzten, bisher größten Vietnamdemonstration am 21. Oktober waren (nach unserer Zählung) über zehntausend Menschen auf der Straße gewesen.
Überraschend schnell nahm die Lösung der Machtfrage im Berliner Zimmer in Schöneberg ihren Lauf. Bald stritten wir nicht mehr über die Wahrscheinlichkeit unseres Amtsantritts, sondern über die politisch korrekten Amtsbezeichnungen der neuen Machthaber. Natürlich durften die Genossen, die die Stadt regieren würden, nicht »Senatoren« heißen. Sie würden als jederzeit abwählbare Räte einer Rätedemokratie vorstehen. Und schon wurden die Ressorts verteilt. Der wichtigste Posten – Regierender Bürgermeister – blieb für einen der nicht anwesenden führenden Genossen der »Bewegung« reserviert. Aber auch für uns fiel etwas ab. Hans-Joachim, unser Chefchaot, sollte als Rat für Inneres die Polizei und den Verfassungsschutz umkrempeln. Der Bücherwurm Bernhard – damals der einzige Marxismus-Leninismus-Kundige unter uns – sollte die Schulen und Universitäten revolutionieren. Der Theaternarr Kajo sollte die Opern und Theater umgestalten und revolutionäre Spielpläne erstellen – mit Bert Brechts »Maßnahme« und Alfred Jarrys »Ubu Roi« als Schwerpunkten. Der kleine Manfred, der die Kasse führte, würde im Senat für Finanzen das Unterste nach oben kehren. Und ich, Spitzname »Dichter«, sollte mich als Rat für Kultur bewähren. Unbesetzt blieben – mangels Interesses – die Ressorts Verkehr, Soziales, Post und Müll.
Wir, die zukünftigen Räte, schüttelten tapfer unsere Köpfe, zeigten uns gegenseitig den Vogel, schlugen andere Namen vor – unter Genossen verstand es sich, daß niemand sich nach vorne drängte. Aber im Ernstfall, soviel war klar, würde keiner von uns sich dem Dienst in einer revolutionären Räterepublik verweigern, wenn ihn denn »die Massen« dazu beriefen.
In einem Anfall meiner kleinbürgerlichen Zweifel fragte ich Hans-Joachim, wie er sich die Machtergreifung konkret vorstelle. Würden sich die Berliner Parteien alle in Luft auflösen, die Berliner Gewerkschaften mitsamt ihrem Vorsitzenden Sickert (»es sickert und sickert und sickert«, hatte ihm ein Flugblatt prophezeit) in den Gullis verschwinden, die Berliner Polizei und der Verfassungsschutz ihren Eid auf uns und die neue Räterepublik schwören? Und die Alliierten, ja, was würden eigentlich die Alliierten sagen, die schließlich in Berlin immer noch das Sagen hatten?
Irgendwie waren es, fand Hans-Joachim, die falschen Fragen – »zu konkretistisch«. Es gehe um die große Ansage, die Langzeitperspektive. Und falls dann doch alles anders kam, falls die alten, abgewirtschafteten Kräfte am Ende obsiegten, konnten wir unser Szenario immer noch zum Happening erklären.
Keine Frage, die revolutionäre Pöstchenverteilung war ein Spiel, ein absurdes und übermütiges Spiel, aber ich kann mich nicht erinnern, daß einer von uns in herzliches Gelächter ausgebrochen wäre.
Wir, die Machthaber eines künftigen »Freistaats Westberlin«, waren damals Anfang und Mitte Zwanzig.
Ein paar Tage später stand ich am Häuschen der Bahnaufsicht im Bahnhof Zoo und beobachtete die ein- und ausfahrenden Züge. Damals gab es dort nur zwei Gleise für den Fernverkehr – der sogenannte »Ersatz-Hauptbahnhof« der geteilten Stadt hatte die Kapazität eines Provinzbahnhofs. Mit dem leisen Schauder eines Geburtstagskindes, das von seinen Eltern eine viel zu große Spielzeugeisenbahn geschenkt bekommen hat, hörte ich den Lautsprecheransagen zu, die die Züge ankündigten. Sie kamen aus Hamburg, Frankfurt, Köln und München, manche auch von weiter her, aus Amsterdam und Paris, und fuhren weiter nach Prag und Warschau. Aber von Minutentakt konnte keine Rede sein. Während ich dort stand und die Züge meist pünktlich, manchmal auch mit angekündigter Verspätung ein- und ausfahren sah, überkam mich ein überwältigendes Gefühl der Überforderung. Wer von uns, überlegte ich, würde imstande sein, all diese Züge zu dirigieren? Wer würde die Weichen stellen? Etwa der abgebrochene Germanist Hans-Joachim, der nichts als reden konnte? Oder der Theaterwissenschaftler Kajo, der in ewiger Trennung mit seiner Frau lebte und unter Schlaflosigkeit litt? Oder ich, der selbsternannte »melancholische Revolutionär«? Wir waren allenfalls fähig, die bestehenden Fahrpläne abzuschaffen; wehe uns und den Passagieren, falls wir jemals die Chance erhalten sollten, die deutsche Bahn zu beaufsichtigen.
Unser unumstrittener »primus inter pares« Rudi Dutschke war an dieser Fata Morgana nicht ganz unschuldig. In einer Kneipe hatte er, so hat er es in seinen Tagebüchern festgehalten, schon im Juni 1967 seinen »Machtergreifungsplan« ausgepackt.
»Es ist nicht mehr übermütiger Irrsinn«, so hat er in diesen Tagen formuliert, »in dieser Stadt die Machtfrage zu stellen und positiv zu beantworten. ›Positiv‹, d.h. durch schon vor der Machtfrage sich herstellende Räteorgane das Gleichgewicht verschieben. Freistaatstatus. Abschaffung der Armee [bis] auf ein notwendiges Minimum, tote Kosten suchen und positiv verwerten für unser Alternativprogramm.«
Später hat er den Plan zusammen mit Gaston Salvatore im Oberbaumblatt ausgeschrieben. Darin behaupteten die beiden allen Ernstes, die Lage sei reif für die »Schaffung einer von kapitalistischen und stalinistischen Bürokraten unabhängigen Assoziation freier Individuen in einem ›Freistaat Westberlin‹«.
Ausformuliert kommt einem der Plan noch irrwitziger vor als das oben skizzierte Gespräch zwischen fünf beschwipsten jungen Männern in einer Berliner Wohnung. Denn wie nebenbei schloß Rudis und Gastons Vision ja auch gleich noch die Befreiung Ostberlins mit ein.
Was war passiert? Wie war es dazu gekommen, daß wir uns kaum ein oder zwei Jahre nach unserer politischen Initiation mit derartigen Plänen beschäftigten? Daß wir auch nur eine Sekunde lang an eine Entwicklung glauben konnten, die uns – selbstverständlich ganz unabhängig »von unserem persönlichen Wollen oder Streben« – dazu »zwingen« würde, die »Verantwortung« in der Stadt zu übernehmen?
Aber ich würde uns und der damaligen Stimmung in Berlin nicht gerecht, würde ich nicht von dem Hochgefühl sprechen, das in jenen Monaten wie ein berauschender Wind durch die Berliner Straßen fuhr. Damals schien alles möglich, besonders das Unmögliche – und wir, die von diesem Wind Getragenen, fühlten uns von der Geschichte selbst dazu berufen, eine andere Gesellschaft nach neuen Regeln aufzubauen. Es war ein Rausch ohne Drogen, der Rausch einer »historisch notwendigen« und »wissenschaftlich begründeten« Utopie, der von unseren Gehirnen und Herzen Besitz ergriffen hatte. Allerdings verlor dieser Rausch beängstigend schnell an Wirkung, sobald man die Tür seines Zimmers in der Wohngemeinschaft hinter sich geschlossen hatte – sofern das Zimmer noch eine Tür hatte.
1
Am 30.5.67 schrieb ich in mein Tagebuch:
In Deutschland stelle ich mir das schicksal eines Che Guevara etwa so vor: er arbeitet jahre, jahrzehnte erfolgreich und unerkannt im untergrund. Er hat mit flugzetteln, mit steckbriefen angefangen, er hat auf anti-vietnam- und anti-notstandsveranstaltungen aufrührerische reden gehalten und es verstanden, die (studentischen) massen hinter sich zu bringen. Er hat zu hause an einem langfristigen umsturzprogramm gearbeitet, von dem er freilich wußte, daß es nur eine unerreichbare utopie beschrieb, an der es sich auszurichten galt, und er hat wohl auch an einigen sprengstoffanschlägen mitgewirkt. Zuletzt plante er, im rahmen einer informationsveranstaltung durch einen großbrand sämtlicher Berliner tankstellen licht in die persisch-deutschen handelbeziehungen zu bringen. Eines tages wird er erkannt und verhaftet, als er mittags um zwölf, alter gewohnheit folgend, als einziger bei rot eine straße überquert.
Aber in meinen Aufzeichnungen finde ich auch, ein paar Tage später, die folgenden Sätze:
In meinem magen ein großes dumpfes loch. (…) Ich kann nicht schreiben, bin wie ausgebrannt, alle kraft ist nach unten gesackt, bis unter meine füße. Ich dachte eine zeitlang, jetzt wüßte ich, wie ich weitermache, jetzt hätte ich »meinen stil gefunden«. Aber alles fängt wieder von vorne an, ich sitze und zweifle, denke an redakteur-werden, lehrer-werden, regieassistent-werden, an schlußmachen. Die trennung von L. war richtig, das hoffe ich. Aber was richtig ist, halte ich nicht aus. Begabt sein heißt: nicht so tief, nicht so hoffnungslos fallen wie ich. Da muß es irgendeine grenze geben; die muß angenommen werden. Diese grenze gibt es bei mir nicht.
Der junge Mann, der aus den Tagebüchern jener Jahre zu mir spricht, ist mir nah und zum Erschrecken fremd. Die politischen Bekenntnisse dieses Fremden erscheinen mir nicht selten lächerlich bis überspannt; seine intimen Aufzeichnungen – diese endlosen Ergüsse über das endlose Scheitern einer Liebe, eines Nicht-Zurechtkommens mit sich und der Welt – machen mich ungeduldig, ja sie sind mir, wenn ein solches Urteil bei unzweifelhafter Identität der Verfasser möglich ist, manchmal sogar widerwärtig. Der sich da in verblichenen, schon wegen des nie gewechselten Farbbands der Olympia-Reiseschreibmaschine kaum erkennbaren Zeilen in Erinnerung ruft, kann nicht ich gewesen sein. Soviel Unglück und Versagung, soviel Kreisen um eine Ausweglosigkeit, ohne daß irgendeiner der gut sichtbaren, autobahnbreiten Auswege je genommen wurde, können eigentlich nur eingebildet sein! Wo war die Brücke zwischen zwanghafter Selbstzerknirschung und dem kollektiven Übermut, zwischen privater Verzweiflung und der Siegeszuversicht bei den Demonstrationen und Straßenschlachten, zwischen vernichtender Selbstkritik und – vom damaligen Verfasser zugespitzten – Parolen wie »Bürger, unterstützt den Vietcong, stürzt euch runter vom Balkon!«. Wie konnte der Schreibende vor vierzig Jahren diesen Abgrund überspringen?
Ich werde mich hüten, die Zerrissenheit dieses einen, dem ich in den Aufzeichnungen begegne, als »Symptom einer gesellschaftlichen Krankheit« zu beschreiben, wie es damals Mode war. Ich kann mir nicht anmaßen, ein Generationsporträt zu verfertigen. Zwar lernte ich in jenen Jahren Hunderte von Gesinnungsgenossen kennen, die ich für meinesgleichen hielt. Aber ich kannte und kenne sie nur bei ihren Vornamen. Das »Du«, mit dem wir uns gegenseitig ansprachen, war eigentlich ein »Wir«. Ebenso voreilig wäre der Versuch, die Abstürze und Hoffnungen dieses einen als einen kuriosen Einzelfall hinzustellen. Mit mir fanden sich in der »Bewegung« Tausende zusammen, die aus je verschiedenen Gründen mit sich und der Welt, in der sie aufgewachsen waren, nicht zu Rande kamen und nicht zu Rande kommen wollten.
Nur: Welchem »Ich« soll der Leser dieses Buches trauen? Dem des hin- und hergerissenen Rebellen oder dem des vierzig Jahre Älteren, der sich mal neugierig, mal verständnisvoll, mal entsetzt über den Jüngeren beugt?
Sicher ist nur, daß der Ältere das letzte Wort behält.
2
Weder als Schüler noch in meiner frühen Studentenzeit konnte ich mit einer Qualität aufwarten, die man in den siebziger Jahren mit strengem Ton »politisches Bewußtsein« nannte. Ich kann mich nicht erinnern, am Gymnasium in Freiburg – neun Jahre Latein, sechs Jahre Altgriechisch – je an einer leidenschaftlichen politischen Debatte teilgenommen zu haben. Staunend lese ich in den Geschichtsbüchern von den Kämpfen der fünfziger Jahre: von der Auseinandersetzung um das KPD – Verbot, von Demonstrationen gegen die Notstandsgesetze, von gewaltigen Aufmärschen gegen die Atombewaffnung, gegen die sich die großen Vietnamdemonstrationen der sechziger Jahre in Berlin bescheiden ausnehmen. Zumindest in der Oberstufe hätte ein Echo dieser Kämpfe an das Ohr eines lesebegierigen Gymnasiasten dringen können, dessen Lieblingsfächer Deutsch und Geschichte waren. Aber das alles ging an mir und meinen Schulfreunden vorbei. Unsere Phantasie war von anderen Unternehmungen besetzt; im Sommer von den langen Bade-Nachmittagen im Faulerbad, wo wir Bremsen totschlugen und die ersten Annäherungen an das andere Geschlecht probten; im Winter von den Skiwochenenden auf dem Schauinsland, wo wir – möglichst in Begleitung der einen Begehrten, auf die alle sich geeinigt hatten – in einer Skihütte Eierlikör brauten und endlose Kitzelorgien veranstalteten. Wenn überhaupt etwas für Unruhe sorgte, so waren es die ersten Platten von Bill Haley, Fats Domino und Little Richard, zu deren Rhythmen ich in meinem Schlafzimmer mit einem Freund den Überschlag beim Rock ’n’ Roll übte.
Einmal nahm mein Vater sich die Zeit, »Rock Around the Clock« mit mir vom Anfang bis zum Ende anzuhören. Anschließend analysierte er das Werk. Da er an den Städtischen Bühnen in Freiburg Opern dirigierte und auch, an Igor Strawinsky, Carl Orff, Harald Genzmer, Arnold Schönberg geschult, selber komponierte, konnte ich an seiner Autorität in Sachen Musik nicht zweifeln. Erbarmungslos hämmerte mein Vater mir am Flügel die drei Akkorde ins Ohr, die in Bill Haleys Ohrwurm endlos wiederkehren: Tonika, Dominante, Subdominante.
»Und das hältst du für Musik?« fragte er. »Diese einfallslose Wiederholung von genau drei Akkorden im immer gleichen Rhythmus?«
Damals wußte ich ihm nichts zu entgegnen, denn ich spielte unter seiner fürsorglichen Überwachung leidlich Geige und war in der Tradition der »Hochmusik« aufgewachsen. Natürlich war Bill Haleys »Rock Around the Clock« im Vergleich zu einer Kantate von Johann Sebastian Bach das Werk eines musikalischen Analphabeten. Nur änderte diese Einsicht nichts daran, daß Bill Haley – im Unterschied zu Bach – meinen Körper in helle Aufregung versetzte und meine Füße elektrisierte. Erst zehn Jahre später, nachdem ich Theodor W. Adornos Essay über Jazz gelesen hatte, der die Argumente meines Vaters auf höchstem philosophischem Niveau durchspielte, holte ich die Entgegnung nach: Das Gesetz von Rock ’n’ Roll, erklärte ich meinem Vater (und dem leider nicht anwesenden Adorno), bestehe eben gerade in der unerbittlichen Wiederholung des Immergleichen. Es sei dieses sture wunderbare Dadadámdamdám, das meinen Körper – und die von Millionen junger Leute – in ein und denselben Rhythmus einschwingen lasse und in Trance versetze. Wehe, wenn dieser Rhythmus durch irgendeinen Einfall oder eine sogenannte »Innovation« gestört werde – es komme nur Krampf dabei heraus! Es war eine Art Kriegserklärung.
Andere, ebenso nachhaltige Erschütterungen lösten die frühen Filme mit James Dean und Marlon Brando aus. Das T-Shirt von James Dean in »Denn sie wissen nicht, was sie tun« – erst später stieß ich auf den schönen Originaltitel: »Rebel Without a Cause« – beeindruckte mich derart, daß ich auf der Suche nach einem ähnlichen Kleidungsstück tagelang durch die Kaufhäuser am Bertholdsbrunnen stromerte. Da das Wort »T-Shirt« noch nicht erfunden oder noch nicht ins Badische gelangt war, konnte ich den hilfsbereiten Verkäuferinnen nur beschreiben, was ich suchte: ein weißes kragenloses Hemd mit kurzem Ärmel, der unbedingt oberhalb des Oberarmmuskels enden mußte. Sie sahen den dürren, halberwachsenen Kunden teilnahmsvoll an und zeigten ihm gerippte Unterhemden verschiedener deutscher Trikotagenhersteller; schließlich, da ich immer nur den Kopf schüttelte, Mädchenblusen. Am Ende erstand ich ein Unterhemd mit rundem Kragen, aber ohne Ärmel und probierte es zu Hause heimlich vor dem Spiegel an. Eines war mir sofort klar: So hatte James Dean nicht ausgesehen. Trotzdem zog ich mein »T-Shirt« am nächsten Tag zur Schule an und hoffte, irgendein phantasiebegabter Mitschüler würde mein Unterhemd für das Original nehmen und mich neidisch fragen, wo ich es erstanden hätte. Statt dessen nichts als Hohn und Spott: Was bloß in mich gefahren sei, in Unterwäsche im Gymnasium zu erscheinen! Die Entblößung männlicher Arme empfanden meine Klassenkameraden als »weibisch«; ein böseres Schimpfwort gab es nicht für einen jungen Mann. Vielleicht hat es mit dieser frühen Schmach zu tun, daß mich heute beim Anblick von jungen und erst recht von älteren Männern, die sich in sogenannten »Muscle-Shirts« präsentieren, das schiere Grauen packt.
Der einzige »Linke« weit und breit war unser Mathematiklehrer Dr. Kniess – ein ehemaliger Florettmeister. Den Ruf eines »Linken« hatte er sich erworben, weil er in Knickerbockern mit dem Fahrrad zur Schule fuhr und demonstrativ den Spiegel las, wenn er uns beim Schreiben einer Klassenarbeit beaufsichtigte. Erst sehr viel später erfuhr ich, daß er wegen einer unbotmäßigen Bemerkung gegenüber dem Direktor einer anderen Schule an unser Gymnasium versetzt worden war. Eine der seltenen Debatten in unserer Klasse bezog sich auf die Frage, ob es sich für einen Klassenlehrer schicke, den Spiegel zu lesen. Ich und ein paar Spiegel – Freunde wurden von der konservativen Mehrheit in der Klasse deutlich überstimmt.
Dabei habe ich in jenen Jahren den Spiegel nur in der Hand unseres Mathematiklehrers gesehen und eigentlich nur das schräg gehaltene Umschlagblatt. Ich blickte oft zu dem Magazin und seinem tapferen Leser auf, um an der Augenhaltung hinter der Lesebrille zu erkennen, ob er über den Blattrand in die Klasse schaute oder in die Lektüre vertieft war. Dies war der Moment, in dem ich von meinem Nebenmann und Freund Jochen unbehelligt abschreiben konnte. In den Beurteilungen meiner Mathematikarbeiten wiederholte sich denn auch die rot notierte Frage nach der fehlenden Herleitung, die mich zu dem richtigen Ergebnis geführt habe. Ich war mir klar darüber, daß Dr. Kniess meinen Betrug durchschaute, aber irgend etwas schien ihn zu hindern, mich dafür zu bestrafen. Allenfalls umrandete er einen dicken Tintenklecks, mit dem ich eine besonders mißglückte Klassenarbeit begonnen hatte, und schrieb daneben: »Peng!« Die Note »fünf«, die ich bei dieser Arbeit mangels rechtzeitiger Einsicht in das Heft meines Freundes erzielte, mußte von einem Elternteil unterschrieben werden. Aus Furcht vor der väterlichen Prügelstrafe entschloß ich mich, die Unterschrift zu fälschen. Nach einem sorgfältigen Testvergleich der Unterschriften meines Vaters und meiner Stiefmutter entschied ich mich für die letztere, da sie mir deutlich leichter von der Hand ging. Dr. Kniess blickte lange auf die Fälschung. »Wer hat das unterschrieben?« fragte er und sah mich durchdringend an. Das Blut schoß mir in die Stirn; ich sah keinen Ausweg mehr und war bereit zu gestehen. »Meine Mutter«, würgte ich hervor. »Hochintelligente Frau!« fuhr Dr. Kniess fort, »richten Sie ihr das aus. Denn ich verstehe etwas von Handschriften!«
Berühmt wurde der Satz, mit dem er einen seiner Lieblingsschüler kritisierte, der bei der Lösung einer schwierigen Aufgabe die rechte Seite der Schultafel mit fehlerlosen Kreideformeln vollschrieb und sie die ganze Zeit mit seinem Körper verdeckte. »Stehen Sie immer so weit rechts?« fragte ihn Dr. Kniess. »Heute steht man doch eher links von der Mitte. Haben Sie das noch nicht gemerkt?« Es war eine Anspielung, die wir durchaus verstanden, aber nicht besonders komisch fanden.
Erst viel später, bei einem Veteranentreffen unserer Klasse, enthüllte Dr. Kniess einer Mitschülerin, er habe während des Dritten Reichs auf der falschen Seite gestanden und seither alles daran gesetzt, seinen Fehler gutzumachen.
Der Antipode von Dr. Kniess war unser Deutsch- und Geschichtslehrer – ein hochaufgeschossener, beängstigend dürrer Mensch mit einem eindrucksvollen, kahlen Kopf, der an einen Totenschädel erinnerte. Dr. Malthan unterrichtete uns im Fach Geschichte bis zum Ende des Ersten Weltkriegs; danach hörte die Geschichte in unserem Geschichtsbuch und folglich auch im Unterricht auf und ging erst im Jahre 1945 weiter. Wir behelligten Dr. Malthan nicht allzusehr mit Fragen nach dem fehlenden Zwischenstück. Ein Gerücht besagte, daß er wegen einer »Belastung« aus der Vergangenheit nicht Oberstudienrat werden konnte. Etwa in der Unterprima teilte uns Dr. Malthan mit, er sei nicht in der Lage, die Geschichte des Dritten Reiches zu unterrichten, weil er »befangen« sei – auch dies ein geheimnisvolles Wort, das wir nicht versuchten zu enträtseln. Die Folge seiner »Befangenheit« war jedenfalls, daß wir in neun Jahren Gymnasium so gut wie nichts über die Nazizeit erfuhren. Gefürchtet war die Stunde des »Gerichts«, wenn Dr. Malthan mit einem Stoß Aufsatzhefte die Klasse betrat. Er legte die Hefte vor sich auf den Tisch. Aus Erfahrung wußten wir, daß die »ungenügenden« bis »ausreichenden« Elaborate zuoberst lagen, die »befriedigenden« bis »guten« zuunterst; die Note »sehr gut« trat in Malthans Berechnungen etwa so häufig auf wie der Halleysche Komet. Und nun begann das Ritual. Er griff nach einem der oberen Hefte – jeder bedauerte den bereits am Umschlag zu erratenden Delinquenten im voraus –, blätterte darin, beugte den Kopf tief über das Heft, um sich seiner Randnotizen zu vergewissern, und begann mit der Urteilsbegründung.
»Eine vielversprechende Einleitung«, hob Malthan an und blickte mit seinen blaßblauen Augen jetzt auf ein Ziel jenseits der Klassenzimmerwand, jenseits der Schule. »Auf der ersten Seite tritt man gleichsam durch ein gotisches Portal. Man geht guter Dinge und hochermutigt weiter – und wo findet man sich? In einem Kaninchenstall!«
So ging es von Heft zu Heft. Seine Kommentare waren streng, aber oft brillant und vom Ehrgeiz nach einer unvergeßlichen Formulierung getragen. Wir respektierten ihn, aber wir liebten ihn nicht.
Irgendwann wurden die Gerüchte über Dr. Malthans Vergangenheit durch ein Detail angereichert: Er habe in den »schlimmen Jahren« in Karlsruhe an einer Napola-Schule unterrichtet. Niemand von uns wußte oder wollte wissen, daß dieses Kürzel für »Nationalpolitische Erziehungsanstalten« stand, deren Auftrag es war, »Schüler zu Nationalsozialisten zu erziehen, tüchtig an Leib und Seele für den Dienst an Volk und Staat«. Der Professorentitel, mit dem Malthan immer noch von einigen Eltern und Lehrern angeredet wurde, stammte offenbar aus dieser Zeit. Eine oberflächliche Recherche hätte zwangsläufig zu der Frage geführt, ob unser Klassenlehrer – äußerlich das extreme Gegenbild zu Arnold Brekers germanischen Kraftmenschen – in der SS gewesen war, wie es gegen Ende der NS-Zeit bei Napola-Lehrern die Regel war. Aber gerade ich hätte an einer solchen Aufklärung kein Interesse gehabt, weil Malthan mein Lieblingslehrer und ich sein Lieblingsschüler war.
Beim Wiederlesen einiger Aufsätze, die ich in der Oberstufe schrieb, wird mir schwindelig. Zur Aufgabenstellung »Ordnen und erläutern Sie die Begriffe: Stolz, Selbstvertrauen, Hochmut, Selbstbewußtsein« schrieb ich nach einer vernichtenden Abfertigung des Hochmuts über den Stolz: »Aber immer hat es in der Zeit des Verfalls, der Schwäche, des Hochmuts die Starken gegeben, die Stolzen. Das sind die ›Herrenmenschen‹, die nicht untergegangen sind in der Masse, das sind die Germanen im Volke, die Felsen. Große, kraftvolle, männliche Menschen sind das, stolz auf ihre Kraft und ihre Herrschsucht, stolz auf ihren Willen, ihren Erfolg, auf ihre verletzende Art, stolz auf ihre Christenverachtung. Das sind Männer, die stolz sein dürfen, denn sie haben Substanz. Der Stolz ist das Szepter der Könige. Ihr Stolz ist der Stolz der Macht, ein Heldenstolz. Sie stehen im Diesseits, sie grübeln nicht, sie handeln.«
Der Verfasser war immerhin schon siebzehn, als er diese Sätze – sichtlich unter dem Einfluß einer hitzigen Nietzsche-Lektüre – zu Papier brachte. Zwar feierte er im Schlußteil seines Aufsatzes das »Selbstbewußtsein« als den Stolz der Dichter und der Künstler und nannte J.W. Goethe als Gewährsmann. Aber offenbar dachte der Siebzehnjährige damals so, wie er schrieb, zumindest wollte er – mit einem Schielen nach dem Beifall des verehrten Lehrers – dieses Denken ausprobieren.
Die einzige kritische Anmerkung, die Dr. Malthan zu dem zitierten Passus machte, galt dem Ausdruck »stolz auf ihre Christenverachtung«. »Was soll das hier?« notierte er am Rand.
Dr. Malthan, der mit uns in seiner Freizeit Dramen unserer Wahl einstudierte und der wichtigste Mentor meiner frühen Schreibversuche war, erscheint in der Rückschau als Antipode zu Dr. Kniess. Weit davon entfernt, »seine Fehler« gutzumachen, bestand er darauf, sie nicht zu verleugnen – wozu auch eine Art Mut gehörte. Malthan sah sich als einen verführten Idealisten, dem niedrige Beweggründe nicht zu unterstellen waren. Das hinderte ihn nicht, am Pflicht-Erinnerungstag, dem 20. Juli, mit dem beängstigenden Zittern, das seine dünnen Lippen vor einem wichtigen Kommentar befiel, zu äußern: »Es ist immer verwerflich, wenn man sein Vaterland in einer schweren Stunde im Stich läßt.«
Kein Zweifel, wir hatten gute, sogar brillante Lehrer. Daß wir in Wahrheit nur die Wahl zwischen mehr oder weniger reuigen ehemaligen Nazis hatten, ist uns damals nicht weiter aufgefallen.
Die Aussparung »des dunkelsten Kapitels der deutschen Geschichte« aus dem Unterricht ist damals keineswegs in allen Gymnasien Freiburgs die Regel gewesen. Ein Freund und Altersgenosse, der Hirnforscher Ernst Pöppel, der auf das naturwissenschaftlich ausgerichtete Keppler-Gymnasium ging, erzählt mir, daß seine Klasse von einem jungen Geschichtslehrer in aller Ausführlichkeit über das Dritte Reich unterrichtet wurde.
3
Freiburg präsentierte sich schon in den fünfziger Jahren als eine idyllische, kulturbeflissene Stadt, die von der Hitlerei halbwegs verschont geblieben war. Obwohl meine Geschwister und ich in Ruinen aufgewachsen sind – zuerst hatte Hitlers Luftwaffe die Stadt versehentlich bombardiert, weil die Piloten das Freiburger Münster mit dem von Straßburg verwechselten; 1944 hatten die Briten große Teile der Stadt in Schutt und Asche gelegt –, hatte ich das Gefühl, daß der Krieg in Freiburg eigentlich nie stattgefunden hatte.
Mein Geigenlehrer, ein Professor der Musikhochschule, war ein Anthroposoph mit Missionsdrang und hatte in seinem Unterrichtszimmer einen bilder- und mineralsteinreichen Altar für Rudolf Steiner aufgebaut. Ich war ratlos, wenn sich der bewegliche, tänzerisch begabte Mann mit dem weißen Haarkranz nach einem falschen oder gekratzten Ton auf der Geige mir näherte und, mit der Hand von meinem Hals über meinen Bogenarm abwärts streifend, meinen »Astralleib« zu erspüren suchte. Totale Entspannung, Hingabe an das Fluidum, an die Vibrationen zwischen mir und dem Unendlichen versuchte er mir nahezubringen. Aber ich konnte und wollte mich nicht entspannen, wollte und konnte nicht »locker« sein. »Lockerkeit« – ein Konzept, das unter anderen Vorzeichen erst in den sechziger und siebziger Jahren eine Weltkarriere machte – war mir zutiefst suspekt: eine Anweisung zum Abschlaffen, zum Augenschließen, zur Unterwerfung. Und schon gar nicht konnte ich die Abneigung meines Lehrers gegen alles Eckige und Kantige in mir und seiner näheren Umgebung nachvollziehen. Bücher, Notenständer und auch Partituren waren und blieben gottlob eckig; ich selbst fühlte mich über alle Maßen eckig. Nervös und gespannt wie ein Flitzebogen, war ich allergisch gegen alles Runde.
Im weiteren Umkreis meiner Familie wimmelte es von lächelnden, bis zum Exzeß entspannten Anhängern Rudolf Steiners. Freiburg war schon damals ein Biotop für Anthroposophen, Hobbyphilosophen und Heilkundige aller Sorten. Schnupfen, Grippe, Asthma, Blasenbeschwerden in der Familie wurden von Dr. Reps und seinen weißen Kügelchen geheilt. Undenkbar, daß einer von diesen liebenswürdigen, leicht spinnerten, aber nie wirklich komischen Harmonikern jemals in einem Weltkrieg gewesen war oder Hitler zugejubelt hatte.
Im übrigen paßte ich mit meinen Neigungen und Interessen in das kulturbeflissene Idyll, das ich später gern als Spießerparadies bespöttelte. Schon als Zehn- oder Elfjähriger holte ich meinen Vater auf dem Heimweg von der Schule oft von der Orchesterprobe im Freiburger Stadttheater ab. Nachdem ich den Bühneneingang passiert hatte, gelangte ich durch ein Labyrinth von Gängen und Treppen nach oben. Auf Zehenspitzen betrat ich den dunklen, vollkommen leeren Zuschauersaal und nahm auf einem gepolsterten Sitz in einer der hinteren Reihen Platz. Von dort sah ich den heftig bewegten Hinterkopf meines Vaters und seine ausgebreiteten, gleichsam schwebenden Arme über dem nur von Lichtpunkten erhellten Orchestergraben. Das einzige, was in dem riesigen dunklen Raum deutlich zu erkennen war, waren die Hände meines Vaters. Schauer liefen über meinen Rücken, wenn er mit einem fast unmerklichen Heben des Stabes in der rechten, dann mit einem Wink der linken Hand die unsichtbaren Instrumentengruppen in der Tiefe des Orchestergrabens aufrief oder sie mit einem knappen Querstrich zum Verstummen brachte.
In der Sexta und Quinta kritzelte ich – in Anlehnung an Eichendorff und Heine – Landschaftsgedichte und Balladen in ein Heft. Als ich einem Schulfreund, einem langen und kräftigen Bauernsohn, auf dem Heimweg davon erzählte, forderte er auf der Stelle eine Probe meiner Kunst. Auswendig trug ich ihm drei Strophen eines eben verfaßten Herbstgedichtes vor. Als ich geendet hatte, sah ich ihn, meinen ersten Zuhörer, unsicher an. Ohne Vorwarnung verpaßte er mir eine Ohrfeige, die ich lange auf der Wange spürte – er wollte nicht glauben, daß das Gedicht von mir war. Mit zwölf, dreizehn Jahren schrieb ich dann Märchen der Gebrüder Grimm – darunter »Schneewittchen« und »Das tapfere Schneiderlein« – in fünfaktige Dramen mit gereimten Versen um. Unser Lateinlehrer, der wegen einer Kriegsverletzung den Spitznamen Humpelmüller trug, machte sich die Mühe, die Stücke auf der Schreibmaschine abzuschreiben und zu inszenieren. Seine Schwäche für meine Märchendramen hat mich mindestens einmal vor einer versetzungsgefährdenden Abschlußnote »fünf« im Fach Latein bewahrt. Nach einem kurzen Abstecher in die Kategorie »Abenteuerroman« im Karl-May-Stil versuchte ich mich mit Hörspielen in der Nachfolge von Ingeborg Bachmann und Wolfgang Borchert. In einem Lesekreis trug ich das eine oder andere vor. Nach der Lektüre wurde dann über Fragen wie die Existenz Gottes, den Nihilismus und den Sinn des Lebens diskutiert – Politik gehörte nicht zu unseren Themen.
In meiner Familie wurde hin und wieder über den Krieg gesprochen, aber eigentlich nur über das Kriegsende, genauer, über die Flucht meines Vaters aus dem Gefangenenlager in Südfrankreich.
Er war nur verhältnismäßig kurz im Krieg gewesen und hatte in dieser Zeit keinen Schuß abgegeben. Propagandaminister Goebbels hatte die deutschen Opernhäuser und Theater bis zum September 1943 in Betrieb gehalten – mit der Folge, daß mein Vater seinen Beruf als Dirigent bis zu diesem Zeitpunkt ausüben konnte. Danach war er dank seiner trainierten Pianistenfinger als Funker hinter der Westfront eingesetzt worden und bei Kriegsende in französische Gefangenschaft geraten.
Seine Flucht wurde zu einem Familienmythos – aber nicht etwa wegen ihrer perfekten Planung, sondern wegen der seltsamen Mischung aus Kühnheit, Naivität, Leichtsinn und Optimismus, die mein Vater dabei an den Tag legte. Aus irgendeinem Grund besaß er noch etwas Geld, das er als Nichtraucher durch den Verkauf seiner gehorteten Zigarettenrationen zielstrebig vermehrte. Es war ihm klar, daß eigentlich nur eine Flucht in ziviler Kleidung Erfolg versprach. Da es ihm nicht gelang, sich einen Anzug oder auch nur einen Mantel zu beschaffen, begnügte er sich mit einer Baskenmütze, die ihm ein Wachmann für mehrere Zigarettenpäckchen abtrat. An Allerheiligen 1945 entschloß er sich zur Flucht und überwand den Lagerzaun. In seiner Häftlingskleidung und mit der Baskenmütze auf dem Kopf erreichte er unbehelligt den nächsten Bahnhof und löste dort eine Fahrkarte erster Klasse nach Lyon. Seine Hoffnung war, daß ein Fahrgast in der ersten Klasse, der seinen Rücken mit dem Aufdruck »POW« (Prisoner of war) fest gegen die Rückenlehne preßte und eine Baskenmütze auf dem Kopf hatte, praktisch unsichtbar wäre und nicht überprüft werden würde. Seine Rechnung ging auf – der Schaffner fragte lediglich nach seinem Fahrschein. In Lyon angekommen, hinderte ihn ein Plakat daran, seine Flucht nach Norden fortzusetzen. Auf dem Plakat war für diesen Feiertag der Auftritt eines berühmten Dirigenten angekündigt, dessen Name mir entfallen ist. Auf dem Programm standen klassische französische und auch deutsche Werke, darunter ein oder zwei Lieblingsstücke meines Vaters. Nichts hatte der POW während der Gefangenschaft so sehr entbehrt wie Musik. Da erst am Abend ein Anschlußzug nach Straßburg fuhr, wurde die Anziehung, die das Plakat auf ihn ausübte, unwiderstehlich. Er fand in die Stadthalle oder in das Theater in Lyon und besuchte das Konzert.
An dieser Stelle verliert sich die Geschichte für eine Weile im Gestrüpp der widersprüchlichen Erinnerungen derer, die sie gehört haben. Ich halte es aber auch für möglich, daß mein Vater uns Kindern und seiner jungen zweiten Frau, die er erst nach dem Tod unserer Mutter in den ersten Nachkriegsjahren kennengelernt hatte, unterschiedliche Versionen erzählt hat. Nach meiner Erinnerung schummelte er sich in Lyon ohne Eintrittskarte in das Konzert hinein. Mit dem Rücken immer an der Wand blieb er in der Nähe einer Einlaßtür stehen. Seine Angst, entdeckt zu werden, schwand, als das Licht ausging und die ersten Akkorde des Orchesters erklangen; er habe sich zurückhalten müssen, nicht mit den Händen mitzudirigieren. In der Pause zwischen Rameau und Beethoven habe er eine junge Französin kennengelernt, der er sich kurz entschlossen offenbarte. Die junge Frau war von der Begegnung mit dem musikbegeisterten Flüchtling offenbar derart berührt, daß sie ihn noch in der Pause mit nach Hause nahm und ihm einen Mantel ihres Mannes gab.
In der – wahrscheinlich vertrauenswürdigeren – Version meiner zweiten Mutter hat sich diese Szene später und höher im Norden Frankreichs abgespielt, in der Nähe Straßburgs oder sogar in Straßburg; im übrigen sei der rettende französische Engel männlichen Geschlechts gewesen. Die französische Militärpolizei war auf dem Bahnhof auf meinen Vater aufmerksam geworden. Im Hundert-Meter-Tempo – er war der beste Kurzstreckenläufer seiner Schule gewesen – lief er seinen Verfolgern davon. In einer Seitenstraße hatte ihn ein junger Franzose in einen Hauseingang gezogen und ihn versteckt. Die Hilfsbereitschaft des jungen Mannes habe wohl daher gerührt, daß er auf der anderen Seite des Rheins eine deutsche Braut hatte. Von ihm sei der Vater dann auch mit ziviler Kleidung ausgestattet worden. Am nächsten Tag habe ihn der Franzose auf der offenen Ladefläche seines Kleinlastwagens, unter Decken und allem möglichen Gerät, versteckt, über die letzte intakte Brücke in Kehl nach Deutschland gebracht. Von dort aus hatte sich mein Vater nach Oberbayern durchgeschlagen, wo wir im mit Flüchtlingen vollgestopften Wochenendhaus meines Großvaters das Kriegsende und den Einmarsch der amerikanischen Truppen erlebten.
Soviel steht fest: Mein Vater war kein Widerstandskämpfer, aber auch kein Nazi. Im Krieg hat er nie ein Gewehr in der Hand gehalten. Die Aufforderung, sich zum Offizier zu qualifizieren, hat er ignoriert. Nach dem Krieg hat er seine Kinder zum Pazifismus und zur Wehrdienstverweigerung angehalten.
Die Baskenmütze, seine Tarnkappe, hat er sein Leben lang getragen. Und immer, wenn ich später einem Mann mit Baskenmütze begegnete, habe ich unwillkürlich Vertrauen zu ihm gefaßt. Einer dieser Männer ist Heinrich Böll gewesen.
Die Geschichte der Flucht meines Vaters enthält einige Elemente jenes Familien-Credos, mit dem meine Geschwister und ich aufgewachsen sind: Kulturelle Fähigkeiten, etwa die Beherrschung eines Musikinstruments, sind ein höheres Gut als der Besitz von weltlichen Gütern und eine sichere Beamtenstelle; Mut und Chuzpe zahlen sich aus und werden im Zweifelsfall belohnt – auch wer die Eintrittskarten für ein Furtwängler-Konzert nicht erschwingen kann, hat ein naturgegebenes Recht, an dem Ereignis teilzunehmen, vorausgesetzt, daß er das Talent entwickelt, sich an der Einlaßkontrolle vorbeizuschmuggeln. Tatsächlich hat der Vater uns frühzeitig und so erfolgreich in dieser Technik unterwiesen, daß wir uns nicht selten alle vier, durch verschiedene Einlaßtüren kommend, in der ersten Reihe wiederfanden, wo erfahrungsgemäß die meisten Plätze frei blieben.
Jeder von uns hat den heftig bewegten väterlichen Kopf vor Augen, dessen rotes Haar nach vornüber fiel, wenn er uns am Flügel begleitete und mit einem heftigen Nicken den Einsatz gab. Keiner von uns konnte der Bestimmung zu einem Musikinstrument entrinnen. Auf meinen Bruder Jost, den Ältesten, entfiel der härteste Part: Er erlernte beim Obermusiker der Familie, nicht selten unter Schlägen, das Klavier und tat es ihm auf diesem Instrument bald gleich. Meine Schwester Barbara strich ohne Begeisterung das Cello, das ihr der Vater mit Blick auf ein hoffentlich bald vollständiges Familienquartett verordnet hatte. Ich erlernte die Geige, mein jüngerer Bruder Michael die Querflöte. Ich weiß nicht, wie die Nachbarn über uns das tägliche Gekratze, Geklimper und Geblase aus dem Parterre ertragen haben.
4
Daß unser Vater auch eine dunkle Seite hatte, bekam meine Schwester Barbara zu spüren. Was die 68er zehn Jahre später mit Schlagworten wie »autoritäre Gesellschaft«, »faschistoide Strukturen«, »falsche« bzw. »überflüssige Autorität« zu fassen suchten, erfuhren in den fünfziger Jahren vor allem die jungen Frauen der Republik.
Als einziges Mädchen unter drei Brüdern wurde meine Schwester zur Rebellin, längst bevor es irgendein Signal zum Aufbruch gab. Nicht, als ob mir die Verbote, gegen die sie Sturm lief, als »geschlechtsspezifische Diskriminierungen« aufgefallen wären. Aber daß ich, der drei Jahre Jüngere, dank meines Geschlechts ein laxeres Leben führen konnte als meine Schwester, war nicht zu übersehen. Wenn ich zu spät von einer Party zurückkehrte, wurde ich schlimmstenfalls ausgeschimpft. Wenn sie dasselbe tat, hatte sie von meinem Vater an der Tür Wutausbrüche und manchmal auch Schläge zu gewärtigen. Solche Szenen spielten sich im Flur der Wohnung ab, aber waren in den Schlafzimmern von uns Brüdern nicht zu überhören.
Unklar, rätselhaft, unheimlich blieb, was den Vater, wenn meine Schwester nachts zu spät zurückkam, derart ausrasten ließ. Auch wir Brüder hatten Ausbrüche von Jähzorn erlebt. Einmal hatte ich im Hinterhof unseres Mietshauses ein Dutzend nagelneue Glühbirnen zurechtgestellt und mit dem Luftgewehr eine nach der anderen abgeschossen; ich war mit dem Teppichklopfer bestraft worden. Aber Schläge ins Gesicht, weil einer von uns – wirklich oder angeblich – die letzte Straßenbahn verpaßt hatte, blieben uns erspart. Ein bitterer Satz meiner Schwester ist mir in Erinnerung geblieben, weil er sich so fremd, so unverständlich anhörte: Sie habe den Vater, wenn sie nachts zu spät zurückkam, in einer Rolle erlebt, in der ihn keiner von uns kannte – eben nicht als Vater, sondern als einen gekränkten, jähzornigen Mann, der die Kontrolle über sich verlor und sich für irgend etwas an ihr rächte.
Zu seinen Wutanfällen trug sicherlich der Umstand bei, daß meine Schwester es nicht eben darauf anlegte, in der Öffentlichkeit nicht aufzufallen. Bevor sie ausging, verbrachte sie viel Zeit vor dem Spiegel, zog die Wimpern und die Augenränder nach, legte Rot auf die Lippen und packte so viel Puder auf ihre aknegeplagte Haut, daß ich, wenn sie mich vertrauensvoll fragte, ob ich noch irgendeinen Pickel sähe, nur den Kopf schüttelte – ohnehin erkannte ich sie unter ihrer Maske kaum wieder.
Es genügte, daß sie im engen Rock und mit ihren vom Vater ererbten flammendroten Haaren auf die Straße trat, um besorgte Anfragen der Nachbarn und Kollegen meines Vaters auszulösen. Um so schlimmer, wenn ein später Zeuge sie nachts auf dem Nachhauseweg erkannte. Das Freiburger Nachtleben bestand damals nur aus einer Schwulenbar namens »Henry« und einer Striptease-Bar am Spielcasino in der Wallstraße. Ab elf Uhr nachts war alles dicht. Tagsüber trafen sich die schrägen Vögel Freiburgs in einem italienischen Eiscafé am Bertholdsbrunnen, das über fünf oder sechs Tische verfügte. Dort standen oder hockten sie meist schon mittags, über bunte, heftig tropfende Eiskugeln gebeugt, und redeten über Brecht, Sartre und Camus. Ob mein Vater das Wort »Hure« zuerst von irgendeinem Nachbarn aufschnappte, ob es ihm selbst herausrutschte, kann ich nicht sagen. Jedenfalls entstand so etwas wie ein Stadtgespräch, als sich meine Schwester im Eiscafé am Bertholdsbrunnen mit zwei afrikanischen Studenten zeigte.
Ich, der Nächstjüngere und damals ihr Vertrauter, hielt zu ihr. Ich log und schwieg zu ihren Gunsten, ich bewahrte ihre Geheimnisse. Meine Schwester war schön, aufregend, widerspenstig – eine Rebellin, bevor ich auch nur das Wort gehört hatte. Aber ich kann mich nicht erinnern, daß ich meinem Vater gegenüber je das Wort für sie ergriffen hätte.
Im Sommer 1955 hatte ich meine Schwester auf einer Fahrradtour begleitet und den Vorwand dafür abgegeben, daß sie ihre erste große Liebe – einen schwedischen angehenden Tenor – wiedersehen konnte. Wie in einem französischen Boulevardstück kam das Geheimnis durch einen Brief heraus, den meine Schwester an eine Freundin geschrieben, aber nicht abgeschickt und zu Hause liegengelassen hatte. Mein Vater schlug in besinnungsloser Wut auf sie ein, verbrannte alle Briefe ihres Freundes und verbot ihr jeden weiteren Umgang mit ihm. Mit dieser Szene begann der lange Auszug meiner Schwester aus der Familie. Sie brach die Cellostunden ab, schmiß die Schule, ging als Au-pair-Mädchen nach England, büßte in ihrer Gastfamilie stellvertretend für alle Deutschen für den Zweiten Weltkrieg, schrieb sich nach ihrer Rückkehr in eine Dolmetscherschule ein, überwarf sich kurz vor dem Examen mit ihren Lehrern, zog nach München und wurde dort in die Schauspielschule aufgenommen.
In den letzten Jahren hat eine »historische Neubewertung«, ja eine regelrechte Verklärung der fünfziger Jahre eingesetzt. Tütenlampen, Nierentische, Schalensessel wurden in einem Bündnis zwischen jungen Historikern und nostalgischen Veteranen in Ausstellungen und Zeitschriftenserien als Wahrzeichen einer heroischen Aufbauphase gefeiert. Damals, so geht das Lied, kannten die Deutschen noch ihre »alten Tugenden« Fleiß, Disziplin, Gehorsam und Bescheidenheit; damals konnten sie noch zupacken, damals wußten sie noch, wie man Kinder erzieht und sich bei Tische und in der Straßenbahn benimmt. Der große Alte vom Rhein, Konrad Adenauer, wuchs in der Rückschau zu einem zweiten König Drosselbart empor. »So einen wie den«, sagte eine Besucherin einer Ausstellung über die fünfziger Jahre in Hamburg, »bräuchten wir heute.«
Jede Generation schreibt die Geschichte neu. Nichts gegen die Aufwertung der Trümmerfrauen und das auch mit ihrer Hilfe bewerkstelligte Wirtschaftswunder; nichts gegen Adenauers Entscheidung für die Westbindung der jungen deutschen Demokratie. Es stimmt: Die mit Millionen von geschlagenen und deswegen willfährigen Altnazis aufgebaute Bundesrepublik war kein postfaschistischer Nachfahre des Dritten Reichs. Sie war ein mit schweren Altlasten befrachtetes, genuin neues demokratisches Gebilde. Aber die Rehabilitation der fünfziger Jahre durch die Einserschüler des 21. Jahrhunderts verharmlost die Kosten des Aufbauwunders. Es war die Zeit, da Ehefrauen ihre Männer noch um Erlaubnis fragen mußten, wenn sie arbeiten gehen, ein Konto einrichten oder den Führerschein machen wollten. Es war die Zeit, da eine Ehe oder ein Verhältnis zwischen Partnern, die nicht derselben Konfession angehörten, einer Familientragödie gleichkam – von der Verfemung homosexueller Partner ganz zu schweigen; es war die Zeit, da es im Münsterland noch üblich war, daß katholische und evangelische Schüler getrennt im Pausenhof herumspazieren und getrennte Toiletten benutzen mußten.
Im Chaos der Kriegs- und der ersten Nachkriegsjahre hatten die Mütter notgedrungen die Rolle des Familienoberhaupts übernommen. Aber schon in den frühen fünfziger Jahren hatten die heimgekehrten Väter die alte Ordnung wiederhergestellt. Die volle Wucht ihres Verlangens nach Respekt und Anerkennung bekamen vor allem die halbwüchsigen Frauen der jungen Republik zu spüren – ihre Töchter. Was war ihnen nicht alles verboten! Die Vorschriften regelten nicht nur den Zeitpunkt der Rückkehr von einem Tanzvergnügen, die Frage, mit welchem Freund sie Umgang pflegen durften, die Wahl eines »für Frauen geeigneten« Berufs – im Zweifelsfall Sekretärin oder eben Dolmetscherin. Mit geradezu islamistischer Verbohrtheit wurden den Töchtern auch ihre Kleidung und Kosmetik vorgeschrieben: die Farbe und der Auftrag des Lippenstifts, die Breite der Augenumrandung, der Knopf, bis zu dem die Bluse geöffnet werden durfte, die Rocklänge, die Strumpffarbe, die Höhe und Breite des Schuhabsatzes. Setzten sie sich über diese Vorschriften hinweg, wurden sie nicht selten handgreiflich an »die Grenzen des Anstands« erinnert. Die Mehrzahl der heranwachsenden Mädchen in den fünfziger Jahren dürfte noch mit den wilhelminischen Handwerkszeugen der Pädagogik – Hand, Stock, Teppichklopfer – erzogen worden sein. Und nicht wenige ihrer männlichen Geschwister, die weit nachsichtiger, aber mit denselben Instrumenten auf ihre zukünftige Rolle als Familienoberhäupter vorbereitet wurden, hatten dann »verschluckt den Stock, womit man sie einst geprügelt«. Auch die 68er haben im Streit mit ihren Freundinnen oder Ehefrauen das von den Vätern abgeschaute Faustrecht angewandt. Erst die Frauenbewegung hat dieses barbarische Relikt aus der kaum vergangenen »Vorzeit« gesellschaftlich geächtet.
Nicht die »kleine radikale Minderheit«, die einen Aufstand gegen die Elterngeneration wagte, ist in Erklärungsnot, sondern jene Mehrheit, die nicht rebellierte und so tat, als könne man nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Zivilisationsbruch des Judenmords in Papas und Großpapas Fußstapfen treten und mit deren Scheitel, in deren Schlipsen und Anzügen einer Karriere nachgehen, als wäre nichts gewesen.
5
Das Wissen über die Verbrechen der Nazizeit war in den fünfziger Jahren eklektisch und blieb der Initiative einzelner Pioniere überlassen. Der erste Haftbefehl gegen Josef Mengele, den »Todesengel von Auschwitz«, wurde von der Staatsanwaltschaft Freiburg im Februar 1959 erlassen. Im gleichen Jahr erschien der vom hessischen Generalstaatsanwalt Fritz Bauer in Frankfurt ausgefertigte Steckbrief. Wir, damals bereits Abiturienten, erfuhren nichts davon – immerhin hätte ein tüchtiger Lokalreporter der Badischen Zeitung aufdecken können, daß Dr. Dr. Josef Mengele zuletzt in Freiburg gemeldet war; daß seine 1954 geschiedene Frau Irene (unter dem Namen ihres zweiten Mannes Hackenjos) in Freiburg lebte; daß der aus der Ehe mit Mengele geborene Sohn Rolf – ein Altersgenosse von uns – in Freiburg zur Schule ging.
Ich bin dem Namen Mengele damals nur auf meinen Trampausflügen nach Norden begegnet: Der Schriftzug prangte in riesigen, schwungvoll gemalten Lettern auf den Lastzügen der Landmaschinenfabrik Mengele in Günzburg, die jedesmal an mir vorbeidonnerten, wenn ich sie in der Autobahnausfahrt Karlsruhe anwinkte. Der erstgeborene Josef Mengele war Miteigentümer dieser Firma, hatte jedoch seinen Anteil an die Günzburger Familie überschrieben, um sie von Schadensersatzforderungen jüdischer Kläger freizuhalten.
Dem Schweigen der Eltern über den Krieg entsprach die früh erlernte Diskretion der Kinder. Dabei waren auch die Biographien von uns Halberwachsenen vollständig durch den Krieg und die Kriegsfolgen geprägt – so auch die Lebensumstände meines engsten Freundes und Nebenmannes Jochen. Die Geschichte seines Vaters entsprach bis ins Detail jenem Heimkehrerschicksal, das Wolfgang Borchert in »Draußen vor der Tür« dramatisiert hat. Wir, Jochens Mitschüler, kannten dieses Stück, wären aber nie auf die Idee gekommen, eine Verbindung zwischen Kunst und Leben herzustellen. Sein Vater, ein Jurist, war 1951 aus russischer Kriegsgefangenschaft heimgekehrt. Gleich nach der Begrüßung gestand ihm seine Gattin, daß sie sich mit einem anderen Mann verbunden hatte und ihn heiraten wolle. Jochens Vater verließ die Stadt und reichte die Scheidung ein.
Die neue Ehe kam dann nicht zustande. Jochens Vater hatte sich nach der Trennung in Freiburg niedergelassen und war dort als Beamter in den höheren Verwaltungsdienst der Post übernommen worden. Seine Frau reiste ihm mit dem gemeinsamen Sohn nach und fand in einem nahe gelegenen Kurort eine Stellung als medizinisch-technische Assistentin. Der damals zwölfjährige Junge wurde in der Familie eines Studienfreundes des Vaters untergebracht.
Während unserer auf derselben Bank abgesessenen Schulzeit kannte ich drei Adressen meines Freundes: die wunderbar verwinkelte und enge Wohnung seiner Gastfamilie in der Mitte Freiburgs, wo er sich mit zwei von insgesamt vier Kindern eine kleine Kammer teilte; das kahle Junggesellenapartment des Vaters, den er am Wochenende besuchte; das lichte und gemütliche Studio seiner Mutter in Glottertal, das wir nach einem langen und mühsamen Aufstieg erradelten. Der Vater verdiente genügend Geld, um seinen Sohn nach Kräften zu verwöhnen. Jochen war der erste in der Klasse, der ein Fahrrad mit vier Gängen besaß. Bei unseren Fahrradkämpfen, bei denen es darauf ankam, den Gegner mit einem Angriff auf dessen Vorder- oder Hinterrad aus dem Gleichgewicht zu bringen und zum Absteigen zu zwingen, hielt er sich mit seiner Viergangschaltung am längsten im Sattel.
Erst kurz vor dem Ende seiner Schulzeit ließen die Eltern meinen Freund wissen, daß sie wieder zueinandergefunden hatten. Hinter dem Rücken des Sohnes und seiner Gastfamilie hatten sie wieder Verbindung miteinander aufgenommen und die geschiedene Ehe als wilde Ehe fortgesetzt. Als Jochen längst studierte, heirateten seine Eltern wieder.
Für meinen Freund war es zu spät. Sein gesamtes Schülerleben war er zwischen zwei Elternteilen hin- und hergeradelt, die sich liebten, aber sich eigentlich nicht mehr lieben durften. Zum Glück hatte er den größten Teil dieser Zeit in einer außerordentlich freundlichen und fürsorglichen Gastfamilie verbracht. Er hatte seinen Vater erst kennengelernt, als er aus dem Krieg zurückkam, und seine Eltern nie als ein Paar erlebt.
Eine Legende der 68er besagt, das Schweigen der Eltern über den Krieg habe jenes Urmißtrauen erzeugt, das in den Jahren der Revolte zum Ausbruch kam. Diese Herleitung mag auf diejenigen von uns zutreffen, die im Bücherschrank ihrer Eltern auf eine Dokumentation über den Nürnberger Prozeß oder auf Eugen Kogons »Der SS-Staat« stießen oder gar – versehentlich oder weil sie danach suchten – auf den versteckten SS-Ausweis ihres Vaters.
Mir fehlte ein derartiges Initiationserlebnis. Aber auch das Schweigen, das Nichtwissen und Nichtwissenwollen waren prägende Erfahrungen. Dieses Schweigen wäre falsch beschrieben, wollte man es auf die Verleugnung der Vergangenheit reduzieren. Das Schweigen griff nach allem, was im Gefühlhaushalt einer Familiengemeinschaft der Mitteilung bedurft hätte: alltägliche Ängste, Mißerfolge, Kränkungen, finanzielle Engpässe und die Not, eine Familie über Wasser zu halten – es bezog sich auf die Äußerung von Gefühlen insgesamt. Es war das Nichtredenkönnen einer verklemmten Generation, das das Klima der fünfziger Jahre so stickig machte. »Jefühle, Jefühle«, sagte mein Vater, wenn einer von uns sich mit der Wendung »aber ich hatte das Gefühl, daß …« für eine Fehlleistung zu rechtfertigen suchte. Als handele es sich bei »Gefühlen« um eine verdächtige Kategorie, die für Mißlingen steht.
Bei unseren Skiwochenenden hatten Jochen und ich nach der Seilbahnfahrt zum Schauinsland einen zweistündigen Langlauf auf unseren Holzskiern zur Hütte in Muggenbrunn zu bewältigen. Die letzte Hütte, die wir auf unserem Weg passierten, gehörte Martin Heidegger. Immer wieder haben wir ihn in derselben Haltung gesehen: den kurzen, unbewegten Rücken in der Lodenjacke auf der Bank, wie er ins beschneite Tal schaute und dünne Rauchfäden in die Luft blies. Irgendwie wußten wir, daß unser nächster Nachbar weltberühmt war und daß man ihn nicht stören durfte. Unwillkürlich senkten wir die Stimme. Obwohl er das Gleiten und Schaben unserer Holzskier in der sonst kaum begangenen Schneespur dicht hinter seinem Haus hören mußte, hat er sich nie nach uns umgedreht. Tatsächlich haben wir Heidegger in all den Jahren nicht ein einziges Mal von vorn gesehen und nie einen Gruß mit ihm gewechselt.
Von vorn sah ich ihn erst, als ich in Freiburg zu studieren begann und eine seiner Vorlesungen hörte. Vom Eingang zur völlig überfüllten Halle des Audimax aus gesehen wirkte der kleine Mann noch kleiner. Ich hörte seinen getragenen, pausenreichen Singsang, aber ich verstand ihn nicht, wollte ihn auch nicht verstehen. Ich mochte die andachtsvolle Stille nicht, mochte seine substantivierten Verben und Adverbien nicht, mochte die priesterliche Tonart seines Vortrags nicht. Ich hatte das Gefühl, daß von mir, von jedem Zuhörer ein Unterwerfungsakt gefordert war; daß man sich kniefällig dem Neusprech dieses deutschen Geistesfürsten nähern mußte, um zu dem erlesenen Kreis derer zu gehören, die mit leuchtenden Augen behaupteten, ihn zu verstehen.
Obwohl ich – vor allem, weil er sich nie nach uns, seinen vorbeischlurfenden Nachbarn, umgedreht hatte – für jeden Einwand gegen Heidegger aufgeschlossen war, habe ich während meiner Studienzeit in Freiburg niemanden getroffen, der mich auf Heideggers Freiburger Rektoratsrede von 1933 und seine begeisterte Begrüßung des Naziregimes aufmerksam gemacht hätte. Ich fand nur Heidegger-Jünger, frisch Erweckte, die bereit waren, ihm auf seinen »Holzwegen« zu folgen.
Was ich hier schreibe, könnte den Eindruck erwecken, als hätte ich darunter gelitten, daß ich nicht schon als Halbwüchsiger in das deutsche Verbrechen an den Juden eingeweiht wurde. Noch bis vor kurzem hätte ich ohne den geringsten Zweifel die folgende Szene beschrieben: Wie unsere Klasse in die Turnhalle kommandiert wurde, wie dort von einem schabenden Projektor ein stark flimmernder Schwarzweißfilm über das Vernichtungslager Bergen-Belsen auf eine handtuchgroße Leinwand geworfen wurde, und wie entsetzt ich war, daß wir nach einem knappen Kommentar des Direktors wieder in unser Klassenzimmer marschierten und dort ein Gedicht von C.F. Meyer erörterten.
Diese Szene, die ich vor mir zu sehen glaube, verdankt sich offenbar einer jener Justierungen, die die Erinnerung an den Erfahrungen anbringt, um ihrem Träger moralische Pluspunkte zu verschaffen: wir – die unschuldigen, allein gelassenen Opfer, sie – die unfähigen Pädagogen und Verdränger. Offenbar hat diese Szene so nie stattgefunden, jedenfalls nicht während meiner Schulzeit. Keiner der Klassenkameraden, die ich befragt habe, bestätigt sie. Also muß ich schließen, daß ich ein späteres Erlebnis in die Schulzeit zurückprojiziert habe.
Nur einmal habe ich zu Hause – nach einem Hausmusikkonzert am Sonntag, bei dem ich die zweite Geige spielte – eine peinliche Frage gestellt. Der erste Geiger des Quartetts war ein Psychiatrieprofessor, der weniger durch sein Spiel als durch sein teures Instrument – eine Stradivari – einen starken Eindruck in mir hinterlassen hat. Einmal hatte ich seine Geige in der Hand halten und ein paar Läufe und Akkorde darauf spielen dürfen. Beim Tee nach dem Konzert nahm der Professor einen Apfel aus der Schale, biß hinein und gab dann die folgende Geschichte zum besten: Während eines sonntäglichen Spaziergangs habe er sich, einer alten, in den Hungerjahren der Nachkriegszeit erworbenen Gewohnheit folgend, nach dem Fallobst unter einem Apfelbaum gebückt. Er sei erschrocken, als er von einer Stimme, deren Besitzerin er nicht ausmachen konnte, mit seinem Namen und Titel angerufen wurde. Im Wipfel des Apfelbaums habe er schließlich eine ältere Frau entdeckt, die ihm heftig zuwinkte. Erst als die Frau herabgeklettert sei, habe er seine ehemalige Hausangestellte wiedererkannt. Sie habe seine Hand ergriffen und nicht mehr losgelassen. Endlich einmal müsse sie ihm sagen, so habe sie unter vielen rührenden, wenn auch wirren Dankesworten hervorgebracht, wie tief sie ihm verpflichtet sei. Denn in den »schlimmen Jahren« habe er, damals Arzt in der psychiatrischen Heilanstalt Emmendingen, ihr das Leben gerettet. Er habe ihr einen »Persilschein« über ihre geistige Gesundheit ausgestellt und sie damit vor dem sicheren Tod bewahrt.
Das »Ulkige« an der Szene sei gewesen, fuhr der immer noch Apfel essende Erzähler fort, daß er sich an das fragliche, nach damaligen Maßstäben sicher falsche Gutachten, mit dem er seinen Ruf als Psychiater aufs Spiel gesetzt hatte, gar nicht mehr erinnern konnte. Man habe so vieles unterschrieben und versucht, eine irgendwie noch mögliche Balance zu halten – niemand, der die Zeit nicht miterlebt habe, könne sich eine Vorstellung von den Zwängen machen, unter der die Ärzte damals standen. »Aber solche schönen Überraschungen«, schloß er seine Geschichte, die er sichtlich nicht zum ersten Mal preisgab, »können einem passieren, wenn man einen Apfel klaut!«
In das anschließende Schweigen hatte ich hineingefragt: »Und wie viele Patienten haben Sie damals nicht gesund geschrieben?«
Halblaut wies mein Vater mich zurecht: »Hast du eigentlich kein anderes Thema im Moment?«
Der Wahrheit am nächsten kommt wohl der Befund, daß wir, die Schüler des Bertholdgymnasiums, über die »dunklen Jahre« wenig wußten und auch nicht viel darüber wissen wollten. Wir vermißten dieses Wissen nicht. Erst der Eichmannprozeß in Jerusalem und der nachfolgende Auschwitzprozeß in Frankfurt öffneten mir die Augen. Danach war die Welt nicht mehr dieselbe.
6
Vielleicht hätte ich meine Frage an den ersten Geiger unseres Quartetts nicht gestellt, wäre ich nicht ein regelmäßiger Besucher im »Hexenhaus« in der Stadtstraße gewesen. Haus und Garten wirkten wie ein trotziger Gegenentwurf zu den Villen der Nachbarschaft mit ihren wie mit dem Lineal gezogenen und von Unkraut befreiten Blumenbeeten. Der Garten des »Hexenhauses« sah aus wie ein verwilderter Friedhof. Zwischen den morschen und sich neigenden Holzzäunen standen hohe, moosbewachsene Bäume, von denen tote Äste herabhingen, die vom letzten oder vorletzten Sturm zerbrochen worden waren. An einem starken, noch intakten Ast baumelte eine von zerfaserten Seilen gehaltene Schaukel – ich habe nie jemanden darauf sitzen gesehen. Fast zu jeder Jahreszeit blühten in dem wilden Garten Blumen, aber das Gras wurde nicht geschnitten, die Gartenmöbel nicht untergestellt und nicht repariert. Wenn man auf dem Kiesweg zur Veranda der verfallenen Villa ging, vorbei an dem von Wind und Regen zerfressenen Liegestuhl, vorbei an dem verrosteten, im Garten abgestellten Fiat Topolino, konnte man aus den offenen Souterrainfenstern die glitzernden Arpeggios einer Gitarre hören. Thomas, Hexes halbwüchsiger Sohn, übte mit gleicher Leidenschaft Flamenco, klassische Gitarre und Beatmusik.
Auf der Veranda saß im Sommer seine jüngere Schwester Petra, die mit den Beinen auf dem Beistelltisch vor ihr in einem Cartoonheft oder einer Zeitschrift blätterte – ein wildes Kind mit Busen, das nicht aufsah, wenn man zur Tür ging und nach seiner Mutter fragte.