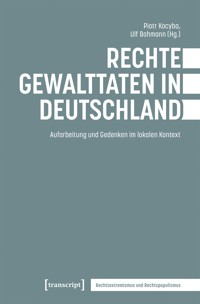
Rechte Gewalttaten in Deutschland E-Book
0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: transcript Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Rechtsextremismus und Rechtspopulismus
- Sprache: Deutsch
NSU, Halle, Hanau und mehr – politische Morde mit rechtsextremem Hintergrund sind von beängstigender Gegenwart in der bundesdeutschen Geschichte. Dabei handelt es sich keinesfalls um Einzelfälle, vielmehr sind sie in einen größeren Kontext rechter Gewalttaten wie etwa der Brandanschläge von Solingen eingebettet. Wie kann und sollte die demokratische Gesellschaft auf lokaler Ebene damit umgehen? Was wurde aus der deutschen Geschichte gelernt und wo greift die Aufarbeitung noch zu kurz? Die Beiträge bieten dazu exemplarische und prinzipielle Ansätze aus interdisziplinärer Sichtweise und eröffnen so kritische Perspektiven auf die heutige Gedenkarbeit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 335
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
This open access publication was enabled by the support of POLLUX – Informationsdienst Politikwissenschaft
and a network of academic libraries for the promotion of the open-access-transformation in the Social Sciences and Humanities (transcript Open Library Community Politik 2024).
Vollsponsoren: Technische Universität Braunschweig | Carl von Ossietzky-Universität Oldenburg | Eberhard-Karls Universität Tübingen | Freie Universität Berlin – Universitätsbibliothek | Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen | Goethe-Universität Frankfurt am Main | Gottfried Wilhelm Leibniz Bibliothek – Niedersächsische Landesbibliothek | TIB – Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften und Universitätsbibliothek | Humboldt-Universität zu Berlin | Justus-Liebig-Universität Gießen | Universitätsbibliothek Eichstätt-Ingolstadt | Ludwig-Maximilians-Universität München | Max Planck Digital Library (MPDL) | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | Ruhr- Universität Bochum | Staats- und Universitätsbibliothek Carl von Ossietzky, Hamburg | SLUB Dresden | Staatsbibliothek zu Berlin | Bibliothek der Technischen Universität Chemnitz | Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt | Universitätsbibliothek „Georgius Agricola“ der TU Bergakademie Freiberg | Universitätsbibliothek Kiel (CAU) | Universitätsbibliothek Leipzig | Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf | Universitäts- und Landesbibliothek Münster | Universitäts- und Stadtbibliothek Köln | Universitätsbibliothek Bielefeld | Universitätsbibliothek Erfurt | Universitätsbibliothek der FernUniversität in Hagen | Universitätsbibliothek Kaiserslautern-Landau | Universitätsbibliothek Kassel | Universitätsbibliothek Osnabrück | Universität Potsdam | Universitätsbibliothek St. Gallen | Universitätsbibliothek Vechta | Zentralbibliothek ZürichSponsoring Light: Bundesministerium der Verteidigung | Bibliothek der Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden | Bibliothek der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig | Bibliothek der Westsächsischen Hochschule Zwickau | Bibliothek der Hochschule Zittau/Görlitz, Hochschulbibliothek | Hochschulbibliothek der Hochschule Mittweida | Institut für Auslandsbeziehungen (IfA) | Landesbibliothek Oldenburg | Österreichische ParlamentsbibliothekMikrosponsoring: Bibliothek der Berufsakademie Sachsen | Bibliothek der Evangelische Hochschule Dresden | Bibliothek der Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig | Bibliothek der Hochschule für Bildende Künste Dresden | Bibliothek der Hochschule für Musik „Carl Maria von Weber“ Dresden | Bibliothek der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig | Bibliothek der Palucca-Hochschule für Tanz Dresden | Leibniz-Institut für Europäische Geschichte | Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) – Deutsches Institut für Internationale Politik und Sicherheit
Piotr Kocyba, Ulf Bohmann (Hg.)
Rechte Gewalttaten in Deutschland
Aufarbeitung und Gedenken im lokalen Kontext
Diese Maßnahme wird mitfinanziert durch Steuermittel auf Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushaltes.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.dnb.de/ abrufbar.
Dieses Werk ist lizenziert unter der Creative Commons Attribution 4.0 Lizenz (BY). Diese Lizenz erlaubt unter Voraussetzung der Namensnennung des Urhebers die Bearbeitung, Vervielfältigung und Verbreitung des Materials in jedem Format oder Medium für beliebige Zwecke, auch kommerziell. (Lizenztext: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de)
Die Bedingungen der Creative-Commons-Lizenz gelten nur für Originalmaterial. Die Wiederverwendung von Material aus anderen Quellen (gekennzeichnet mit Quellenangabe) wie z.B. Schaubilder, Abbildungen, Fotos und Textauszüge erfordert ggf. weitere Nutzungsgenehmigungen durch den jeweiligen Rechteinhaber.
2024 © Piotr Kocyba, Ulf Bohmann (Hg.)
transcript Verlag | Hermannstraße 26 | D-33602 Bielefeld | [email protected]
Umschlaggestaltung: Maria Arndt
Druck: Elanders Waiblingen GmbH, Waiblingen
https://doi.org/10.14361/9783839472385
Print-ISBN: 978-3-8376-7238-1 | PDF-ISBN: 978-3-8394-7238-5 | ePUB-ISBN: 978-3-7328-7238-1
Buchreihen-ISSN: 3052-542X | Buchreihen-eISSN: 3052-5438
Inhalt
Rechte Gewalttaten in DeutschlandPiotr Kocyba/Ulf Bohmann
I.Grundlagen des Gedenkens: Theoretische Ansätze und historische Kontexte
Überlegungen zum Gedenken an die Opfer rechter Gewalttaten im Kontext des Gedenkens an die Opfer der nationalsozialistischen VerbrechenSarah Kleinmann
Erinnern und Vergessen als Praktiken der Unterdrückung und ErmächtigungTanja Thomas/Fabian Virchow
Wahrheitsfindung im Kontext von rechtem TerrorEine Spurensuche in gesellschaftlichen Arenen der AufarbeitungHannah Zimmermann
Erstes Gespräch: Die rechtliche Perspektive
»Sobald jemand nicht einem Klischee-Skinhead-Look mit Springerstiefeln und Hakenkreuzbinde entspricht, dann scheint es schwer, eine rechte Tatmotivation zu erkennen.«Im Gespräch mit Björn ElberlingPiotr Kocyba/Ulf Bohmann
II.Stadtgesellschaft und Aufarbeitung: Dynamiken der lokalen Gedenkarbeit
Antirassistische Erinnerung als Instrument zur Demokratisierung?Çağrı Kahveci
Halle im HerbstKontroversen und Spannungsfelder im Umgang der lokalen Stadtgesellschaft mit dem rechtsterroristischen Anschlag vom 9. Oktober 2019Tobias Johann
Zweites Gespräch: Die journalistische Perspektive
»Ja also jetzt kommt auch noch die Presse. Das ist ein solcher Imageschaden. Ihr berichtet immer nur das Negative.«Im Gespräch mit Annette RamelsbergerPiotr Kocyba/Ulf Bohmann
III.Spurensuche: Persönliche Erinnerungen und lokale Narrative
Der NSU als biographischer KomplexEpistemische Folgen persönlichen VerstricktseinsAlexander Leistner
Das Gras, das einfach nicht über die Sache wachsen willChristian Nicolae-Gesellmann
Drittes Gespräch: Die Betroffenenperspektive
»Man verschließt gerne die Augen davor, es würde aber reichen, einfach die Augen zu öffnen, um das Problem deutlich zu erkennen.«Im Gespräch mit Semiya ŞimşekPiotr Kocyba/Ulf Bohmann
IV.Zivilgesellschaft im praktischen Erinnerungsprozess: Aufarbeitung und Zukunft des Gedenkens
Die Rolle von Geschichtswerkstätten in der Aufarbeitung der NSU-Täter*innengesellschaftDanilo Starosta
Zivilgesellschaft unter DruckDie Rolle der Zwickauer Zivilgesellschaft bei der Entwicklung einer würdevollen Gedenkkultur und der Verteidigung einer offenen GesellschaftJörg Banitz
Re:member the futureDie Imagination eines Gedenkortes in ChemnitzArlo Jung
Autor*inneninformationen
Rechte Gewalttaten in Deutschland
Piotr Kocyba/Ulf Bohmann
Die mehrjährige Mordserie des NSU ab 2000, das Oktoberfestattentat 1980, die Ausschreitungen in Rostock-Lichtenhagen und Hoyerswerda, die Brandanschläge von Mölln und Solingen Anfang der 1990er, die Terroranschläge von Halle 2019 und Hanau 2020, und erschreckend viele mehr – das ist der phänomenbezogene Ausgangspunkt der vorliegenden Publikation. Auf den ersten Blick erscheint der Titel dieses Bandes dabei selbsterklärend: einerseits haben wir ein unmittelbares, intuitives Verständnis, was »rechte Gewalttaten« sind. Und in gewisser Weise sind wir sie andererseits, so absurd es klingen mag, in Deutschland längst gewohnt – es handelt sich nicht um ein völlig neues, überraschendes Phänomen (Mayer 2013). Meist genügt bereits die Nennung des Tatortes, um die kollektive Erinnerung zu mobilisieren. Es ist mithin vielmehr die – möglicherweise bereits zunehmende – Gewöhnung an das Unbegreifliche, die Fragen aufwirft. In diesem Band werden wir jedoch nicht zuvorderst jene zweifelsfrei wichtige Perspektive einnehmen, wie man rechte Gewalttaten heute individuell oder strukturell beschreiben und erklären kann. Im Mittelpunkt wird stattdessen die Frage stehen, wie gesellschaftlich mit ebenjenen Taten umgegangen wird, umgegangen werden kann und vielleicht auch umgegangen werden sollte, nachdem sie geschehen sind. Mithin geht es zentral um aktuellere Gedenkarbeit, gelungene wie gescheiterte. So wie sich der gewaltförmige Rechtsextremismus in Deutschland im Verlauf der Jahrzehnte gewandelt hat, so haben sich auch die bundesweiten wie lokalen Reaktionen auf Attentate, Brandanschläge oder Morde verändert. Es gehört wohl zu den wesentlichen Erfolgen der gesellschaftspolitisch ausgerichteten Gedenkarbeit der jüngsten Vergangenheit, meist getragen von zivilgesellschaftlichen Initiativen, dass Strategien des Verschweigens oder der Entpolitisierung rechter Gewalttaten wie auch ein überbordender Fokus auf die Täter*innen, der die Betroffenen und ihre Stimmen marginalisiert, zunehmend unhaltbar geworden sind.
Mit dem vorliegenden Band wird das Ziel verfolgt, diese gesellschaftlichen Lernprozesse zu konsolidieren. Dabei werden wissenschaftliche Erkenntnisse und Positionen aus verschiedenen akademischen Disziplinen mit praktischem Erfahrungswissen in Verbindung gebracht, sei es aus der politischen Bildung, dem Journalismus, der rechtsstaatlichen Aufarbeitung oder der Betroffenensicht. In einigen Beiträgen dieses Bandes werden zudem auch bewusst solche Bereiche beschritten, die sich dieser scheinbar klaren Unterscheidung widersetzen, in denen es also gezielt zu Überschneidungen dieser nicht immer säuberlich oder zielführend zu trennenden Ausrichtungen kommt. In der Summe soll damit ein Schritt im (oder vielmehr hin zu einem) bislang noch allzu unklar konturierten Feld der sozial-, geschichts- und kulturwissenschaftlich und zugleich gesellschaftspolitisch informierten zeitgenössischen Gedenkarbeit beschritten werden.
Um diesen Schritt gehen zu können, bedarf es vorab jedoch deutlicherer begrifflicher Abgrenzungen. Denn auch wenn man als heute lebende*r und medial mindestens in Grundzügen unterrichtete*r Bürger*in der Bundesrepublik Deutschland intuitiv eine allgemeine Vorstellung vom hier interessierenden Thema haben mag, ist eine genauere analytische Bezeichnung alles andere als trivial. Den hier ins Visier genommenen Phänomenen und Zusammenhängen geht nämlich entweder (und meistens) ein erhebliches Maß an einschlägiger Forschung voraus, der gegenüber sich zumindest grob zu verhalten ist; oder es mangelt umgekehrt noch an handfesteren Wegmarkierungen. Nicht zuletzt nehmen wir eine notwendige Auswahl und Schwerpunktsetzung in zeitlicher, thematischer und regionaler Hinsicht vor – eine wirklich systematische und repräsentative Bündelung bleibt ein wissenschaftliches wie politisches Desiderat für die hoffentlich nicht allzu ferne Zukunft.
Konkret gilt es also, folgende begriffliche Problemkomplexe zum Thema rechte Gewalttaten zu befragen: (1) Welches Verständnis von »Rechtsextremismus« wird zugrunde gelegt? (2) Was wird überhaupt unter »Gewalt« verstanden? (3) Welche spezifische Verbindung aus beiden Begrifflichkeiten wird adressiert? (4) Was meint »Gedenken«? (5) Was ist die zeitliche Begrenzung und welche »lokalen Kontexte« werden dabei hervorgehoben?
1.Rechtsextremismus
Die ursprüngliche politische Zuschreibung als »rechts« geht auf eine historische Sitzordnung im französischen Parlament zurück und hat sich, auch wenn es teilweise noch zutrifft, längst verselbständigt. Als orientierende Abkürzung ist sie gleichwohl unvermindert aktuell und hochgradig geläufig. Für die Parteienlandschaft sind damit bisweilen konservative Positionen mitgemeint (typischerweise als »Mitte-rechts«), im hier interessierenden Verständnis geht es jedoch um deutlich darüberhinausgehende Einstellungen, die nur bei verharmlosenden Absichten noch einem vermeintlich besorgten Bürgertum zugesprochen werden (Kocyba 2016). Wie diese genau zu bezeichnen sind, ist ebenso stark diskutiert wie umstritten. Während mit »Rechtsradikalismus« meist etwa im Sinne des Verfassungsschutzes eine stark übersteigerte, aber vermeintlich noch legitime Position gemeint ist, bezeichnet »Rechtsextremismus« ein klares und intolerables Überschreiten der demokratischen Ordnung. Als typischer Inhalt fungiert eine (rassistische, homophobe, misogyne etc.) Ungleichwertigkeitsideologie in Verbindung mit (meist aggressivem) Autoritarismus, (im deutschen Fall geschichtsrevisionistischem) Nationalchauvinismus und (häufig homogenitätsfixiertem) Antipluralismus; weitere familienähnliche oder anschlussfähige Elemente treten je nach Definition beziehungsweise Erkenntnisinteresse und Stoßrichtung hinzu. Überzeugende Konzepte aus Sozialwissenschaft und politischer Bildung sind zahlreich (etwa Rippl/Seipel 2022, Salzborn 2020 oder Virchow 2017), gleichwohl bleibt eine Vielzahl an Herausforderungen bestehen (Quent et al. 2025). Teilweise wird der Begriff in der politischen wie sozialwissenschaftlichen Debatte aber auch gemieden – nicht wegen »Rechts«, sondern wegen des »Extremismus«: Um die sogenannte »Extremismustheorie« (Backes/Jesse 1993), die verbindende Elemente (wie Staatsferne und Distanz zu einer als demokratisch kategorisierten »Mitte«) zwischen Rechtsextremismus, Linksextremismus und Islamismus betont, gibt es sehr kontroverse Diskussionen, wird der Begriff mitunter als »extrem unbrauchbar« abgelehnt (Berendsen/Uhlig/Rhein 2019; ausführlicher zur Vermessung des Extremismusbegriffes siehe Ackermann et al. 2015). Entsprechend wird zum einen die Umkämpftheit des Begriffes selbst zum Thema (Grimm 2018), zum anderen eine Umgehung über »extrem rechts« gewählt (etwa Schmidt-Kleinert/Siegel/Birsl 2019, Demirtas et al. 2023, Bohmann/Heinrich/Sommer 2024) – oder wie im englischsprachigen Diskurs aufgrund der Überlappung unterschiedlichster politischer »äußerst rechter« Strömungen für den Begriff »far right« plädiert (so etwa Pirro 2022). Für den vorliegenden Band werden wir diese Debatte nicht weiter aufgreifen, sondern aufgrund der hohen Verbreitung und Verständlichkeit synonym von »rechter«, »extrem rechter« und »rechtsextremer« Gewalt sprechen, wenn es um die spezifischen politischen Hintergründe geht – dabei aber explizit kein Verständnis von der »äußersten Rechten« im Sinne einer mechanistisch verstandene Extremismustheorie verstetigen.
2.Gewalt
In der elaborierten sozialwissenschaftlichen Gewaltforschung – seit den sogenannten »Innovateur*innen der Gewaltforschung« – wird in der Regel sowohl begrifflich extensiv als auch normativ enthaltsam gearbeitet. Im Vordergrund steht dabei das reflexive Erkenntnisinteresse, genau was von genau welchen Akteur*innen überhaupt als Gewalt gerahmt und bezeichnet wird (Barth et al. 2021, Nedelmann 1997, Staudigl 2015). Teilweise als Voraussetzung für diese Orientierung, teilweise als Konsequenz daraus, besteht ein Großteil der Gewaltforschung darin, sie entweder an einem weiten Gewaltverständnis auszurichten, das etwa symbolische (Bourdieu 2013), strukturelle (Galtung 1975) oder epistemische Gewalt (Brunner 2020) umfasst. Demgegenüber schließt dieser Band – auch wenn es gute Gründe für eine Kritik an der Unterscheidung geben mag (etwa Imbusch 2002, Endreß 2014) – vordringlich an einem engeren, substanzielleren, mithin auf physische Verletzung abhebenden Gewaltverständnis an (Collins 2008, Nunner-Winkler 2004). Noch einen Schritt weiter gehend fokussieren wir uns innerhalb des Gewaltbereiches insbesondere auf Fälle der intendierten Tötung. Dabei wird nicht systematisch danach sortiert, ob etwa bei Attentaten oder Anschlägen einzelne oder mehrere Menschen betroffen sind (beziehungsweise aus Perspektive der Verübenden betroffen sein sollen). Im Zentrum stehen aber simultane oder kombinierte Gewalttaten, sei es im Zuge eines einzigen Aktes, oder mehrerer in unmittelbarem – etwa als Mordserie sequentiellem – Zusammenhang stehender Handlungen. Typischerweise kommen gravierende Gewalttaten nicht aus dem Nichts, sondern sind in psychologischer, sozialer, institutioneller, politischer oder diskursiver Hinsicht meist in größere Gewaltkontexte eingebettet. So geht etwa terroristischen Akten in der Regel bereits kommunikative Gewalt voraus und wird durch selbige häufig maßgeblich beeinflusst, in ihrem Zustandekommen wahrscheinlicher oder überhaupt erst motiviert. So bedeutend dieser vorausgehende Kontext auch ist, wird im vorliegenden Band zum einen auf die gravierende Gewalttat selbst, und zum anderen auf nachfolgende gekoppelte Gewaltformen fokussiert – zu denken ist hier typischerweise an die sogenannte sekundäre Viktimisierung (Quent/Geschke/Peinelt 2014), bei der Betroffene der ursächlichen Gewalttaten durch unterlassene Anerkennung oder gar falsche Beschuldigungen erneutes Leid erfahren und dadurch gewissermaßen ein zweites Mal zum Opfer gemacht werden. So erfahren viele Überlebende von Gewalt oder deren Angehörige nach einer Tat in solchen Fällen Verharmlosung, Nichtbeachtung, Leugnung und/oder weitere Benachteiligung durch ihr unmittelbares soziales Umfeld, die gesellschaftliche Öffentlichkeit und/oder staatliche Institutionen (aus der Perspektive der Betroffenen selbst siehe Semiya Şimşek in diesem Band). Insofern gilt der Umgang von Polizei, Justiz, Behörden, Medien und Politik mit den Betroffenen auch als Spiegelbild, welchen Stellenwert eine Gesellschaft dem Schutz von gewaltbezogenen Grund- und Menschenrechten im Allgemeinen und der direkten oder indirekten Opfer im Besonderen einräumt.
3.Verknüpfungen von »rechts« und »Gewalt«
Der Fokus dieses Bandes liegt auf der spezifischen Verbindung von Rechtsextremismus und Gewalt im soeben skizzierten Verständnis. Damit erlangen entsprechende Gewalttaten eine doppelte politische Dimension, und zwar sowohl in ihrer charakteristischen Eigenheit als auch im zusätzlichen Anforderungsprofil und Gebot des Umgangs mit ihnen. Während letzteres im nachfolgenden Abschnitt unter dem Stichwort »Gedenken« adressiert wird, steht nun zunächst ersteres im Vordergrund.
Dabei kann man zweistufig vorgehen und sich einerseits am grundlegenden Verständnis einer politischen Tötung beziehungsweise eines politischen Mordes (hier nicht weiter differenziert) orientieren. Ein Mord ist naheliegenderweise dann entsprechend einzustufen, wenn der Akt auf spezifisch politische Motive zurückgeht. Damit ist im Allgemeinen gemeint, entweder eine gewünschte Einflussverringerung abgelehnter politischer Akteur*innen oder eine wie auch immer gestaltete politische Veränderung zu erzeugen. Spezieller lassen sich die Motivationen eines politischen Mordes insbesondere wie folgt unterscheiden: 1. Tötung aufgrund tatsächlicher oder unterstellter divergenter politischer Einstellungen. 2. Tötung aufgrund tatsächlicher oder unterstellter Zugehörigkeit (etwa ethnische Zugehörigkeit, Parteizugehörigkeit etc.). 3. Tötung zur Verringerung des Einflusspotenzials von Akteur*innen, die als Bedrohung eigener Zielsetzungen betrachtet werden. 4. Tötung, um ein Abschreckungspotenzial für andere Akteur*innen zu erzeugen. Einzelne Motivationen können simultan auftreten (Lange 2007). Ein aktuelleres Beispiel hierfür wäre der Mord am Kasseler Bezirksregierungspräsidenten Walter Lübcke 2019 aufgrund einer vermeintlich zu affirmativen Haltung und zu entgegenkommenden Maßnahmen gegenüber geflüchteten Menschen (dazu etwa Steinhagen 2021), wobei in diesem Fall bereits eine bestimmte Verknüpfung einiger der genannten Motivationen offenkundig eine Rolle gespielt haben dürfte.
Andererseits, und besonders einschlägig im Zusammenhang dieses Bandes, werden politische Tötungen mit spezifisch rechtsextremem Hintergrund in der Regel als »Rechtsterrorismus« bezeichnet. Viele Bestimmungen des politischen Mordes gelten hier analog, wobei typischerweise der Aspekt der Gewaltkommunikation – konkret die Verbreitung von Angst und Schrecken bei entsprechenden Bevölkerungsgruppen und politischen Gegnern – besonders deutlich hervortritt. Häufig ist Rechtsterrorismus dabei umfassender angelegt, insofern es um mehrere Ziele geht, sowohl was die Qualität (etwa in Form von materieller Umwelt wie bestimmten Einrichtungen) als auch die Quantität (der betroffenen Menschen) anbelangt.
Eine einheitliche Definition zum Begriff »Rechtsterrorismus« existiert aufgrund mannigfaltiger Perspektiven und Auslegungen nicht. Nicht zuletzt daher die Bezeichnung als »Blackbox« (Schmidt-Kleinert/Siegel/Birsl 2019). Im Sinne von Schedler (2021) hat Rechtsterrorismus insbesondere Symbolcharakter, wobei zwar die Tötung von Menschen in geplanter (also nicht spontaner) Weise entweder beabsichtigt oder gebilligt wird, aber stets über die konkreten Opfer hinaus auf eine indirekte Zielgruppe gerichtet ist. Die Gewalt kann dabei durch individuelle oder kollektive Akteure organisiert werden. Rechtsterrorismus verfolgt im Wesentlichen das Ziel, Emotionen auszulösen und Akteur*innen zu affektiven Reaktionshandlungen zu treiben. Typische Motive sind Einschüchterung, Vertreibung, Bestrafung und Konflikteskalation (Virchow 2021). Zum Bereich des Rechtsterrorismus gibt es zahlreiche sozialwissenschaftliche Publikationen (etwa Puls/Virchow 2023, Quent 2022, Schedler 2021, Gräfe 2017, Nobrega/Quent/Zipf 2021). Die Forschung deckt dabei bereits ein breites Spektrum ab und zielt in einer erweiterten Perspektive jenseits einzelner Fälle von der Herausarbeitung historischer Kontinuitäten (Waibel 2022) über die Modellierung neuer Wellen (Fürstenberg 2023) bis hin zur Problematisierung einer Dethematisierung rechten Terrors (Salzborn 2022). Darüber hinaus gibt es mehrere Sachbücher zu rechtem Terror (etwa Sundermeyer 2012, Wenzel/Rosenzweig/Eith 2015), die sich an ein breiteres Publikum wenden und die gesamtgesellschaftliche Bedeutung zusätzlich unterstreichen.
Gleichwohl ist die Einordnung konkreter Fälle als extrem rechte Gewalt kein Automatismus, weder in behördlicher, medialer, noch sozialwissenschaftlicher Hinsicht, was auch die beiden in diesem Band abgedruckten Interviews mit dem Rechtsanwalt Björn Elberling und der Journalistin Annette Ramelsberger thematisieren. Im Hinblick auf die angemessene Einschätzung »unproblematisch« ist allen voran der NSU, da einschlägig bekannte Akteur*innen unmissverständliche Selbsteinordnungen und dezidierte Propaganda vorgenommen haben. Ähnliches gilt etwa für die eindeutig rechtsextrem motivierten Anschläge in Norwegen – insbesondere Utøya – 2011. In den eingangs genannten Fällen wird es auch keine ernsthaften Zweifel an der Einordnung geben. Bisweilen ändern sich aber Einschätzungen, etwa beim tödlichen Anschlag (mit mehreren weiteren Verletzten) im Münchner OEZ 2016 auf neun junge Menschen mit Migrationshintergrund durch einen Deutsch-Iraner. Während etwa die Staatsanwaltschaft und die Polizei noch 2017 von einem psychisch bedingten, unpolitischen Amoklauf ausgingen, änderte sich die Einstufung durch mehrere Behörden als gesichert rechtsextrem in den Jahren 2018 und 2019. Ein aktuelleres Beispiel ist der Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg 2024, bei dem eine deutlich artikulierte rechtsextreme Gesinnung des Täters vielfach dokumentiert ist. Bezeichnenderweise wurde im politischen Diskurs seitens der AfD aufgrund der Migrationsgeschichte des Täters – und trotz erklärter starker Sympathien des selbigen für die AfD – robust migrationsfeindlich mobilisiert.
Bei allen in diesem Band verhandelten Fällen ist die Einordnung in den rechtsextremen Kontext mittlerweile unbestritten, aber auch hier zeichnete sich immer wieder ein Ringen um die angemessene Bezeichnung auf vielen Ebenen ab.
4.Aufarbeitung und Gedenken
Der Fokus dieses Bandes liegt auf dem Umgang mit rechten Gewalttaten. Die Perspektive ist mithin zeitlich am »Danach« ausgerichtet, nicht an den vor den Taten liegenden und diese ermöglichenden oder unterstützenden Strukturen, Einstellungen, Diskursen oder Ereignissen – auch wenn die Thematisierung des die Taten ermöglichenden »Davor« insbesondere von den Betroffenen und mit ihnen solidarischen Aktivist*innen, »danach« vehement eingefordert wird. Hierzu gibt es wichtige Wortmeldungen (Steinbacher 2016) und Forschungsbeiträge, um die es im Folgenden aber nicht vordringlich gehen soll. Erinnern ist zwar stets auch als Arbeit an »Vergangenheitskonstruktionen« (Gardei/Soeffner/Zabel 2023) zu verstehen, aber auch diese sind den jeweiligen Ereignissen nachgelagert. Entscheidend ist, dass es um die Rolle der Gegenwärtigkeit geht. Schon Walter Benjamin (2010[1940]) betonte mit seinem Begriff des »Eingedenkens«, dass der Vergangenheit unversöhnlich gegenüberzustehen sei, womit er sich von einer verklärenden, die Vergangenheit ruhen-lassenden Erinnerung scharf abgrenzte. Mit der Perspektivenentscheidung ist dabei weder vorgezeichnet, auf welcher Ebene – politisch, kulturell, medial, institutionell, bildungsbezogen und vieles mehr – agiert werden kann oder soll, noch wer die – unter anderem staatlichen, zivilgesellschaftlichen, betroffenen – Akteur*innen des Umgangs sind. Vor allem aber, und hier scheint sich in konzeptuell-theoretischer Hinsicht eine sozial- und kulturwissenschaftliche Forschungslücke aufzutun, scheint chronisch vage wie umstritten, welche Art des Umgangs eigentlich gemeint ist. So verändern sich die Ansatzpunkte, Ausrichtungen und Zielstellungen massiv, je nachdem, von welchem Begriff ausgegangen wird – gesellschaftlich wie kultur- und sozialwissenschaftlich: Es macht mitunter einen gravierenden Unterschied, ob allgemein von »Gedenken«, »Erinnerung«, »Aufklärung«, »Trauer«, »Vergangenheitsbewältigung«, »Aufarbeitung« oder auch spezifisch zukunftsorientiert von »demokratischer Bildung«, »rassismuskritischer Präventionsarbeit« oder »zivilgesellschaftlichem Resilienzaufbau« die Rede ist – ohne das unbedingt im Einzelnen klar umrissen und eindeutig ist, was diese Begriffe für sich jeweils bedeuten können oder sollen (hierzu am Beispiel Halles ausführlich der Beitrag von Tobias Johann). Während die spezifischeren Begriffe oft nicht hinreichend die in den gegebenen Fällen adressierten Fragen in ihrem Zusammenhang erfassen, sind umgekehrt viele der allgemeineren Begriffe gerade in der Forschungsliteratur oft von bestimmten (etwa psychologischen) Fachzugriffen, von bestimmten Gegenständen (etwa sexueller Missbrauch) oder von bestimmten, weiter zurückliegenden historischen Phasen (in Deutschland insbesondere die Zeit des Nationalsozialismus) dominiert. Für die uns hier interessierenden Kontexte rechter Gewalt in der jüngeren Vergangenheit scheint es hingegen in puncto faktischer oder wünschenswerter Umgangsweisen einen gewissen Mangel zu geben. Die Forschungsliteratur dazu erstreckt sich weitgehend auf Einzelaspekte wie Strafverfolgung als Prävention (Lüttig/Lehmann 2020). Im Folgenden geht es uns also darum, hierzu einen Beitrag zu leisten. Der Fokus liegt dabei konstruktiv auf gelingenden oder besseren Umgangsweisen. Ziel ist also weniger die Darstellung gescheiterter, problematischer oder selbst diskursiv gewaltförmiger Umgangsweisen (siehe etwa oben: sekundäre Viktimisierung), auch wenn diese als Kontrastfolie immer wieder aufgerufen werden. Dezidiert gar nicht geht es um das an sich ebenfalls sehr aufschlussreiche Feld der Erinnerungspolitik der extremen Rechten, etwa nach dem Motto »Opa war in Ordnung« (Killguss/Langebach 2016).
Mit der verknüpfenden Bezeichnung »Aufarbeitung und Gedenken« haben wir uns im Untertitel für ein Spektrum entschieden, das sowohl eine politisch aktive und gesellschaftlich selbstkritische Rolle nahelegt, als auch den Wünschen und Forderungen der Betroffenen rechter Gewalt angemessenen Raum geben soll. In den letzten Jahren beobachten wir insgesamt eine Verschiebung des Fokus weg von den Täter*innen rechter Gewalt und hin zu den Betroffenen (siehe dazu theoretisch reflektiert die beiden Beiträge von Tanja Thomas/Fabian Virchow und Hannah Zimmermann). Dabei sind sowohl deren Selbstbehauptungen, Wissensproduktionen und Forderungen gemeint, als auch die spezifischen Belastungen (ausführlich etwa zur biographischen Dauerkrise Betroffener: Kaya 2024). Somit wollen wir uns auf einem Pfad bewegen, der mit Aleida Assmann (2020) als »ethische Erinnerungskultur« beschrieben werden kann, die sich zuvorderst als kritische Auseinandersetzung aus der Perspektive der Betroffenen versteht.
Einen inhärenten Zusammenhang mit den erwähnten, hier aber nicht zentral gestellten Voraussetzungen und Ermöglichungsbedingungen rechter Gewalttaten gibt es gleichwohl trotzdem: Implizit zielt jede Art des Gedenkens, oder offener: des Umgangs mit entsprechenden Taten nicht allein auf ein Wachhalten, eine Bewahrung, eine Bewusstmachung der Vergangenheit, sondern notwendigerweise immer auch in präventiver Absicht auf die Zukunft – in aufbauender Absicht auf Früherkennungs-, Verhinderungs- und Widerstandskapazitäten, und in abbauender Hinsicht auf die genannten gesellschaftlichen Voraussetzungen (auch hierzu lohnt ein Blick in den Beitrag von Hannah Zimmermann).
5.Raumzeitlicher Kontext und Gegenstandsfokus
In diesem Band geht es, neben den beschriebenen inhaltlichen und gegenstandsbezogenen Varianzen, nicht um eine grundsätzliche beziehungsweise allgemeingültige Betrachtung rechter Gewalt per se, sondern um die Präsenzen und Effekte in einem bestimmten raumzeitlichen Ausschnitt. Obwohl weder Gewalttaten noch Rechtsextremismus – trotz typischerweise nationalistischen Hintergrunds – an nationalstaatlichen Grenzen haltmachen und nicht unbedingt von spezifischen nationalstaatlichen »Gewaltkulturen« ausgegangen werden kann, begrenzen wir uns auf die Bundesrepublik Deutschland (zu den Todesopfern rechter Gewalt in Deutschland siehe u.a. Billstein 2020). Noch genauer blicken wir, ähnlich anderer jüngerer Forschungsarbeiten (Mullis/Miggelbrink 2022), insbesondere auf das Lokale. Hierbei nehmen wir hauptsächlich einen Gegenwartsfokus ein, der um spezifische Vorgeschichten oder Vergleichsbeispiele der letzten Jahrzehnte erweitert wird. Im Vordergrund steht dabei die Gedenkarbeit im lokalen Kontext, das heißt konkrete Umgangsweisen in einzelnen Städten und Kommunen, nicht unbedingt die bundesdeutsche Erinnerungspolitik als solche (Steinbacher 2016). Um hierfür einen geeigneten historisch-räumlichen Rahmen zu bieten, wird die Perspektive eingangs durch zwei Beiträge (Sarah Kleinmann, Tanja Thomas/Fabian Virchow) erweitert, die einen Vergleich zur Gedenkarbeit in Bezug auf den Nationalsozialismus beziehungsweise eine Einordnung im nationalen und internationalen Kontext bieten. Die Hervorhebung des lokalen Kontextes in der Gedenkarbeit ist einerseits aus dem Umstand begründet, dass es hier in der Regel deutlich konkretere Maßnahmen und Beispiele gibt, die zudem meist unmittelbarer auf die soziale Umwelt wirken; andererseits sind hier spezifische Herausforderungen und Kämpfe gegeben – und nicht zuletzt teilweise direkte Bedrohungslagen durch die Verübenden oder Unterstützenden rechter Gewalttaten.
Aus einem in diesem Band gesetzten inhaltlichen Schwerpunkt auf den NSU, zu dem es mittlerweile eine besonders reichhaltige Forschungsliteratur gibt (etwa Schmincke/Siri 2013, Karakayalı et al. 2017, Quent 2022, Schedler 2021), erwächst zugleich ein regionaler Schwerpunkt auf entsprechende »Brennpunkte« (Garsztecki/Laux/Nebelin 2024, Brichzin/Bohmann/Laux 2022) in Südwestsachsen (insbesondere Zwickau und Chemnitz, die als Operationsbasen der Mordserie dienten und Unterstützungsnetzwerke boten sowie teilweise weiterhin bieten; aus unterschiedlichen Perspektiven mit verschiedenen Schwerpunkten hierzu siehe die Beiträge von Alexander Leistner, Christian Nicolae-Gesellmann, Danilo Starosta, Jörg Banitz und Arlo Jung). Um einen Abgleich mit anderen lokalen Umgangsweisen zu ermöglichen, wurden zudem Analysen über Halle (Beitrag TobiasJohann) und Solingen (Beitrag Çağrı Kahveci) aufgenommen.
Der Fokus auf die lokale Gedenkarbeit in Südwestsachsen steht zudem in einem doppelten organisatorischen Zusammenhang: Zum einen erfolgte der initiale Anstoß des Publikationsprojektes durch den Auftrag des Kulturamtes derStadt Zwickau und die Förderung des Sächsischen Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung (2019–2024) an die beiden Herausgeber dieses Bandes für die Erarbeitung einer Ausstellung mit dem Titel Zwickau und der NSU. Auseinandersetzung mit rechtsextremen Taten, die vom 1. September bis 4. November im Museum Priesterhäuser Zwickau gezeigt wurde. Zum anderen fand der diesem Band vorausgehende Autor*innenworkshop mit dem Titel »Rechte Gewalttaten in Deutschland. Gedenkarbeit zwischen Verdrängung, Aufarbeitung und Institutionalisierung« am 26. und 27. Oktober 2023 im Rathaus Zwickau statt und wurde vom Verein ASA-FF e.V., ebenfalls mit Mitteln des Sächsischen Staatsministeriums, gefördert.
6.Bandstruktur und Beiträge
Das Buch ist wie der eben erwähnte Autor*innenworkshop dezidiert dialogisch und multiperspektivistisch angelegt, weil auch die Aufarbeitung und das Gedenken an rechte Gewalttaten mehrstimmig vonstattengeht, gar nicht anders realisierbar wäre – deshalb kommen neben Forschenden auch Aktivist*innen zu Wort, deshalb wurden Interviews mit einer Betroffenen, einer Journalistin und einem Anwalt geführt. Bei den dementsprechend hier vor allem als Praxisexpert*innen fungierenden Beitragenden weisen wir jeweils vorab über eine kurze biographische Notiz auf den persönlichen Hintergrund hin. Der Aufbau des Bandes geht dabei vom Allgemeinen zum Spezifischen vor. Den ersten Abschnitt bilden drei Beiträge, die wissenschaftlich einen breiteren Rahmen zeichnen und den Hintergrund für die nachfolgenden Analysen liefern. Dann folgen zwei Artikel zu zwei verschiedenen Beispielen, wie Stadtgesellschaften mit dem »Erbe« rechts motivierter Anschläge umgehen, bevor eine Sektion zwei sehr persönliche Perspektiven auf Zwickau richtet, die Stadt, in der das Kerntrio des NSU die längste Zeit Unterschlupf und eine unterstützende Szene gefunden hat. Abgeschlossen wird das Buch durch drei aktivistische Perspektiven auf den Umgang mit dem NSU in Südwestsachsen. Die vier Abschnitte werden dabei von den drei Interviews separiert.
Der Band wird von einer Sektion (I) mit drei Texten eröffnet, die allgemeiner über die zentralen Fragestellungen der hier vorliegenden Publikation reflektieren. Den historischen Rahmen knüpft zum Auftakt Sarah Kleinmann, die das Gedenken an Opfer rechter Gewalt in Bezug mit dem Gedenken an die nationalsozialistischen Verbrechen stellt. Dabei zeigt sich nicht nur eine gewisse Gleichzeitigkeit, weil die »neue« rechte Gewalt bereits ab 1945 verübt wurde, zu einem Zeitpunkt also, während dem man um die Aufarbeitung und das Gedenken an die NS-Verbrechen erst zu ringen begann. Trotz dieser so früh einsetzenden Gewaltkontinuität und der daraus resultierenden Parallelität von Erinnerung an NS-Verbrechen und Zeug*innenschaft aktueller rechter Gewalt werden beide Phänomene in der Gedenkarbeit häufig als separate Sphären betrachtet – und das obschon von den »neuen« rechten Täter*innen der Bezug zum Dritten Reich teilweise sehr deutlich gemacht wird (zu denken sei etwa an die Selbstbezeichnung des NSU). Gründe für eine solche Separierung gibt es dennoch viele, wie etwa die gesellschaftliche Scheu davor, sich die nahtlose Fortsetzung rassistischer und antisemitischer Gewalt zuzugestehen. Wichtig ist hier, so Kleinmann, vor allem die Sorge davor, die NS-Verbrechen zu relativieren, die wegen ihres industriellen Charakters und dadurch, dass sie nicht von individuellen Akteur*innen oder Akteursnetzwerken, sondern vom Staat verübt wurden, ein Alleinstellungsmerkmal innehaben.
Trotz der Aufrechterhaltung dieser strikten Trennung gibt es weitere Parallelen, nicht nur in der ideologischen Motivation für die Gewalt, sondern auch im Verlauf der Etablierung der Erinnerung selbst. In beiden Fällen mussten Aufarbeitung und Gedenken gegen gesellschaftliche wie politische Widerstände durchgesetzt werden. Forciert wurde das Erinnern in beiden Fällen häufig »von unten«, durch Betroffene und ihre Mitstreiter*innen, die teilweise über Jahrzehnte beharrlich gegen das Weghören der Mehrheitsgesellschaft kämpfen mussten. Die Gründe hierfür sind recht ähnlich. So gab (und gibt!) es im Kontext der Etablierung des Gedenkens an die NS-Verbrechen eine Schuldabwehr, die teilweise mit einer Umkehrschuld einherging – ein gesellschaftlicher Reflex, den in diesem Band etwa Çağrı Kahveci für die rassistische Gewaltwelle der frühen 1990er Jahre attestiert, als die bloße Anwesenheit von als nicht-deutsch gelesenen Menschen von der Politik als Grund für die vielen Ausschreitungen und Brandanschläge ausgemacht und das Asylrecht deshalb verschärft wurde. Auch ist bis heute ein verharmlosendes Bild der Täter*innen oder zumindest eine Verengung der Verantwortlichen auf (häufig als psychisch krank markierte) Einzeltäter*innen oder Kleingruppen zu beobachten, was es ebenso vereinfachte, die NS-Gräueltaten zu externalisieren, wie die »Mitte« der Gesellschaft von der Mitverantwortung für rechten Terror freizusprechen. Und bis heute sind es nicht nur der Widerwille der Mehrheitsgesellschaft, sondern auch rechte Bedrohungen und Gewalt, mit der sich die Betroffenen und Aktivist*innen konfrontiert sehen. Vor dem Hintergrund solcher und weiterer Analogien appelliert Kleinmann dafür, über »Anschlüsse« zwischen beiden Sphären intensiver als bislang nachzudenken und »solidarische Allianzen« zu knüpfen und zu pflegen.
Dem gerade beschriebenen Mechanismus des Weghörens und Ausblendens der Dominanzgesellschaft einerseits und des Kämpfens für Anerkennung von Betroffenheit und für ein angemessenes Gedenken an Unrecht durch Opfer und Aktivist*innen andererseits widmen sich Tanja Thomas und Fabian Virchow. Die Konzeptualisierung eines strikten Gegensatzes zwischen »Erinnern« und »Vergessen«, so die zwei Verfassenden, verkennt dabei nicht nur die Überlappungen zwischen beiden, sondern auch, dass es sich um einen Ausdruck eines politischen Ringens um Deutungshoheit handelt. Der von beiden in ihrem Beitrag zentral reflektierte Begriff des »Vergessens« ist also nicht eine unabsichtlich herbeigeführte Abwesenheit von Erinnerung, ein zufälliges Ausblenden der Betroffenenperspektive, sondern kann als »epistemische Gewalt« verstanden werden, die nicht nur Rassismus oder Antisemitismus leugnet, die Täter*innen schützt und die Mehrheitsgesellschaft entlastet, sondern auch die Betroffenen marginalisiert und (aktiv) unsichtbar zu machen versucht, indem ihnen die Stimme abgeschnitten und sie ausschließlich in eine Opferrolle gezwungen werden. Diesem »repressiven Vergessen« stehen Praktiken des »transformativen Doing Memory« entgegen, die von Betroffenen und solidarischen Gruppen forciert werden. Zentral sind hier die Erfahrungen und Perspektiven der Betroffenen selbst, denen beharrlich Öffentlichkeit geschaffen wird, um einen empathischen Blick auf ihr Leid zu etablieren. Diese Perspektivenverschiebung soll die Mehrheitsgesellschaft dazu ermächtigen (vielleicht sogar zwingen?), sich mit den Ermöglichungsstrukturen der Taten, ihren Hintergründen, aber auch den postmigrantischen Lebensrealitäten unter Bedingungen eines strukturellen Rassismus auseinanderzusetzen. Ein solcher Ansatz zielt dabei dezidiert darauf ab, nicht nur das Vergessen zu brechen und Vergangenes aufzuarbeiten, sondern für gegenwärtige Missstände zu sensibilisieren und auf Veränderungen hinzuwirken.
Während Thomas und Virchow sich vor allem auf das Vergessen konzentrierten, schließt Hannah Zimmermann mit einem anderen Schwerpunkt an, indem sie fragt, wie »Wahrheitsfindung« im Kontext rechter Gewalttaten in den verschiedenen gesellschaftlichen Arenen – der individuellen Perspektive der Betroffenen, der rechtsstaatlichen Aufklärung sowie der künstlerisch-kulturellen Verarbeitung – stattfinden kann. Die Aufarbeitung und Auseinandersetzung mit den Verbrechen oder die Versuche der Wiederherstellung von Gerechtigkeit unterliegen in den verschiedenen Bereichen je unterschiedlichen Logiken, die sich etwa in feldspezifischen Wissensproduktionen und divergierenden Verständnissen davon, was überhaupt Gerechtigkeit und Wahrheit ist, ausdrücken – und dies zwangsläufig, weil hier verschiedene institutionelle Rationale und Rollenverständnisse aufeinandertreffen. Dabei ist eine enge Verflechtung der verschiedenen Arenen zu beobachten, wenn beispielsweise die Betroffenen Bündnisse schließen, um auf Demonstrationen bereits fünf Jahre vor der sogenannten Selbstenttarnung des NSU öffentlichkeitswirksam von den Sicherheitsbehörden die Berücksichtigung ihres (migrantisch situierten wie marginalisierten) Wissens einzufordern, das eindeutig auf ein rassistisches Tatmotiv hindeutete; oder wenn künstlerische Interventionen wie die NSU-Tribunale die als unzulänglich empfundene rechtsstaatliche Aufarbeitung konterkarieren, indem sie die gesellschaftliche Mitverantwortung stärker in den Blick nehmen. Die zivilgesellschaftlich-künstlerische Arena, wie die der Betroffenen, bemühen sich damit, die rechtsstaatlich aufgedeckten Ausschnitte der Wahrheit zu ergänzen – ganz im Sinne der »Restorative Justice«, die für eine pluralistische und dialogische Wahrheitsfindung mit einem Fokus auf die Betroffenenperspektive plädiert.
Vor dem Hintergrund dieser Ausführungen erklärt sich das Vorhaben, ein Dokumentationszentrum zum NSU-Komplex zu etablieren, das alleine aufgrund seiner Konzipierung dazu prädestiniert ist, die verschiedenen Perspektiven der Betroffenen, des Rechtsstaates, der Zivilgesellschaft sowie künstlerischer Formate an einem Ort zusammenzuführen und in einen (produktiven) Dialog treten zu lassen. Dieses Zusammenwirken der verschiedenen Wissensbestände soll ein tieferes Verständnis für die gesellschaftlichen Ermöglichungsbedingungen und die Lebenswelten der Betroffenen generieren, dabei aber auch dezidiert als Brücke in die Zukunft fungieren, da weder »Wahrheitsfindung« noch Gedenken je abgeschlossen werden können – zumal rechte Gewalttaten auch nach der sogenannten Selbstenttarnung des NSU ein virulentes gesellschaftliches Problem bleiben. Hinzugefügt sei von den Herausgebern des Bandes: Der Text Zimmermanns zeichnet sich durch besondere Aktualität und politische Brisanz aus, weil er wenige Monate vor der Eröffnung des Pilotdokumentationszentrums zum NSU-Komplex in Chemnitz und während der politischen Entscheidungsfindungsphase um ein vom Bund getragenes (wohl dezentrales) Dokumentationszentrum entstand.
Die gerade angeklungene Rolle juristischer Aufarbeitung rechter Gewalt ist Thema des Interviews mit Björn Elberling, einem renommierten und für seine Unterstützung von Betroffenen von Rassismus und Antisemitismus bekannten Rechtsanwalt. In dem Gespräch wird nicht nur die gerade beschriebene Binnenlogik rechtsstaatlichen Vorgehens sehr deutlich, sondern auch hier zu beobachtende Veränderungen. Elberling führt aus, dass es bereits strukturelle Bemühungen darum gibt, ideologisch motivierte Taten als solche frühzeitig zu erkennen. Dabei kann die Bedeutung der klaren Einordnung einer Tat als »rechts motiviert« nicht überbewertet werden. Daraus folgen nicht nur die Zurverfügungstellung entsprechender Ressourcen (etwa durch auf Fälle von Rassismus spezialisierte Staatsanwaltschaften); auch wirkt eine solche Klassifizierung strafverschärfend. Von ähnlicher Tragweite sind die Nebenklage und Betroffenenvertretung, die allerdings bestimmte Implikationen mit sich bringt, welche über das anwaltliche Mandat hinausgehen und von Beratungsstellen für Betroffene eingefangen werden. Dennoch: So wichtig Urteile mit einer eindeutigen Benennung der ideologischen Hintergründe einer Straftat auch für die Betroffenen sind, kann das Problem des Rechtsextremismus nicht allein durch das Justizwesen gelöst werden. »Ein Strafverfahren ist kein Untersuchungsausschuss«, wie es bei Elberling heißt, und beide können die Rolle der Zivilgesellschaft nicht ersetzen, die beispielsweise sofort nach der Urteilsverkündung im NSU-Prozess mit der Demonstration unter dem Motto »Kein Schlussstrich!« ihre und die Forderungen der Betroffenen öffentlich kundtaten. Die im Abschnitt davor von Zimmermann genannten Arenen der Wahrheitsfindung werden damit auch aus juristischer Perspektive in ihrer Bedeutung wie Verquickung begriffen.
Der darauffolgende Abschnitt (II) zoomt in zwei lokale Fallbeispiele des Gedenkens an in ihren Konsequenzen fatale rechts motivierte Gewalttaten hinein, die alleine wegen ihrer anderen historischen Verortung ganz verschiedene Entwicklungen darlegen. Unter Rückbezug auf Antonio Gramscis Konzept vom Kampf um gesellschaftliche Hegemonie zeigt Çağrı Kahveci wie und gegen welche Widerstände sich das Gedenken an den verheerenden Brandanschlag in Solingen vom 29. Mai 1993 entwickelte, bei dem fünf Menschen getötet und 14 weitere teilweise schwer verletzt wurden – allesamt Mitglieder der Familie Genç. Dieser bis heute andauernde Verhandlungsprozess zwischen den Wünschen und Bedürfnissen der Familie, dem lange die Opferperspektive ausblendenden Engagement der Zivilgesellschaft und dem zumindest zurückhaltenden Handeln der Stadtverwaltung wurde durch mehrere Faktoren bestimmt. Zunächst verweist Kahveci auf einen allgemeingesellschaftlichen und politischen Konsens darüber, Rassismus zu negieren. Auch wenn der Anschlag von Solingen den Höhepunkt einer rechtsextremen Gewaltwelle im damals erst kurz wiedervereinigten Deutschland markierte, wurde öffentlich wie politisch nicht etwa selbstkritisch nach den rassistischen Wurzeln für diese Übergriffe gesucht, sondern in einer Art Umkehrschuld die Anwesenheit von als fremd markierten Personengruppen als Ursache ausgemacht und entsprechend etwa das Asylrecht in einem »Kompromiss« verschärft wurde. Dies führte zu einer Verharmlosung des Solinger Brandanschlages, und mithin dazu, dass der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl der Gedenkveranstaltung fernbleiben konnte, sowie zu Gerüchten, die Familie Genç hätte von dem Anschlag zumindest finanziell profitiert (oder gar aus diesem Grund das Feuer selbst gelegt) und zu weiteren Formen sekundärer Viktimisierung. Vor diesem Hintergrund, so Kahveci, fehlte auch in der lokalen Zivilgesellschaft zunächst der Impuls, den Betroffenen und Opfern unterstützend zur Seite zu stehen.
Beides zusammengenommen resultierte in einer Anonymisierung und tiefgreifenden Isolierung der Opfer, was von Familie Genç als ein Vorenthalten von Empathie und öffentlichem Beistand wahrgenommen und so auch als Kritik zum Ausdruck gebracht wurde. Einen Wandel brachten erst eine Ende des 20. Jahrhunderts einsetzende »Kosmopolitisierung der Erinnerung«, die den Raum für marginalisierte Perspektiven im nationalen Gedächtnisraum eröffnete, sowie damit einhergehende bzw. diesen vorgelagerten Veränderungen in der Zivilgesellschaft, die als Arena ideologischer Auseinandersetzungen wesentlich für eine weitgehende Perspektivenverschiebung mitverantwortlich war. Im konkreten lokalen Kontext von Solingen bedeutet dies, dass erst Jahrzehnte nach dem Brandanschlag damit begonnen wurde, zentralen Erwartungen und Wünschen der Familie ansatz- und schrittweise gerecht zu werden. Exemplarisch hierfür ist die 2012 (und damit erst fast 20 Jahre nach dem Anschlag) vorgenommene Umbenennung eines Platzes in der Nähe des Solinger Rathauses in Mercimek-Platz, dem Namen des Heimatdorfes der Opferfamilie – einer Umbenennung, die zum 30. Jahrestag nochmals vollzogen wurde, dieses Mal dem langjährigen Wunsch von Familie Genç folgend in Mevlüde Genç-Platz.
Einen weiteren Einblick in den Umgang einer Stadtgesellschaft mit den Konsequenzen eines rechtsextremen Anschlags bietet Tobias Johann, wobei der Zugang hier zwangsläufig ein anderer ist, was zunächst mit der anders gelagerten Temporalität zusammenhängt. Während Kahveci eine knapp mehr als dreißigjährige Entwicklung im Umgang, Gedenken und Erinnern an den verheerenden Brandanschlag von Solingen nachzeichnen konnte, lag das antisemitisch motivierte Attentat in Halle an der Saale vom 9. Oktober 2019 beim Verfassen des Beitrages »erst« fünf Jahre zurück. Eine historisierende Darstellung konnte Johann damit gar nicht liefern. Der Zeitpunkt der beiden Gewalttaten erklärt auch den zweiten grundlegenden Unterschied, nämlich den der Akzeptanz des Erinnerns und Gedenkens. So stand in Halle gar nicht zur Debatte, ob dem rechtsextremistischen Anschlag (auch auf höchster Ebene) gedacht werden soll, was wesentlich darauf zurückzuführen ist, dass das antisemitische Attentat knapp acht Jahre nach der Selbstenttarnung des NSU verübt wurde. In dieser Zeit haben die Betroffenen und ihre Unterstützer*innen eine gänzlich neue Selbstverständlichkeit des Einforderns eigener Interessen und Perspektiven (endlich) breitenwirksam etablieren können. Dies bedeutet, dass die (politische) Öffentlichkeit und insbesondere die Zivilgesellschaft einen sowohl offensives Gedenken wie Aufklärung einfordernden Gestus eingeübt haben.
Diese beiden zwischen Solingen und Halle grundsätzlichen Unterschiede in der Temporalität wie gesellschaftlichen Empfindsamkeit haben zur Folge, dass Johann nicht eine Geschichte des Kampfes der Betroffenen für ein gerechtes Gedenken kritisch nachzuzeichnen hat, sondern die »neue« Selbstverständlichkeit im Umgang mit rechtsextrem motivierten Attentaten analysieren kann. Dies geschieht auf Grundlage eines vergleichenden Projektes, das für Halle und Hanau fragt, ob die »Lessons learnt« wurden. Dabei offenbart die empirisch auf Interviews mit Vertreter*innen der Zivilgesellschaft und Stadtverwaltung basierende Studie, dass es zwar eine breite Übereinkunft darüber gibt, dem Attentat zu gedenken. Gleichzeitig bestehen jedoch kontroverse Standpunkte über das »Wie« des richtigen Umgangs. Uneinig scheint man sich auf verschiedenen Ebenen zu sein, sei es bei der Frage nach den wahrgenommenen Auswirkungen des Anschlages auf die Stadtgesellschaft, der »richtigen« Bewältigungsstrategie sowie der Unterstützungsressourcen. Dabei gehen die divergierenden Perspektiven auf verschiedene, unterschiedlich bewertete Grundannahmen zurück, so etwa auf die Frage nach den richtigen Adressat*innen der Aufarbeitung und des Gedenkens. Während einerseits das Engagement auf direkte Opfer und Betroffene als auch auf von Rechtsextremen gemeinte und bedrohte Personen und Gruppen abzielt, wird andererseits insbesondere von mit der Stadtverwaltung kooperierenden zivilgesellschaftlichen Initiativen und Organisationen ein vermeintlich inklusiver Blick auf die gesamte Stadtgesellschaft geworfen. Dies hängt wiederum eng mit der Frage zusammen, als wie politisch der Anschlag interpretiert werden soll. Während insbesondere zivilgesellschaftliche Akteur*innen aus dem linken Spektrum den strukturellen Rassismus als gesellschaftlicher Bedingungsfaktor für rechtsextreme Gewalt betont wissen möchten, wiegeln hier Vertreter*innen der Stadtverwaltung und die ihr nahestehende Zivilgesellschaft mit dem Verweis auf ein »Neutralitätsgebot« ab und sprechen von einer Überpolitisierung. Solche und weitere Gegensätze werden dabei, so zeigt es Johann in seinem Beitrag, nicht nur von den Interviewten kritisch beobachtet, sondern teilweise als »unangemessen« delegitimiert, weil oftmals die eigene Perspektive auf den »richtigen« Umgang mit dem Anschlag als absolut gesetzt wird.
Für das Auseinandersetzen mit rechten Gewalttaten ist vor allem der öffentliche Diskurs zentral, der wesentlich von Journalist*innen mitbestimmt wird. Über diesen Themenkomplex wird in einem Gespräch mit Annette Ramelsberger reflektiert, die als Reporterin über Jahrzehnte schwerpunktmäßig zu rechten Gewalttaten berichtet und alleine zum NSU-Prozess über 500 Beiträge veröffentlicht hat. Dabei unterstreicht Ramelsberger gleich zu Beginn des Gesprächs die gerade angesprochene Rolle der medialen Darstellung rechter Gewalttaten. Ihr zufolge hat sich der gesellschaftliche wie politische Umgang mit dem Phänomen erst infolge der Arbeit von Journalist*innen gewandelt, die Ende der 1990er Jahre die bis dahin übliche Wahrnehmung von Einzelfällen mit ihrer Recherche zu der hohen Anzahl rechtsmotivierter Tötungsdelikte korrigiert haben. Journalistische Arbeit ist damit als einer der »Startschüsse« für den Beginn einer breiteren gesellschaftlichen Aufarbeitung rechter Gewalt der Nachwendezeit zu verstehen. Selbstverständlich war damit der Lernprozess nicht abgeschlossen, worauf etwa die mediale Begleitung der Mordserie bis zur sogenannten Selbstenttarnung des NSU hinweist – Stichwort »Dönermorde«. Und obwohl man heute, insbesondere auch nach den Erfahrungen des NSU-Prozesses, viel weiter ist, weil man etwa gelernt hat, die Perspektive der Betroffenen stärker einzunehmen und ihr Gehör und Breitenwirkung zu vermitteln, bleiben ethische Dilemmata in der journalistischen Arbeit bestehen. Diese entfalten sich wesentlich auf zwei miteinander verwobene Ebenen, dem Spannungsverhältnis zwischen Objektivität und Empathie und dem Gegensatz von Berichterstattung und Kommentierung, die beide selbst für eine so erfahrene Gerichtsreporterin nicht nur emotional eine Herausforderung bleiben – eine Herausforderung, die der erste Beitrag im nun folgenden Abschnitt in einer durchaus vergleichbaren Art und Weise zu teilen scheint.
Die anschließende Sektion (III) des Bandes bündelt zwei sehr persönliche Beiträge eines Schriftstellers und eines Wissenschaftlers. Beide sind um 1980 in bzw. in unmittelbarer Nähe von Zwickau aufgewachsen und beide setzen sich als Zeugen bzw. Beobachter der lokalen Umgangsformen mit dem tief in der Region verwurzeltem Rechtsextremismus, seinen Gewalttaten und deren Folgen auf je spezifische Art und auseinander. Alexander Leistner geht dabei für einen Wissenschaftler ungewöhnlich persönlich wie biographisch vor, um zu illustrieren, welch tiefgreifende Konsequenzen für einen in den 1990er Jahren politisch gegen rechts engagierten Menschen es bis heute hat, durch die sogenannte Selbstenttarnung des NSU völlig überrascht worden zu sein. Dieser »Schock« saß und sitzt deshalb so tief, weil Leistner





























