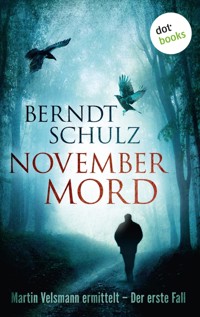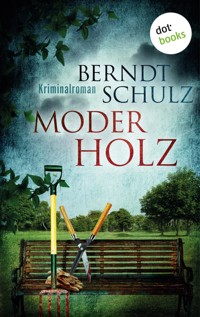Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Martin Velsmann
- Sprache: Deutsch
Dieser Mord lässt niemanden los! Begleiten Sie Kommissar Velsmann bei seinem dritten Fall: "Regenmord" von Berndt Schulz jetzt als eBook bei dotbooks. Sie sieht so friedlich aus, wie sie da auf der Parkbank sitzt. Doch die Idylle täuscht: Sie wurde brutal hingerichtet, ihre Augen ausgestochen, die Brille liegt zersplittert und blutverschmiert zu ihren Füßen. Dieser Fall ruft den inzwischen pensionierten Kommissar Velsmann zurück auf den Plan. Schnell begreift der Ermittler, dass der Mord im Zusammenhang mit einem anderen steht. Die Spuren führen Martin Velsmann und sein Team in längst vergangene Zeiten – und so beginnt für sie ein Wettlauf gegen die Geschichte … Jetzt als eBook kaufen und genießen: "Regenmord" von Berndt Schulz. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 477
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Sie sieht so friedlich aus, wie sie da auf der Parkbank sitzt. Doch die Idylle täuscht: Sie wurde brutal hingerichtet, ihre Augen ausgestochen, die Brille liegt zersplittert und blutverschmiert zu ihren Füßen. Dieser Fall ruft den inzwischen pensionierten Kommissar Velsmann zurück auf den Plan. Schnell begreift der Ermittler, dass der Mord im Zusammenhang mit einem anderen steht. Die Spuren führen Martin Velsmann und sein Team in längst vergangene Zeiten – und so beginnt für sie ein Wettlauf gegen die Geschichte …
Über den Autor:
Berndt Schulz wurde 1942 in Berlin geboren. Er veröffentlichte zahlreiche Kriminalromane und Sachbücher. Außerdem ist Schulz unter dem Pseudonym Mattias Gerwald als Autor historischer Romane erfolgreich. Er lebt in Nordhessen und Frankfurt am Main.
Bei dotbooks erscheint Berndt Schulz' Krimi-Reihe rund um Kriminalkommissar Martin Velsmann, die folgende Bände umfasst: »Novembermord: Martin Velsmann ermittelt – Der erste Fall« »Engelmord: Martin Velsmann ermittelt – Der zweite Fall« »Regenmord: Martin Velsmann ermittelt – Der dritte Fall« »Frühjahrsmord: Martin Velsmann ermittelt – Der vierte Fall« »Klostermord: Martin Velsmann ermittelt – Der fünfte Fall« Die ersten zwei Romanen der »Martin Velsmann«-Reihe sind auch als Sammelband unter dem Titel »Novembermord & Engelmord« erhältlich.
Außerdem erscheinen bei dotbooks Berndt Schulz' Kriminalromane »Wildwuchs« und »Moderholz«, der Roman »Eine Liebe im Krieg« sowie der Kinderkriminalroman »Das Geheimnis des Falkengottes«.
Ebenfalls bei dotbooks veröffentlicht Berndt Schulz unter dem Pseudonym Mattias Gerwald folgende Bände der »Tempelritter-Saga«:
»Die Suche nach Vineta«, »Das Grabtuch Christi«, »Der Kreuzzug der Kinder«, »Die Stunde der Gerechten«, »Die Säulen Salomons«, »Das Grab des Heiligen« Und die historischen Romane »Die Geliebte des Propheten«, »Das Geheimnis des Ketzers«, »Die Entdecker«, »Die Sternenburg«, »Die Gottkönigin«, »Die Gesandten des Kaisers« und »Die Hetzjagd«.
***
eBook-Neuausgabe Februar 2015
Copyright © der Originalausgabe 2007 Aufbau Verlag, Berlin
Copyright © der Neuausgabe 2015 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design, München, unter Verwendung von shutterstock/Claudio Divizia, Eugene Sergeev
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH
ISBN 978-3-95520-768-7
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Regenmord« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Berndt Schulz
Regenmord
Martin Velsmann ermittelt – Der dritte Fall
dotbooks.
Er wirft seinen Hagel wie Brocken herab,
die Wasser erstarren vor seinem Frost.
Er sendet sein Wort und schmilzt sie auf
laßt seinen Tauwind wehen.
Und die Wasser fließen.
»Vespro della Beata Vergine«,
Antiphon des zehnten Teils.
ERSTER TEILMusik
1.
Sonntag, 24. April 2005
Es war ein verzauberter Abend. Martin Velsmann rechnete nicht damit, das Andere könnte noch einmal Gestalt annehmen und sich vor ihm aufbauen. Der Zauber hatte von allem Besitz ergriffen.
Es war mild. Es duftete. Der Winter war zu Ende. Andrea blickte zu ihm empor, als sei ihr etwas gelungen. Sogar ein Pirol mischte seine drei vollendeten Töne in die Harmonie. Sie schritten durch die Dunkelheit, als gehörte der aufatmende Garten ihnen allein. Die anderen Besucher besaßen das Leben nicht wirklich, sie simulierten es, ihr Schatten, den das gleißende Scheinwerferlicht gegen die Eingänge der Sakristei warf, blieb haften, wenn sie weggingen. Sie selbst verloren sich spurenlos in der Nacht.
Eine solche flüchtige Wahrnehmung ist gefährlich, sie macht unvorsichtig. Martin Velsmann wußte es aus Erfahrung. Der Polizist in ihm würde jeden eindringlich davor warnen, aber an diesem Abend war er selbst anfällig. Die Dinge, die sein Leben bisher bestimmt hatten, konnten ihn nicht mehr bedrohen. Dieses ganze Elend war vorbei.
Als die Fanfaren vom Tonband erklangen, dreimal, faßte er den Arm seiner Frau so fest, daß sie leise aufschrie. Er flüsterte mit ihr. Martin Velsmann hatte genug Dunkelheit gesehen und Distanz gehabt, und sie kehrten aus dem Park mit seinen Lauben aus niedrig hängenden Ästen von Lebensbäumen und Kegeln von Taxus zurück, dorthin, wo das gleißende Licht war. Und ihre Schatten bewegten sich mit ihnen.
Martin Velsmann verspürte für einen Moment ein Glücksgefühl, das er festhalten wollte, um sich später daran zu erinnern. Doch schon war es vorbei, als jemand mit einem nachhaltigen Parfümgeruch ihn anstieß. Er versuchte, die Erschütterung nicht an Andrea weiterzugeben. Velsmann balancierte zwei Gläser Wein, im Kapitelsaal der Mönche fiel sein Blick auf ein schreiendes Gesicht, das aus einem steinernen Blattwerk herausgearbeitet war. Die einzige Säule mitten in dem quadratischen Raum mit den umlaufenden Sitzbänken aus Stein stand mächtig da. Sie tranken langsam. Dann stellten sie die Gläser auf den alten Sandstein in der Fensteröffnung der Arkade, es klirrte dünn, welch ein Sakrileg eigentlich, und sie gingen den Kreuzgang hinunter. Sie mußten in der Menge mit Trippelschritten über holprige Steinplatten in Richtung des Eingangs gehen, aus dem ein Rauschen zu hören war. Die Basilika war dunkel, und der Ton stand darin stärker, Martin Velsmann konnte aber keine Ursache dafür erkennen.
Andrea dirigierte ihn mehr als er sie, und so gingen sie durch den Mittelgang bis zur Reihe mit der Nummer vierzehn. Wieder erhob sich das Rauschen. Es kam von den eintausenddreihundert Zuhörern, eine Zahl, die der Veranstalter gerade vom Bühnenpodest herab stolz verkündete. Sie bewegten sich im gleichen Augenblick, setzten sich oder erhoben sich wieder. Martin Velsmanns Blick ging in die Höhe, wanderte an der Decke mit den Gurtbögen entlang, in der er Risse und schadhafte Stellen entdeckte. Überall ruhiges Kerzenlicht an den ehrwürdigen Pfeilern der Basilika. Noch war nur Licht anstelle von Musik, aber der Echohall, die Abweichung, das wußte er, würde 0,075 Sekunden betragen.
Hier saßen sie also richtig, nahe am echten Ton, und die Verzögerung würde sie nicht erreichen. Die Musik würde alles Feste verflüchtigen, so hatte es Andrea ausgedrückt. Das Ende alles Materiellen. Velsmann war glücklich darüber. Das Ende aller Dienstvorschriften, dachte er. Er sah Andrea immer wieder an, als könne er kaum glauben, daß sie tatsächlich da war. Wie immer ging von ihr eine innere Kraft aus, sie besaß eine gesunde, gebräunte Gesichtsfarbe, ihr Haar war durch Wind und Wetter gebleicht, etwas in ihr war in Bewegung wie eine strömende Quelle. Velsmann hatte am Morgen bewundert, wie geschmeidig sich ihr noch immer junger Körper trotz der schwerer werdenden, fraulichen Formen bewegte. Surge, amica mea, et veni! Steh auf meine Freundin, und komm!
Jetzt betraten die Musiker die Bühne. Ein Schwarm von schwarzweiß gekleideten Instrumententrägern, von denen Velsmann nur wußte, daß sie die besten der Welt waren. Ihnen folgten die Sänger. Als letzter der Dirigent. Velsmann beteiligte sich am allgemeinen Beifall. Alle traten in die besondere Sphäre ein. Gleich würde etwas Neues entstehen, ein innerer Klangraum, aus dem niemand mehr herauskonnte. So hatte Andrea es ihm angekündigt.
Mal was anderes, dachte der ehemalige Hauptkommissar und blickte ergeben zur Seite auf das Programmheft, das Andrea in der Hand hielt. Ein mächtiger, bärtiger Kopf, die großen dunklen Augen durchdrangen den Blick des Betrachters, weißer Stehkragen, lange Hände, die sich auf Notenblätter legten. Der alte Komponist.
Dann erhoben sich schon die ersten Töne, sie waren schön, aber nicht das, was Velsmann erwartete. Sie schmeichelten nicht, sie weckten nicht sehnsüchtige Gefühle wie in Schlagern, sie türmten sich auf zu einer unerbittlichen Anklage. Er richtet Völker. Er häuft die Toten und zerschlägt die Häupter weit übers Land. Velsmann rutschte unruhig auf seinem Stuhl herum. Er wollte sich wohl fühlen, genießen, aber er merkte, daß der Polizist in seinem Inneren ihm zusetzte. Der Polizeidienst hatte tiefere Spuren hinterlassen, als er sich eingestehen wollte. Denn da war es wieder, er hatte es vergessen wollen. Die Drohungen und der kurze Weg bis dorthin, wo daraus Gewalt wird. Er begann sofort in einem instinktiven Impuls, sich innerlich zu versperren.
Andrea jedoch, die das bemerkte, legte ihm die Hand auf den Arm. Hier ging es nur um Musik. Velsmann blickte sich dezent um. Hier saßen nicht die Täter mit den eingefrorenen Gesichtern, in deren Inneren unsichtbare Flammen loderten. Seine Linke ist unter meinem Haupte, und seine Rechte hält mich umfangen. Velsmann war dankbar für die Berührung seiner Frau. Ja, dachte er, ich brauche das tatsächlich nicht mehr, diesen Kampf, diese ständige Bereitschaft. Ich muß das loswerden.
Ich muß den Polizisten in mir zum Schweigen bringen.
Und die Musik kam ihm jetzt entgegen, sie stimmte in einem sofort folgenden Antiphon Versöhnung an, mit sechs sphärenhaften Stimmen im Chor, ohne Musik. Velsmann beruhigte sich. Und bevor er über sich nachdenken konnte und Selbstmitleid in ihm aufstieg, eine Art Opfer zu sein, das drei Jahrzehnte lang aussichtslos gegen das Verbrechen gekämpft hatte, riß ihn die nächste Woge der Musik mit sich fort. Wieder war es eine gesungene Gegenrede, bevor der Psalm einsetzte. Mein Geliebter strahlt hell und rot! Die kraftvollen Töne und hellen Stimmen stiegen dort auf, wo sie saßen, nahmen sein Unbehagen mit sich und erfüllten den hochfahrenden Raum. Velsmann fühlte sich aufgehoben, jetzt war es gut, er war angekommen in dem inneren Bereich aus Klängen, von dem Andrea gesprochen hatte. Schon ist der Winter vergangen. Der Regen ist vorbei und versiegt.
Die mächtig vorwärtstreibende Musik umspielte die Psalmen, angetrieben vom Cembalo, gekontert von Flöten und Posaunen, darin der reine Klang von Stimmen, die sich im Preisen ekstatischer Gefühle ergingen. Velsmann verspürte plötzlich den Wunsch, »Amen« zu sagen. Es war ihm peinlich, doch als der Hymnus Ave maris stella ertönte, Velsmann den lateinischen Text aus dem Programmheft übersetzte und verstand, fühlte der ausgeschiedene Polizist plötzlich ein anderes Gefühl in sich aufsteigen. Löse das Band der Sünde. Spende Licht den Blinden. Allem Bösen wehre. Alles Gute begehre. War es das, was er wollte? Eine erbauliche Welt?
Er spürte erneut Widerspruch, er wollte nicht eingelullt werden.
Was willst du also, verdammt?
Es ist ein schöner Abend!
Denke nicht an den Tod! Denke nicht an die Erlösung! Du ermittelst nicht mehr an Tatorten!
Bevor er mit sich im reinen war, ergriff ihn die Musik wieder. Und der ehemalige Polizist dachte: Warum nicht? Wenn es eine solche Musik gibt, dann vielleicht auch die Gegenwart des Guten. Vielleicht beginnt sie nach Dienstschluß. Ich bin in meinem Feierabend angekommen.
Martin Velsmann atmete tief durch und überließ sich der Musik.
Und er verließ ihren inneren Raum tatsächlich nur noch einmal für kurze Zeit und dann nicht mehr. Sein Nachbar zur Linken war damit beschäftigt, sein Programmheft in der Jackentasche zu verstauen und es sofort wieder herauszuholen, um es im Kerzenlicht zu studieren, er stieß Martin Velsmann mehrmals an. Velsmann knurrte innerlich, aber die Zuschauermenge verschmolz zu einer Art morphogenetischem Feld, in dem er schließlich keine Einzelwesen mehr wahrnahm. Auch sich selbst empfand er nur noch als Teil der Menge, leise wogend in Musik. Für einen Polizisten, der argwöhnisch das einzelne Gegenüber zu beobachten gewohnt war, für einen sturen Ermittler, ein Abgleiten.
Trompeten, mächtige Cornetti, schmelzende Violinen, Stimmen in einem sehnsüchtigen Gespräch vertieft. Sicut erat, wie es war.
Martin Velsmann schloß die Augen. Als eine Stunde später der letzte Akkord im aufbrausenden Magnifikat mit Cornetti, Dulzian, Orgel und Streicher verlöschte, das Deo gratias mit sieben Stimmen und Sopran ohne Instrumente schlicht verklang, ging durch den Raum ein großes Aufatmen.
»Ach, schön!« sagte Andrea beim Hinausgehen. Unter ihren seegrünen, ruhigen Augen bildeten sich Fältchen. »Du mußt dich übrigens verändert haben, Martin, bisher konntest du nur Musik ertragen, bei der du den Takt schlagen und mitwippen konntest.«
»Ich war Polizist, der Bursche rumort noch immer mächtig in mir, das ist mir gerade klargeworden«, erwiderte Velsmann, jetzt erleichtert.
»Laß ihn einfach stehen«, sagte Andrea.
»Ich hatte keine Ahnung, daß ich auch genießen kann!«
Sie ließen sich hinaustreiben. Jetzt wurden sie in der Menge durch den Klostergarten geschoben. Sie überquerten den Parkplatz bis zur Klostermauer, dort warteten kleine, blaugelbe Shuttle-Busse. Weil beinahe jeder Zuhörer mit dem eigenen Auto gekommen war, hatte Velsmann außerhalb parken müssen.
Man fuhr den Kilometer bis zur Klinik Hohen Eichen, dann gingen sie durch den nächtlichen Hospitalpark unter Kiefern und suchten das Auto. Die abschüssige Wiese, auf der es mit hundert anderen Fahrzeugen stand, war feucht, und Velsmann hatte Mühe, das Gefährt mit durchdrehenden Sommerreifen auf den Parkweg zurückzufahren. Sie erreichten den Stau, der sich inzwischen gebildet hatte. Velsmann hatte Gelegenheit, aus dem Seitenfenster die erleuchteten Häuser der Psychiatrie wahrzunehmen. Er sah Villen und Sanatoriumsgebäude wie Herrenhäuser im vollen Lichterglanz. Hinter beinahe jedem Fenster brannte festliches Licht. Das mußten die Häuser der Ärzte sein. Oder feierten die Patienten?
Sie genossen es, nichts weiter als Belanglosigkeiten auszutauschen. Velsmann stellte das Autoradio an, drehte den Verkehrsfunk aber gleich wieder ab. Er mußte auf die enge, dunkle Straße aufpassen. Als sie nach der Fahrt durch die Weinberge eine halbe Stunde später den Gasthof im Gottesthal erreichten, war er nicht mehr beleuchtet. Sie bogen auf eine Schotterstraße ein. Am Weg lagerten zwei angekettete, braune und schwarze Kamerunschafe, die mit schrägen Augenschlitzen in die Autoscheinwerfer starrten. Martin Velsmann parkte den Wagen hinter dem Haus, unmittelbar vor einem quer verlaufenden Weinberg, der wie ein grünes Band vor dem Rheintal lag.
Die Luft war trotz der frühen Jahreszeit weich und mild. Sie tranken ein letztes Glas Wein auf dem Balkon, der nach hinten hinausging, zu einem Gebüsch aus Brombeerhecken. Sie wollten auch jetzt nicht über ihre Gefühle sprechen und auch nicht über ihre Arbeit. Nicht über die Kinder, nicht über den Stand ihrer Ehe. Es sollte keinen Anlaß für Vorwürfe geben.
Andrea seufzte. »Bisher der schönste Tag im Jahr. Warum machen wir so was nicht öfter!«
»Ich habe jetzt Zeit«, sagte Velsmann. »Ich kann mir alles erlauben, aber irgendwie steckt mir der Dienstausweis immer noch in der Tasche. Ich muß mich auf mein neues Leben erst einstellen. Das geht nicht so fix.«
Andrea schwärmte den Nachthimmel an. »Himmlische Musik«, sagte sie. »Aber ich fragte mich die ganze Zeit, ob man überschäumende Gefühle zu liturgischen Texten spielen kann? Liebessehnsucht statt Erbauung? Was dachte sich Monteverdi dabei?«
Martin Velsmann war kein Experte. Er wollte die Schultern zucken, doch dann sagte er: »Mir gefällt jede gute Musik, wie du weißt. Bei dieser hab ich was gehört, das nicht auf Trennung aus ist. Ein Miteinander wie auf einer guten Teamsitzung im Präsidium, wovon es beileibe nicht viele gab.«
Andrea war noch immer im Bann der Musik. »Ohne Orgel«, sagte sie, »wäre es noch inniger gewesen.«
»Manchmal müssen Gefühle gewaltig sein«, widersprach Velsmann. »Sie müssen aufrütteln.«
»Tatsächlich?« fragte Andrea mit gerunzelten Augenbrauen.
»Ich brauche keine Harmonie«, sagte Martin Velsmann. »Im Konzert ist mir das aufgefallen. Ich wollte einfach nur die Musik hören, und plötzlich haben mich tausend Sachen gestört. Ich brauche aber auch keine Bedrohung, darauf kann ich noch mehr verzichten.«
»Es war doch nur Musik!«
»Weiß ich schon. Ich komme noch nicht klar mit meinem Abschied«, gab Velsmann zu. »Außerdem bin ich diesen Genuß nicht gewohnt. Ich besitze keine Sinne dafür. Fünfunddreißig Dienstjahre lassen sich nicht ausknipsen. Am Anfang des Konzertes wußte ich überhaupt nicht, wie ich auf die Musik reagieren sollte. Ich fühlte mich richtig hilflos – schlecht für einen Polizisten. Mich haben eben andere Dinge geprägt als die Kunst.«
»Kann ich dir helfen, mit deiner neuen Situation klarzukommen?«
»Meine neue Situation ist die alte«, sagte Velsmann. »Es geht um Standpunkte.«
»Meiner ist im Moment nur der«, sagte Andrea launig und hob ihr Glas zum Himmel, »daß dieses untergeschobene Ritornello von Heinrich Bone im elften Stück Gefühlsduselei darstellt, im Gegensatz zur Reinheit der Marienvesper!«
»Was? – Ich fand alles nur schön, auch das Sitzen und Schauen in dieser Kirche.«
»Wie wäre es, wenn wir morgen noch einmal nach Eberbach fahren?« meinte Andrea. »Es ist so wunderschön dort.«
»Ah, ist das ein gutes Gefühl!« sagte Velsmann und räkelte sich. Er streckte alle viere von sich. »Morgen? Gibt es einen weiteren Tag ohne Bürozeiten? – Unfaßbar!«
Vom Rheintal her fächelte kühler Wind herüber.
Andrea sagte: »Es ist spät. Laß uns zu Bett gehen.«
Velsmann überwand das Gefühl der Distanz und der damit verbundenen Mutlosigkeit, das ihn ergriffen hatte. Wir sind weit auseinander, mußte er denken.
Er riß sich zusammen. Als er aufstand, zitierte er mit der Geste eines Schauspielers: »Schon ist der Winter vergangen. Der Regen ist vorbei und versiegt. Steh auf meine Freundin, und komm.«
Sie gingen hinein, und es gelang ihnen, die Nacht ganz eng um sich zu legen.
2.
Montag, 25. April 2005
Muß man sechzig werden, um das zu erleben, dachte Janne van Lent. Daß man so abschließen kann. Aber was heißt das schon – abschließen! Noch ist so viel zu vertuschen. Was aufgeklärt sein wollte, muß jetzt versteckt werden, denn es wäre unerträglich, es anzusehen. Schlimmer als das Medusenhaupt, vor dem man Auge in Auge erstarrt.
Aber wie sehnte sie den Tag herbei, an dem es gezeigt werden konnte. Sie selbst würde es tun. Und alle sollten es anschauen müssen.
Der holprige Pfad führte schon eine Weile bergauf. Janne drehte sich um und sah ihre Fußabdrücke auf dem feuchten Boden. Sie erschrak. Im ersten Moment war sie versucht, hinter sich aufzuwischen. Sie wollte ihre Spuren auslöschen, instinktiv wie ein Tier, niemand sollte sie verfolgen können. So hatte sie es immer getan.
Aber dann nahm sie sich zusammen. Hier war sie sicher. Sie zog die Postkarte aus der Jacke. Jetzt ging es um etwas anderes.
Janne hielt die Postkarte vor sich, blickte in die Runde. Sie mußte noch weitergehen, spürte den inneren Antrieb. Sie hatte keine Zeit. Immer plagte sie diese Vorstellung, durch das Dunkle gehen zu müssen, um es eines Tages endlich zu schaffen, eines Tages wird alles besser – dahin, bis zu diesem fernen, hell erstrahlenden Ort mußte sie unbedingt.
Aber im Moment ging es nur darum, auf den Berg zu gelangen, so dicht wie möglich an den Himmel heranzukommen. Denn von dort hatte sie diese Nachricht erhalten, da war sie geschrieben worden. Das Bild zeigte alles. Und sie wollte es sehen. Am Himmel zogen wieder Regenwolken auf.
Rechter Hand lag die Kuppel der Abhöranlagen eines Geheimdienstes. Ein riesengroßes, halbrundes Ohr, das unaufhörlich lauschte. Kinder kamen plötzlich schreiend aus der glänzenden Aluminiumhaut gelaufen. Janne blieb stehen. Was war da los, wurde die Anlage jetzt nicht mehr genutzt? Bei ihrem letzten Aufenthalt waren noch Uniformierte hinter Stacheldraht herumgegangen. Alles ändert sich, dachte sie. Aber tut es das gründlich? Vielleicht ändern sich nur die Bilder.
Sie ging weiter. Die schreienden Kinder verschwanden in einem Waldstück, vor dem ein handgemaltes Schild mit dem Aufdruck Märchenwiese prangte.
In der Ferne stand das Gipfelkreuz, von diesem Teil der Kuppe wußte sie, daß er Pferdskopf hieß, er besaß auch diese Form. Dahinter ging es steil bergab. Aber so weit mußte sie wohl nicht.
Janne van Lent registrierte beim Aufstieg die Fernsicht nach allen Seiten, aber sie genoß sie nicht. Sie stieg höher, aber sie hatte den Eindruck, die Täler und kleinen Dörfer glitten wie auf einem unsichtbar bleibenden Lastenaufzug in die Tiefe und verschwanden bald im Schatten. Die Sonne vor den heranziehenden Regenwolken erzeugte ein milchiges, dramatisches Licht, wie einen betonten Hinweis, der nicht zu übersehen war.
Janne war es lästig. Sie wollte nicht abgelenkt sein.
Die Fußgängerin atmete heftig, leise keuchend. Sie wußte, sie besaß nicht die beste Kondition. Dann erblickte sie das Denkmal, es tauchte hinter dem Gipfel in einer kleinen Senke auf. Auf einem kegelförmigen Steinhaufen der mächtige Steinadler. Wieder hielt sie sich die Postkarte vor die Augen. Sie war am Ziel. Sie drehte die Karte um. Ihr Lieben zu Hause, wir ziehen weiter, es ist schön in Deutschland. Uns geht es gut. Wir sehen uns bald wieder.
Sie erreichte das Denkmal. Daneben stand eine Bank vor einem klobigen Tisch, und Janne ließ sich schwer atmend nieder. Sie sah an dem Schaft empor, der aus dem Steinhaufen wuchs, bis zu dem Vogel, der seinen Kopf mit den Stirnwülsten, dem scharf gebogenen Schnabel nach Westen reckte. Alle waren getäuscht worden, das wußte sie jetzt. Man hatte sie vielleicht gerade an jenem Tag festgehalten, an dem sie diese Karte mit diesem Abbild schrieben. Warum war ihnen gerade dieses Bild wichtig gewesen?
Sie blickte um sich. Kein Mensch weit und breit. Und das Licht nahm zu, obwohl es Abend war und die Sonne bald versinken würde. Janne fühlte sich, als säße sie auf einer Bank in den Wolken.
Sie versuchen mir einzureden, daß ich einsam bin, dachte sie, ohne dabei erregt zu sein, daß ich unfähig bin, über mich selbst zu sprechen. Ich spreche unaufhörlich, dachte sie, ich spreche mit mir selbst, höre die Stimmen, die mir etwas bedeuten. Und ich antworte. Wer kann mir sonst schon etwas sagen?
Janne wendete die Postkarte hin und her. Ja, es war vielleicht derselbe Tag der Tat gewesen, vielleicht derselbe Augenblick, und die Verbrecher hatten die Karte in der Hand gehalten, vielleicht neben den Opfern geschrieben, den Blick auf sie gerichtet, vielleicht die Füße auf ihren Leibern, vielleicht lachend.
Wo hatte man sie verscharrt!
Janne rückte unruhig auf der Bank herum. Sie hatte es vor sich selbst nicht mehr vertuschen können. Irgendwann war es zu spät, und sie hatte es nicht mehr ausgehalten. Sie mußte einfach handeln. Sie hätte die menschlichen Überreste, das Grab, finden müssen, sie nach Hause bringen müssen. Sie fing an zu zittern. Sie ließ ihre Eltern in deren Obhut, Menschen, die keinen Seelenfrieden fanden, bewacht von laut lachenden, gefühllosen Tätern.
Wie hatte sie das zulassen können! Wie konnte sie damit weiterleben! Es war nicht wiedergutzumachen!
Janne wußte insgeheim, sie hatte tatsächlich zu wenig darüber gesprochen. Über alles. Man hatte sie überall fragend angeblickt, herausfordernd, auch wütend. Jemand hatte ungeniert einen Verdacht geäußert. Aber sie schwieg. Sie wußte einfach nichts zu sagen. Sie hatte längst beschlossen, auf eigene Faust zu handeln. Deshalb vertuschte sie ihre Spuren von Anfang an. Am Ende würde man schon erkennen, warum das nötig war.
Dann sollte man sie richten. Dann sollten alle über sie herfallen. Aber nicht jetzt. Vor allem nicht jetzt, wo noch so vieles zu tun war.
Janne van Lent griff in die Brusttasche ihrer weiten, hellblauen Leinenjacke und zog das Handy hervor. Sollte sie anrufen und sagen, daß sie kurz vor dem Ziel war? Aber mit wem sollte sie sprechen? Sie starrte das Handy an, blickte auf das Display wie in einen Spiegel, sah sich aber nicht. Dann wollte sie es wieder einstecken, aber sie traf die Innentasche nicht, das Gerät fiel in den Sand. Janne hielt eine Hand vor den Mund und stieß einen kindlichen Schrei aus.
Ich muß mir das abgewöhnen, dachte sie. Sie kannte das. Immer wieder diese halb ausgeführten Gesten, abgebrochene, fahrige Handlungen. Es war schon immer so gewesen. Wenn sie jemandem etwas geben wollte, schaute sie nie genau hin, ließ es schon los, bevor der andere es wirklich in der Hand hatte. Sie konnte nichts wirklich übergeben.
Man schimpft mit ihr. Und sie weint.
Aber jetzt wollte sie nicht weinen. Statt dessen zog sie aus der anderen Brusttasche eine flache Flasche Oude Genever mit einem aufgeschraubten Plastikglas als Verschluß. Sie füllte das Glas, hob es gegen den Raubvogel aus Stein, murmelte etwas und trank, den letzten Tropfen ließ sie mit zurückgelegtem Kopf in den Mund hineinlaufen. Dann schenkte sie noch einmal nach. Trank ruckartig. Und dann noch einmal. Als sie die Flasche wieder einsteckte, fühlte sie es warm werden. Das war schön. Es war eine Täuschung, die sie kannte, aber es war schön. Mit so wenig ließ sich eine Illusion erzeugen.
Janne van Lent ertappte sich plötzlich dabei, daß sie ruhig wurde, für einen Moment einverstanden war, daß alles einen Sinn ergab. An diesem Platz kam alles zu einem Ende.
Auch das war jedoch eine Täuschung. Sie hatte diese lange Spur durch dieses Land gezogen. Sie hatte viele Spuren hinterlassen, die sie bedauerte. Aber sie war vorangekommen. Und das nicht, um jetzt zufrieden zu sein, sie hatte nicht alle diese Toten angesehen, um sich an den Anblick zu gewöhnen. Nein, das hörte nicht auf. Es würde weitergehen, und sie war mitten darin – die Schuldige, die Täterin. Die alles hatte geschehen lassen.
Man hatte nie auch nur die geringste Spur von ihnen gefunden. Und doch suchten alle nach ihnen. Mit Fotos, auf langen Namenslisten, mit Steckbriefen, mit Kameras der Medien, es hatte sogar einen Dokumentarfilm über sie gegeben. Der berühmte Arzt, der die falsche Frau geheiratet hatte und sich weigerte, sie jetzt zu verlassen. Nur Janne suchte nicht. Sie verschloß sich davor so lange, bis in ihrem Inneren alles wund war und herumschrie bis in ihre Träume hinein, und nichts mehr war in ihrem Leben an seinem Platz.
Nun mußte sie aufräumen.
Wenn man Dinge zu lange mißachtet, dachte sie, entfalten sie ein Eigenleben. Sie bekommen plötzlich kranke Auswüchse und fallen über einen her. Ja, man wird krank, wenn man die Dinge nicht in der Zeit bewegt, in der sie fällig sind.
Jetzt war es aber anders. Sie war allein übriggeblieben, nur sie suchte noch nach den Vermißten, und alle anderen hatten die Suche endgültig eingestellt. Es gab so viel anderes zu tun, das schnellen Erfolg versprach, den man vorzeigen konnte.
Wieder sah sie auf, blickte um sich, die Sonne stand jetzt so tief, daß sie übernatürlich lange Schatten warf, und noch immer war keine Menschenseele zu sehen. Unten im Tal lagen die Dörfer im blauschwarzen Schatten, hier oben saß sie in einem weißen, geheimnisvollen Licht. Die Regenfront schien abzuwarten, lauerte dunkel im Westen.
Die Frau mit den weißen, straff nach hinten gebundenen Haaren kramte Briefe aus einem roten Rucksack, sie breitete sie vor sich aus. Wie konnte es sein, dachte sie, daß es so viele Zeugen gab? Wo doch alles so tief in der Nacht geschehen war. Alle hatten es gesehen, auch der Bruder und der Freund des Bruders. Und sie selbst hatte nur geschrien und hatte nichts denken können außer daran, daß jetzt durch den Lärm ihre Puppe aufwachte und nicht wieder einschlafen würde, und dann war sie selbst eingeschlafen, während die Eltern unter Schlägen aus dem Haus getrieben worden waren. Die Nachbarn hatten es später erzählt.
Sie hatte versagt, sie war nicht auf der Hut gewesen. Seit dieser Nacht schlief sie nicht mehr wirklich.
Als die ersten Tropfen fielen, kamen sie Janne van Lent vor wie Tränen. Wer weinte da? Sie blickte zum Himmel. Die Sonne war hinter den dunklen Wolken verschwunden.
Verdammt, dachte sie, wer weint da oben!
Der Regen wurde stärker. Janne blieb sitzen.
Sie kramte noch einmal den Genever hervor und goß den Becher voll. Der Regen lief in das Gefäß, doch Janne war es gleichgültig. Der Regen lief an ihrem Gesicht herunter. Sie schob die Unterlippe vor. Sie spürte, wie der Regen in ihren Mund lief. Sie trank den Regen. Er schmeckte nach Tränen.
Sie konnten den Park bei Tageslicht genießen. Im blühenden Garten hinter dem gelben Gebäude der Orangerie ließen sie sich auf einer Decke nieder. Vor ihnen breiteten sich die ehemaligen Fischteiche aus, die abgestuften Baumterrassen endeten vor dem Himmel mit einer dunkelgrünen, breit gesäumten Verzierung von dicht belaubten Kronen.
Andrea trug ein den warmen Temperaturen angepaßtes Kleid unter einem burgundroten Oberteil, ihre weißblonden Haare hielt sie mit einer Spange. Sie zückte ihren digitalen Fotoapparat und nahm Velsmann vor der Orangerie auf. Er merkte, daß sie unbedingt das vorkragende Schieferdach, das die Sonnenstrahlen auf zehn hohe Glasfenster darunter lenkte, mit ihm zusammen ins Bild bringen wollte. Sie probierte lange, dann drückte sie auf den Knopf.
Andrea sagte nicht, was sie empfand, aber er kannte sie genau, ihre Augen leuchteten verräterisch. Sie kramte eine Bastschale mit den ersten Erdbeeren des Jahres aus ihrer Handtasche und hielt Velsmann eine besonders schöne hin. Er fragte, ob sie ihn zu irgendwas verführen wolle. Zum Hineinbeißen, sagte sie. Sie sah ihm zu, wie er die süße Frucht in den Mund gleiten ließ. Dann legte sie den Kopf in den Nacken.
Martin Velsmann entspannte sich und blickte zu einem jungen Paar hinüber, das gerade die Wiese unter den blühenden Obstbäumen mit großen Gesten und lauten Stimmen betrat. Das Paar wirkte wie zitternd vor Vorfreude auf ein Ereignis. Die junge Frau öffnete eine Wasserflasche aus Plastik. Es zischte. Er zog seine Schuhe aus, blies Staub fort und lachte. Sie legte sich hin und streckte die halbnackten Arme über den Kopf. Er begann, in einem Programmheft zu lesen. Sie setzte sich wieder auf. Er legte das Heft zur Seite. Als Velsmann wieder hinübersah, lagen beide nebeneinander. Sie hatte ihr rechtes Bein über seinen Unterleib gelegt.
Andrea sagte: »Das ist Gänsefingerkraut. Es bringt Glück.«
Velsmann nahm den fünfblättrigen Stengel entgegen. »Verwechselst du das nicht mit Glücksklee?«
»Nein, es unterscheidet sich ganz und gar, siehst du das nicht? Es besitzt eingeschnittene, gemaserte und geriffelte Blättchen.«
»Und Klee?«
»Auch. Aber es ist kein Klee.«
Die Sonne schien warm, aber im Hintergrund tauchten Wolken auf. Ein Eichelhäher stieß einen schrillen Warnruf aus. Velsmann mußte fast im gleichen Augenblick an den Tod denken. Er schämte sich dafür. Du bist im Ruhestand, sagte er zu sich selbst, dann gib auch endlich Ruhe. Er schaute wieder zu dem glücklichen Paar hinüber. Sie wirkten noch immer erregt. Die Frau lag jetzt auf dem Bauch und las im Programmheft. Der Mann kehrte ihr im Sitzen den Rücken zu und sprach. Velsmann konnte nicht verstehen, worüber. Seine Stimme klang dunkel. Sie lachte einmal hell auf. Jetzt begriff Velsmann, daß er telefonierte, sein Handy am rechten Ohr mußte sehr klein sein. Er sprach unaufhörlich. Die junge Frau drehte sich zur Seite, legte den Kopf auf ihre nackten Arme und schloß die Augen.
»Wußtest du«, fragte Martin Velsmann, »daß die Zisterziensermönche beim Essen eine geheime Zeichensprache entwickelten, um sich zu verständigen und das Sprechen zu vermeiden?«
»Nein. Warum?«
»Die Klosterregel bestimmte es, beim Essen bedeutete verbotenes Sprechen den Verlust einer Mahlzeit. Man versuchte, das zu umgehen. Heute sprechen wir viel zuviel, vielleicht weil das nicht mit dem Entzug von Nahrung bestraft wird.«
Andrea hatte einen Grasfleck auf ihrem hellen Kleid und wollte gehen. Sie erhoben sich. Von Osten her, dort, wo das Gebirge lag, näherte sich die dunkle Wolkenfront.
Als sie an großen Tontöpfen mit noch nicht blühenden Fuchsiensträuchern und Rhododendron vorbeigingen, fielen erste Tropfen. Schon wenig später troffen bereits die mächtigen Thujas plicatas vor dem Eingang zur Sakristei, ein nasser Vorhang. Sie konnten sich nicht mehr im Kreuzgang aufhalten, weil der einsetzende Regen auf die alten Steine spritzte. Es war wie ein Überfall.
Andrea zog Velsmann in die Klosterkirche. Dort hatte man den Konzertsaal inzwischen in den Andachtsraum zurückverwandelt, nur noch das vordere Drittel des Mittelschiffes war bestuhlt. Bis dorthin, wo der Echohall einsetzte. Andrea hatte ihm während der Herfahrt erzählt, daß die klösterlichen Baumeister Akustik und Verzögerung bewußt eingebaut hatten, denn der Hall diente den Gesängen der Mönche und den liturgischen Responsien, den Antworten.
Sie setzten sich an den Rand. Auch das weiße Licht, das durch die Obergadenfenster einfiel, war gewollt, es war das klösterliche Licht der Zisterzienser.
Es waren nur wenige Kirchenbesucher da. Die Musik war seit gestern verstummt. Jetzt war nur noch die Architektur zu bewundern, die nackte, graue Basilika auf dem Grundriß des lateinischen Kreuzes. Aber in Velsmann stieg die Musik des Vorabends auf, er merkte, wie sehr ihn das Erlebnis nachträglich ergriffen hatte, vor allem die hellen Stimmen und Instrumente strahlten noch immer. Am schönsten war es gewesen, wenn die alten Instrumente mit ihrem ungewöhnlichen Klang einzeln klar zu vernehmen waren.
Martin Velsmann staunte selbst darüber, daß er plötzlich über das Individuelle dieser Töne zum Zeitpunkt der Komposition nachdachte. Das Jahr 1610 war sicher keine Zeit für Egotrips gewesen, aber er wußte nichts darüber. Diese Musik sprach davon, daß es auf jeden einzelnen ankam. Wieder stellte sich Martin Velsmann eine Teamsitzung im Präsidium vor – das war sein Erfahrungshorizont. Alle redeten durcheinander, wenn sie nicht zurechtgewiesen wurden oder eine anwesende Autorität den Ton angab. Vor allem Poppe hielt sich nie an Regeln. Wie mochte es seinen Assistenten gehen, Tosca Poppe und Alfons Freygang? Aber er verdrängte den Gedanken, das war weit entfernt. Es war aus einem anderen Leben.
Während sie andächtig in der Basilika saßen und ihre Blicke schweifen ließen, das Licht sich langsam veränderte, entstand ein neuer Ton. Er kam von draußen. Das Rauschen des Regens wurde lauter. Velsmann hatte Mühe, es zu überhören. Es ist mehr als ein Rauschen, dachte er, wenn die Musik noch spielte, würde das Ave maris stella noch gewaltiger klingen. Er stellte sich eine Regensinfonie vor und sah, wie es spritzte.
Plötzlich hörte Velsmann einen spitzen Schrei. Unruhe entstand ein paar Reihen seitlich von ihm. Jemand stand auf und beschrieb mit den Armen einen Halbkreis. Stühle wurden verrückt. Velsmanns Nachbar, ein paar Stühle weiter zur Linken, beugte sich vor und starrte wie betäubt zu Boden. Martin Velsmann nahm in diesem Moment wahr, wie Wasser seine Füße umspülte.
»Siehst du das?« fragte er leise.
Auch Andrea schrie auf. »Du meine Güte! Woher kommt das!«
»Es regnet«, sagte Velsmann.
Er bemerkte, daß immer mehr Wasser von einer Seite aus eindrang, von dort, wo sich die Klostergasse zwischen Basilika, Bibliothek und Laienrefektorium befand. Auf diesem Hof erhob sich plötzlich aufgeregtes Geschrei, das bis in die Kirche drang. Jetzt standen die Besucher in der Basilika auf. Ein Prasseln nahm zu.
Der letzte Ton, den Velsmann von der längst abgebauten Bühne wahrzunehmen glaubte, waren zwei pikante, hohe Männerstimmen im sechsten Stück. Dann sprang er auf, weil eine Welle heranschoß. Im gleichen Moment brach die Musik in seinem Kopf ab.
Um Andrea und Velsmann herum sprudelte es. Unter der Auslegware, die im Mittelgang die alten, rotbraunen Fliesen bedeckte, quoll mit verhaltenem Blubbern dunkles Wasser heraus. Blasen bildeten sich zu den Füßen der Besucher. Schmatzende Geräusche entstanden, als genieße jemand die Situation. Die ersten leeren Stühle schwammen durch das rechte Seitenschiff davon.
Velsmann packte die Hand von Andrea und zog seine Frau mit sich. Vor ihnen stolperten Besucher davon.
Ein Programmheft vom Vorabend trieb vorbei, darauf Claudio Monteverdi mit wäßrigem Bart. Jemand begann zu weinen. Ein Mann schrie eine grobe Verwünschung. In den Eingängen tauchte eine junge Frau der Klosterstiftung in blauweißer Kleidung mit rotem Halstuch auf, sie breitete die Arme aus.
»Keine Panik! Bitte, keine Panik! Um Gottes willen … !«
Jemand stieß die Hosteß zur Seite. Sie stolperte über die ausgelegte Rampe, die zur erhöht liegenden Ausgangstür führte. Sie stürzte Martin Velsmann vor die Füße. Er half ihr auf die Beine. In ihren Augen stand ein Entsetzen, das Velsmann für übertrieben hielt. Wir sind nicht auf der Titanic, dachte er.
Auf dem Klosterhof, zwischen Fraternei, Refektorium der Konversen und dem darüber liegenden Dormitorium, schäumte ein wildes, reißendes, braun gefärbtes und gefährlich sprudelndes Wasser. Schlamm ergoß sich von allen Seiten in den Hof, klatschte gegen die Mauern des Laienrefektoriums und rutschte zur anderen Seite über die Treppen hinab in den Kreuzgang. Kaskaden von Wasser schossen über das natürliche Gefälle hinab in das Tal des Gartens mit dem Brunnen und suchte sich einen Weg in Richtung Orangeriegarten, wo sie vorhin noch gesessen hatten. Notenblätter trieben den Hof hinab, eingekeilt in Geröll, Äste und Unrat.
In der Mitte der Klostergasse sprudelte in einer langen Linie das Wasser wie aus einem Brunnen empor.
Andrea stand im Nu bis zu den Oberschenkeln im Wasser, Martin Velsmann bis zu den Knien. Und das Wasser stieg schnell. Neben ihnen brach in einer Mauer ein mannshohes Loch auf, das Wasser schoß gurgelnd hinein. Andrea mußte sich an Velsmann klammern, um nicht fortgerissen zu werden.
Jemand in der Klostergasse hatte plötzlich ein Schlauchboot. Er paddelte mit den Händen. An der offenen Tür zum Kabinettkeller verkeilte sich das Gefährt und schien zu kippen, der Mann in der blauen Montur eines Hausmeisters sprang heraus, fiel ins Wasser und verschwand im Keller. Velsmann griff geistesgegenwärtig nach dem Schlauchboot, in dem mehrere Spaten lagen. Andrea ließ sich einfach hineinfallen, Velsmann stieg dazu. Dann schoß das Gefährt auch schon in den Kabinettkeller.
Martin Velsmann konnte nur schwer mit beiden Händen lenken, er griff nach einem der Spaten, damit ging es leichter. Sie wurden in die weite Halle des Laienrefektoriums hineingespült. Jetzt nutzte der Spaten nichts mehr, es ging in rasender Fahrt durch die langgestreckte, düstere Halle, vorbei an den mächtigen Dockenkeltern aus geschwärztem Eichenholz, gegen die das Boot ebenso stieß wie gegen die klobigen Mittelsäulen. Das Boot drehte sich um sich selbst, ein Strudel nach dem anderen ließ es umhertanzen.
Velsmann sah den Mann in blauer Montur im Wasser, er hielt jetzt eine Rohrzange mit langen Griffen in der Hand, bevor Velsmann ihn auffordern konnte einzusteigen, drehte er sich ab und wurde fortgerissen. Andrea schrie immer wieder auf, Velsmann hörte sich fluchen. Er versuchte, das Gefährt von den rauhen, mit Schimmel der Jahrhunderte besetzten Wänden so abzustoßen, daß er die Richtung bestimmen konnte. Vergeblich.
Jetzt wurden sie wieder in die Klostergasse hinausgespült, der Sog war unwiderstehlich, Velsmann warf den Spaten ins Wasser, sie drehten sich mehrmals um sich selbst, dann ging es über Stufen hinunter durch das Doppelportal in den Kreuzgang.
Das Schlauchboot trieb, ohne daß Velsmann es jetzt noch steuern konnte, vom Gang in die abschüssige Fraternei, dann auf den Kassenraum zu. Martin Velsmann nahm wahr, daß die Kassiererinnen von Uniformierten in Rettungssitzen herausgehoben wurden. Auch ein Besucher wurde gerettet. Hier mußte das schäumende Wasser zuerst eingedrungen sein, es stand besonders hoch und wirbelte in Strudeln. Es stieg unaufhörlich.
Aussteigen war unmöglich, wäre auch zu gefährlich gewesen. Das fragile Boot bot immerhin den Schutz einer festen Außenhaut. Möbelstücke und Verkaufsmaterial aus dem Kassenraum und Flaschen aus den Vitrinen schossen vorbei, von Strudeln hin und her gerissen. Dann trieb das Schlauchboot hinaus in den Park.
Auf allen erhöht liegenden Zufahrtswegen erschienen Feuerwehrfahrzeuge mit jaulenden Sirenen und wirbelndem Blaulicht. Die Parkwege standen unter Wasser, aber die Strömung war hier nicht mehr so stark. Irgendwo schien das unaufhaltsame Wasser abfließen zu können.
Die letzte Etappe waren die Steinstufen zum noch tiefer liegenden Teil des Gartens. Das Schlauchboot drehte sich, schlug gegen die Sandsteinfassung des Portals und dahinter gegen eine Mauer aus Bruchsteinen und holperte mit dem weißen Strom des Wassers über die Treppen. Die schäumenden Kaskaden trugen es mit Schlägen über jede einzelne Stufe hinunter. Es strandete in Rosensträuchern.
Andrea verfing sich mit ihrem Kleid in den Sträuchern, und Velsmann sprang aus dem Schlauchboot und befreite sie. Er mußte den Rock ihres Kleides zerreißen. Sie setzten sich außer Atem auf eine Bank und sahen hinüber zu den Gebäuden, aus denen noch immer das gurgelnde Wasser schoß. Sie merkten nicht, wie fest sie sich umklammerten.
Vor der Sakristei, zwischen altem Hospital und Kirche und zu allen Seiten des Parks trieben Menschen dahin, versuchten zu fliehen, taumelten, richteten sich auf und stürzten.
Wie auf der Titanic, dachte Martin Velsmann fassungslos.
3.
Dienstag, 26. April 2005
»Freygang, Freygang«, sagte Tosca Poppe. Sie hielt sich dabei die Nase zu, so daß es wie eine Lautsprecherdurchsage klang. »Bitte zurücktreten von der Thekenkante.«
»Mal sehen, was gibt’s denn – ah! Beefsteak von Tartar! Wie auf der Polizeihochschule! Was ist denn los, sonst gibt’s doch hier nur rohe Karotten?«
»Der Präsident soll auf eine Visite kommen, der braucht was Kräftiges.«
»Was will der hier?«
»Überprüft alle Polizeidienststellen in Hessen, seitdem der betrunkene Inder in der Ausnüchterungszelle zu Tode gekommen ist.«
»In Kassel?«
»In der Ausnüchterungszelle.«
»Ißt er denn mit uns?«
»Wer? Der Inder?«
»Tosca, Tosca! Dir ist wohl gar nichts heilig! Respekt vor den Toten!«
Sie waren an der Kasse angelangt und suchten sich in der vollen und lauten Kantine einen Platz an der Wand. Tosca erregte wie immer Aufsehen bei den Beamten. Sie trug ihre Lieblings-Zebrastreifenhosen, knalleng, mit goldenem Gürtel, darüber etwas Wuscheliges aus lila Plüsch. Beim Gehen durch die Reihen wackelte sie provokant mit dem Hinterteil. Freygang ruckte verlegen mit dem Kopf, als trüge er einen Schlips, der ihm zu eng war. Seit er Ehemann war, hatte er seine Lockerheit verloren. Jetzt war ihm plötzlich manches peinlich.
Warum eigentlich?
»Warum eigentlich«, sagte Tosca spitz, »muß man sich dauernd sagen lassen, was man lassen soll? Von dir beispielsweise. Kann ich das nicht selber entscheiden? Bin ich etwa nicht aus Thüringen?«
»Und welches Recht gibt dir das? Lernt man da mehr als anderswo?«
Sie setzten sich. Tosca stützte den rechten Ellenbogen auf und aß, indem sie die Gabel wie ein Messer hielt, das sie in die Beute stach. Es schien ihr zu schmecken. Schon nach wenigen Bissen legte sie die Gabel klirrend auf den Teller und lehnte sich zurück.
»Ich sag dir was, Alfons …«
»Inspektor Freygang, Vorgesetzter …«
»Laß dir was von deiner Assistentin gesagt sein …«
»Das Essen schmeckt dir.«
»Nein. Mir fehlt der Hauptkommissar! Irgendwie ist da eine Leerstelle, verdammt noch mal. Velsmann gehört doch einfach zum Team! Warum ist er ausgebüchst!«
»Tosca! Bist du dreizehn, oder was? Er ist nicht ausgebüchst! Er hat den Dienst quittiert, weil er nicht immer rohe Karotten in der Kantine …«
»Jetzt bist du dreizehn! Ich weiß schon, warum er aufhörte. Aber ich empfinde es als Davonrennen. Wir sind doch auch im Dienst geblieben, hier, bei all den Karottenschälern, Quenglern, Nörglern, Besserwissern in ihren zu engen Unterhosen. Und bei den Massenmördern, die draußen herumschleichen. Warum konnte also er es nicht, verdammt!«
Einige Kollegen wendeten den Kopf und blickten kauend herüber. Freygang versuchte, seine Assistentin zu beruhigen.
»Schrei nicht so! Wir sind nicht allein. Sie warten doch nur drauf, Velsmann was dafür anzuhängen, daß er den Dienst einfach vorzeitig quittierte, und sie selbst dürfen es nicht. Liefere ihnen bloß keine Anregungen.«
»Ich schreie, wie es mir … ja, schon gut. Ich vermisse ihn eben einfach.«
»Meinst du, ich nicht? Zum Glück haben wir im Moment nur Hühnerdiebstähle und Kleinkram, aber ich weiß nicht …«
»Du nennst die Vergewaltigungen in Künzell Kleinkram?«
»Nein, Hühnerdiebstahl!«
»Komm du nach Hause, Inspektor!«
Als sie ihre Mahlzeit beendet hatten, war die Mittagspause noch nicht vorbei, aber sie standen auf und gingen hinaus. Tosca wollte rauchen.
Endlich regnete es nicht mehr, doch die Luft dampfte, für die Jahreszeit zu warm und zu dick. Tosca Poppe, die ihren Namen nach der Heirat behalten hatte, und Alfons Freygang, der nach Velsmanns Abschied zum jüngsten Inspektor Fuldas aufgestiegen war, überquerten den Platz zum Bonifatiusdenkmal und setzten sich unter eine schon blühende Kastanie in den Garten des Café Palais. Es war nicht das nächstliegende Café, aber das schönste. Sie behielten die Uhr im Auge, überflogen gemeinsam die gerade eintreffende Nachmittagsausgabe der Zeitung und bestellten Cappuccino. Tosca sog den Rauch ihrer filterlosen Zigarette wie eine Verdurstende ein und schnippte das abgebrannte Streichholz auf den Sandboden. Alfons Freygang legte eine Hand auf den Oberschenkel seiner jungen Frau.
»Ich glaube«, sagte er und schüttelte den Kopf, »ich sollte auch den Dienst quittieren.«
»Und ich kriege eine Migräne«, sagte Tosca, »wenn ich all diesen Scheiß hier lese.«
Ich werde dich töten, dachte Janne van Lent. Jetzt bin ich auf deiner Spur. Und wenn ich auch Angst habe vor dem, was mich erwartet, ich werde es tun. Du entkommst mir nicht.
Während sie diesen ersten Gedanken an einem trüben Morgen dachte, versuchte sie, wach zu werden. Sie schlief nie wirklich, aber zwischen Dunkelheit, Vergessen und dem heller werdenden Licht von draußen gab es immerhin Abstufungen, jetzt war sie wieder bei Sinnen. Sie blickte auf die Armbanduhr. Kurz nach sieben. Ein neuer Frühlingstag. Es regnete nicht mehr.
Janne hatte das Gefühl, in einen Tag hineingeboren zu werden, der so sinnlos war wie die vergangenen. Alles schien ihr gleich weit entfernt. Nichts zum Greifen nah. Sie hätte einfach liegenbleiben können. So lange, bis der Tod einsetzte.
Aber sie richtete sich auf. Tat das, womit sie es schaffte, in den Tag hineinzukommen. Es war wenig genug. Immerhin konnte sie ihre Glieder jetzt frei bewegen.
Sie schaute durch die leicht beschlagenen Fenster nach draußen. Am linken Seitenfenster hatte sich eine Perlenschnur aus Regentropfen gebildet, die sich langsam nach unten bewegte. Klirrte es nicht sogar leise? Janne kurbelte das Seitenfenster herunter. Ringsherum Grün.
Als sie in der Nacht den Waldweg gesucht hatte, bog sie von der Straße nach Fulda ab, kam durch eine kleine Ortschaft namens Döllbach und hatte die Schneise gesehen, die der Feldweg in den Wald hinein schlug. Sie achtete darauf, weit genug von der Straße entfernt zu sein, aber nicht so weit, daß es Verdacht erregen konnte, falls jemand sie sah. Darauf achtete sie immer.
Aber wer sollte sie schon sehen? Sie war daran gewöhnt zu denken, daß sich für sie niemand interessierte. Und die Spuren verwischen, das hatte sie inzwischen gelernt.
Sie rutschte über die Rückbank und stieg aus dem Auto. Dann reckte sie sich. Auf den jungen, Ende April noch zartgrünen Blättern lag Tau, oder war es Regenwasser? Janne streifte die Feuchtigkeit von den Zweigen ab und strich sie mit flachen Händen über ihr Gesicht, dessen Haut sich spannte. Es erfrischte. Sie wiederholte den Vorgang, verbarg ihr Gesicht in den Händen. Nach einem Moment spürte sie ein Brennen im Gesicht. Sie versuchte, das Brennen mit dem Tau der Blätter abzuwaschen, aber es verstärkte sich noch.
Sie ging zum Auto und blickte in den Seitenspiegel. Sie erschrak. Ihr Gesicht war fleckig und rot.
Sie spritzen die Sträucher, dachte sie. Ich habe mir ihr Gift in die Haut eingerieben!
In einem Anflug von Panik öffnete sie ihren Rucksack, der auf dem Beifahrersitz lag, holte eine große Plastikflasche Mineralwasser heraus und ließ es über ihr Gesicht laufen. Die Flüssigkeit lief ihr in den Hemdkragen hinein. Sie hörte nicht auf, bis die Flasche leer war. Nach einer Weile ließ das Brennen nach. Janne blickte wieder in den Rückspiegel. Die Rötung blieb. Sie setzte die Sonnenbrille auf.
Janne setzte sich auf den Platz hinter dem Steuer. Sie blickte aus der Frontscheibe in den Waldweg hinein. Es war still, doch allmählich setzte ein Geräusch ein, das sie in den letzten Tagen begleitet hatte. Erst schlugen einzelne Tropfen auf das Autodach, als trommelte jemand mit den Fingerknöcheln, dann wurde das Pochen weicher, und es begann zu rauschen.
Sie schlug die Seitentür zu. Der Regen wurde im Nu so dicht, daß Janne nicht mehr hinaussehen konnte. Sie fühlte sich wie in einer automatischen Waschanlage. Sie blieb sitzen, legte dann langsam den Kopf auf die Hände, die das Steuerrad umfaßten. Sie bewegte den Kopf leicht hin und her. Sie fror.
Wann wird das vorbei sein? dachte sie. Wann kann ich dieses Land wieder verlassen? Ich werde ihn finden. Und töten. Aber auf diesem abschüssigen Weg darf ich nicht verzweifeln. Ich muß mich an die Äußerlichkeiten halten. Ich darf nicht absinken.
Ich werde mir ein Hotel suchen, beschloß sie, ein gutes Hotel. Nur für den letzten Tag. Auch das ist wichtig. Wenn man jemanden umbringen will, dachte sie, ist auch das Wohlbefinden wichtig.
Sie wußte jetzt ganz genau, wen sie suchte. Es hatte lange gedauert, aber jetzt wußte sie es. Es würde ein Wettlauf werden. Er oder ich, dachte sie. Aber wer so lange wie ich eine Spur verfolgt hat, kann nicht mehr verlieren.
Sie hatte sich an ihn gehängt, und er wußte es nicht. Er konnte es nicht wissen. Das war ihr Vorteil. Er wiegte sich in Sicherheit, das war ihr klar.
Die Spur führte genau hierher, in diese Region. Sie wußte jetzt, wo er wohnte. Erst vor wenigen Tagen hatte sie ihn gesehen, und er sah arglos aus. Es war allerdings im westlichen Teil des Landes gewesen, ungefähr zweihundert Kilometer von hier. Dort hatte er früher eine leitende Stellung eingenommen. Irgendwann war er dann fortgezogen. Hierher. Sie hatte den Eintrag im Meldeamt eingesehen. Und sie hatte ein paar Seiten darüber geschrieben, denn er war der Haupttäter auf ihrer Liste. Einer Liste, die jetzt abgearbeitet werden mußte.
Sie wußte inzwischen, der Observierte besaß morsche Knochen, irgendeine Art Gicht, die bei nassem Wetter unangenehm wurde. In diesen Tagen litt er also. Und sie wünschte es ihm, sie wünschte, daß der Regen noch stärker würde. Sonst wirkte er wie ein Mann ohne Sorgen. Ein Mann, für den die Welt ein Vorhof war, über den er schritt. Er wußte noch nicht, daß hinter dem Eingang der Schrecken lauerte.
Oder konnte es doch sein, daß er mich nur in Sicherheit wiegen will? dachte Janne. Habe ich etwas übersehen? Habe ich einen Fehler gemacht?
Sie erschrak jäh bei diesem Gedanken. Unwillkürlich sah sie sich nach allen Seiten um. Aber die Autoscheiben blieben beschlagen, und im Wald blieb alles ruhig.
Ich will nicht in seine Falle tappen, dachte sie. Mit dem Fallenstellen ist er ja berüchtigt geworden.
Wenn ich ihn töte, dachte sie, will ich das namenlose Erstaunen in seinen Augen sehen. Und dann die späte Ahnung, das Erkennen im Moment des Todes. Seine Augen werden brechen, und das Entsetzen darüber, doch noch eingeholt worden zu sein, wird darin erfrieren, und es wird stehenbleiben bis in alle Ewigkeit.
Das ist es, was ich will.
Sie hatte lange gebraucht, um diesen Wunsch zu begreifen. Sie benötigte manchmal sehr viel Zeit, um sich über die eigenen Motive klarzuwerden. Woher kam das? Litten andere Menschen auch darunter?
Lange Zeit hatte sie nur abgewartet. Dabei hatte sie überhaupt nichts empfunden außer einer dumpfen Angst. Und ein bohrendes Schuldgefühl. Stimmen hinter ihr hatten gemahnt. Dann begriff sie, daß sie es war, die handeln mußte. Es kam auf sie an. All dieses Furchtbare um sie herum konnte nur aufhören, wenn sie etwas tat. Sie mußte sich in Bewegung setzen. Dann würde sie begreifen, wer sie selbst war.
Es war immer so gewesen. Sie sah sich selbst nicht deutlich. Wenn jemand mit dem Finger auf sie zeigte, erschrak sie zu Tode.
Sie war sich fremd, nicht eins mit sich. Nicht daran gewöhnt, etwas zu entscheiden.
Aber jetzt, in diesem verregneten Land, wurde ihr vieles klar.
Sie frühstückten auf der überdachten Terrasse, an die Rebstöcke stießen, die Trauben waren trotz des milden Klimas noch klein wie blaßgrüne Erbsen. Der Blick ging über den Rhein bis zu den rheinhessischen Weinbergen. Der Schrei eines Vogels war zu hören, in der Ferne ein Zuggeräusch, es war schön, keine Autos zu sehen.
Es regnete noch leicht, die Feuchtigkeit saß überall, aber drinnen im Gastraum war es stickig, außerdem störten Andrea dort die goldgerahmten Aquarelle und bestickten Wandmatten auf Rauhputz. Draußen war die Luft warm. Jemand putzte eine trockene Fensterscheibe, und es hörte sich an wie Frauenkichern. Die Wirtin ging vorbei und grüßte im Dialekt, sie trug etwas Undefinierbares, das einem Schlafanzug glich.
Martin Velsmann atmete tief ein, die Luft schmeckte weich, nach Erde und Wasser. Als die junge Bedienung in Schwarz zu ihnen kam, ein frisches, blondes Mädchen, das lange schaute und sich am Arm rieb, bestellten sie. Wenig später kam das Frühstück, und die Bedienung stellte auch zwei kleine Flaschen Wasser Black Forest auf den Tisch. Martin Velsmann hätte geschworen, daß es aus dem Schwarzwald kam, konnte aber das Etikett nicht entziffern.
»Es ist doch unglaublich«, entfuhr es Velsmann. »Was ist eigentlich los in diesem Land!« Er rieb sich schmerzende Stellen an Armen und Schulter.
Andrea hatte die Morgenzeitung aufgeschlagen. In dem Aufmacherartikel kamen sie vor, zwei in einem Schlauchboot. Es hatte ein paar Verletzte gegeben, zum Glück aber keinen Toten. Unter Schock waren vier ältere Klosterbesucher in das benachbarte psychiatrische Krankenhaus eingeliefert worden.
»Wir haben schweres Glück gehabt«, sagte Andrea und tastete nach ihrem Pflaster, das ihre rechte Stirnseite bedeckte. »Die Schlammlawine hat das halbe Kloster begraben. Sie befürchten, es ist für immer verloren.«
»Ach, es ist Weltkulturerbe«, sagte Velsmann und trank Black Forest, »sie werden es schon retten. Dafür wird immer Geld aufgebracht.«
»Es steht alles unter Dreck und Wasser!«
»Wie kann so was passieren?« sagte Velsmann kauend. »Es regnet doch nicht zum erstenmal in Hessen. Ich dachte die ganze Zeit: Das kann nicht wahr sein, ich träume! Das gibt es doch einfach nicht!«
Andrea las den Artikel. »Die Zeitungsschreiber haben Humor. Es ist allerdings auch nicht ihr Schaden«, sagte sie und griff nach der Kaffeetasse. »›Wasser zu Wein! Staatsweingut Kloster Eberbach überschwemmt!‹«
»Lies mal vor.«
Andrea stellte die Kaffeetasse ab. »›Der Kisselbach ist normalerweise ein Bächlein. Ein beschauliches Gewässer, das aus dem Taunus in die Weinberge des Rheingaus gluckert. Und keinesfalls ein Strom, von dem gravierende Hochwasserwellen zu erwarten wären. Wohl auch deshalb werden sich die Mönche des Zisterzienserklosters oberhalb von Eltville nur wenig Gedanken um mögliche Fluten gemacht haben, als sie um das Jahr 1750 beim Bau des neuen Krankenhauses den Bach nicht nur kanalisierten, sondern in einem Gewölbe unter dem Kloster hinweg führten. Den spärlichen historischen Bauzeichnungen zufolge ist das gemauerte Halbrund mal nur 50 Zentimeter, mal aber auch fast zwei Meter hoch. 350 Jahre lang ging das gut. Bis Montagabend.‹«
»Aha«, murmelte Martin Velsmann. »Und ausgerechnet wir müssen dabeisein.«
Andrea trank einen weiteren Schluck Kaffee, blickte dann über die Weinberge und las weiter.
»›Starkregen, der auf den Kleinen Feldberg im Taunus innerhalb von 24 Stunden mit elf, auf dem Frankfurter Flughafen sogar zweiundzwanzig Litern in 24 Stunden niederprasselte, ließ den Kisselbach anschwellen. Ein wilder, reißender, braun gefärbter, gefährlich sprudelnder Bach entstand. Doch das allein hätte die Überschwemmung mit ihren Massen von Schlamm, die sich über das Klosterareal ergossen, noch nicht verursacht. Irgendwo in dem mehr als hundert Meter langen Gewölbe muß es eine Blockade gegeben haben. Vielleicht ist ein Teil des Kanals eingestürzt, vielleicht haben sich irgendwo Geröll, Äste, Unrat verkeilt und einen Rückstau ausgelöst. Bis gestern nacht wußten das die Feuerwehr und die Leitung der Stiftung Kloster Eberbach noch nicht. Denn an den eigentlichen Ort des Unglücks war noch kein Herankommen.‹«
»Unglaublich«, brummte Martin Velsmann. »Das ist mal ein Tatort. Zum Glück geht es mich nichts an. Ich kann einfach hier sitzen bleiben und in mein Brötchen beißen.«
»›Soviel steht fest‹«, las Andrea weiter, »›mitten auf dem Hof zwischen dem Hospital und der Fraternei mit dem darüber liegenden Mönchsdormitorium hatte sich der Bach mit Gewalt einen neuen Ausgang gesucht und war sprudelnd an die über einen halben Meter darüber liegende Oberfläche geschossen.‹ – Na ja, den Rest kennen wir.«
»Irgendwas in dem Gewölbe hat eine Blockade bewirkt?« fragte Velsmann. »Kein Wunder, sollte es seit 1750 nicht mehr gewartet worden sein.«
»Wahrscheinlich kann man nur in einem Boot unten hindurchpaddeln«, vermutete Andrea.
»Laß uns mittags noch mal rüberfahren«, schlug Velsmann vor. »Wandern ist sowieso nicht drin bei den aufgeweichten Wegen zwischen den Weinbergen. Und wir können nicht den ganzen Tag Winzerplatten essen. Ich will mir das noch mal gründlich ansehen.«
»Sie werden alles abgesperrt haben«, vermutete Andrea.
»Ich kenne den Verwalter von einer früheren Ermittlung. Ein Herr Reinhard. Er wird uns schon reinlassen. Stell dir bloß mal vor, der Weinkeller wird überspült, dann treiben die ganzen teuren Flaschen davon!«
»Fast schon komisch«, meinte Andrea. »Aber das Lachen bleibt einem im Hals stecken. Denn hier steht ja, daß einige Leute mit einem Schock ins Krankenhaus gebracht werden mußten. Und einen Monteur aus Kiedrich hat es am übelsten erwischt, er hat sich beide Beine gebrochen.«
»Den haben wir doch vorbeitreiben sehen«, meinte Velsmann. »Ich habe versucht, nach ihm zu greifen …«
»Er stürzte immer wieder ins Wasser«, erinnerte sich Andrea und schüttelte sich. »Ich sehe das Bild noch vor mir.«
»Hat es im Kloster nicht früher einmal einen Mord gegeben? Ich meine, etwas darüber gelesen zu haben. Irgendein Abt. Aber es kann auch in einem anderen Kloster gewesen sein.«
»Kloster Eberbach, ein Ort des Verbrechens!« sagte Andrea und beschrieb mit der Hand eine Schlagzeile in Augenhöhe. »Aber du bist nicht mehr im Dienst, komm nicht auf die Idee, da irgendwas umzugraben.«
»Versprochen.«
»Es ist doch ungefährlich, wenn wir uns das ansehen?«
»Mal bloß den Teufel nicht an die Wand«, sagte Martin Velsmann.
Tosca Poppe hatte an diesem Nachmittag Besuch. Zuerst von Gedanken über ihren frisch Angetrauten. Ihm fehlt der Ehrgeiz, dachte sie und mußte lächeln, das ist vielleicht ein Alfons, er will gar keine Karriere machen, er ist Velsmannschüler. Unser lieber Hauptkommissar hat ihn geprägt.
Dann kam auch ein leiblicher Besucher. Revierleiter Friedrich, wie immer mit geröteten Wangen, die dünnen Haarsträhnen sorgsam über den Schädel verteilt, schob einen jungen Mann mit gelbem Hahnenkamm durch die Tür. Tosca wunderte sich über dessen schlechtsitzende Hosen, Jeans, die mindestens drei Nummern zu groß waren und augenblicklich in die Kniekehlen abzurutschen drohten. Sie selbst trug gern enge Hosen.
»Der junge Mann hat Ihnen etwas zu erzählen, nehmen Sie es bitte auf«, sagte Friedrich und verschwand wieder.
Tosca deutete auf einen freien Stuhl. »Also los.«
»Ich habe gestern nacht jemanden gesehen«, erklärte der junge Mann mit beleidigter Stimme.
»Aha«, sagte Tosca. »Wie heißen Sie übrigens?«
»Peter Kippers. Ich wohne in Döllbach, in der Rhön.«
»Aha«, sagte Tosca.
»Ich fuhr mit dem Fahrrad vorbei. Es war so um Mitternacht, Geisterstunde, ich kam vom Doppelkopf …«
»Ein Berg in der Rhön?«
»Ein Kartenspiel. Da sah ich ein Auto, irgendein Japaner, kann nicht sagen, was für einer. Ich stand gerade hinter den Bäumen, weil ich dringend …«
»Einen Neger abseilen wollte …«
»Nein, nur klein. Jedenfalls fuhr der Wagen von der Straße ab, direkt in den Waldweg rein, in dem ich stand.«
»Hinter Bäumen.«
»Na klar. Und als ich heute morgen wieder daran vorbeifuhr, stand das Auto immer noch da.«
»Aha«, machte Tosca, jetzt doch interessiert. »Und was haben Sie noch gesehen?«
»Sonst nichts.«
»Das Kennzeichen vielleicht?«
»Irgendeine Mietnummer mit HH, sonst nichts.«
»Saß jemand in dem Auto?«
»Na, von allein wird es nicht gefahren sein.«
»Schon, aber haben Sie jemanden darin gesehen? Den Fahrer? Einen Beifahrer? Hat im Rückfenster der Plastikhund mit dem Kopf gewackelt?«
»Nein, nichts.«