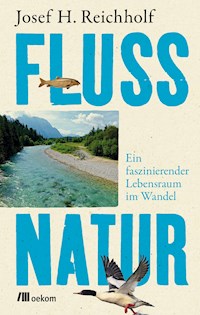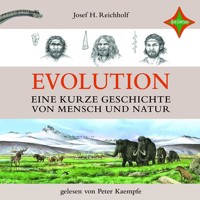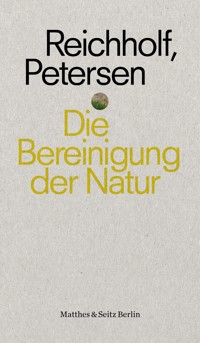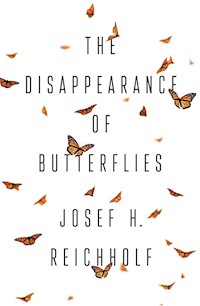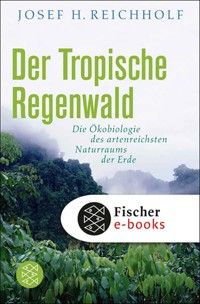19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Ein Buch, das die Wunder einer untergehenden Welt sinnlich erfahrbar macht. Warum schwinden die tropischen Regenwälder weiter, obwohl schon so lange klar ist, welch bedeutende Rolle sie global für Klima und Artenvielfalt haben? Das neue, große Buch von Bestsellerautor Josef H. Reichholf liefert Antworten. Es lädt dazu ein, den grünen Tropengürtel des blauen Planeten neu zu entdecken – bevor seine Pracht und Vielfalt für immer verloren gehen. Auf den opulenten Schautafeln Johann Brandstetters kommt uns eine untergehende Welt ergreifend nah. Wir verstehen, warum die Tropen eine so besondere Natur mit winzigen Kolibris und prachtvollen Orchideen hervorbringen konnten, aber auch, wie der Westen den Regenwald zerstört – und wie diese Vernichtung noch gestoppt werden kann »Hier gelingt etwas fast Vergessenes: die Schönheit der Welt in der Schönheit eines Buches einzufangen.« Katja Oskamp über »Symbiosen«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 292
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Über das Buch
Ein Buch, das die Wunder einer untergehenden Welt sinnlich erfahrbar macht.
Warum schwinden die tropischen Regenwälder weiter, obwohl schon so lange klar ist, welch bedeutende Rolle sie global für Klima und Artenvielfalt haben? Das neue, große Buch von Bestsellerautor Josef H. Reichholf liefert Antworten. Es lädt dazu ein, den grünen Tropengürtel des blauen Planeten neu zu entdecken – bevor seine Pracht und Vielfalt für immer verloren gehen. Auf den opulenten Schautafeln Johann Brandstetters kommt uns eine untergehende Welt ergreifend nah. Wir verstehen, warum die Tropen eine so besondere Natur mit winzigen Kolibris und prachtvollen Orchideen hervorbringen konnten, aber auch, wie der Westen den Regenwald zerstört – und wie diese Vernichtung noch gestoppt werden kann
»Hier gelingt etwas fast Vergessenes: die Schönheit der Welt in der Schönheit eines Buches einzufangen.« Katja Oskamp über »Symbiosen«
Über Josef H. Reichholf und Johann Brandstetter
Josef H. Reichholf, 1945 in Niederbayern geboren, war bis Mai 2010 Leiter der Wirbeltierabteilung der Zoologischen Staatssammlung München und Professor für Ökologie und Naturschutz an der TU München. 2007 wurde er mit dem Sigmund-Freud-Preis für wissenschaftliche Prosa ausgezeichnet. 2010 erhielt sein Bestseller »Rabenschwarze Intelligenz« den Preis »Wissenschaftsbuch des Jahres«. Zuletzt erschienen von ihm 2017 in den »Naturkunden« der als »Wissensbuch des Jahres« ausgezeichnete Band »Symbiosen« »Das Leben der Eichhörnchen« (2019) und »Der Hund und sein Mensch«.
Johann Brandstetter, 1959 in Oberbayern geboren, war zunächst Restaurator und wechselte später ins Fach der künstlerischen Illustration. Er hat fast 200 Bücher bebildert, seine Arbeiten wurden mehrfach ausgezeichnet. Studienreisen nach Zentralafrika, Asien und Mittelamerika inspirierten ihn zum Bilderzyklus »Symbiosen«, der 2016/17 in Salzburg in einer Ausstellung zu sehen war. Das gleichnamige Buch, dessen Text von Josef Reichholf verfasst ist, wurde mit dem Preis »Wissensbuch des Jahres« ausgezeichnet.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Josef H. Reichholf Johann Brandstetter
Regenwälder
Ihre bedrohte Schönheit und wie wir sie noch retten können
Illustriert von Johann Brandstetter
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Newsletter
Vorbemerkung – Amazonien brennt
Einleitung – Der grüne Gürtel
Teil I: Tropische Lebensvielfalt
Grünes Paradies – grüne Hölle
Erste Eindrücke vom tropischen Regenwald
Immense Artenvielfalt
Die Geographie des Artenreichtums
Seltene Jaguare, häufige Käfer und ausgestorbene Faultiere
Warum im Regenwald Riesen und Zwerge wohnen
Warum Kolibris so klein und Paradiesvögel so schön sind
Die tropischen Regenwälder im Vergleich
Wie sich tropische Regenwälder regenerieren – oder eben nicht
Wälder und ihre Rodung
Die Grundzüge der Waldnatur
Die Natur der Bäume
Der dünne Boden der Regenwälder
Wie ernährt sich der tropische Regenwald?
Menschliches Leben im Regenwald
Der Feuerplanet – von Brandrodungen und Biodiversität
Teil II: Warum die Regenwälder verloren gehen – und was daraus folgt
Der Mensch und der Wald
Wie die Vernichtung der tropischen Regenwälder begann
Grundlagen der tropischen Plantagenwirtschaft
Nach dem Gummiboom
Tropenholz
Rindvieh frisst Regenwald
Der Siegeszug der Sojabohne
Eine kurze Geschichte der »Grünen Energien«
Die fatale Rolle des Palmöls
Squatter
Giftiges Gold
Von Zoonosen und anderen Seuchen
Teil III: Die Erhaltung der Tropenwälder
Wald kaufen
Das Washingtoner Artenschutzübereinkommen
Schuldenerlass und Direktzahlungen
Was vermag der Naturtourismus?
Weil wir die Regenwälder brauchen – eine Bilanz
Dank
Literaturhinweise
Regenwaldforschung und Organisationen für Regenwaldschutz
Anmerkung
Impressum
Vorbemerkung – Amazonien brennt
Amazonien brennt. Stärker als je zuvor. Zigtausende Quadratkilometer tropischer Regenwald gehen in Flammen auf. Allein im August 2020 wurden auf Satellitenbildern über zehntausend Feuer in Amazonien gezählt. Über 50 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Solche Meldungen gehörten im Sommer 2020 zu den wenigen Themen, die sich in die Flut der Berichte über die größte Pandemie, die jemals die Menschheit erfasste, hineinschieben ließen. Sogar die Klimaerwärmung und die »Fridays for Future«-Bewegung gerieten in den Hintergrund. Bis zu Beginn der Ausbreitung des Corona-Virus hatten sie die Umweltthemen beherrscht. Der Sommer, der Nordsommer, ist alljährlich die Zeit, in der die Erde zum flambierten Planeten wird. Denn auf der Südhalbkugel herrscht da weithin Trockenzeit, die unserem Winter entspricht. In dieser löschen keine prasselnden Wolkenbrüche die Feuer, mit denen Rodungen angelegt werden. Ungehindert können sie sich hineinfressen in den Wald oder über die Savannen hinwegfegen. In Brasilien nutzte der politisch umstrittene Staatspräsident diese Zeit, um die Vernichtung des Regenwaldes, des größten, den es global noch gibt, voranzutreiben oder diese wenigstens zuzulassen. Dass sich so manches Feuer unkontrolliert ausbreitet, gilt als Kollateralschaden.
Gelegt wurden sie, wie seit Jahrzehnten, um Regenwald umzuwandeln in nutzbringendes Land. Für Rinderweiden, Sojafelder oder um landlosen Kleinbauern etwas zu bieten, mit dem sie sich einige Jahre abmühen können, damit sie keinen politischen Ärger machen. Folgen für das Klima der Erde? Darüber sollen sich die Europäer Sorgen machen. Sie unternehmen leider nichts, was wirksam würde. In den USA hielt indessen ein national gesinnter Präsident die Diskussion um den Klimawandel für unnützes Gerede, das nur Kosten verursacht und Schaden anrichtet, weil es Amerika nichts bringt. Die Argumentation des globalen Südens lautet in etwa so: »Was die Europäer, allen voran die stets auf Weltverbesserung bedachten Deutschen mit Energie-Einsparungen gewinnen, frisst das Wirtschaftwachstum in China in einem Jahr auf. Warum also nicht auch »Brasilien zuerst«? Die Bevölkerung wächst. Seit einiger Zeit zählt man schon über 200 Millionen Köpfe. Warum auf die Weltverbesserer hören, wenn es doch um den eigenen Fortschritt geht? Und den von ganz Südamerika, von allen Tropenländern. Formal sind sie längst befreit von der Bevormundung durch die Kolonialherren. Nun will man sich nicht wieder die Souveränität nehmen lassen. Mit dem »Gerede« vom unersetzlichen tropischen Regenwald und von der angeblich so großen Biodiversität, die er beherbergt. Ausnützen wollen sie diese doch bloß, die Neokolonialisten, verwerten für ihre Zwecke. Und wir, die so nachholbedürftigen Tropenländer, wir sollen sie dafür konservieren, unsere Tropenwälder.« So in etwa sehen es viele in Brasilien. 2020 vernichtete Brasilien daher auch etwa 15000 Quadratkilometer seiner Regenwälder. Für Brasilien. Doch für wen in Brasilien? Und wir Europäer? Wir lamentieren über den sterbenden Regenwald und kaufen doch bereitwillig die Produkte, die Brasilien und seine Nachbarländer im tropischen Bereich auf den einstigen Regenwaldflächen erzeugen. Für Export und Import gilt eine andere Moral, diktiert vom Geld, vom Gewinn, vom politischen Kalkül. Wie wir diese Situation ändern können, steht in diesem Buch.
Einleitung – Der grüne Gürtel
Der Blaue Planet trägt einen grünen Gürtel. Aus dem Weltraum betrachtet schimmert er auf, wo im Bereich des Äquators Kontinente und Inseln aus den Ozeanen ragen. Wälder sind es, tropische Regenwälder, die diese unterschiedlich breite, dunkelgrüne Binde bilden. Gebildet haben, müsste es heißen, denn der Gürtel ist schmaler und löchrig geworden. Rodungen haben ihn angefressen. Gebietsweise fehlt er bereits. Aus dem All wirkt dieses grüne Band wie von gigantischen Motten befallen. In den letzten hundertfünfzig Jahren ist mehr als die Hälfte der Regenwälder der Tropen vernichtet worden. Durch Raubbau in kaum vorstellbarer Dimension. Doch gerade in unserer Zeit dringen Brandrodungen weiter hinein in die verbliebenen Reste. Niemand und nichts hält sie auf, obwohl längst bekannt ist, wie bedeutungsvoll diese Wälder für uns alle, für die Menschheit und für das globale Ökosystem sind. An Fläche übertrifft sie zwar der nördliche Nadelwald, die Taiga, aber die Regenwälder der Tropen sind weitaus reicher an Lebensvielfalt und viel wüchsiger. Denn weder Winterkälte, wie in den nördlichen Nadelwäldern, noch Trockenheit, wie in den tropischen und subtropischen Savannen, schränken das Wachstum der Bäume ein. Dank der innertropischen Lage beiderseits des Äquators erhalten diese Wälder Niederschlagsmengen, die in unseren, den klimatisch gemäßigten Breiten gewaltige Überschwemmungen hervorrufen würden. Zweieinhalb Meter Regen pro Jahr sind es mindestens, in weiten Regionen viel mehr und im Extrem bis über zehn Meter. Wasserfluten gehen nieder, die auf jeden Menschen, der sie zum ersten Mal erlebt, wie ein Zusammenstürzen des Himmels wirken. Die größten Flüsse kommen aus diesen Wäldern, der Amazonas in Südamerika, der allein ein Fünftel bis ein Viertel sämtlichen Wassers, das global Flüsse führen, in den Südatlantik ergießt. Im Jahresmittel sind es über zweihunderttausend Kubikmeter pro Sekunde. Der Kongo in Afrika bringt es als zweitgrößter auf rund vierzigtausend Kubikmeter pro Sekunde. Beim Rhein sind es zweitausend, also ein Hundertstel des Amazonas oder ein Zwanzigstel des Kongo. Welch ungeheure Wassermassen in den Einzugsgebieten dieser beiden Flussgiganten niedergehen, lässt sich aus solchen Zahlen dennoch nur erahnen. Tatsächlich bestimmen Wald und Wasser die Natur der tropischen Regenwälder. Aber auch die Winde, die vom Meer her die Niederschläge bringen. Sie sind eingebunden in ein tropisches Windsystem, das den Kreislauf des Wassers aufrechterhält. Über die Wolken zum Land und über die Flüsse zurück in die Ozeane. Eine weitgehend amphibische Welt entsteht in den Regenwäldern; eine Welt, die urweltlich wirkt und dies durchaus auch ist. Denn trotz wiederkehrender globaler Klimaschwankungen, die diese Tropenwälder schrumpfen ließen oder ihre Wiederausbreitung bewirkten, blieben sie als Waldgürtel über die Erdzeiten hinweg erhalten. Bis Menschen in unserer Zeit anfingen, die Wälder großflächig zu vernichten. Mit Auswirkungen, die weit schwerer wiegen als die Waldrodungen in außertropischen Regionen.
Von diesen Tropenwäldern handelt unser Buch, von ihrer Vernichtung und den Folgen für Menschheit und Natur. Aber auch davon, dass erhalten werden kann, was an Tropenwäldern noch existiert. Wie sich zeigen wird, sind wir, die Menschen der sogenannten Ersten Welt, großenteils dafür verantwortlich. Mit der Ausbeutung der Tropenwelt durch den europäischen Kolonialismus setzte die Zerstörung im 18. und 19. Jahrhundert ein. Überwunden ist dieser keineswegs. Er wird mit anderen Methoden fortgeführt. Maßgeblich beteiligt sind unsere Vorstellungen von »Grüner Energie« und unser Stallvieh. Es frisst Tropenwälder auf, weil diese für den Anbau von Futtermitteln und Ölpalmen gerodet werden. Unsere exzessive Viehhaltung, die weit über die Kapazitäten unserer eigenen Fluren hinausgewachsen ist, wirkt über die Vernichtung von Tropenwäldern in mehrfacher Weise auf das globale Klima ein. Es wird uns, unseren Kindern und Enkeln wenig nützen, sollten wir es tatsächlich schaffen, in Deutschland oder EU-weit »klimaneutral« zu werden, wenn die Auswirkungen unseres Wirtschaftens auf die Tropenwelt unberücksichtigt bleiben. Wie sehr wir über die Tropen das Klima verändern und wie viel von der noch existierenden Vielfalt des Lebens wir verlieren, wenn der Raubbau nicht aufhört, sind zwei der drei Kernthemen dieses Buches. Das dritte besteht im Anliegen, die Einzigartigkeit der Tropenwelt vor Augen zu führen und realistische Möglichkeiten aufzuzeigen, sie zu erhalten.
Die Regenwälder der Tropen sind nicht einfach Wälder, deren Flächen und Flächenverluste wir zu bilanzieren haben. Sie sind die mit Abstand artenreichsten Lebensräume der Erde. Menschengemachte Vielfalt und Schönheit lassen sich nach der Zerstörung wiederherstellen. Bei der Vielfalt und Schönheit der Natur geht dies nicht. Was wir anrichten, ist endgültig. Das neue Erdzeitalter des Menschen, das Anthropozän, meint nicht den Beginn einer schönen neuen Welt. Die Charakterisierung drückt aus, dass die Menschheit zur Katastrophe für die Erde geworden ist, vergleichbar dem Einschlag eines Riesenmeteoriten. Als Verursacher beteiligt sind jedoch längst nicht alle Menschen gleichermaßen. Einige wenige verhalten sich wie Parasiten, um sich zu bereichern. Die große Mehrheit hat die Verluste zu tragen. Nicht an Kenntnissen und Einsichten mangelt es, sondern an angemessener Kontrolle der zerstörerischen Mächte. Sie können und müssen in die Schranken verwiesen werden – zum Wohle von Menschheit und Natur.
Teil I: Tropische Lebensvielfalt
Grünes Paradies – grüne Hölle
Tropische Regenwälder quellen über vor Artenfülle. Hinter jedem Blatt verbirgt sich geheimnisvolles Leben. Vor Blumen, die in leuchtenden Farben und bizarren Formen erblühen, schwirren Vögelchen, die aufleuchten wie Edelsteine, wenn sie ein Sonnenstrahl trifft. Affen turnen wie schwerelos an Lianen, bunte Papageien fliegen vorüber, und Düfte von betörendem Aroma durchziehen die Waldpfade. In paradiesischer Nacktheit leben Menschen als Naturkinder, die in der dauerhaften Wärme keine Kleider benötigen. Junge Mütter liegen in schaukelnden Hängematten, ihre Babys an den Brüsten. Geräuschlos kommen Jäger mit Pfeil und Bogen zurück ins Dorf mit einem erbeuteten Wildschwein, das alsbald zu einem duftenden Festmahl geröstet werden wird. Irgendwie so muss das Leben im Paradies gewesen sein. Vielleicht mit etwas weniger dichtem Wald, der die Sonne nur in kleinen Reflexen und Blitzchen zum Boden kommen lässt. Ähnlich wie unsere Wälder vielleicht, nur vielfältiger, geheimnisvoller und jahraus, jahrein warm. Gilt unser Wald schon als »grünes Paradies«, so muss es sich bei den Tropenwäldern geradezu um ein Überparadies handeln.
Solch idealisierte Vorstellungen, verbunden mit der Sehnsucht nach einer unbekannten Urheimat, entstanden seltsamerweise in einer Zeit, in der Glücksritter und Forscher den Regenwald der Tropen als »grüne Hölle« erlebten und auch so schilderten: In der Dauerfeuchte verschimmelt die Kleidung, setzen sich Pilze auf der Haut fest und arbeiten sich in diese hinein, stechen die verschiedensten Insekten, saugen Blut, übertragen dabei lebensgefährliche Krankheiten, und hinter der nächsten Baumwurzel liegt eine Giftschlange bereit zum Zuschlagen. Oder sie lässt sich von oben auf die Ahnungslosen fallen, die sich mit dem Buschmesser gerade einen Pfad freischlagen. Nachts kommen Vampirfledermäuse und suchen die fiebrig Schlafenden heim, um sich an ihrem Blut zu laben. Heimtückische Eingeborene locken mit Rufen oder Flötentönen die Irrenden tiefer in die weglosen Wälder, wie einst Pan in die griechischen Buschwälder der Antike. »Indianer« oder Pygmäen erweisen sich als von Krankheiten entstellte, leidende Kreaturen, die seltenste, vom Aussterben bedrohte Tiere töten, um noch ein paar Tage weiter zu überleben.
Paradies und Hölle scheinen vieltürig miteinander verbunden und durchaus austauschbar. Beide Bilder repräsentieren auf ihre Weise die Wirklichkeit als zwei Ansichten, die einander gar nicht widersprechen, sondern sich ergänzen. Was schwer zu fassen ist für jemanden, der sich in einer dieser beiden Blickwelten befindet, weil dann die jeweils andere als Ausgeburt einer irren Phantasie erscheint. Beide Sichtweisen charakterisieren aber die Lage. Die Tropenwälder sollen mit ihrem Reichtum an Arten und Lebensformen, mit ihrer Schönheit und Einmaligkeit erhalten werden, soweit dies irgendwie noch geht. Aber wer in ihnen, in ihrem Naturzustand, leben muss, sieht sich genau jenen ebenso übertrieben dargestellt wirkenden Gefahren ausgesetzt. Für Menschen ist das Leben im tropischen Regenwald kein Urlaub im Paradies. Der Mensch war seiner Natur nach kein Regenwaldbewohner, und der Regenwald selbst ist kein Garten Eden, der üppig gibt. Diese Paradoxie aufzulösen gehört zu den Hauptschwierigkeiten der Annäherung an den tropischen Regenwald, und zwar in beide Richtungen. Deshalb ist der erste Teil des Buches den Lebensbedingungen in diesen Wäldern gewidmet. Nur wenn wir sie hinreichend kennen, lassen sich Art und Folgen der bisherigen Nutzungen verstehen und – hoffentlich – durch bessere Konzepte ersetzen.
Erste Eindrücke vom tropischen Regenwald
Die derzeit noch größten tropischen Regenwälder gibt es in Amazonien, in der Kongoregion und auf Borneo. Wer sie besuchen will, bringt Vorstellungen mit, genährt von den Klischees, die im vorigen Abschnitt hervorgehoben wurden. Lassen wir die Abenteurer beiseite, die sich hineinwagten und darüber berichteten, wie sie die »grüne Hölle« überlebten. Die andere Annäherung geht von der Erwartung einzigartiger Tropenwunder aus. In Rudyard Kiplings »Dschungelbuch« erlebt Mowgli, das Menschenkind, die Affen, den Panther, den Tiger, den Bären, die Elefanten und andere. Doch der indische Dschungel meint nicht den tropischen Regenwald, wie wir noch sehen werden, sondern einen Monsunwald, der seit Jahrtausenden von Menschen genutzt wird und eigentlich nicht zu den tropischen Regenwäldern gehört. Welche Tiere können wir in solchen erwarten, in Amazonien zum Beispiel? Affen wohl sicher, den Jaguar, der noch größer und stärker als ein Panther (Leopard), aber schwächer als ein Tiger ist, aber keine Elefanten und Bären, denn die amazonischen Ameisenbären sind ganz anders geartete, höchst seltsame Tiere. Selbstverständlich gibt es Papageien und andere bunte Vögel. Kolibris zum Beispiel; Winzlinge mit besonderer Flugweise, die wir noch näher betrachten werden. Und Schmetterlinge von schier überirdischer Schönheit. Aber der allererste Eindruck wird von alldem kaum etwas bieten. Oftmals fällt er geradezu enttäuschend aus. Das Grün der Blätter wirkt stumpf, fast abweisend. Die Bäume, die sich auf den ersten Blick nur nach Palmen und Nicht-Palmen unterscheiden lassen, sind keineswegs voller herrlich blühender Orchideen. Auf anmutige Vogellieder lauscht man vergebens, zunächst zumindest. Eher dringen misstönende, weil zu schrille Laute von Zikaden in unsere Ohren.
Die mit Abstand häufigsten Tiere bekommen wir kaum zu Gesicht, aber schmerzhaft zu spüren, wenn wir nach Lianen greifen, Zweige vom Pfad beiseitedrücken oder uns auf einen umgestürzten Baumstamm setzen. Es sind die Ameisen und die Termiten, die der Menge nach das Tierleben des amazonischen Regenwaldes bestimmen. Die Termiten bleiben unseren Blicken verborgen, bis wir ihre Nester erkennen. Als dunkle Gebilde sitzen sie an Stämmen, wo Äste abzweigen, oder sie kleben einfach daran. Wie dicke Adern oder seltsame Formen von Wurzeln verlaufen röhrenartige Gänge, die sie bauen, zum Boden herab. Termiten scheuen das Licht. Wo sie, wie im Überschwemmungsbereich der Flüsse, keine Bodennester anlegen können, weichen sie in die Baumkronen aus. Die »Adern« ihrer Gänge geben einen zu schwachen Eindruck davon, wie häufig sie sind. Auch von den Ameisen, die in höchst unterschiedlichen Arten im Regenwald leben, sehen wir zu wenig, um ihre Häufigkeit erahnen zu können. Indirekt drücken es Spezialisten der Tierwelt aus, die von Ameisen und Termiten und von sonst nichts leben.
Wichtig für den ersten Eindruck ist das Verständnis der Mengenverhältnisse: Termiten und Ameisen stellen mehr tierisches Lebendgewicht auf die Fläche bezogen, also pro Hektar Regenwald zum Beispiel, als die übrige Tierwelt aus Affen und Vögeln, Käfern und Schmetterlingen zusammen. Was auch bedeutet, dass sich ausgerechnet die Tierwelt, die wir beim Besuch des tropischen Regenwaldes erwarten, durch Seltenheit auszeichnet. Vielfalt und Seltenheit gehören zusammen. Das wird eine wichtige und sehr folgenreiche Lektion sein. Der erste Eindruck ist richtig und wichtig. Wir finden keine Serengeti voller Tiere vor, wenn wir solche tropischen Regenwälder besuchen, die sich noch weitgehend im Naturzustand befinden. Was uns erwartet, ist eine Masse von Grün voller gewaltiger Baumstämme, eine Pflanzenwelt, in der es wichtig ist, auf jeden Schritt zu achten, den wir tun, und Zugriffe auf Lianen tunlichst zu vermeiden, bis wir genau geprüft haben, ob sie nicht von schmerzhaft stechenden Ameisen besetzt sind. Anders als in den südostasiatischen Regenwäldern lauern in Amazonien keine Landblutegel auf uns. Aber wo immer ein Pfad verläuft, kann es Milben (Jiggers) geben, die juckende, sich entzündende Stiche erzeugen, wenn sie sich in unsere Haut einbohren. Und wo uns Stechmücken überfallen, können wir sicher sein, dass Ansiedlungen von Menschen die Brutstätten dafür geschaffen haben und wir daher mit Malaria und anderen von Mücken übertragenen Tropenkrankheiten rechnen müssen.
All das tritt zurück, wenn uns ein zartes Brummen aufmerksam macht und wir bemerken, dass wir angeschaut werden. Ein Kolibri steht in der Luft auf Armreichweite vor unserem Gesicht, rutscht ein Stück zur Seite, nach vorn oder zurück und studiert uns so offensichtlich, dass man nicht weiß, ob er begrüßt werden will – und wenn ja, wie. Sein Gefieder schimmert smaragden, ohne tiefe Brillanz, wenn es sich um ein Weibchen handelt, aber juwelenhaft mit Glutrot, Saphirblau oder Violett bei Männchen. Im nächsten Moment ist der Winzling verschwunden. Weg, als ob er eine Einbildung gewesen wäre. Doch da gleiten blaue Blitze auf dem dunkelschattigen Pfad auf uns zu. Im Vorbeischweben erkennen wir, dass es ein Schmetterling ist, mehr als handflächengroß und mit schillernd blauer Oberseite der Flügel. Ein Morpho.
Und plötzlich hören wir Vogelgesänge, die wir zumindest als solche deuten möchten, und Folgen von Pfeiftönen, bei denen wir nicht sicher sind, ob sie von Fröschen oder doch von Vögeln stammen. Gezirpe und Gekreisch deuten wir als von Zikaden kommend. Vielleicht; vielleicht auch nicht. Hell klingende, weit durch den Wald schallende Hammerschläge macht kein Schmied, sondern ein Vogel. Geschnatter kann von Papageien oder Affen ausgehen, zwitscherndes Gezirpe aber auch. Wir sehen davon meistens nichts und können daher das Gehörte nicht zuordnen. Nur kundige Führung verrät die Rufer. Oder man erlangt selber ausreichend Expertise durch langjährige Erfahrung.
Das sind völlig andere Verhältnisse als die, die weit gereiste, welterfahrene Naturfreunde von ostafrikanischen, süd- und südostasiatischen Nationalparks kennen, wo man bequem vom Liegestuhl aus mit Fernglas und Bestimmungsbuch die bunte Fülle der Vögel studieren und dazu die großen Wildtiere panoramaartig genießen kann. Webervögel fliegen an vielen solcher Lodges zu den Veranden, angelockt von Futterstellen oder weil sie gelernt haben, dass die Touristen, denen Essen oder Tee serviert wird, bereitwillig Leckerbissen abgeben. Amazonische Vögel, die ähnlich wie afrikanische und asiatische Webervögel beutelförmige Hängenester fabrizieren, leben häufig mit Wespen zusammen, die höchst unangenehm stechen und jedes Lebewesen, das sich den Nestern zu sehr nähert, sogleich angreifen. Kleinvögel treten kaum jemals in Scharen auf. Viele verhalten sich in Amazonien sehr zurückhaltend und ruhig, verglichen mit ihren Entsprechungen in Ostafrika und Indien. Dennoch lebt ein Viertel aller Vogelarten der Erde allein im Großraum Amazonien.
Was wir bei solch ersten Eindrücken erleben, eröffnet bereits tiefere Einblicke in die Tropennatur. Die indigenen Völker wissen um die Besonderheiten dieser Natur. Sie haben sich in Jahrtausenden über viele Generationen hinweg darauf eingestellt. Ihre Lebensweise, die über die Kontinente hinweg erstaunlich übereinstimmt – obwohl die Regenwaldvölker sehr unterschiedlichen Ursprungs sind, was sich in ihrem Äußeren ausdrückt –, wird uns Aufschlüsse darüber geben, wie es sich im tropischen Regenwald lebt, wenn man darin dauerhaft leben will. Wir werden verstehen, warum es richtig und falsch ist, in diesen dauerfeuchten Wäldern überall Wolken blutsaugender Stechmücken zu erwarten oder zu befürchten; richtig, weil es solche Gebiete tatsächlich gibt, und falsch, weil andere, durchaus riesige Regionen nahezu frei von Stechmücken sein können.
Aber nicht nur von Stechmücken und anderen Blutsaugern hängt es ab, ob die Regenwaldbewohner bekleidet sein müssen oder nackt sein können. Wichtiger ist oft, ob sich Hautpilze entwickeln, wenn feuchte Kleider den Körper bedecken. Und ob die Menschen genügend Mineralstoffe mit ihrer Nahrung aufnehmen oder mit dem Wasser trinken können. Gegenüber diesen tagtäglichen Problemen tritt die von Sensationsschriftstellern hervorgehobene Gefahr durch Raubtiere weitestgehend in den Hintergrund. Nicht am Tiger, Leopard oder Jaguar lag es, ob Menschen in den Regenwäldern der Tropen erfolgreich leben und überleben konnten, sondern am Kleinen bis Unsichtbaren, an den Verursachern von Krankheiten und an Mangelerscheinungen.
In den südostasiatischen Regenwäldern passiert es zwar, dass Elefanten die Pflanzungen heimsuchen und großenteils vernichten, aber nur, wenn solche überhaupt angelegt werden können. Wo die Böden zu wenig ertragreich sind, geht dies nicht, und die Elefanten werden, wie von den Kongo-Pygmäen, ganz anders betrachtet: als mögliche, gleichwohl sehr seltene Quelle von viel Fleisch. Dass es große Tiere, wie Elefanten, Büffel und Waldantilopen, in den amazonischen Regenwäldern nicht gibt, wohl aber in Afrika und Südostasien, wird ebenfalls wichtige Aufschlüsse über die Nutzbarkeit der unterschiedlichen Regenwälder geben. Amazoniens größtes Säugetier, der Tapir, ist nach afrikanischen und asiatischen Maßstäben nicht einmal Mittelklasse. Und zudem ist er sehr selten.
Warum fehlen große Säugetiere in Amazonien, und welche Chancen und Folgen haben die Rinder, die aus Europa und Südasien stammen? Für Rinder-Weideland sind riesige Flächen an den Randgebieten Amazoniens bereits gerodet worden. Rinderweiden und Anbauflächen für Soja fressen sich hinein in den Regenwald, so der Eindruck, den Satellitenbilder vermitteln. Wir sehen dies ganz direkt, wo immer man sich tropischen Regenwäldern nähert, ob in Brasilien, auf Borneo oder im Kongogebiet. Warum geschieht dies? Das ist die Kernfrage. Doch um sie beantworten zu können, ist es nötig, die besondere Natur der tropischen Regenwälder zu betrachten.
Tropischer Regenwald in Mittelamerika
Anfangs überwältigt die Fülle. Man weiß nicht, wohin man die Blicke richten soll. Überall gibt es eine Vielfalt zu sehen, die einfach überfordert. So der erste Eindruck im Regenwald von Costa Rica; ein Zwerg nach globalen Maßstäben für Staaten, aber ein Riese mit seiner Biodiversität. In diesem Tropenland auf der schmalen Verbindung zwischen Nord- und Südamerika leben mehr Vogelarten als in ganz Europa, viel mehr verschiedene Schmetterlinge und andere Insekten, und es gibt sogar mit dem Jaguar die größte und stärkste Katze der Neuen Welt. An Gewicht und Kraft übertrifft »El Tigre«, wie der Jaguar in Lateinamerika häufig genannt wird, den Leoparden von Afrika und Südasien beträchtlich. Lediglich Löwen und Tiger sind größer. Dennoch leben die Menschen hier im schmucken, sehr wohl zivilisierten Costa Rica mit dem Jaguar und mit der Vielzahl anderer Tiere, die speziell von Europäern und Nordamerikanern für »sehr gefährlich« gehalten werden.
Weit mehr als von diesen wird ihr Leben und Wirken von den Kräften der nicht-lebendigen Natur bestimmt: von Erdbeben, die es sehr häufig gibt, von Vulkanausbrüchen, die stets gleichsam im Hintergrund drohen, und auch von Stürmen und Überschwemmungen. Doch genau darin steckt der Schlüssel zum Verständnis der gewaltigen Biodiversität auf der mittelamerikanischen Landbrücke. Die »tektonische Unruhe«, also die Vulkanausbrüche und die Erdbeben mit ihren Rissen im Gestein versorgt die Böden mehr oder minder regelmäßig mit Mineralstoffen, die dem Wachstum der Pflanzenwelt zugutekommen.
Gut ernährte Pflanzen kommen wiederum der Tierwelt zugute. Sie kann in Costa Rica, wie auch in Panama, Guatemala und der Nachbarschaft, in weit größerer Häufigkeit pro Art vorkommen als in den einförmigen Weiten Amazoniens. Und geradezu luxuriös wirkende Bildungen hervorbringen. Wie den Quetzal, der Göttervogel der Azteken und Mayas. Ist sein Gefieder schon brillant im besten Sinne dieses Ausdrucks mit einem unvergleichlichen Smaragdglanz der Rückenseite, so kontrastiert dazu auch noch eine scharlachrote Brust- und Bauchseite. Bei den Männchen geht der Glanz des Rückens über in zwei mehr als körperlange Schwanzfedern, die im Flug zwischen den Bäumen wie grüne Wellen eines meisterhaft gestalteten Hologramms aufleuchten und den etwa taubengroßen Vogel zu verfolgen scheinen. Schlüpft so ein Prachtstück von Quetzal-Männchen in eine Baumhöhle zum Nest, so ragen nicht selten die Schwanzfedern aus dem Eingang heraus und baumeln im leichten Wind, der durch die Baumkronen zieht. Denn das Reich des Quetzals erstreckt sich über die Bergregenwälder Mittelamerikas. Seine Federn waren so geschätzt, dass sich die Herrscher indianischer Kulturen vor dem Eindringen der Europäer Mäntel daraus fertigen ließen, die ihre Macht zum Ausdruck brachten. Feiner und viel glänzender, als wirkliche Smaragde hätten glänzen können. Kaum zu fassen, dass der Quetzal hauptsächlich von kleinen Avocado-Früchten lebt, die in ihrem stofflichen Gehalt nichts von dem erahnen lassen, was sich im Prachtgefieder ihrer Nutzer äußert. Das liegt einmal daran, dass es sich beim Smaragdglanz nicht um eine »echte« Farbe handelt, sondern um Feinstrukturen der Federoberseite, die Licht reflektieren, die grünen Wellenlängen des Lichts zurückwerfen und sich dabei zu einem milden, samtig wirkenden Schimmer vereinen. Das Rot der Bauchseite ist hingegen eine echte Farbe, hervorgerufen von Farbstoffen, wie wir sie von mitteleuropäischen Vögeln, vom Rot des Gimpels und vom noch intensiveren Rot der Gesichtsmaske des Stieglitzes, kennen.
Das Smaragdgrün, das für unsere Augen so perfekt zum Grün des Urwaldes passt, entspricht dem grünen bis blauen oder violetten Schiller verschiedener Arten von Kolibris, von denen es 52 verschiedene in Costa Rica gibt. Sie sind allgegenwärtig, besonders häufig aber überall dort, wo Blumen blühen, deren Blüten Nektar enthalten. Solche, die auf Kolibris als Bestäuber spezialisiert sind, »stechen« auch uns ins Auge mit ihrem intensiven Rot. Uns deshalb, weil wir ähnlich wie die Kolibris dieses Rot sehen können, Bienen und andere Insekten aber nicht. Für sie, die sie zumeist die Hauptbestäuber von Blüten sind, wirkt das Rot nicht mehr. Es ist mehr oder weniger dunkel. Diese biologische Gegebenheit führt mitunter zu herzerfrischenden Erlebnissen. Stark rot gefärbte Lippen werden von Kolibris angeflogen, als ob sie die betreffenden Damen küssen wollten; eine »Begrüßung« in Costa Ricas Tropennatur, die sicher nie vergessen wird.
Blüten bleiben dennoch, aller Fülle zum Trotz, die sich den staunenden Augen bietet, eher selten. Wie überall in den Tropen, von Gärten und Anlagen abgesehen, in denen Gepflanztes das ganze Jahr über blüht. Die Blüten solcher Besonderheiten, wie der auf der Tafel rechts dargestellten Spinnenorchidee, überhaupt zu finden setzt Vertrautheit mit dem Regenwald voraus. Nicht zu übersehen sind hingegen die vielen Aufsitzerpflanzen, die Epiphyten, die anzeigen, dass sie sich von dem ernähren können, was auf dem Luftweg zu ihnen kommt – einschließlich düngender Staub aus der fernen Sahara, herangetragen vom Passatwind. In Costa Rica gibt es mehr als 1100 verschiedene Arten von Orchideen.
Die der Menge und ihrer ökologischen Bedeutung nach vorherrschenden Ameisen erkennt man oft erst bei genauerem Hinsehen – auf dem Bild wie auch in der Natur. So plakativ bunte Schmetterlinge wie der Anaxita decorata, ein Bärenspinner, entziehen sich der Entdeckung durch perfekte Tarnung tagsüber. Aber nachts kommen sie und viele andere Schmetterlinge ans Licht. Dann wird die Fülle erst sichtbar.
1. Tropischer Regenwald in Mittelamerika
Immense Artenvielfalt
Über eineinhalbtausend verschiedene Vogelarten gibt es in Amazonien. Nimmt man noch die Andentäler dazu, aus denen die Zuflüsse des Amazonas kommen, sowie die für europäische Verhältnisse riesigen Flussgebiete des Orinoko und des Magdalena in Venezuela und Kolumbien, gleicht die Fläche ungefähr der von Europa. Aber die Vogelartenzahl liegt darin dreimal so hoch wie hier. Noch beeindruckender wird die Artenfülle, wenn wir das kleine Costa Rica betrachten. Obwohl es nur etwa zwei Drittel der Größe Bayerns hat, gibt es dort mehr Vogelarten als in ganz Europa. Säugetierarten leben in Costa Rica 236, Frösche und Kröten 140, Reptilien 228 Arten. Schwärmer (Sphingidae) sind in 121 Arten nachgewiesen, in den Vereinigten Staaten und Kanada zusammen aber nur 115. Rund 550 Tagfalterarten kommen in Costa Rica vor; in Europa und Nordwestafrika sind es nur 440 Arten. Und so fort. Für besonders artenreiche Gruppen, wie die Käfer, die Schmetterlinge oder die Wanzen, lassen sich nur ungefähre Zahlenangaben oder Schätzungen anführen, weil die Artenfülle der Tropen bei Weitem noch nicht bekannt ist. Doch der Trend ist klar: In Richtung innere, also feuchte Tropen steigen die Artenzahlen bei den allermeisten Tier- und Pflanzengruppen steil an; steil im Sinne von exponentiell sogar. Denn der Artenreichtum muss für Vergleichszwecke auch auf die Flächengröße bezogen werden. Nimmt man Costa Rica und Bayern (sehr) großzügig für annähernd gleich groß, hat dieses Tropenland mehr als zehnmal so viele Frosch- und Krötenarten, über zwanzigmal so viele Reptilien und knapp zehnmal so viele Schwärmerarten (oder deutlich mehr, weil in Bayern mehrere nur als Zufluggäste vorkommen). Die Fülle der Baumarten im tropischen Regenwald ist so groß, dass nur Spezialisten in der Lage sind, sie alle zu determinieren. Bestimmungsbücher, wie bei uns üblich und bei Freilanduntersuchungen vielfach benutzt, gibt es dafür nicht. Allein für Venezuela sind mehr als 2400 Baumarten nachgewiesen. Mehrere Hundert verschiedene können auf einem Quadratkilometer zu finden sein. Auf hektargroßen Forschungsflächen repräsentiert unter Umständen jeder Baum eine andere Art. Was für den laienhaften Blick gleichartig aussieht, kann zu ganz verschiedenen Gattungen, ja zu unterschiedlichen Pflanzenfamilien gehören.
Alexander von Humboldt erahnte die Artenfülle der Pflanzen auf seiner großen Reise in die »Äquinoctialgegenden des neuen Kontinents«, weil sein Begleiter Aimé Bonpland ein guter Botaniker war. Beide beeindruckte die Tropennatur so sehr, dass sie ins Schwärmen gerieten, obwohl sie unter den blutsaugenden Insekten und anderen Plagegeistern litten. Doch erst ein halbes Jahrhundert später realisierten zoologisch ausgerichtete Forscher und Sammler die ungeheure und zunächst ganz unverständliche Artenfülle. Zu nennen sind da vor allem Henry Bates und Alfred R. Wallace, die beide in Amazonien sammelten. Anderen Forschern fiel auf, dass es eine besondere Bewandtnis mit der Artenfülle hat. Aber sie konnten sich nicht erklären, warum die allermeisten Arten, die sie fanden, so selten waren. Die Jagd nach Käfern oder Schmetterlingen lehrte, dass es viel leichter ist, ein Dutzend verschiedene Arten zu sammeln, als fünf oder zehn Exemplare derselben Art. Offenbar wurde angenommen, die Seltenheit wäre menschengemacht, weil ja die Flussufer mehr oder weniger besiedelt waren. Die Flüsse bildeten aber damals und bis weit ins 20. Jahrhundert hinein die Straßen, auf denen man sich fortbewegen und in die riesigen Wälder eindringen konnte.
Wie sehr die Vorstellungen von den Erwartungen geprägt waren, drückte sich in den Bildbänden aus, die kurz nach der Mitte des 20. Jahrhunderts erschienen. Sie zeigten die Vielfalt des Tierlebens in bunten Gemälden, auf denen an jedem Baum ein exotischer Vogel, eine Schlange oder eine riesige Spinne zu sehen ist oder ein Jaguar zwischen Brettwurzeln hervorschaut auf die kleinen Schweine, die Pekaris, die davor am Boden herumsuchen. Oben in den Kronen sitzen blau und rot gefiederte Papageien und andere Vögel, die unvergleichlich aussehen, weil es keine vergleichbaren Arten in den USA oder in Europa gibt. Selbstverständlich fehlten auch Kolibris nicht und die himmlisch schillernden großen Morpho-Falter, prächtige Orchideen in voller Blüte und, und, und … Solche Bilder prägten die Vorstellungen von der Fülle des tropisch-amerikanischen Regenwaldes. Für Afrika kamen Gorilla, Schimpanse, die erst Anfang des 20. Jahrhunderts entdeckte Waldgiraffe, das Okapi, und für Südostasien Orang-Utans, Gibbons, Nashornvögel und als Schönste von allen die Paradiesvögel Neuguineas hinzu.
Zwar gab es sie alle. Kein Tier war erfunden oder aus dem Hörensagen ersonnen, wie die alten Darstellungen der Menschenaffen. Aber sie existierten in den tropischen Regenwäldern nicht in dieser Art einer exquisiten Zoohaltung mit Waldkulisse. Die Wirklichkeit war für viele, die von diesen Bildern geprägt in die amerikanischen, afrikanischen oder südostasiatischen Tropen reisten, geradezu erschreckend anders. Wie eingangs schon ausgeführt, erwiesen sich die Wälder, insbesondere die noch weitgehend unbeeinflusst von Menschen verbliebenen, geradezu als tierleer. Hundert oder hundertfünfzig verschiedene Vogelarten an einem Tag zu sehen fällt leicht auf einer Safari durch ostafrikanische Nationalparks. Hundert Arten kann ein gutes Gebiet in Deutschland auch in einem Tag ergeben. In tropischen Regenwäldern wird man diese Vielfalt erst nach wochen- oder monatelangem Suchen erzielen, von wenigen besonderen Stellen abgesehen, die als »Hotspots« für die »Bird Watcher« rasch bekannt wurden. Doch vor Ameisen wimmelt es, und auch Termiten gibt es überall, wo man sucht.
Nach den Gründen für dieses Phänomen zu fragen ist in doppelter Weise wichtig. Denn die Gegebenheit als solche erweckt ja den Eindruck, dieses oder jenes Waldstück könne ohne Weiteres gerodet werden, gibt es doch ohnehin fast kein Tierleben darin. Wo nichts zu sehen ist, fällt es sehr viel schwerer, den Fortbestand des Waldes zu verteidigen, als in solchen Gebieten, in denen das Erlebnis der Tiere die Sinne überwältigt. Deshalb sind sogar die Zoologischen Gärten attraktiver als die meisten Naturschutzgebiete bei uns, obwohl man im Zoo noch strenger auf die Wege beschränkt bleibt als draußen in der geschützten Natur. Der zweite Aspekt betrifft das Verständnis der Seltenheit. Wie hängt die Artenvielfalt damit zusammen? Weshalb entstand die so große Biodiversität der tropischen Regenwälder, wenn doch Wärme, Licht und Feuchtigkeit gleichermaßen günstige Lebensbedingungen schaffen und damit allen Arten beste Voraussetzungen bieten? Unsere Wälder sind gewiss weit unterschiedlicheren Umweltverhältnissen ausgesetzt als die immerfeuchten innertropischen Wälder. Also sollte es vielleicht sogar bei uns mehr Biodiversität im Wald geben, kommen doch der Winter mit seinen höchst unterschiedlichen Ausprägungen und wechselnde Höhenlagen als strukturierende Elemente dazu. Ein allgemeiner Befund der wissenschaftlichen Ökologie besagt nämlich, dass Artenvielfalt sehr stark von struktureller Vielfalt abhängt. Einförmige Großlandschaften sind weit weniger artenreich als vielfältig strukturierte. Die traditionelle Landwirtschaft hatte somit tatsächlich den Artenreichtum in unseren Landschaften gefördert und nicht drastisch dezimiert, wie die moderne, industrialisierte.