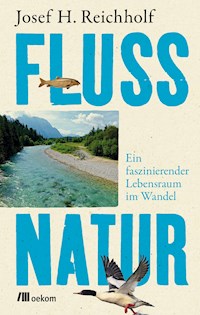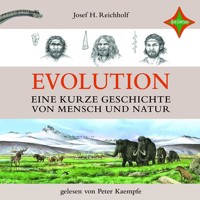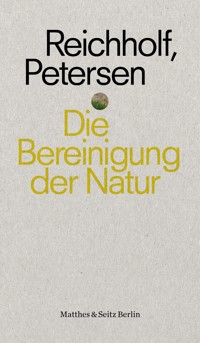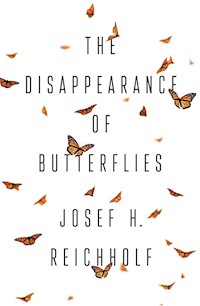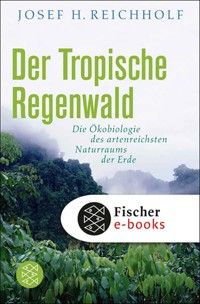Vorwort
Weder Kulisse noch Holzfabrik
In diesem Buch geht es zwar hauptsächlich um die Natur des Waldes, aber auch darum, welchen Nutzungen Wälder unterliegen und wie sich diese auswirken. Darüber befinden die verschiedenen Nutzer recht unterschiedlich. Deshalb möchte ich vorab betonen, dass ich weder Waldbesitzer noch Förster oder Jäger bin. Den Wald und die Einwirkungen der Menschen darauf betrachte ich aus dem Blickwinkel der wissenschaftlichen Ökologie. Dies schließt engagierte Empathie nicht aus. Sie ist vielfach die Triebkraft hinter der Forschung, die keineswegs nur distanziert und wie unbeteiligt zählt und misst. Zumal dann, wenn kein Forschungsprogramm zu erfüllen ist und kein Geld damit verdient wird. Dann motiviert das Wissen- und Verstehenwollen.
Allerdings gerät man dabei leicht zwischen die Fronten, wenn eine heftig umstrittene Problematik vorliegt. Beim Wald ist das so. Ganz ausgeprägt sogar, weil mit den Wäldern jahrhundertelang (hoch)herrschaftliche Privilegien verbunden waren. Bei Holznutzung, Jagd und Zugänglichkeit. Und das Gegenteil davon, sich selbst weitgehend überlassene Wildnis. Nach wie vor sind Privilegien vorhanden, sogar in Wäldern, die formal der Allgemeinheit gehören. Ängste werden geschürt. Weil es wilde Tiere geben kann, sollten Menschen nicht in den Wald. Vor allem nachts nicht. Eine Warnung, die mancherorts durchaus bedacht werden sollte. Weil dort von Menschen Gefahren ausgehen. Von Räubern heutzutage allerdings am wenigsten. Zudem soll sich Geheimnisvolles in Wäldern tun. Waldweben mit alten Geistern in neuen Verkleidungen. Je entfremdeter von der Natur, desto empfänglicher werden manche Menschen für seltsame Vorstellungen.
Dabei steckt der Wald so voller Leben in faszinierenden Formen, dass wirklich nichts Andersartiges hineinfantasiert werden muss. Weder geheime Kräfte und okkulte Vorgänge noch neue Mythen in pseudowissenschaftlicher Verkleidung. Wer einmal angefangen hat, sich hineinzuvertiefen in die realen »Geheimnisse« des Waldes, wird keine irrealen nötig haben. Entdeckt wird genug und zu viel zugleich, weil sich die Vielfalt als grenzenlos erweist; für ein Menschenleben zumindest. Vom wirklich Wesentlichen wissen wir längst genug, um mit den Wäldern anders umzugehen, als das immer noch geschieht. Auch darum geht es in diesem Buch, und was Sie alle als Nicht-Waldbesitzer, Nicht-Jäger und Nicht-Förster, aber als engagierte Menschen, denen es nicht länger gleichgültig ist, wie die Zukunft wird, tun können, um die Wälder und ihre Lebensvielfalt zu erhalten. Als Doch-auch-Waldbesitzer, nämlich an den Staatswäldern, haben wir das Recht dazu. Nehmen wir es wahr!
Eine weitere Klarstellung betrifft die Ausrichtung des Buches. Es ist kein Lehrbuch für Waldökologie oder Forstwissenschaft. Dementsprechend gehe ich nicht »lehrbuchhaft« vor, sondern versuche, die Texte aus dem zu entwickeln, was man bei Waldgängen sehen und erleben kann. Das »Erlebnis Wald« steht im Vordergrund. Zu diesem berechtigt das freie Betretungsrecht des Waldes. Er sollte uns aber nicht bloß Kulisse sein; grüne Wand zum Joggen oder Spazierengehen mit frischer Luft als Zugabe. Der Wald lebt und in ihm gibt es viel Leben, das es wert ist, wahrgenommen zu werden. Und viel mehr beachtet, als das geschieht. Denn Wälder sind bei uns Forste, also Produktionsstätten von Holz und damit Landwirtschaft in spezieller Form. Den Unterschied zwischen Wald und Forst sichtbar und verständlich zu machen, darauf kommt es mir ebenfalls an.
Frühlingsauwald mit Biberdamm
Wir alle sind (hoffentlich) irgendwann mal in einem Wald gewesen. Viele Menschen machen regelmäßig Waldspaziergänge. Was man dabei erwartet, ist meistens von den ersten Besuchen geprägt worden. Führten sie in Eichen- oder Buchenwälder, wirken Fichtenwälder finster und nicht besonders einladend. Bergwälder erfordern es, die Augen auf den Pfad gerichtet zu halten. Das vermindert den Blick auf den Wald, bis man zu Ausblicken innehält. Für mich ist ein Waldtyp der attraktivste, den es bei uns kaum noch gibt, der Auwald. In Auwäldern am unteren Inn in Niederbayern stromerte ich in meiner Kindheit und Jugend umher. Als Dschungel empfand ich sie, und dschungelartig können Auwälder tatsächlich sein. Das bestätigten mir später die Erfahrungen in »richtigen« Dschungeln. In den Auwald zieht es mich immer noch. Mehrmals die Woche pflege ich, »meine Routen« darin zu gehen oder neue Stellen zu suchen. Dabei gibt es kaum einen Tag, an dem mir nicht etwas »Neues« auffällt. Die Vielfalt ist unerschöpflich über Jahr und Tag und über Jahrzehnte hinweg.
Weit einförmiger verlaufen die Waldgänge in den Forst. Sie sind deshalb aber nicht weniger interessant. Denn während die Fülle im Auwald eher ablenkt, macht es die Einförmigkeit leichter, bestimmte Vorhaben zu verfolgen. Wie das Tun der Waldmistkäfer, das Erblühen und Fruchten der Fingerhutstauden, der Wechsel des Zapfenansatzes bei den Fichten über Jahre und Jahrzehnte und seine Folgen und so fort. Weit besser sichtbar ist im Forst, was bei der Holzernte geschieht und welche Folgen sie hat, als im Auwald. Dieser wird unregelmäßig bewirtschaftet, wenn überhaupt, aber manchmal von Hochwasser überflutet. Dies mag andeuten, dass Auwald und Forst sehr verschieden sind. Wie überhaupt sehr Unterschiedliches unter »Wald« zusammengefasst wird. Wenn Sie also von »Ihrem Wald« andere Eindrücke haben und manches nicht vorfinden, was hier nachfolgend beschrieben wird, so ist das ganz natürlich.
Denn erschöpfend im Sinne der Vielfalt der Wälder kann mein Buch nicht sein, sonst würde es hoffnungslos erschöpfen. Es bietet eine persönliche Auswahl von Themen, die illustrieren und ergänzen sollen, was die Waldnatur ausmacht. Vielleicht regt es auch dazu an, selbst ein »Waldjournal« zu führen.
Einführung
Ein Frühlingstag im Auwald
Jeder Waldgang hat seinen Reiz, so wir offen dafür sind, anzunehmen, was die Waldnatur gerade bietet. Im Jahreslauf fällt das sehr unterschiedlich aus. Zudem sind die Vorlieben recht verschieden. Manche Menschen mögen den Wald am liebsten, wenn das Laub die Herbstfärbung angenommen hat, die Luft mild wurde und man nicht mehr von Insekten belästigt wird. Andere stapfen am liebsten im Winter bei Schnee durch den Wald. Die meisten Menschen gehen im Sommer in den Wald. Doch auf das, was es zu sehen und zu hören gibt, achten sie im Frühjahr am intensivsten. Die Gesänge der Vögel animieren sie dazu, und ganz besonders die Blumen.
In diesem Sinne reagiere ich also ganz normal, wenn es mich im April bei schönem Wetter in den Auwald zieht. Da erliege ich jedes Jahr wieder der Faszination von Kuckucksruf, Grasmückengesang, Rotkehlchentriller und den Blütensternchen der Buschwindröschen, Gelben Windröschen, Blausterne und anderer Frühlingsblumen, die den Boden des Auwaldes bedecken. Meistens komme ich mit einem bestimmten Vorhaben. Dann muss ich darauf achten, mich von der Frühlingsflut nicht allzu sehr ablenken zu lassen, die über Auge und Ohr über mich hereinbricht. Mitunter weiß ich nicht, wo ich zuerst hinschauen soll. Zählungen habe ich vor, Bestandsaufnahmen, um langjährige Entwicklungen verfolgen zu können. Aber dann singt plötzlich, früher als sonst, schon ein Fitis. Ich muss ihm zuhören, obwohl ich unzählige Male Fitisse singen hörte, muss dem Flug eines Zitronenfalters folgen, weil sein Gelb meinen Blick anzieht, wie das Liedchen des Fitis das Ohr. Der Himmel ist föhnblau, die Luft mild. Bussarde kreisen und rufen miauend, damit anzeigend, dass sie ein Brutrevier besetzt haben.
Ein bräunlicher Falter eilt vorüber. Er fliegt fast genau in meiner Kopfhöhe und weicht von seiner Flugbahn nicht ab. Er ist unterwegs nach Norden. Die Föhnströmung hat ihn über einen Alpenpass getragen und nun strebt er hinaus ins Alpenvorland. Ich weiche einen Meter zur Seite, um seine Flugbahn nicht zu stören. Beim Zitronenfalter ist das nicht nötig. Er umfliegt mich und setzt seinen ohnehin im Zickzack verlaufenden Flugkurs fort. Bis er auf einen zweiten trifft und mit diesem einen kurzen Luftkampf ausführt. Ein Ansatz zum Revierverhalten ist das; bei Schmetterlingen nicht sehr ausgeprägt, aber bei manchen Arten zumindest ansatzweise vorhanden. Ein frühes Waldbrettspiel Pararge egeria meint es ernster, als wir am Weg in der Au aufeinandertreffen. Der bräunliche, gelblich gefleckte Falter fliegt mir fast an die Nase. Kein Zweifel, er versucht mich zu vertreiben. Die Männchen des Waldbrettspiels wählen eine Strecke von ein paar Dutzend Metern als Revier. Sie fliegen in diesem in einem bis eineinhalb Meter Höhe und verjagen andere Falter daraus. Zwischendurch, wenn die Luft noch kühl ist, auch längere Zeit, sitzen sie auf einem Ästchen und halten Wache. Oder sie wärmen sich am Boden auf. Das dauert einige Minuten, dann beziehen sie wieder ihren Ausguck. Es amüsiert mich, dass mich so ein Schmetterlingsmännchen zu vertreiben versucht.
Ob es bei Rehen wirkt, die in der Größe infrage kämen? Bei Wildschweinen wohl nicht, deren Suhle ich gleich zu Beginn der Exkursion aus gebührender Distanz kontrollierte, ob die Rotte da ist und Frischlinge mit dabei sind. Ich will sie nicht stören. Sie werden ohnehin so intensiv verfolgt. Beim so großäugigen Reh kann ich mir vorstellen, dass der Anflug des Falters ein Ausweichen bewirkt. Gefährdet ist er dabei nicht. Wie auch ich ihn nicht gefährde, nur bewundere. Dabei hat er mich prompt vom Ziel der Exkursion abgelenkt. Ölkäfer sind es, weswegen ich genau dieses Auwaldstück am Inn aufgesucht habe. Der Austrieb der Traubenkirschbüsche signalisiert, dass es genau die richtige Zeit sein sollte, nach ihnen zu schauen. Die höchst komplizierte Lebensweise der Ölkäfer beschäftigt mich seit Jahren. Nur wenig davon bekommt man in den Frühlingstagen zwischen Ende März und Mitte oder Ende April mit. Etwas mehr, wenn der Frühling nasskalt verläuft, weil sich dadurch vieles verzögert. Ist es ein Super-Frühling, wie einige Male im letzten Jahrzehnt, läuft mir die Zeit davon, in der die so unförmigen Ölkäfer zu beobachten sind. Die Blauen Ölkäfer Meloë violacea, wie zu präzisieren ist.
Was ich heute von ihnen zuerst entdecke, sind ihre Larven. Als schwarze, etwas dicklich geratene Striche mit winzigen Beinchen sitzen sie auf den Blüten von Buschwindröschen, von Gelben Windröschen und der Roten Pestwurz. Vor allem an solchen Blüten finde ich sie, die nahe am Wegrand stehen. In manchen haben sie sich zu einem Klumpen im Zentrum der Blüte zusammengeballt. Nähere ich mich, um zu fotografieren, löst sich dieser blitzschnell auf. Die Larven eilen zu den Rändern der Blütenblätter und verharren daran. Meine Annäherung wirkte also ähnlich wie eine anfliegende Biene. Diese wäre ihr Ziel. Sie springen die Blütenbesucherin an, halten sich an ihrem Pelz des Brustteils fest und lassen sich zu ihrem Nest tragen. Dieses hat die Sandbiene tief im Boden angelegt, mit einer Pollenkugel ausgestattet und für die eigene Larve vorbereitet. Die Ölkäfer sind Parasiten. Die eingeschleppten Larven verzehren Ei oder Larve der Bienen und deren Pollenkugel. Dabei wandeln sie sich in eine andere Larvenform um. Sie müssen eine ganze Anzahl von Einzelnestkammern der Sandbienen ausfressen, um groß genug für die Verpuppung zu werden. Die fertigen Käfer sind mehr als zwanzigmal so schwer wie eine Sandbiene. Mit dem Leben der Ölkäfer befasse ich mich, weil noch viele Fragen offen sind. Der weitaus größte Teil ihres Lebens spielt sich unterirdisch im Verborgenen ab. Doch auch das, was sichtbar an der Erdoberfläche geschieht, steckt voller Rätsel. So finde ich Ölkäferlarven fast immer schon bevor ich die ersten Käfer entdecke. Also müssen die Gelege den Sommer und Winter überdauert haben und die Larven können erst im Frühjahr mit dem Aufblühen der Windröschen und dem Hervorkommen der Sandbienen geschlüpft sein. Deshalb will ich versuchen, möglichst viele Paarungen mitzubekommen, und vielleicht auch die Eiablage der Ölkäferweibchen. Und anderes mehr. Zum Beispiel, welche Wildbienen die Ölkäferlarven tragen. Als Wirte geeignet sind nur wenige.
Larven des Blauen Ölkäfers warten auf einer Buschwindröschenblüte auf Sandbienen, in deren Nestern sie schmarotzen.
Im Frühlingsauwald wird sehr deutlich, wie Temperatur und Licht zusammenwirken. Die Weidenkätzchen blühen. Weithin sichtbar ist dies, weil sie nicht mehr silbrig glänzen, sondern gelb überzogen sind. Die Sandbienen fliegen zu ihnen hinauf und holen Pollen. Die Kätzchen sind viel ergiebiger als die für uns so auffälligen Blütensterne der Gelben und der Weißen Windröschen am Auwaldboden. Die Larven der Ölkäfer krabbeln zu diesen empor und platzieren sich in die Blüte. Die Weidenkätzchen wären völlig außer ihrer Reichweite. Aber wie finden die nur wenige Millimeter langen Larven die Blüten, die sich dem Licht entgegenrichten? Vom Boden aus können sie diese nicht sehen. Dennoch sitzen oft sogar zehn bis zwanzig von ihnen in so einer Anemonenblüte. Ich kann nur vermuten, dass sie hineinkriechen, wenn sich die Blüte abends glöckchenförmig zur Schlafstellung nach unten neigt. Hinzu kommt, dass die Ölkäfer hier im blütenreichen Auwald herumlaufen und sich paaren, wobei sie aus den Sandbienenkolonien kommen, die draußen am sonnigen Rand angelegt sind. Dutzende Meter entfernt. Darin haben sie sich entwickelt. Nach dem Auskriechen streben sie in den Auwald, fort von den Nestanlagen der Bienen. Wie finden sie den Auwald? Wie darin die besonders blütenreichen Stellen? Die Ölkäfer haben keine Flügel. Ihre geschwollenen Körper sind unförmig und gewiss nicht leicht zu bewegen. Die Paarung fällt offenbar auch nicht gerade leicht; die Hinterleiber sind zu dick. Doch genug davon, das Leben der Ölkäfer ist noch viel komplizierter.
Was in dem schmalen Zeitfenster von Ende März bis April davon zum Ausdruck kommt, ist die komplexe Verbundenheit mit ganz anderen Abläufen im Auwald. Laubaustrieb und Erblühen der Weidenkätzchen, Blütezeit der Windröschen und ihre Häufigkeit, Sonnenstunden, die den dickleibigen Käfern genügend Wärme geben, und andere Umweltfaktoren wirken zusammen. Die Zitronenfalter fliegen, die bunten Kleinen Füchse wandern, Mönchsgrasmücken sind zurück und singen. Und zwar bereits »richtig« im Sinne der Abgrenzung von Brutrevieren, während die Fitisse vielleicht nur singen, weil ihnen zumute ist bei dem schönen Wetter auf ihrer Zwischenrast im Rückzug ins Brutgebiet irgendwo in den Birkenwäldern Skandinaviens. In den Büschelchen von Traubenkirschblättern, die dem Auwald in dieser Zeit schon mehr Grün verleihen als die Grauerlen und die Silberweiden, die beiden Hauptbaumarten dieser Weichholzaue hier, werde ich winzige Räupchen finden, die angefangen haben, erst kaum sichtbare Gespinste zu fabrizieren. Traubenkirschen-Gespinstmotten sind es. Von ihnen wird ausführlicher berichtet, weil sie ein Beispiel dafür sind, wie Bäume unter für sie natürlichen Lebensbedingungen mit der Massenvermehrung eines Insekts zurechtkommen, das Kahlfraß verursacht. Aus der Zahl der frischen Triebe, in denen ich die gerade aus den Eiern geschlüpften Räupchen finde, lässt sich eine erste Prognose ableiten, ob es wieder zu Kahlfraß kommt oder ob wenige Wochen später die Traubenkirschbäume blühen und den Auwald mit ihrem Duft erfüllen werden. Längst weiß ich, dass die Prognose fehlschlagen kann, wenn ein Spätfrost die noch winzigen Raupen trifft und vernichtet. Erfrieren dabei auch die Blütenanlagen, gibt es weder Duft noch die kleinen schwarzen Kirschen im Hochsommer, die Marder mögen und deren Kerne sie mit ihren Kothäufchen ausscheiden. Und so neue Traubenkirschbäume pflanzen.
Die lauten, wohltönenden Gesänge der Mönchsgrasmücke sind im Frühjahr und Frühsommer in Auwäldern häufig zu hören.
Von den Erlen sind die Kätzchen bereits abgefallen. Sie hatten fast zeitgleich mit den Haselstauden schon im Spätwinter geblüht und Wolken gelben Pollens dem Wind übergeben, als noch Schnee am Boden lag. Wenn ich nun die Kronen der Grauerlen mit dem Fernglas genauer betrachte, bekomme ich eine Vorstellung davon, ob es dieses Jahr viele Zapfen mit Samen oder wenige geben wird. Ist der Zapfenansatz gut, kann ich damit rechnen, dass im nächsten Spätherbst und Winter Schwärme von Zeisigen kommen und die Samen verzehren. Sehr viele werden zu Boden fallen und auf dem Schnee sichtbar werden. Im heutigen Frühjahrsbefund steckt viel, was sich in den folgenden Monaten entwickeln und ereignen wird.
Die Zeisige können als Gäste aus den Bergwäldern oder aus nordischen Wäldern kommen. Die Erlen verknüpfen diese Au mit weit entfernten Wäldern. Mit dem Fluss waren sie auf andere Weise mit der Ferne verbunden. Denn ihre Wurzeln nehmen Mineralstoffe auf, die aus den schweizer Bergen stammen. Hochwasser hatte sie hier im Auwald abgelagert. Dass gerade unter Erlen so viele Frühlingsblumen blühen, weist auf zwei andere Zusammenhänge hin. Die Erlenaue ist sehr licht im Vorfrühling und Frühling. Licht brauchen die Frühlingsblumen. Aber auch Nährstoffe. Und diese bietet die Erlenaue aus einem ganz anderen, das Hochwasser mit seiner Unregelmäßigkeit ergänzenden Fundus. An den Erlenwurzeln leben Strahlenpilze. Sie sind in der Lage, Luftstickstoff chemisch zu binden und in eine für die Pflanzen nutzbare Form überzuführen. Die Frühlingsblumen benötigen solche Pflanzennährstoffe auch für ihr schnelles Wachsen und Erblühen. Daher ihre Fülle im Erlenauwald. Licht, Nährstoffe, Bodenfeuchte natürlich auch. Blattaustrieb, Symbiose von Wurzeln mit Wurzelpilzen und Geschehnisse, die lange zurückliegen, wie der Gletscherabrieb in fünfhundert Flusskilometern Entfernung, wirken als System zusammen.
Die Bezeichnung Auwald ist nur ein Wort, eine extreme Kurzform, und der Zusatz Frühling ein kleines Zeitfenster daraus. Beispielhaft mag es veranschaulicht haben, dass die Waldnatur weit mehr ist als Waldbau und Holznutzung. Ich werde versuchen, Facetten aus dem unüberschaubar großen Netzwerk von Beziehungen und Vorgängen herauszugreifen, die Einblicke vermitteln in diese komplexe Natur. Wir werden uns dabei nicht im Detail verlieren, aber Details berücksichtigen, die bei der wirtschaftlichen Nutzung missachtet werden. Und auch immer wieder auf die viel zitierte Nachhaltigkeit eingehen. Ihre gegenwärtig häufige, mitunter geradezu beschwörende Zitierung macht sie nicht nachhaltiger.
Teil I
Vom großen Ganzen
Wald – eine Grundcharakteristik
Vor lauter Bäumen den Wald nicht zu sehen, warnt ein bekanntes Sprichwort. Wer zu sehr das Einzelne betrachtet, büßt den Blick aufs Ganze ein. Aber was ist »das Ganze«? Sagt uns ein erster Blick bereits, dass wir einen Wald vor uns haben? Fast immer tut er das, aber eben nur fast. Denn sollten wir genauer begründen, was ein Wald ist, geraten wir in Schwierigkeiten. Gehört ein Stadtpark dazu, in dem es schöne alte Bäume gibt? Ist die Baumgruppe in einem großen Garten bereits einer; ein Wäldchen zumindest? Wie verhält es sich mit der Weihnachtsbaumplantage? Ist sie Wald, wenn sie im Wald angelegt wurde? Und keiner, wenn sie draußen auf der Flur liegt? Noch unangenehmer nachgefragt: Wie viele Bäume machen einen Wald? Wie alt müssen sie (geworden) sein, um sich dafür zu qualifizieren? Tausend Weidensprösslinge oder gekeimte Eicheln sind sicher noch keiner. Die gleiche Zahl ist es nach hundert Jahren sicher. Es sei denn, die Bäume stehen zu weit auseinander. Wie in Savannen. Gehören diese zu Wäldern oder zum Grasland? Was in ihnen am meisten wächst, sind Gräser. Aber Bäume, wie Schirmakazien, können trotzdem einander mit ihren Kronen fast berühren. Savannen nehmen riesige Flächen in den wechselfeuchten Tropen und Subtropen ein. In Afrika bedecken sie weit mehr Land als der tropische Regenwald. Die Frage, was ein Wald ist, wirkt bei Weitung der Betrachtung auf globale Verhältnisse also nicht mehr so überflüssig oder als bloße akademische Spitzfindigkeit. Wir sollten zudem bedenken, dass wir automatisch unsere Körpergröße als Maß mit einführen. Für uns haben die Bäume eines Waldes groß zu sein. Reichen sie uns nur bis zum Kopf oder zur Brust, stufen wir den von ihnen gebildeten Bewuchs als Buschwerk ein. Als Macchie im Mittelmeerraum zum Beispiel, die für viele Tiere sicherlich ein dichter Wald ist. Für uns bleibt sie unter der »Würde« eines Waldes. Noch krasser gestaltet sich die Sicht, wenn wir Zwergsträucher aus der Ameisenperspektive betrachten. Im bekannten Kinderbuch Hänschen im Blaubeerenwald ist sie gewählt. Durchaus zu Recht, denn die nähere Betrachtung der Bäume wird beträchtliche Übereinstimmungen mit den Zwergsträuchern ergeben, zu denen die Heidelbeeren (Blaubeeren) und das Heidekraut gehören.
Also hilft nur der gesunde Menschenverstand weiter. Gefühlsmäßig sagt er uns, dass dies ein Wald, das dort aber nur eine Pflanzung mit Bäumen ist. Und auch, dass in den fernen Savannen offenbar andere Verhältnisse herrschen, sodass wir nicht alles in einer Kategorie unterbringen. Oder dass auch mehr hineingepackt wird, weil Vereinfachung Klarheit schafft. Geografische Bezeichnungen wie Schwarzwald oder Bayerischer Wald bedeuten nicht, dass diese Regionen komplett von Wald bedeckt sind und keine Siedlungen oder Fluren enthalten. Aber sie besagen sehr wohl, dass sie der hohe Waldanteil von anderen Gebieten unterscheidet. Berechtigt sind sie alle, diese Bezeichnungen, weil sie tatsächlich das Wesentliche meinen, was Wälder und Waldgebiete ausmacht.
Eichenwald (oben) ist der vierthäufigste Waldtyp in Deutschland. Die Höhenzüge des Schwarzwaldes (unten) sind hauptsächlich von Fichtenwäldern bedeckt.
In ihnen herrschen eigene Lebensbedingungen, die sie vom Offenland, von Fluren, Heiden, Mooren und auch vom Siedlungsraum der Menschen unterscheiden. Dazu müssen sie Mindestgrößen und hinreichend lange Beständigkeit aufweisen. Dass es uns schwer fällt, die Mindestgröße für einen Wald anzugeben, hängt mit dem gleichen Grundproblem der Skalierung zusammen, wie bei der Frage, wann aus einem ersten Gebäude mit weiteren ein Weiler, ein Dorf, eine Klein- und eine Großstadt werden. Grenzwerte pflegen wir einfach festzulegen. Ab dem ersten Einwohner, mit dem eine Stadt die Grenze von 100.000 überschreitet, ist sie formal eine Großstadt, obgleich sich nichts geändert hat. Ist sie über 900.000 Einwohner hinausgewachsen, strebt sie bzw. die Stadtverwaltung und viele Bewohner mit ihr den Status einer Millionenstadt an. Daraus können wir viel lernen für den Wald. Ein Baum mag der Beginn eines Bestandes sein, wenn er über Wurzelschösslinge austreibt, wie dies zum Beispiel Zitterpappeln können, aber zum Wald wird er erst, wenn viele weitere Bäume hinzugekommen sind, die durchaus zu anderen Arten gehören dürfen. Die Zunahme, um die es geht, verläuft nicht linear, sondern exponentiell. Deshalb geben Zehnerpotenzen in der Menschenwelt Sinn mit Grenzwerten von 100, 1000, … 1 Million. Die Wirkungen, die von der Vergrößerung ausgehen, verlaufen nämlich auch exponentiell, nicht linear.
Der Zustand, den wir Wald nennen möchten, wird vielleicht bei tausend alt gewordenen Bäumen erreicht, aber hunderttausend junge reichen unter Umständen noch nicht. Denn wenn fünf davon auf jedem Quadratmeter stehen, ergeben sie lediglich eine Bestandfläche von zweieinhalb Hektar. Das lassen wir als »Wäldchen« durchgehen. Ginge es aber um hunderttausend Bäume, um Eichen, die hundert Jahre alt sind und von denen jede zwanzig Quadratmeter Bodenfläche überdeckt, bilden sie einen zwei Quadratkilometer großen Wald. So einen hochstämmigen Eichenwald zu besitzen, wäre gewiss nicht schlecht. Die Berücksichtigung des Baumalters fügt über die Zeit eigentlich den Raum als dritte Dimension hinzu. Was anfänglich, bei ganz jungen Bäumen, noch Niveau von Wiese oder einfach Offenland war, ist nun mit Höhen von 15 oder 20 Metern zum Raum geworden. Und das ist entscheidend. Um die (ökologische) Wirkung »Wald« zu erzielen, muss ein hinreichend großer Rauminhalt entstehen, in dem sich ein eigenes Innenklima entwickeln kann. Ein Klima, das sich von dem des Offenlandes unterscheidet. Dafür reicht es noch nicht, wenn die Bäumchen gerade übers Gras hinausspitzen, das sich auch auf Jungwuchspflanzungen im Wald ausbildet. Kleinklimatisch bringt jede üppig gewachsene Wiese Ähnliches zustande.
Niederwald (oben), eine früher häufige Nutzungsform, ist selten geworden. Offene Flächen im Auwald charakterisieren die ursprünglichen Waldlichtungen, die von großen Weidetieren offen gehalten wurden (unten).
Ob die Savanne mit ihren Schirmakazien Acacia tortilis oder den Mopanebäumen Copaifera mopane den Wäldern zugerechnet werden soll oder doch eher nicht, ergibt sich aus der Wirkung ihrer Bestände auf das Klima. Wir bezeichnen es als Mesoklima, um es vom Allgemeinklima einer Region, wie es über die offiziellen meteorologischen Messstationen ermittelt wird, und vom Kleinklima, das sich bodennah in zahlreichen Varianten ausbildet, zu unterscheiden. In der Praxis heißt es Waldklima. Mit dieser Bezeichnung wird das Mesoklima im Folgenden benutzt, aber mitunter gegen das Mikroklima abgegrenzt, wo dies wichtig ist. Es wird sich auch zeigen, dass Bäume zu zählen wichtig und nützlich ist, aber eben vorausgesetzt, wir bewegen uns im selben Raumbereich. Wälder sind Räume. Das ist das Kernstück der Feststellung. Sie kartografisch als Fläche darzustellen, vereinfacht häufig viel zu stark. Mit der Holznutzung wird in den Raum des Waldes eingegriffen. Die Nutzung, jede ihrer zahlreichen Formen, verändert die Raumstruktur. Dies sollte der mühsame Weg über die Frage, wie viele Bäume einen Wald »machen«, zum Ausdruck bringen. Es mögen Tausende, Zehntausende gepflanzt worden sein. Die Entnahme einzelner großer alter Bäume können sie auf lange Zeit nicht ersetzen. Weil auch die Gesamtmasse von zehntausend Jungbäumen nicht aufwiegt, was in einem alten steckt: Lebenszeit und Lebensleistung.
Solche Behauptungen gilt es abzusichern. Mit der Lebenszeit geht dies zunächst recht einfach. Bäume wachsen. Aber »nicht in den Himmel«, wie das Sprichwort warnt. Richtigerweise, aber falsch zugleich. Selbstverständlich wachsen sie nach oben, also himmelwärts, nur nicht ohne Ende. Alle erreichen sie spezifische Maximalhöhen. Auch die Riesenmammutbäume an der amerikanischen Westküste, die Sequoia gigantea und ihre australische Konkurrenz, die Riesen von Eucalyptus regnans. Beide Baumarten, die kaum unterschiedlicher sein könnten, werden bis über 100 Meter hoch. Aber bei etwa 120 Metern endet auch bei ihnen das Weiterwachsen. Naturgesetze und Naturwirkungen setzen diese Grenze. Die meisten der als Urwaldriesen bezeichneten Bäume werden nicht einmal halb so hoch. In unseren Wäldern sind 70 Meter besondere Ausnahmen. Das Kronendach von Laub- oder Nadelwäldern entwickelt sich bei ungehindertem Wachstum in Höhen von 30 bis 40 Metern. Das ist mit dem ungefähr Zwanzigfachen unserer Körpergröße eindrucksvoll genug. Manche Wälder können das Gefühl von Heiligen Hallen vermitteln.
Warum solche Grenzen naturgegeben sind, ergibt sich aus der näheren Betrachtung der Biologie der Bäume. Hier ist die andere, die noch gar nicht beachtete Ebene zu ergänzen. Wir kennen sie, achten sie aber wenig in der Forstwirtschaft. Die Bäume wachsen nicht nur nach oben, sondern auch nach unten. Dabei bilden sie ein vielgestaltiges Wurzelwerk aus, das wir stark vereinfacht eine zweite, im Boden steckende Krone nennen könnten. Denn es ist ähnlich verzweigt und bis in feinste Enden aufgefächert. Zwischen dieser unteren und der oberen Krone vermittelt der Stamm. Seltsamerweise wäre er entbehrlich, gäbe es keine anderen Bäume der gleichen Art oder weiterer Arten. Denn wie sich aus der nachfolgenden Betrachtung der Vorgänge im Baum klar ergibt, hat er eigentlich nur eine Stützfunktion. Sie wäre unnötig, könnten sich Äste und Zweige mit dem Blattwerk oder den Nadeln gleich an der Bodenoberfläche ausbreiten. Das tun sie auch in Sonderfällen bei echten Bäumen, normalerweise aber nicht bei uns hierzulande. Die vergleichbare Form kennen wir aber gut, denn das sind die Sträucher, die viele Sprosse, aber keinen zentralen Stamm ausbilden und sich daher auch nicht mit einem Laubdach über den Boden erheben.
Aber wir wissen auch, dass Buschwälder von Natur aus nicht vorkommen; in unserem Bereich, ist einzuschränken. Die Macchie am Mittelmeer ist zum allergrößten Teil Menschenwerk. Sie entstand durch Abholzung der einst vorhandenen Wälder ohne entsprechende Wiederaufforstung. Die selbstständige Wiedererholung verhinderte die intensive Beweidung durch Ziegen und Schafe. Wie in der Lüneburger Heide, nachdem der Waldbestand für die Salzsiedereien vernichtet worden war. Auf den Typ Heide kommen wir zurück in spezielleren Zusammenhängen. Der Seitenblick darauf an dieser Stelle soll vorerst nur ergänzen, dass das Aufwachsen eines Baumes oder ganzer Wälder nicht allein von Boden, Wasser und Licht abhängt. Tiere können die Waldentwicklung nachhaltig beeinflussen; im uns leicht zugänglichen Bereich am besten zu sehen in beweideten Heidelandschaften und an dem, was Berge und Hügel oder Felsküsten rund ums Mittelmeer bedeckt. Aber trotz der so stark veränderten Waldform gibt es darin ein eigenes, sehr charakteristisches Waldklima – voll würziger Aromen in der Macchie und ein von zahlreichen Tieren geschätztes Mikroklima in der Heide.
Damit lässt sich der Wald ganz allgemein charakterisieren als ein höherer bis hoher Bewuchs, der ein eigenes Waldklima schafft, weil er dafür groß genug ist. Holzgewächse bilden den pflanzlichen Hauptbestandteil. Daher die relativ große Beständigkeit. Es liegt am Holz, dass der Wald langfristig Wald bleibt. Jahrzehntelang, über Jahrhunderte oder Jahrtausende; im Extremfall über Jahrmillionen. Die Beständigkeit wird uns bei den verschiedensten Themen immer wieder begegnen. Aber auch die Folgen von zu schneller »Umtriebszeit«, wie es im forstlichen Jargon heißt. Denn Wälder können altern. Sie tun es auch. Aber sie erneuern sich selbst, ohne die Unterstützung von Menschen dafür zu benötigen. Wenn man sie lässt.
Befassen wir uns daher nun mit dem Altern von Wald. Wiederum aber nur in einer allgemeinen Übersicht, weil Altersstadien später oft noch eine spezielle Rolle spielen werden. Altern heißt, dass es für Bäume wie für andere Lebewesen so etwas wie Altersstadien geben muss und sie offenbar nicht »ewig jung« bleiben können.
Wie Bäume altern
Wer in der Jugend ein Bäumchen gepflanzt hat, wird dieses im Alter als vielleicht schon recht stattlichen Baum im Garten haben. Einen, der in jugendlicher Kraft weiterwachsen wird, wenn es nicht gerade ein Apfelbäumchen war oder eine Weide. Wenige Baumarten wirken schon gealtert, wenn sie 50 Jahre erreicht haben. Manche, wie etwa die Eiche, sehen noch richtig jung aus. Das ist ganz normal, weil die natürliche Lebensdauer von Bäumen sehr unterschiedlich, aber in aller Regel viel länger als unsere ist.
Dabei gehören wir Menschen schon zu den großen Ausnahmen, was die Lebenserwartung für Säugetiere betrifft. Menschenaffen, unsere nächsten Artverwandten, übertreffen wir rund um das Doppelte. Über 70 Jahre wird kaum ein Elefant. Unsere gegenwärtige durchschnittliche Lebenserwartung fällt aus dem Rahmen. Ein hohes Alter, 90 oder 100 Jahre zu erreichen, gehört mehr zum Lebensstil großer Schildkröten. Doch der verläuft bekanntlich recht langsam. Dieses Privileg, das wir genießen, sollten wir berücksichtigen, wenn wir uns mit dem Alter von Bäumen und Wäldern befassen. Ihr Zeitmaß ist ein anderes als unseres; eines, das die Lebensdauer vieler anderer Pflanzen ebenfalls weit übertrifft. Die Gesamtspanne liegt zwischen einigen Wochen, in denen Pflänzchen keimen, aufwachsen, blühen, Samen bilden und wieder vergehen, und einigen Jahrtausenden im anderen Extrem bei wenigen Arten von Holzgewächsen. Unsere Waldbäume liegen mit einigen Jahrhunderten, die sie alt werden können, dazwischen.
Doch hier stoßen wir auf das gleiche Problem, wie bei der Frage, wie viele Bäume es bedarf, um einen Wald zu bilden. Die einfache Art, mit der wir unsere Jahre zählen, eignet sich nicht. Die Skalierung sollte besser in (logarithmischen) Größenordnungen vorgenommen werden. Um 500 Jahre herum bekommen wir eine Gruppierung von Lebensdauern, die gut zu unseren Waldbäumen und der Geschwindigkeit ihres Wachstums passt. Einige bleiben darunter, andere gehen deutlich darüber hinaus. Also erreichen Bäume rund das zehnfache Alter wie wir Menschen, falls wir sie so alt werden lassen. Der Vergleich mit uns Menschen hat noch einen weiteren Hintergrund. Wir zählen zwar unsere Jahre schön der Reihe nach, teilen sie aber, sogar juristisch mit dem 18. und dem 67. Geburtstag, in mehrere Phasen: Babyzeit, Kleinkindheit, Kindheit, Jugend, Alter und Hohes Alter mit der langen, von 18 bis 67 Jahren reichenden Zeit des voll erwachsenen (Erwerbs-)Lebens. In diesem erwartet man von uns, und wir normalerweise auch, die volle Leistungsfähigkeit. Davor entwickelt sie sich nach und nach, danach schwindet sie dahin.
Dies ist bei Tieren unserer Größenklasse nicht so, zumindest nicht so ausgeprägt. Sie wachsen (viel) schneller heran; ein Schwein in nur einem halben Jahr zur Schlachtreife. Und eine längere Altersphase erleben die wenigsten, weil die Leistungsfähigkeit sehr schnell sehr stark abnimmt. Uns Menschen kennzeichnet eine besonders lange Zeit der Adoleszenz (mit der Pubertät). Sie nimmt gut ein Jahrzehnt in Anspruch. Und eine noch längere Zeit der Seneszenz, des Alterns, die um die 30 Jahre dauert. Sie ist kein Siechtum, wenngleich man davon betroffen sein kann, sondern eine echte und auf ihre Weise produktive Lebensphase. Wir rechnen damit und gehen nicht davon aus, dass mit dem Ende der reproduktiven Zeit auch das Lebensende erwartet werden sollte.
Diese Selbstbetrachtung sagt uns viel zum Leben der Bäume. Es folgt dem grundsätzlich gleichen Schema. Auf die sehr prekäre Keimung der Samen, die meistens mit hohen Verlusten verbunden ist, folgt das rasche Wachsen der Sprösslinge, die überlebt haben. Sie streben ans Licht, so der Eindruck. Aber es dauert Jahr um Jahr, bis sie so selbstständig geworden sind, dass man sie für erwachsen halten kann. Mit dem Ausdruck »selbstständig« verwenden wir das passende Bild, bestehen zu können. Viele Baumarten machen eine lange Phase der Adoleszenz durch, in der sie noch nicht blühen und fruchten (können). Erst mit den Jahren fängt dies an und geht weiter, ebenso wie auch ihr Wachstum. Dass sie anhaltend größer und kräftiger werden, scheint nicht zum bildhaften Vergleich mit uns Menschen zu passen. Aber bei verändertem Blickwinkel dann doch sogar bestens, wie sich gleich zeigen wird. Die Jahre, in denen der Baum »erwachsen ist«, aber weiter wächst, entsprechen unserem Erwachsensein. Allmählich setzt das Altern ein. Ein genauerer Zeitpunkt lässt sich nicht festlegen. Wie bei uns Menschen auch. 67 ist eine formale Konvention. Als Altersgrenze kann sie für manche Menschen zu spät, gegenwärtig für die Mehrzahl leistungsmäßig zu früh angesetzt sein. Berücksichtigen wir, dass für Bäume eine zehnfach größere Zeitskala anzusetzen ist, bekommen wir eine entsprechend längere Spanne, in der ihr Altern beginnt. Und sich hinzieht bis zum Zusammenbruch und Zerfall.
Dass es dazwischen irgendwann und zu jeder Zeit zu Unfällen und Krankheiten mit Todesfolge kommen kann, fügt sich bestens ins Vergleichsbild. Das Bäumchen kann vom Wild verbissen, von Käfern aufgefressen oder von Konkurrenten erdrückt werden. Der große Baum voller Saft und Kraft kann vom Blitz getroffen oder vom Sturm entwurzelt werden. In den Regenwäldern der Tropen gehört Sturmwurf zu den häufigsten Todesursachen für die Bäume. Auch bei uns beeinflussen Stürme und Fraßschäden die Wälder. Gegen Letztere versucht man vorzugehen, wie wir unsere eigenen Krankheiten bekämpfen. Für uns zählt das Individuum, hat jeder Mensch ein Recht auf Leben und Unversehrtheit. Für die Bäume im Wald sieht das anders aus. Der Wald entsteht, weil viele, sehr viele Jungbäume sterben. Sturmwurf und Insektenkalamitäten verjüngen gealterte Wälder, vernichten sie aber nicht. Auch davon später mehr; ein heikles Thema, zumal wenn wir auch das Feuer, den Waldbrand, berücksichtigen. Bleiben wir vorerst beim Lebenslauf des einzelnen Baumes. In einer Hinsicht unterscheidet sich seine Endphase wirklich grundsätzlich von uns Menschen. Im hohen Alter stirbt er nicht plötzlich. Sein Tod ist ein Vergehen, verläuft als langsamer Übergang in den Boden, aus dem er gewachsen ist. Der Baum stirbt nicht, weil ein lebenswichtiges Organ versagt. Er ist keine organismische Einheit wie ein Mensch und wie die allermeisten Tiere. Aus einem unscheinbaren Seitenast, sogar aus einer Wurzel, kann ein neuer Baum aufwachsen, während der Mutterbaum vergeht. Jene Bäume, die vergleichsweise schnell wachsen und rasch altern, wie die Weiden, verfügen über diese Selbstverjüngung in besonderem Maße. Mit 70 können sie in den Zusammenbruch übergehen, aber jede Menge Sprösslinge aus allen Winkeln und Teilen, auch aus den schon umgestürzten und am Boden liegenden, austreiben und aufwachsen lassen. Genetisch sind sie identisch mit dem Mutterbaum, also Klone. Sein Tod betrifft also eigentlich nur die Statur, so wie wir sie sehen, bedeutet aber nicht das Ende seines Lebens. Dieses geht in neuen Sprösslingen weiter.
Ein intuitives Verstehen, vielleicht nur eine tiefere Ahnung, mag dazu geführt haben, dass sich bei der Entstehung unserer Sprache der Begriff »Fortpflanzung« gebildet hat. Wir verwenden ihn ganz selbstverständlich auch für uns und die Reproduktion der Tiere. Reproduktion klingt zu technisch, weil damit an sich nur erneute Produktion gemeint ist. Und so kommt die höchst merkwürdige Formulierung von der vegetativen Fortpflanzung zustande, also pflanzliche (Fort-)Pflanzung. Man mag darüber nachsinnieren, ob tiefe Wertschätzung des alles Lebendige verbindenden Vorgangs der Weiterführung des Lebens dahinter steht oder Prüderie, den Akt der Erzeugung neuen Lebens klar zu benennen.
Tote Bäume, auch Wurzelstöcke, bleiben lange bestehen – wenn man sie lässt!
Diese Abschweifung mag sich rechtfertigen, weil gegenwärtig so viel Geheimnisvolles aus dem Leben der Bäume und des Waldes ausgepackt wird, dass sich Wirklichkeit und Spekulationen schwer trennen lassen. Tiefere Gemeinsamkeiten gibt es, aber sie sind nicht geheimnisvoll. Es wird lediglich nicht näher darüber nachgedacht. Mitunter weist man Ähnlichkeiten und Übereinstimmungen aus bestimmten Motivationen heraus zurück. Bäume werden geerntet, wie der Mais oder das Getreide, nicht wie Äpfel und andere Früchte. Die Alterseinstufung erfolgt nach ihrem Nutzwert, nicht nach ihrer Lebensleistung, schon gar nicht, was sie für den Wald bedeuten. Handelt es sich um einen Forst, wie bei mehr als 90 Prozent unserer Wälder, werden alte Bäume möglichst gar nicht geduldet, allenfalls, im Staatswald, eher zähneknirschend hingenommen aufgrund des Druckes aus der Bevölkerung. Alt werden dürfen Bäume in unserer Zeit fast nur noch in der Stadt, in Parks oder in großen Gärten. Die Zeiten, in denen sie verehrt wurden, sind längst vorbei. Die Zeit, in der man an ihnen herumsägt oder sie vorsorglich lieber gleich entfernt, bevor von ihnen ein Ast abfallen könnte, wo sie kein Holz für die Nutzung zu produzieren haben, tut vielen einigermaßen alt gewordenen Bäumen auch nicht gut. Jung, kräftig und sturmfest sollen sie sein und dies am besten auch bleiben. Dann machen sie keine Probleme. Es ist sehr schwierig, alte Bäume als Naturdenkmal zu erhalten. Die dafür zuständigen Unteren Naturschutzbehörden machen jede Menge schlechte Erfahrungen damit. Einen Forst sich selbst über Jahrzehnte und Jahrhunderte zu überlassen, damit er sich zum Zustand eines Urwaldes entwickelt, rief Widerstände hervor, vergleichbar solchen, mit denen Atomkraftwerke bekämpft wurden. Ausgerechnet ältere und alte Menschen erwiesen sich als vehementeste Gegner eines solchen Nationalparkzieles, nicht jüngere und die Jugend.
Warum Bäume altern
Diese Frage ist nicht so abwegig, wie es den Anschein erwecken mag. Denn offensichtlich erneuern sie ihre Blätter regelmäßig, blühen und fruchten Jahr für Jahr, wenn sie groß und alt genug dafür geworden sind. Sie machen auch sonst einen stabilen Eindruck. Nun wissen wir aber, dass sie nicht wesentlich über hundert Meter in die Höhe wachsen können. Der entscheidende Grund dafür ist der Wassertransport so weit nach oben. Die Bäume haben nur mit den Blättern oder Nadeln ein Pumpsystem, das Wasser aus dem Boden nachzieht. Es muss durch enge, kapillarartige Gefäße nach oben. Dabei leisten die von den Seiten der Röhren ausgehenden Kapillarkräfte Widerstand. Es ist ohnehin enorm, dass in oft weniger als einen Millimeter engen Röhrchen Tag für Tag die vielen Liter Wasser aufsteigen, die eine Buche oder eine Eiche im Sommer verdunstet. Auch wenn es sich bei ihren Kronenhöhen nur um ein Fünftel der Höchstmaße von Bäumen handelt. Dieser Wasserdurchsatz wird uns in anderem Zusammenhang noch ausführlicher beschäftigen. Nachvollziehbar ist auf jeden Fall, dass die Saughöhe auch davon abhängt, welche Temperatur und welche Luftfeuchte im Kronenbereich herrschen. Wärme ist förderlich, hohe Luftfeuchte aber hemmt, wie wir von eigenem Schwitzen wissen. Deshalb erreichen nicht die Baumriesen der tropischen Regenwälder die höchsten Dimensionen, sondern Bäume in außertropischen Regionen. Sogar solche, deren Blätter auf Verringerung des Wasserverlustes gebaut sind, wie die nach unten hängenden der Rieseneukalypten Ostaustraliens. Aber dort ist die Luft sehr trocken und Wind zieht Verdunstungsfeuchte nach.
Bäume in unseren Breiten müssen sogar die Verdunstung bremsen, selbst wenn sie in Auwäldern wachsen. Wie die Silberweiden und die Silberpappeln, die so benannt wurden, weil ihre Blattunterseite silbrig glänzt. Verursacher ist ein dichter Belag aus feinen Haaren, durch den weniger Wasser aus den Spaltöffnungen der Blätter entweicht, als es der Temperatur und dem Wind am Wasser entsprechen würde. Obwohl die Wurzeln eigentlich keine Schwierigkeiten haben sollten, Wasser aufzunehmen und nachzuliefern, ist dieser Schutzmechanismus nötig, weil die dünnen, aufwärts gerichteten Wassersäulchen nicht abreißen dürfen. Sonst würde Ähnliches drohen, was wir beim Menschen Embolie nennen. Es geht also auch um die rechte Geschwindigkeit, mit der das Wasser nachgesaugt wird, nicht allein um die Menge. Diese Geschwindigkeit hängt von der Enge der Röhren und der Höhe des Baumes ab. 20 bis 30 Meter Höhe sind ein günstiger, vielfach sogar optimaler Wert. Die meisten unserer Laubbäume wachsen bis in diese Höhe und hören dann auf. Aber was dann?
Das Baumwachstum geht in beide Richtungen, nach oben und in die Breite. Die Dickenzunahme ist nötig, um die Kräfte zu kompensieren, die auf Stamm und Wurzeln mit dem Größerwerden wirken. Diese müssen sich entsprechend besser im Boden verankern. Auch dies erfordert »Dickenwachstum«. Ein überstarkes sogar, weil das Gewicht und die davon ausgehenden Zug- oder Druckkräfte mit der sogenannten dritten Potenz, der Querschnitt (die Dicke) aber nur mit der zweiten zunehmen. Übersetzt heißt dies, weil die Bäume beim Wachstum schwerer werden, muss die Dicke stärker zunehmen als die Höhe. Die Stämme der Mammutbäume sind aus diesem Grund weit eindrucksvoller als ihre Kronen. Sie entwickeln gleichsam einen Elefantenfuß. In tropischen Regenwäldern, in denen häufig Gewitterstürme vorkommen, bilden viele Bäume riesige Brettwurzeln aus, die ihre Stämme seitwärts in mehreren Richtungen zusätzlich stützen. Manche dieser Brettwurzeln sind so groß und breit, dass sich ein Mensch hinter ihnen glatt verbergen kann. Allerdings liegt das auch daran, dass in Böden vieler tropischer Regenwaldgebiete im tieferen Mineralboden sehr wenige Pflanzennährstoffe vorliegen. Die Verwurzelung reicht daher nicht weit in die Tiefe, weil es dort nichts zu holen gibt und manchmal auch Sauerstoff im Mangel ist. Bei uns umklammern Bäume in Bergwäldern manchmal einen Felsen, sodass wir die Bedeutung eines festen Standes daran direkt sehen.
Lässt sich daraus schließen, dass die Bäume einfach immer dicker werden sollten, wenn sie die vom Wasserstrom vorgegebene Höhengrenze erreicht haben? Grundsätzlich ja, aber gleichfalls mit Einschränkungen. Sehr alte Eichen und andere Baummethusalems zeichnen sich tatsächlich durch einen gewaltigen Stammumfang aus. Doch mag dieser im Durchmesser auch über fünf Meter hinausreichen, es werden gewiss keine fünfzig daraus. Wie alt ein solcher Baum geworden sein müsste, ergibt eine einfache Rechnung. Beträgt der durchschnittliche jährliche Dickenzuwachs 0,5 Zentimeter, würde der 50-Meter-Baum zehntausend Jahre alt sein. Dieses Alter läge zwar jenseits der Grenze der ältesten Bäume, die wir kennen, fiele aber gar nicht so sehr aus dem Rahmen. Dennoch weisen nicht einmal versteinerte Hölzer auf solche Dimensionen hin. Die Last selbst tragen könnte der Baum, denn sie stünde ja auf dem Boden, fest verankert von starken Wurzeln. Die Holzmasse wäre auch nicht so viel anders, wenn unser 50-Meter-Baum nur 20 Meter hoch ist und mit einem Riesenmammutbaum verglichen wird.
Mammutbäume im pazifischen Küstengebirge Nordamerikas übertreffen an Holzmasse alle anderen Baumarten, auch solche tropischer Regenwälder.