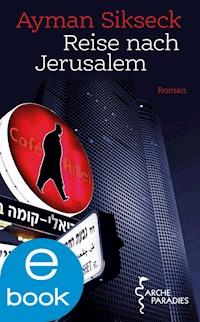
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Arche
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
"Wir neigen dazu, aggressiv und aufgeregt über den israelisch-arabischen Konflikt zu diskutieren. Ayman Sikseck gewährt uns ganz unaufgeregt tiefe Einblicke in die Komplexität der Situation." Yudit Shahar, Haaretz Aus dem Leben eines Palästinensers in Israel: Ayman Sikseck erzählt die Geschichte eines jungen Mannes, der als Palästinenser in Jaffa geboren wurde und nach Jerusalem geht, um dort an der Universität Literatur zu studieren. Als ein Fremder in Jerusalem, verläuft er sich auch in Jaffa zwischen den zahlreichen Neubauten für betuchte Juden, die dort wie Pilze aus dem Boden schießen. Und selbst mit der Liebe fühlt er sich wie in einem Labyrinth: Seine arabische Freundin darf er nur heimlich treffen, solange er nicht bei ihrem Vater um ihre Hand anhält - während seine jüdische Freundin, eine Soldatin, ihn erst abfüllen muss, um ihn anschließend abzuschleppen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 158
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Ich schreibe in der hebräischen Sprache,
die nicht meine Muttersprache ist,
um auf der Welt verloren zu gehen.
Wer nicht verloren geht,
wird das Ganze nicht finden.
Denn jeder hat die gleichen Zehen an den Füßen,
die er behutsam einen vor den anderen setzt.
Aus »Ich schreibe Hebräisch«
von Salman Masalha
Seit ich von meiner Mutter weiß, dass Samaher ihre Bedenken aufgegeben hat und endlich der Heirat zustimmt, kann ich ihr kaum noch in die Augen sehen. Der Gedanke, dass meine Schwester wegen dieser arrangierten Ehe alle anderen Zukunftspläne über den Haufen wirft, macht mir eine Gänsehaut und irgendwie auch ein heftiges Schuldgefühl, vor allem jetzt, da ich überlege, nach Jaffa zurückzukehren.
Samaher weiß, ich habe nichts damit zu tun, dass sie mit einem Mann verheiratet wird, den sie anfangs nicht akzeptieren wollte und den ich noch nicht einmal kennengelernt habe. Das Recht, in derlei Dingen zu entscheiden, hat Mutter ihren beiden Brüdern übertragen, die natürlich nichts auf die Meinung ihres jüngsten Neffen geben. Und wenn ich mutig genug gewesen wäre, den beiden die Stirn zu bieten und ihre Beschlüsse in Zweifel zu ziehen oder sie auf ihren Fehlgriff hinzuweisen, hätte ich Mutter damit so viel Kummer und Sorge bereitet, dass sie mir vor meiner Rückfahrt nach Jerusalem wohl nicht mehr verziehen hätte.
Trotzdem wurde ich dieses dumpfe Schuldgefühl nicht los. Seit ich mit dem Studium begonnen habe, bin ich überzeugt davon, für meine Familie, und vor allem für meine Mutter, eine Enttäuschung zu sein, weil ich nicht den Platz eingenommen habe, der mir nach Vaters Unfall zugekommen wäre. Wenn ich damals nicht so in meine Bücher vertieft gewesen wäre, hätte Mutter die Almosen ihrer Brüder vielleicht nicht annehmen müssen. Aber Samaher und ich haben nicht auf sie gehört: Gleich nach dem Abitur schrieb Samaher sich fürs Pädagogikstudium ein und betätigte sich ehrenamtlich im jüdisch-arabischen Gemeindezentrum. Sie war auf die regelmäßige finanzielle Unterstützung unserer Onkel angewiesen, die man ihr zähneknirschend und mit saurer Miene gewährte. Ich wiederum zog mir Mutters Ärger zu, weil ich unbedingt in Jerusalem studieren wollte. Jetzt musste ich kleinlaut eingestehen, dass sie vielleicht recht gehabt hatte. So hatten Samaher und ich uns die Zukunft nicht ausgemalt, als wir Schulter an Schulter auf unserem geteerten Flachdach lagen und einander erzählten, was für große Ambitionen wir hegten. Samaher hatte beteuert, dass sie nicht vor ihrem achtundzwanzigsten Geburtstag heiraten würde, und auch dann nur, wenn sie bis dahin ihren Master in der Tasche hätte. In den letzten Tagen, als ich noch öfter als sonst an sie dachte, sah ich sie vor mir, wie sie mit geballten Fäusten beteuerte, dass sie Vater noch einmal Reue lehren würde, wenn er erst ihren Erfolg zu sehen bekäme. Ihr zuliebe hatte ich sie so aufmerksam angesehen, als würde ich kein einziges Wort verpassen wollen. Als ich heute niedergeschlagen im Bus zurück nach Jaffa saß, hoffte ich, sie nicht zu Hause anzutreffen, wenn ich gegen Abend ankam. Am liebsten wäre mir sogar, wenn ich sie bis zur Verlobungsfeier am Samstag gar nicht sehen würde.
In Gedanken versunken, beugte ich mich über meinen Rucksack und zog das alte Notizbuch heraus. Seine Ecken sind abgenutzt, die Seiten vergilbt und zerfleddert, aber ich mag es lieber als das neue, das Samaher mir geschenkt hat, als ich aus Jaffa wegzog. Die Seiten sind fast alle vollgeschrieben, sodass ich neue Notizen auf die Innendeckel, die Seitenränder oder in winziger Schrift zwischen die bestehenden Zeilen kritzeln muss. Aber wann immer ich etwas notieren möchte, scheint mir das alte Notizbuch eine weitere Schreibfläche einzuräumen. Ehe ich jedoch diesmal etwas schreiben konnte, rief der Fahrer Tel Aviv aus und stellte den Motor ab. Ich steckte das Notizbuch zurück in den Rucksack und stieg aus.
In der Gasse vor dem Busbahnhof trat ein junger Mann mit Kippa auf mich zu. Er trug einen ganz ähnlichen Rucksack wie ich über der Schulter und hielt mir ein Büchlein hin, das beiderseits in Kartondeckel gebunden und mit ungeübter Hand bepinselt war. »Der Psalter, Kamerad«, erklärte er und deutete mit der freien Hand auf ein improvisiertes Schild, das er an einen Strommast gelehnt hatte. »Fünf Schekel, um die Synagoge zu retten. Na, was sagst du? Eine Mizwa.« Ich sah zerstreut auf das Schild und erkannte die Synagoge, um die es ging. Ich steckte die Hand in die Hosentasche und holte ein paar Münzen für ihn heraus. »Danke, Kamerad, vielen Dank«, sagte er. Er heiße Jigal, stellte er sich vor, drückte mir die Hand und übergab mir das Büchlein. Ich setzte den Rucksack ab, um es einzustecken, aber meine Finger verhedderten sich und rutschten immer wieder vom Reißverschluss ab. »Lass mich mal!« Jigal beugte sich hinunter und öffnete mit einem schnellen Ratsch das große Fach. »Der ist genau wie meiner.« Sein rascher Griff nach meiner Tasche machte mir Angst, es fühlte sich an, als hätte er einfach so eine Tür aufgerissen, die ich sonst sorgfältig geschlossen hielt. Ohne sein Lächeln zu erwidern, nahm ich meinen Rucksack und ging davon.
Ich kam später als erwartet nach Hause. In unserem Viertel begrüßten mich die Straßenlaternen und warfen ihr Licht auf die Begonien, die noch einmal blühten. Ich vergewisserte mich, dass Samahers Wagen nicht da war, und ging ins Haus. Als die Tür ins Schloss fiel, hörte ich, wie meine Mutter zu jemandem in der Küche sagte: »Da ist er.« Sie kam mir entgegen und flüsterte mir auf dem Gang zur Küche ins Ohr: »Dein Onkel ist da.« Unnötig zu sagen, welcher, denn nur der eine besucht uns hin und wieder. Ich setzte mich an den Tisch, möglichst weit von unserem Gast entfernt, und klemmte den Rucksack zwischen meine Beine. In diesem Moment freute mich der Gedanke an all die Abende, die ich an diesem Tisch verbringen würde, sobald ich Mutter mein Versagen eingestanden hatte und nach Jaffa zurückgekehrt war.
»Was gibt es denn zu lächeln?«, fragte mein Onkel verwundert und zündete sich eine Zigarette an. Die Frage überraschte mich.
»Nichts«, quetschte ich hervor und suchte Mutters Blick.
»Noch dazu so ein breites Lächeln«, fuhr er fort. »Aber du hast ja auch guten Grund dazu, nicht wahr? Die Geschäfte florieren gegenwärtig, und wir können dir problemlos dein Studium finanzieren.« Er fixierte mich und betonte die Worte »dein Studium«, als würde er mir damit meinen Egoismus vor Augen halten wollen. Ich reagierte trotzdem nicht und ließ ihn weiterreden: »Aber vor allem musst du dich bei Samaher bedanken, nicht wahr?«
Mutter sah ihn an.
»Habe ich etwa nicht recht?«, sagte er und blies Rauch in die Luft. »Er hat doch immer gewusst, dass wir die Studiengebühren für beide auf einmal nicht aufbringen können.«
Der Rucksack lastete jetzt schwer auf meinen Füßen. Ich kickte ihn zur Seite und streckte mich verlegen.
»Sie hätte ohnehin geheiratet«, wandte Mutter ein und suchte mit ihrer Hand nach meinem Nacken. In diesem Moment, im weichen Abenddunkel der Küche, war ich nahe daran, ihr um den Hals zu fallen, ihr zu sagen, dass sie recht gehabt hatte, dass ich nie hätte ausziehen dürfen und dass ich jetzt zurückkommen wollte, nach Jaffa, zu ihr, ein für alle Mal. Ich hatte das völlig unsinnige Gefühl, gleich würde mir eine Ader platzen und mein ganzes Gesicht überfluten. Aber unser Gast ließ kein Auge von mir, und seine Anwesenheit verlieh dem Gedanken etwas Lächerliches. Ich musste an den selbst gebastelten Psalter denken und überlegte, ob der Fußtritt das Buch so kurz nach dem Kauf womöglich in fliegende Blätter verwandelt hatte.
Am Samstagabend erschien Samaher in einem blauen Kleid, das ihr Bräutigam ihr gekauft hatte. Ich wusste, dass sie diese Farbe noch nie ausstehen konnte, wunderte mich aber trotzdem nicht bei ihrem Anblick. Als ich an den Ecktisch im Wohnzimmer trat, um mir ein Glas Wasser einzuschenken, hörte ich einen der Anwesenden sagen, man könne denen von der anderen Seite des Trennzauns einfach nicht klarmachen, was guter Geschmack sei. Das Haus wimmelte von Gästen, und alle suchten aufgeregt die Hauptperson der Feier, meine Mutter, um dem Ehebündnis Glück zu wünschen. Der zukünftige Bräutigam sagte gar nichts. Er saß kerzengerade und in sich gekehrt neben Samaher und zerbröselte einen Keks zwischen seinen Fingern. Nur sein angespannter Blick schweifte durch den Raum und zog überall Aufmerksamkeit auf sich.
Immer mehr Gäste trafen ein und brachten hübsch verpackte Geschenke und Blumensträuße. Die meisten waren wohl Verwandte des Bräutigams und sprachen ein militantes, krachendes Arabisch, von dem mir nur ein paar Splitter vertraut vorkamen. Angestrengt lauschte ich ihren Gesprächen. Sie drehten sich um die Braut und darum, wie gut die beiden Familien doch zusammenpassten. Jemand erwähnte die alte Synagoge am Rand des Viertels und den seit Jahren andauernden Kampf um die Rückgabe des Gebäudes an die Familie, die 1948 daraus geflüchtet war. Ich musste an Jigal denken, stopfte mir einen Keks in den Mund und hastete in mein Zimmer. Dort blieb ich am Fenster stehen und betrachtete die Gebäude gegenüber. Sie wirkten näher als sonst und starrten mit erleuchteten Fenstern auf den wachsenden Trubel in unserem Wohnzimmer. Mir wurde heiß, trotzdem machte ich die Fensterläden zu und beschloss, einige Zeit hierzubleiben und das Geschehen von meinem Zimmer aus zu verfolgen. Der schmale Türspalt gab zwar nicht viel preis, aber ich konnte meine Mutter und einige der Fremden beobachten. Samaher und ihren Verlobten sah ich allerdings nicht mehr. Die lachenden und fröhlichen Stimmen der Gäste ärgerten mich, ich grollte ihnen allein dafür, dass sie im Haus waren. Ich musste mir immer wieder sagen, dass am nächsten Tag keiner mehr da sein würde, nur noch Mutter und ich, und dass das ganze Haus, das früher Vater und mir gehört hatte, fortan nur noch meins sein würde. Gleich morgen früh würde ich in der Universität anrufen, dort mitteilen, dass ich das Studium abbreche, und dann gleich auf Arbeitssuche gehen. Ich werde nach Jaffa zurückkehren. Der Gedanke an Mutters Reaktion munterte mich auf. Ich legte mich aufs Bett, schloss die Augen und wäre vermutlich eingeschlafen, wenn sich nicht die Zimmertür geöffnet hätte. »Samaher …«, flüsterte ich.
Bis vor Kurzem war das unser gemeinsames Zimmer gewesen. Samahers Bett hatte hinter einer Zwischenwand aus Gips gestanden, die in der Mitte des Raums eingezogen worden war. Morgens hatte ich das matte Ächzen ihrer Schubladen hinter der Wand gehört und gewusst, dass es Zeit zum Aufstehen wurde. Dort, wo die Wand gestanden hat, ist ein heller Streifen zurückgeblieben, eine Art Mahnung, dass hier die Grenzen zu Samahers Reich gelegen haben.
»Möchtest du dich setzen?« Ich spürte, dass meine Wangen glühten. Samaher gab keine Antwort. »Setz dich. Ich räume meine Klamotten vom Bett …«
Sie kam näher und ließ den Blick umherschweifen, als wolle sie sich über ihre Position in dem neuen Raum klar werden. Dieses Zimmer war ein weiterer Bereich, aus dem ich sie unweigerlich verdrängt hatte. Ihr Blick blieb an dem alten Schaukelstuhl unseres Vaters hängen und wurde starr. Auf dem Stuhl lag lässig hingeworfen mein Rucksack. Der Psalter, den ich gekauft hatte, lugte daraus hervor. »Der ist fürs Studium …«, log ich. »Du weißt, wie das ist. Ich muss ihn lesen und eine Arbeit darüber schreiben, nichts Besonderes.«
Sie schwieg hartnäckig.
»Weißt du«, sagte ich, »vielleicht komm ich zurück. Das heißt, hierher, nach Hause. Ich weiß nicht …«
Meine Worte verhallten ungehört. Samaher fasste mechanisch ihr Haar zusammen und kam auf mich zu. Das Schweigen lastete im Raum, eine schwüle, bedrückende Stille, die den Trubel draußen fast erstickte. Ich war so angespannt, dass ich bereute, aus dem Bett gestiegen zu sein. Samaher stand vor mir, ich spürte ihren Atem im Gesicht. Unvermittelt holte sie aus und versetzte mir mit aller Kraft eine Ohrfeige, einen einzigen wütenden Schlag ins Gesicht. Ich ließ den Kopf einige Sekunden hängen, dann blickte ich zögernd zu ihr auf.
Sie wandte sich um und ging, ließ die Tür sperrangelweit offen und tauchte in dem Schwarm von Menschen unter, die ich nicht kannte. Ich stand da wie angewurzelt, bis sie ganz verschwunden war, strich mir lindernd mit der Hand über die brennende Wange und ging dann an den Schrank, um die Kleider wieder herauszuholen, die ich hastig vom Bett dort hineingestopft hatte. Ich legte sie neu zusammen und verstaute sie in einem ordentlichen Stapel in meinem Rucksack. Ich musste morgen zurück nach Jerusalem, wie geplant. Ende des Monats begann das neue Studienjahr.
Scharihan und ich trafen uns erst eine Woche später, an unserem üblichen Platz in der Altstadt von Jaffa, dort, wo uns kaum einer sehen kann und die, die es doch können, nicht wissen, wer wir sind. Sie war müde und zerzaust und lief fast automatisch den Pfad entlang, der die Mole überblickt. Nur ab und zu sah sie sich nach mir um, um sicherzugehen, dass ich hinter ihr war. Der schmale Weg beginnt am Eingang zur Altstadt, wo große Paradesoldaten aus Beton die Touristen begrüßen, macht dann einen Bogen und verliert sich schließlich auf einer gesichtslosen Sand- und Geröllfläche. Ich folgte ihr langsam, hielt hier und da inne, um ein paar Steine aus dem Weg zu kicken und so zu tun, als hätte ich kein besonderes Ziel. Als wir endlich unseren Treffpunkt an der bröckelnden Rückwand eines alten Restaurants erreichten, empfing mich Scharihan mit offenen Armen und zog mich an sich. Wir standen lange eng umschlungen, dann küssten wir uns zu den Schreien der Fischer, die auf den Felsen unter uns standen und ihre Netze einholten.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!





























