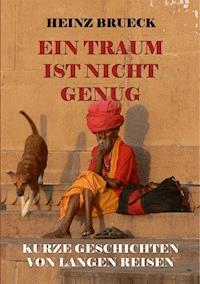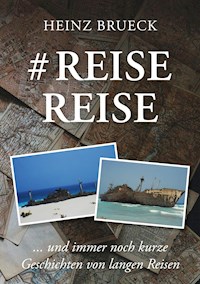
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Geschichten von Reisen quer durch die Welt, durch Kontinente, Landschaften und Regionen, Geschichten von Menschen und Begegnungen, von Begebenheiten und Abenteuern, von Alltäglichem, Besonderem und Absonderlichem, Geschichten zur Anregung und zum Nachahmen, Geschichten über die Schönheit der Welt und über die Gefahren, die dieser Welt drohen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1001
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
DEN KINDERN UNSERER KINDER
Für
Kilian
Leander
Simon
Hanno
und
Ida
Mögen sie ihren Horizont stets so hoch wählen, dass sie aufrechten Hauptes und lächelnd durch das Leben gehen können
Inhalt
FÜR MEINE FAMILIE
NUR EINE KLEINE GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR »IMMER NOCH … KURZE GESCHICHTEN VON LANGEN REISEN«
EL BRUJO – ODER REISE IN DIE VIELFALT
LIEGT HIER DIE ZUKUNFT?
MORA MORA (MALAGASY)
JUHANNUS
DAS LETZTE ABENTEUER EUROPAS
MALTA – TOURISMUS SEIT DER STEINZEIT
AUF DER STRASSE NACH MANDALAY
FLORES LINDAS – SCHÖNE BLUMEN
VON ENGELN, GEIERN UND WIEDEHOPFEN
IN EINEM ANDEREN LAND
DER OSTEN IST KARG
EIN ÖSTLICHER DIWAN
BIG IN JAPAN
IM LAND DER BÄREN
ROSE BLANCHE – WEISSE ROSE
IN HOHEN BREITEN
KONTINENT DER EXTREME – ANTARCTICA
DAS SIRIUS-MISSVERSTÄNDNIS
FÜR MEINE FAMILIE
Gern benutzt man eine der ersten – der meistens sonst leeren – Seiten eines Buches, um sich zu bedanken bei denen, die einen besonders unterstützt, gefördert, vielleicht auch gefordert und manchmal auch in Ruhe gelassen haben, obwohl man eigentlich angewiesen war nicht nur auf die Anwesenheit des Schreibenden, sondern auch schon einmal seiner Hilfe bedurfte bei alltäglichen Dingen, vielleicht sogar von seinen besonderen Fähigkeiten profitieren konnte oder musste, wenn er denn überhaupt solche hatte, und ihn auch schon einmal ein wenig gestört hatte beim Schreiben – er fühlte sich so, oder er war es wirklich, gestört. Und das ohne Doppeldeutigkeit – oder doch mit?
Aber manchmal, nein, meistens eigentlich, war es einfach umgekehrt: nicht der Schreibende wurde gestört, der Schreiber war mit seinen Wünschen, Forderungen oder ablehnenden Kommentaren – »Nicht gerade jetzt – Moment mal – Nein, ich muss jetzt nachdenken und brauche Ruhe – Ein Kaffee wäre jetzt auch nicht schlecht – Die Musik stört sehr, außerdem ist sie zu laut und schrecklich« – der Störenfried der Familie und zwar kein kleiner, hatte man ihm doch keinen Bunker der Ruhe gebaut, um ihn schreiben zu lassen, sondern er war mitten im Geschehen und das auch noch aus eigener Schuld, denn soll doch der Pensionär einfach Ruhe geben und sich vorbereiten auf … tja, auf was denn? Da gehen die Meinungen auseinander. Die deutsche Rentenversicherung hat sicherlich eine andere als man selbst, vermute ich.
So widme ich das nachfolgende Werk, wenn man es denn so nennen darf, ich mache das schon einmal, andere werden vielleicht kichern oder sich schlapplachen darüber oder es einfach weglegen – uninteressant, langweilig – den Menschen, die es ganz bestimmt verdient haben. Ich folge also hiermit diesem anscheinend guten Brauch, den man aber immer weniger findet.
Früher, liest man die ganz alten Dinger, waren diese Widmungen Gang und Gäbe, doch kein lieber Verwandter war der Adressat, der Fürst, der Mäzen, der den Schreiber bezahlt oder ihn vor dem Militärdienst bewahrt hatte, musste ganz vorn stehen, auch wenn er entweder nicht lesen und schreiben konnte, was bei Erbfürsten, Kindern aus Verwandtenehen, ja schon einmal vorkommen konnte oder er sich für das Machwerk einen » …« interessierte (was soll da jetzt stehen, ohne sprachlich anzuecken? Suchen Sie sich was aus, aber lassen Sie sich nicht vom Geschlecht »einen« beeinflussen, denn ansonsten ist das Resultat immer gleich).
Noch schlimmer, ja es konnte noch schlimmer kommen, war es, wenn man, und das musste man zu den ziemlich frühen Zeiten eigentlich immer, wenn man kein »Schwarzdrucker« war, nämlich das Buch der »Heiligen Inquisition« vorlegen, die freundlich nickte, weil sie es nicht verstanden hatte, es aber harmlos fand oder freudig zustimmte, weil Gott darin andauernd vorkam, oder aber schon einmal befahl, Holz zu sammeln für … (ich fand es schon recht absurd, dass das Original – ja das gibt es, dass man so etwas herumstehen hat, auch wenn es nur ein teures Faksimile ist – der »Os Lusiadas« des Luis De Camões, das portugiesische Nationalepos, nur erscheinen durfte, weil die »Heilige Inquisition« gnädig zugestimmt hatte).
Die Inquisition hätte das hier vorliegende Buch, dieses »Machwerk«, sicherlich nicht gutgeheißen. Aber so … Glück gehabt!
Ich bedanke mich bei meiner Familie für jedwede Unterstützung, bei meiner Frau natürlich zuerst und besonders, die jahrelang nichts dagegen hatte, mich für Reisen, manchmal auch für längere Zeit und in seltsame Gegenden, wie sie damals meinte, loszulassen, bis sie merkte, dass ich ja – bis jetzt – immer wiederkomme und man eigentlich gefahrlos mitreisen könne. Was sie jetzt auch manchmal tut.
Und dafür, dass sie mich in meinem Arbeitskeller an den Computer lässt, ohne mich laufend darauf hinzuweisen, dass der Rasen wieder mal gemäht werden müsste, was er allerdings auch wirklich manchmal muss.
Und ich bedanke mich bei meinen Kindern, denen ich hoffentlich ein wenig Fernweh mitgegeben habe, um solche Dinge zu entdecken, über die ich in Auszügen berichte, ein Auge für die Besonderheiten ferner Welten, die aber auch schon mehr als einmal auf ihren Vater verzichten mussten, so zu Beispiel meine Tochter, die immer dann pflegt, Geburtstag zu haben, wenn ich Semesterferien hatte und auf Tour war. 2017 zu ihrem Vierzigsten war ich das erste Mal seit 23 Jahren vor Ort, nachträglich »dreadfully sorry«. Dummerweise waren die nachfolgenden Jahre wieder durch meine Abwesenheit geprägt.
Und bei meinen Söhnen muss ich mich bedanken, bzw. entschuldigen, denen ich in der Zeit meiner Abwesenheit nicht bei irgendwelchen schulischen Dingen helfen konnte, die solche Einmischungen wahrscheinlich aber auch gar nicht gewollt hätten, ich glaube das nämlich eher, eigentlich weiß ich es sogar.
Aber ganz so schlimm wird es nicht gewesen sein mit meiner Abwesenheit, und manchmal ist man zu Hause bestimmt auch überflüssig, denn als die Familie vor langen Jahren einmal beim Abendessen saß (das wir als »Ihr seid komische Eltern« den Kindern zwangsverordnet hatte – »Einmal am Tag sind alle zusammen!«) und ich in einer Diskussion über das Alter die Worte fallen ließ: »Na ja, die Zeit geht vorüber und die Hälfte ist vorbei«, wobei ich mein damaliges Alter von 50 meinte, kam die Frage: »Welche Hälfte?« und meine Antwort: »Ernst Jünger (deutscher Schriftsteller, für die, die keine Kriegsliteratur – »In Stahlgewittern« – lesen, was ja sehr verständlich ist) ist jetzt 102, das werde ich wohl auch noch schaffen!« Darauf die nachdenkenswerte Frage eines meiner Söhne: »Willst Du uns bedrohen?« Ernst Jünger ist dann übrigens auch mit fast 103 verstorben, meine Mutter – ich hoffe, dass dieses Gen an mir vorbei gehen wird, ansonsten … musste mit 104, und das auch nur durch einen dummen Zufall, das Zeitliche segnen, wie man so (schön?) sagt.
In diesem Sinne … sollte man nicht zu lange warten mit dem Aufschreiben von Geschichten, und die letzten, die mir eingefallen sind, können Sie jetzt und hier lesen oder einfach ignorieren, wegwerfen, weiterempfehlen oder … das weiß der Himmel (und dies wiederum würde die Heilige Inquisition sicher freuen).
Also noch einmal Danke an alle Betreffende oder gar Betroffene!
NUR EINE KLEINE GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR »IMMER NOCH … KURZE GESCHICHTEN VON LANGEN REISEN«
»Werter Leser«*,
lesen Sie diesen zweiten Band der »Kurzen Geschichten« als wirklich Ihren zweiten Band, so werden Sie bemerken, dass Sie die »Gebrauchsanweisung« schon kennen, denn Gebrauchsanweisungen ändern sich bei unverändertem Produkt ja nur, wenn sie Fehler enthalten oder in ihrer Gesamtheit fehlerhaft sind oder überholt, alt, nicht mehr gültig, nicht lesbar, weil halb chinesisch, Unsinn oder noch Schlimmeres.
Lesen Sie ihn als Ihren ersten Ausflug in meine Welt, dann streichen Sie den obigen Absatz einfach, denn dann ist das, was folgt, neu und auch nicht überflüssig.
Denn die Welt ist ein Mythos. Ein Mythos, den die Naturwissenschaft mehr und mehr entschlüsselt. Aber sie ist auch einzigartig im Universum, der einzige Planet, von dem wir wissen, dass er Leben in Vielfalt hervorbrachte und weiter hervorbringt, und auf dem es Philosophen gibt, die versuchen, uns den Sinn der menschlichen Existenz näher zu bringen sowie Idioten, die es immer wieder schaffen, selbst ein wenig Ordnung in grausiges Chaos zu verwandeln (Wählen Sie hier Ihren Lieblingsidioten: _______________________________ ).
Die Welt ist aber auch ein Mosaik. Ein Mosaik von Kontinenten und Ozeanen, von Ländern und Landschaften, von Bergen und Ebenen, von Seen und Strömen, von Lebensgemeinschaften der Pflanzen und Tiere. Aber auch ein Mosaik der Menschen, ihrer Gesellschaften und ihrer Geschichte, ihrer Sprachen und Kulturen, ihrer Religionen und Moralvorstellungen und Gewohnheiten, Interessen, Vorlieben und Aversionen, ihrer Meinungen, Urteile und Vorurteile, ihrer guten und schlechten Eigenschaften, aber auch ihrer geistigen Kultur, ihrer Literatur und ihrer Musik, ihrer Kleidung, ihrer Ess- und Trinkgewohnheiten und von noch so vielen Dingen mehr.
Und die Elemente dieses großen Mosaiks zu entdecken, zu betrachten, zu verstehen, zu mögen oder zu hassen, anzunehmen oder abzulehnen, das schafft nur eins: ihr Kennenlernen. Das Kennenlernen durch persönliche Berührung, durch das Reisen zu den und hinein in die unterschiedlichen »Mosaiksteine(n)« der Welt. Denn nur so erhält man die Weltanschauung, deren Gegenteil Alexander von Humboldt in seinem Zitat für so gefährlich hält und natürlich auch nicht gutheißt, denn niemand kann das eigentlich.
»Die Gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben«
Alexander von Humboldt
Und …
es gibt ihn also doch, den Menschen, der sich für dieses Buch interessiert und für die Geschichten, die Anekdoten und Episoden aus dem Mosaik, die es beschreibt.
Aber …
… dieses Buch ist kein Reiseführer und schon gar kein Reisehandbuch.
Es ist eine Zusammenstellung von Geschichten aus dem »Mosaik«, von Orten der Erde, die man vielleicht nicht jeden Tag besucht, und so werden auch Erlebnisse erzählt, die einem nicht regelmäßig passieren – etwas anderes wäre ja auch ziemlich langweilig.
Zudem ist es nicht erforderlich, das Buch unbedingt vorn zu beginnen – wie es ja zum Beispiel bei einem Roman oder sogar einem Kriminalroman sinnvoll sein kann – obwohl ich gehört habe, dass es Leute geben soll, die auch zuerst das Ende eines Kriminalromans lesen, aus welchen Gründen auch immer.
Hier können Sie das tun, schadlos und ohne Verlust von Spannung und Erkenntnis, die einzelnen Geschichten haben keine logische Reihenfolge. Sie stehen so da, wie es mir eingefallen ist, ohne Bezug auf das Jahr der Entstehung, ohne Bezug auf Ortsverwandtschaften und Geschehnisse.
Erlebnisse als Erlebnisse eben. Entdecken aller oder besser vieler Facetten des großen Mosaiks, denn wer kann schon alles entdecken?
Aber es ist und bleibt ein Traum, besser mehr, mit der »Entdeckung« neuer Teile des Mosaiks, so unscheinbar sie auch anfangs erscheinen mögen, fortzufahren. Denn den »Atem der Fremde« glaubt man immer im Nacken.
Sollten Sie das Buch also erworben haben, um eine Reise damit vorzubereiten, war der Kauf »ein Schuss in den Ofen«, wenigstens ein kleiner, aber wirklich nur ein kleiner. Ein »Schüsschen in den Ofen«, weil es keine aktuellen politischen, wirtschaftlichen und soziologischen Daten über ein angepeiltes Reiseziel, keine aktuell wichtigen Informationen über Naturräume, über Flüge, Eisenbahn- und Busfahrten oder über Hotels und Tourenangebote gibt. Auch Hinweise über Kosten irgendwelcher Arten werden Sie nicht finden, dafür ändern sie sich und die Wechselkurse zu schnell, man ist ja meistens außerhalb der Eurozone.
Aber zu solchen, hier nicht zu erhaschenden Daten finden sich haufenweise sehr und gute Führer – gute deswegen, weil man merkt, dass die Schreiber auch wirklich in den Gegenden waren, über die sie berichten – aber es gibt auch solche Berichte, denen man – leider meist erst am Ort des Geschehens – anmerkt, »dass es dort aber gar nicht so aussieht, wie im Führer beschrieben«. Seltsam und selten? Nein, normal und häufig!
Dass aber dieses Buch zu gar nichts Reiseinteressantem tauglich ist, kann man auch nicht behaupten. So entstanden die Geschichten, die Erlebnisse, aber auch Vorfälle, selten sogar schon einmal Unfälle, manche würden manches auch mit »Abenteuer« übersetzen, ja nicht in der Phantasie des Verfassers, so wie in der des Herrn Karl May, was aber dessen Geschichten »gottbehüte« nicht abqualifizieren soll – ich habe die Werke in meiner Jugendzeit verschlungen, mehrfach sogar, was ich normalerweise nicht mache – sondern es sind Ergebnisse von wirklichen Reisen, so dass man einen Teil des Gelesenen durchaus auch sehen kann als Einführung in die Länder, Regionen, Örtlichkeiten, ohne deren Grundkenntnis man nicht versteht, warum bestimmte Dinge so und nicht anders passiert sind oder ohne die das Geschilderte leicht langweilig würde.
Berichtet wird aber hauptsächlich über Geschehenes und ein Bericht über das, was passiert ist, kann leicht übersetzt werden in das, was noch passieren kann und auch, was anderen Reisenden schon mal passieren kann.
Dabei soll dem Verb »passieren« in diesem Zusammenhang keine Wertung beigemessen werden, weder eine negative, die übliche nämlich, »Stell Dir vor, was mir passiert ist« oder »Was einem hier nicht alles passieren kann«, aber auch keine positive, wie die im Sinne von »Erfahren« oder »Erleben«, sondern es ist wirklich nur das Geschehen, für den einen – vielleicht ist Angsthase ja etwas vorurteilsbeladen (dabei sind Hasen überhaupt nicht ängstlich, sie sind nur schnell, wer hat den Mythos erfunden?) ausgedrückt – also für den Vorsichtigen, den Zurückhaltenden, den Voraussehenden, wirklich etwas Negatives oder sogar den Fatalistischen, der immer erwartet, dass sich ein schlechtes Karma auch just in dem Moment erfüllt, in dem man an die Möglichkeit denkt, es könnte … aber auch für den Mutigen, vielleicht Tollkühnen, oder besser, den, der den »sogenannten« Abenteuern nicht aus dem Weg zu gehen pflegt, der an dem »Passieren« vielleicht sogar mehr oder weniger aktiv beteiligt und nicht unschuldig an seinem Verlauf ist.
So soll und kann dieses Buch einen qualifizierten Reiseführer zwar nicht ersetzen, es kann jedoch helfen, ein Ziel so zu beschreiben, dass man Sympathie dafür »Da muss ich auch mal hin!« oder Antipathie dagegen »Keine zehn Pferde würden mich dahin bringen!« entwickelt, denn die Beschreibung eines Erlebnisses kann ja nicht losgelöst von der Umgebung erfolgen, in der es »passiert« ist, weil häufig diese Umgebung maßgeblich an einem solchen Erlebnis beteiligt ist oder sogar ausschließlich dafür verantwortlich gemacht werden kann oder muss.
Und in diesem Kontext sind die Geschichten in ihrer Summe doch ein wenig Reiseführer, »Komm her oder bleib weg«. Und … wenn Sie eine Begebenheit lesen ohne einen – wenigstens kleinen – Bezug zu der Gegend, dann wäre das bestimmt langweilig, also ein wenig Information von mir für die Bildung von Ihnen (das ist schlechter Schreibstil, ich weiß, passt aber sinngemäß eigentlich ganz gut, also lasse ich es so stehen, Verzeihung), das muss sein. Und ein wenig Bildung hat ja noch niemandem geschadet, nicht wahr, oder?
»Reisen bildet«, ein Schlagwort, das man – nach langer Abstinenz – mittlerweile wieder häufiger lesen kann, sogar in den Katalogen namhafter Reiseveranstalter – wer hätte das gedacht – wobei es ja ganz unterschiedliche Anlässe gibt, eine Reise zu tun, aber jeder, »der [wer] eine Reise tut, [der] kann auch etwas erzählen«.
Der klassische Urlaub (vom Mittelhochdeutschen ›Urloup‹, der »Erlaubnis« des Dienst- oder Lehensherrn, sich vom Dienstort für eine bestimmte Zeit zu entfernen) ist heute meist doch der Erholungsurlaub, es sind landläufig die Ferien (vom lateinischen ›Feriae‹, den Festtagen unterschiedlichster Gründe), der Urlaub am Strand, das süße Nichtstun, da, wo die Sonne immer scheint, wo das Essen gut ist und die Getränke kostenlos sind. Da, von wo man nichts zu erzählen hat.
Mitnichten, auch ein solcher Urlaub kann viele Geschichten erzählen, Geschichten von der Gegend, dem Hotel und seinen Qualitäten, den Leuten, die man mag oder doof findet, vom Essen, das man lobt oder tadelt, vom Wetter, vom Sonnenbrand, von Kakerlaken im Zimmer und so weiter, Geschichten, die für den Erzähler ja erzählenswert sind, vielleicht mit Bildern unterlegt und je nach der Vorstellung, die man überhaupt von Urlaub hat und den eigenen intellektuellen Grundansprüchen eben als wichtig erscheinen.
Zwar hat jemand einmal formuliert – und ich werde mich hüten, diesen Menschen zu enttarnen – dass es Leute gibt, die durch das Studium ihrer Briefmarkensammlung weiter durch die Welt kommen als manche, die am Pool liegen, zwar jedes Jahr an einem anderen, aber für die eben dies die Welt ist, ihre Welt. Wir sollten allerdings nie vergessen, dass der Geschmack ja ausschließlich individuelle Züge aufweist und Vorgaben, was man zu tun oder zu lassen hat, vielleicht juristisch bedeutsam, aber im Sinne der Urlaubswahl inopportun sind.
Seit einiger Zeit gibt es ja noch den »Aktivurlaub«, die Ferienzeit, in der bestimmte Tätigkeiten, für die bestimmte Orte prädestiniert sind, durchgeführt werden. So eignen sich Berge eben besonders für Klettertouren, aber auch für das Wandern oder das Drachenfliegen (womit aber keine Flugreise mit der Schwiegermutter gemeint ist, Verzeihung), das Wasser eignet sich gut zum Schwimmen und Tauchen oder zum Bootfahren mit Segel oder Motor. In diesen Urlauben sind also besondere Aktivitäten gefordert, die allerdings auch schon das eine oder andere Mal zum Abenteuer mutieren können, wenn zum Beispiel das Wetter nicht mitspielt, die körperlichen Fähigkeiten oder die erforderliche Ausrüstung unzureichend sind – man sich also überschätzt oder von den Gegebenheiten – dem Mosaik Welt eben – überschätzt wird, denn die sind für sich betrachtet, immer neutral.
Der sogenannte »Wellnessurlaub«, die Zeit, in der man sich aus den unterschiedlichsten Gründen, meist gesundheitlicher oder esoterischer Art, hauptsächlich irgendwelcher medizinischer oder sogar pseudomedizinischer Behandlungen hingibt, meist in Orten mit einem teuren Vornamen – »Bad« – soll hier unkommentiert sein und als gegeben stehen bleiben – und jetzt bitte nicht lachen, sonst lache ich mit.
Die meisten Reisen hatten und haben ja das Ziel, an eben diesem angestrebten Ziel etwas zu wollen, zu sollen oder sogar zu müssen. Das Erreichen des jeweiligen Zieles ist also Grundvoraussetzung für den Erfolg einer Reise. Aber selbst eine solche Beschreibung wird häufig nicht nur die Beschreibung des Endergebnisses beinhalten, sondern eine Beschreibung des Weges sein, der Erfolge oder Misserfolge, der Schwierigkeiten, der Menschen, die man getroffen hat und der Gefühle, die man dabei entwickelte.
Hätte Homer über die Fahrten des Odysseus lediglich berichtet, wo und warum dieser abgefahren und dass und wann er in Ithaka angekommen war – Ziel erreicht, Zweck erfüllt – glauben Sie, der Odyssee wäre dieser jahrtausendlange Erfolg beschieden worden? Selbst Kinder kennen Odysseus und wissen, was er erlebt hat. Und was ist mit den Schriften von Mungo Park über den Niger, der Ibn Battutas über Afrika und große Teile Asiens, Marco Polos Lebens- und Reisegeschichten, Sven Hedins Forschungsreisen in Tibet, Luìs de Camões’ Lusiaden der Reisen Vasco da Gamas, zum portugiesischen Nationalepos geworden, und vielen, vielen anderen mehr? Diese Geschichten verschlingt man doch wegen der Geschichten auf den Reisen, weniger wegen des Ziels.
»Der Weg ist das Ziel«, dieser Satz von Konfuzius – vielleicht, aber auch nur vielleicht von Konfuzius – zeigt uns den Unterschied zwischen einer teleologischen Zielsuche – ich habe das Ziel erreicht, der Zweck ist erfüllt – und dem Versuch der Selbstverwirklichung in kleinen Schritten, der Neugier auf immer neue, vielleicht nur kleine, scheinbar nebensächliche Ziele, deren Summe sich aber am Ende nicht nur als Sinn des Lebens sondern als Beweis für die Kohärenz des Kosmos offenbart.
»Dass ich erkenne, was die Welt … im Innersten zusammenhält«
Goethe, Faust 1
Und wer hätte diesen Zusammenhang, diese Vision einer Erkenntnis, besser beschreiben können als Andrea Wulf, die deutsch-britische Kulturwissenschaftlerin, in ihrem Werk:
»Alexander Von Humboldt und die Erfindung der Natur«; Bertelsmann, Berlin 2016 über das Universalgenie Alexander von Humboldt, der reiste, nur der Erkenntnis wegen. Man kann es als weltgewandter Deutscher übrigens auch in der englischen Originalfassung lesen, man muss nur mehr Zeit einkalkulieren und darf nicht vergessen, es … aus dem Flugzeug auch wieder mitzunehmen, so ein Mist!
Und es gibt in der realen Welt noch so viel zu suchen, zu entdecken, zu finden und zu erfinden, dass wir die vielgepriesene und hochgelobte virtuelle Welt – und die werden wir in der Zukunft ohne Zweifel brauchen und auch gebrauchen – müssen – hoffentlich aber nur als Instrument, als nützliche Hilfswelt, einsetzen und nicht als »Weltersatz« auffassen, so wie es heute schon manchmal? – häufig? – geschieht.
Die »virtuelle Irrealität« – Verzeihung für die leichte Abwandlung des häufig benutzten Begriffs der Realität – kann die reale nicht ersetzen und sie wird sie auch nicht ersetzen – können – das sage ich voraus, Punkt – niemals. Und wir werden irgendwann froh sein, dass die Welt, so wie sie ist, auch so existiert, wenn sie denn noch so existiert, dass sie für uns lebens-, besser, überlebensfähig, ist. Denn diese Welt hat – obwohl sie uns manchmal Unerwartetes zeigt – glücklicherweise eine immanente Logik, die es zu beachten gilt, auf die Ursache folgt die Wirkung und nicht umgekehrt, auch wenn es schon mal etwas dauert.
»Vor dem Aufstehen das Hinfallen nicht vergessen«, also bitte immer berücksichtigen.
Und vielleicht wird die so hochgepriesene Künstliche Intelligenz KI unser Leben so entlasten, dass die Gedanken frei werden für die »reale Welt«. Ich bin da allerdings eher skeptisch. Aber wir sollten (mehr als) etwas tun, diese Welt zu erhalten, verbessern kann sie sich nur selbst, verschlechtern, das können wir ausgesprochen gut, und wir tun es ja auch schon ziemlich lange.
Somit trauen Sie sich einfach, das Buch zu lesen.
Lesen Sie die knapp 20 Kurzgeschichten als Appendizes der ersten 40 – »Short stories«, sagt man, denn wenn heutzutage nicht zumindest ein einziger, wenn auch kurzer und zur Not völlig deplatzierter englischer Schimmer im Text auftaucht, wird es ein Misserfolg, garantiert, ich weiß, darum taucht der englische Begriff hier auch eigentlich unplanmäßig auf – das also als meine (einzige) Konzession an die Brexitgeplagten – Geschichten aus den Mosaiksteinchen der Erde, aber um alle und alles zu würdigen, bräuchte man bestimmt mehr als hundert Leben und um sie zu erzählen, mehr als »Tausend und eine Nacht«.
Aber ich verspreche Ihnen, es wird nicht langweilig, es wird aber auch nicht übermäßig kompliziert und wissenschaftlich, vielleicht wird es schon einmal ungewöhnlich, vielleicht für den einen oder anderen an der einen oder anderen Stelle etwas unappetitlich, aber so ist die Welt eben, es wird auch nicht übermäßig gefährlich, na ja, es kommt darauf an, was man unter Gefahr versteht, aber es gibt bestimmt das eine oder andere Neue und Interessante und wenn nicht, dann ziehen Sie sich die eine oder andere Geschichte eben als »Alten Hut« an und wenn Sie Dinge besser wissen als ich, was ja immer sein kann und bestimmt auch sein wird, weil es Menschen gibt, die wirklich schon fast überall schon fast alles gesehen und fast alles erlebt haben, dann bitte ich um Korrektur, denn dafür bin ich immer offen.
Und wenn Sie noch Ziele kennen, deren Besuche konventioneller oder besser unkonventioneller Art Ihrer Meinung nach besonders lohnenswert erscheinen, dann bitte ich um Mitteilung derselben, das wäre schön.
Aber natürlich sind meine Geschichten lediglich eine Auswahl aus viel mehr Möglichen und subjektiv zusammengestellt, weil ich glaube, dass »normale Reiseabläufe«, wie sie ja wohl in der überwiegenden Zeit geschehen, für ein Buch doch etwas zu trivial sind. Denn es stimmt schon, was ein Weitgereister einmal gesagt hat: »Wenn auf einer Reise alles nach Plan verläuft, dann gibt es keine gute Story.«
Außerdem soll es ja Gegenden geben, von denen man so plastisch behauptet, dass dort niemand »tot über dem Zaun hängen wolle« und solche Lokalitäten zu beschreiben, auf die man einmal gestoßen ist, ist auch nur kurz und dann auch nur einmal lustig. Dass man von dort schnell wieder fort will, dürfte klar sein. Aber … gibt es solche Gegenden überhaupt?
Reisen tut man schon einmal allein, das kommt vor. Entweder ist man nicht angewiesen auf Unterhaltung oder sehr introvertiert, manche würden sagen, autistisch veranlagt. Sein kann allerdings auch, dass niemand mit einem unterwegs sein will, das Ziel ist anderen vielleicht doch zu exotisch, man kann aber auch zufällig – wie man hierzulande sagt – ein Kotzbrocken sein, Misanthrop ist besser aber natürlich nicht freundlicher, oder jemand, der schon alles weiß und drei Wochen lang Belehrungen ausspuckt – aber in den meisten Fällen reist man eben nicht allein.
Mit Frau, wenn die sich traut, mit Kindern, die in den wenigsten Fällen mit wollen aber in den meisten mit müssen oder in einer Gruppe, was ich persönlich aus den unterschiedlichsten Gründen nicht besonders favorisiere, nur wenn es sich absolut überhaupt nicht vermeiden lässt. Oder mit Bekannten oder Freunden, das kommt vor.
An dieser Stelle möchte ich deshalb eine lange Lanze brechen für meine Mitreisenden in all den Jahren, insbesondere für meinen Freund und ehemaligen Kollegen Jürgen, der ja schon das eine oder andere Mal namentlich genannt wird und mit dem ich über eine lange Zeit viele Touren unternommen habe, und der schon häufig mehr als eine Hauptrolle in den Begebenheiten gespielt hat.
Er ist stets aufgeschlossen für alles, wissbegierig, sprachgewandt, immer gut vorbereitet, nicht besonders kapriziös und auf Luxus erpicht, humorvoll aber auch abgeklärt und ruhig, abgesehen von kurzen, aber heftigen Wutanfällen, also insgesamt der beste Reisegefährte, den man sich vorstellen kann.
Der beste? Nein, der allerbeste. Er gehört also ganz und gar nicht zu den Leuten, von denen man scherzhaft – aber mit ernstem Hintergrund – meint, sie seien ja schon 30 Jahre tot, hätten es allerdings noch nicht bemerkt (von denen kenne ich allerdings mehr als ein Dutzend Exemplare – leider – sie sind so still, dass Spinnen sie umgarnen konnten).
Ihm – dem Kollegen – gilt mein besonderer Dank.
Immer wieder wird man gefragt, woher das nach langer Zeit noch vorhandene Wissen über Geschehnisse, Abläufe oder Zusammenhänge noch stammt, oder ist es Phantasie, bloßes Fabulieren, ach, es merkt ja doch niemand? Das Gedächtnis an die beschriebenen Begebenheiten muss man ja aus der »Langzeitecke« holen, und es ist immer noch da, danke dafür, denn meistens wurde ja nur Marginales schriftlich festgehalten. Obwohl … mit zunehmendem Alter scheint das Langzeitgedächtnis auch immer besser zu funktionieren, das merkt man bei vielen alten Leuten. Ist das etwa ein Zeichen von …? Ach, lassen Sie mal.
Danken muss ich aber auch externen Quellen, die man als Fortführung der »Inneren Lektüre« in der heutigen Zeit zur Verfügung hat, Bücher gibt es ja glücklicherweise immer noch – »Fahrenheit 451« ist (auch glücklicherweise) noch nicht eingetreten, und ich hoffe, es wird nie eintreten – und ohne die ist man verloren, Google hilft schon einmal, auch wenn viele dieser »Informationsmedusa« nicht über den Weg trauen, denn Google gibt nicht nur Informationen her, sondern kassiert auch solche vom Leser, und Wikipedia hilft im Besonderen, ich habe es also schon mal bemüht, wenn es Not tat, und das tat es schon mehr als einmal.
Fand man noch vor einigen Jahren bei einer Suche im Netz ach so manchen Unsinn und verzettelte sich schnell und hoffnungslos, so ist das »System« heute systematischer, vollständiger und vor allen Dingen richtiger, wird es doch seit einiger Zeit auch kontrolliert.
Und wenn ich schon für Wikipedia hier mal schnell eine Lanze breche – und es ist keine Lanze der Schleichwerbung – glaube ich, dann mit dem Hinweis, der Bitte der dafür Verantwortlichen nicht nur Lob und Kritik zur Verfügung zu stellen, sondern sich auch an der weiteren Existenz dieses Universallexikons durch das Einwerfen des einen oder anderen Euro in den Klingelbeutel des Wissens zu beteiligen. Und … Spendenquittungen gibt es bei denen natürlich auch. Los, machen Sie mit!
Leider wird man älter, und das ist dummerweise das konkrete Wesen des abstrakten Wortes »Alter«, dass es einen nämlich selber trifft. Und man merkt, dass bestimmte zukünftige Ziele nicht mehr so leicht aus den gut eingelagerten Vorstellungen und Ideen im hinteren Teil des Hirns in die vordere Abteilung, genannt Fastrealität, zu rücken sind, und wenn einmal vorn im Gehirn, so ist der Übergang von da in die Lunge, in die Muskeln und die Gelenke auch nicht so leicht, da habe ich das Herz überhaupt noch nicht erwähnt. Ist aber in vielen Facetten mit von der Partie.
Aber wir haben vor einigen Jahren im Busbahnhof von Nazca – Peru – zwei holländische Damen getroffen, die so wie wir um Mitternacht auf den verspäteten Fernbus nach Arequipa warteten, und das mit Rucksack und einem geschätzten Alter von – wir haben die Damen natürlich nicht danach gefragt, denn das tut man ja nicht, aber man kann so etwas auch vom Aussehen her abschätzen – so zwischen 75 und 80.
Es gibt also noch Hoffnung, machen Sie auch da mit!
Übrigens … stören Sie sich nicht daran, dass (fast) jede Episode mit einem Zitat beginnt. Bekannte und manchmal auch unbekannte Leute haben mit ihren Weisheiten viele Dinge antizipiert oder ihre Bemerkungen passen schon ganz gut dahin, wo sie stehen.
* In unserer jungen Zeit hatten wir einmal einen alten Vermieter, der eine Anrede immer mit »Werter …« begann, und ich glaube, er dachte es auch noch mit »th«.
EL BRUJO – ODER REISE IN DIE VIELFALT
»DIE WÄLDER GEHEN DEM MENSCHEN VORAUS, DIE WÜSTEN FOLGEN IHM«
François-René de Chateaubriand
Der Heiler nimmt einen tiefen Zug aus seiner Zigarette, hält lange die Luft an und bläst dem »Patienten« dann schnell den Rauch in die Augen. Der Patient bewegt sich nicht, er verzieht keine Miene, atmet schwer.
Der Heiler murmelt einige Worte, ergreift dann die Caña-Flasche, Caña ist übrigens hochprozentiger Zuckerrohrschnaps, selbst gebrannt, nicht immer sauber, aber … recht beliebt, nimmt einen großen Schluck daraus, nähert sich dem Gesicht des Patienten bis auf fünf Handbreit und sprüht ihm den hochprozentigen Schnaps fein verteilt mitten ins Gesicht. Der Patient schließt die Augen, verzieht das Gesicht, der Schnaps brennt in seinen Augen, Tropfen laufen über seine Wangen, aber er bleibt still, atmet ruhig.
Der Heiler fasst den Kopf des Mannes mit beiden Händen an den Ohren und schüttelt ihn schnell vor und zurück, dabei ruft er einige Worte in einer mir nicht verständlichen Sprache. Der Patient lächelt. Er ist vollkommen »relaxt«. Die Zeremonie ist vorüber.
Der Heiler hat den bösen Geist aus dem Kopf des Patienten ausgetrieben, den Geist, der ihn schon lange gequält hat mit schrecklichen Schmerzen am Tag, aber auch mit bösen Träumen und dunklen Gesichtern in der kurzen Nacht, die ihm blieb, vertrieben in die Dunkelheit des Dschungels Südamerikas, in das Labyrinth Amazoniens, und hoffentlich für immer.
Wir sind in Ecuador, einem kleinen südamerikanischen Land an der Westküste des Halbkontinents, der Küste des pazifischen Ozeans und das – wie der Landesname es ja schon sagt – auf dem Äquator liegt.
Angereist aus Europa in einer abenteuerlichen Tour, über die an anderer Stelle berichtet wird, sind wir in der Hauptstadt Quito gelandet, eigentlich nur als eine Zwischenstation gedacht, für einige Tage lediglich, in einer der ältesten Städte Südamerikas, die man sehen, bewundern und verstehen muss, aber dann … eigentlich wollen wir auf die Galapagos-Inseln, das »offene Buch der Evolution«, das Sehnsuchtsziel vieler biologisch Interessierter, noch besser, vieler Biologen, und damals noch ein Ziel, das für viele unerreichbar war, nur wenige Touristen trafen wir, wo doch heute auch diese – eigentlich empfindlichen – Inseln überlaufen, fast überfahren werden von Kreuzfahrtschiffen, von schwimmenden Städten, die Tausende gleichzeitig ausspucken, fast auswürgen. Aber wir wollen uns nicht als die naturwissenschaftlichen Jünger Darwins und als die einzig legitime Elite des Tourismus dort betrachten, obwohl …
… denn wer hat das Recht, die Inseln zu besuchen und wer hat es nicht? Wir können es nicht entscheiden, möchten es aber eigentlich schon, denn entschieden muss es sein, sonst … ist das Erbe Darwins für immer verloren.
Doch entschieden hat es der Staat Ecuador, entschieden gegen die Natur, denn er verdient Geld mit der Natur, und je mehr Touristen kommen, umso mehr bezahlen für die »Nochnatur«.
Nur nebenbei bemerkt: als wir die Inseln besuchten, und wir waren einige Wochen dort, war das Jahreskontingent des Tourismus gerade auf 16.000 Personen pro Jahr angehoben worden, heute (… schluck) strömen fast 150.000 Menschen in derselben Zeit auf die Galapagos-Inseln. Denn sie sind für den Tourismus so exotisch wie Mallorca vor 70 Jahren für die Deutschen und die Engländer – leider.
Aber wer fremdländische Tiere sehen will, sollte gefälligst in den Zoo gehen und die Natur der Inseln verschonen, einfach in Ruhe lassen. Elitäre Vorstellung? Mag sein, aber ein wenig oder ein wenig mehr Elitäres hat der Natur noch nie geschadet.
Quito nimmt uns auf im Hotel Majestic, einem (für uns) normalen Haus in der Neustadt (manch andere würden ein besseres bevorzugen, Snobs zum Beispiel). Wir sind zufrieden, wir wohnen fast zentral, die Verkehrsanbindungen sind gut, wenn man sich denn traut, mit dem Bus zu fahren. Über Tag ist die Gegend quirlig, sehr lebhaft, alle Geschäfte sind stark besucht, Straßenhändler wuseln auf und ab, ab 18.00 Uhr, kaum dass es dunkel ist (wir sind auf dem Äquator), ruht der Verkehr, und Scharen von Hühnern picken auf sonst überfüllten Straßen, Hunde liegen auf dem noch warmen Asphalt, Autos? Was war das noch mal?
Bitte berücksichtigen Sie, dass es gerade 1982 ist, also es ist schon etwas her. Aber das Hotel gibt es immer noch und bei Booking. com bekommen Sie auch ein Zimmer und das unverschämt günstig. Ich hatte mir schon einmal überlegt, deshalb noch einmal dorthin zu fahren (das war ein Witz!).
Kurzfristig ziehen wir um nach Cumbayá, in einen Vorort ganz im Süden von Quito, denn wir haben uns einquartiert beim Sohn der ehemaligen Arzthelferin unseres Kinderarztes aus Köln, die hier bei ihrer Familie in Rente ist. Und mit ihr machen wir einige Touren rund um die Hauptstadt.
Cumbayá war damals ein Dorf, bewohnt von Indigenes, langsam in Besitz genommen von ehemaligen Einwohnern Quitos, es ist billiger, hier auf dem Land zu leben, es ist deutlich wärmer als in der Hauptstadt, liegt Cumbayá doch fast 700 Meter tiefer, und die Reichen und Schönen zieht es dorthin, mittlerweile hat das ehemalige Dorf, so wie man lesen kann, den höchsten Lebensstandard Ecuadors – und fast keine Indigenes mehr – zu teuer, weg da, so wie bei uns.
Reimar, der Eigentümer »unseres« Domizils, hatte ein sehr großes Haus mit Platz und Gastfreundschaft genug für Jürgen (der wird bekanntlich als bekannt vorausgesetzt) und mich.
Und mit seiner Familie und einigen Freunden beschließen wir, in den Regenwald Amazoniens zu fahren, in die Region eines großen Amazonaszuflusses, des Rio Napo. Ein kleines Türchen (idiolektische aber eigentlich falsche Verkleinerungsform von Tour, aber eine solche beginnt ja auch immer mit einer Tür, die man aufstößt, und erlaubt ist ja bekanntlich, was gefällt, und das Wort gefällt mir, gefiel mir eigentlich schon immer) soll es werden.
Wir machen uns eines frühen Morgens auf den Weg, Reimar in seinem Pseudogeländewagen (das Wort SUV war noch nicht erfunden) von VW do Brasil mit seiner Mutter Jutta, seiner Tochter Annette, schlanke 16 und mit seiner Freundin Pilar – besser Pili – einer attraktiven Hochlandindia (die übrigens für Jürgen und mich einmal Cuy, das in Südamerika beheimatete Riesenmeerschweinchen – es heißt nur so, das mit dem Riesen ist nicht so wild – und DAS Gericht der Indigenen im heimischen Backofen zubereitet hatte, was den Hausherrn zu kleineren Wutanfällen hinreißen ließ, obwohl die Meerschweinchen in Südamerika wirklich nur zu kulinarischen Zwecken gehalten werden), einem Freund (Robbi) aus der Schweiz mit einheimischer Frau und kleinen Zwillingen in einem »Japaner« (Kurzform für ein japanisches Auto) und Rüdiger, Repräsentant von BASF für diesen und andere Teile Südamerikas (wir nannten ihn despektierlich Frühstücksdirektor, wohl wissend, dass es diesen Begriff unter der Hand wirklich gibt), kurz vor seiner Pension und mit dem firmeneigenen Geländewagen und mit Jürgen, mir und Susi, der Schwester von Robbis Frau, eben der »verrückten Susi«.
Eine größere Gruppe auf dem Weg ins Grüne, ins große Dunkelgrüne, ins riesige Schwarzgrüne. Hindernisse? Bisher keine bekannt.
Wir müssen über die Ostkordillere, fahren über die E 20, hört sich gut an, was aber nicht heißt, dass es eine in unserem Sinn Hauptstraße ist, Asphalt finden wir, doch recht sporadisch. Aber unsere Fahrer machen das hier wahrscheinlich nicht zum ersten Mal.
Wir schleichen nach Papallacta, einem kleinen Ort voller Einheimischer auf 3.300 Metern, Sie merken, wir sind nicht im Tiefland, und … tiefes Luftholen ist angesagt, bekannt ist er für seine Thermalbäder, aber wer hat die hier nicht, Vulkane haben sie geprägt und prägen sie noch immer, die unter- und oberirdischen Aktivitäten der Erde, Humboldt war schon vor fast 200 Jahren schier außer sich ob dieser Erdaktivitäten. Wir schleichen über den Papallacta-Pass, zum ersten Mal überqueren wir die 4.000-Meter Marke, Holzbohlen über dem Abgrund, es wackelt und klappert, nur nicht anhalten und durch, und es wird kalt, die Luft wird dünn (wir hatten damals noch keine Erfahrung mit diesen Höhen, bewundern Alexander von Humboldt und Aimé Bonpland, die vor (damals) 180 Jahren in Sommerkleidung und mit schlechten Schuhen einen großen Teil, den größten Teil des Chimborazos bestiegen haben), und es wird feucht, es wird wahrlich nass, es regnet in Strömen, was soll’s, wir fahren ja auch in Richtung Regenwald.
Der Ostabhang der Anden erfährt seine Feuchtigkeitsgabe aus diesem Wald, hier, wo die nassen Wolken aufsteigen müssen und inkontinent werden, sehr. Und heute meint das Wetter es gut mit sich, nur mit sich, es erfüllt einmal wieder alle Vorhersagen. Die Westkordillere ist im Vergleich dazu ein ziemlich trockenes Plätzchen.
Die Straße wird schmaler, für Europäer recht gewöhnungsbedürftig, die Berge kommen näher und erscheinen steiler, nicht nur das, sie werden steiler. Und die Wolken werden dicker, wir fahren durch den Nebelwald, der hier in einem Höhenbereich ab 2.000 Metern bis zur Baumgrenze vorkommt. Es ist kühl hier, kalt, sagen die Ecuadorianer, die Luftfeuchte, die in den meisten Monaten zwischen 90 und 100 Prozent beträgt, kondensiert zu Wolken, an den Oberflächen der Pflanzen und am Boden. Auch an unseren Fahrzeugen, die Scheibenwischer arbeiten hart.
Wir müssen nach Baeza auf die E 45, aber zuerst müssen wir nichts mehr, denn die Straße hatte kürzlich erst einen kleinen Schluckauf, der Hang war sauer und hat gerülpst (sorry, aber so war es nun einmal), der Weg ist versperrt durch Felsen (glücklicherweise wenige dicke), Steine und viel Schlamm, der Sträucher und Bäume mitgerissen hat. Vor uns ein Bus, der Indigene transportiert – wir kennen diese Fahrzeuge, denen man in Europa nicht vertrauen würde, die aber eigentlich zuverlässig sind, auch ohne (manchmal ganz ohne) oder mit etwas abenteuerlicher Beleuchtung und lauter Hupe, wir haben sie genossen auf unserer Fahrt nach Santo Domingo de los Colorados – aber bei schönem Wetter. Der Bus muss warten, die Passagiere nehmen es stoisch, sind es gewohnt, wären bestimmt erstaunt, wenn man denn einfach so durch käme, es ist eben wie immer, niemand kann sagen, sagt den Daheimgebliebenen auch nicht, wann man ankommt im Dorf. Denn Unfälle kommen vor, häufiger als einem lieb ist.
Die Männer verschwinden hinter den nächsten Bäumen, die Frauen schauen sich scheu um und marschieren ins Gebüsch.
Und wir … was sollen wir machen, außer zu warten, die Planierraupe ist schon am Werk, der Radlader schafft die Felsen in den Abgrund, wir freuen uns über die Straßenarbeiter im Regen und über die ecuadorianische Organisation, überhaupt herzukommen und zu arbeiten, niemand beschwert sich über die Zeit (wir sehen uns um, die Zeit ist nicht verloren, Proust hätte hier keinen Grund zur Suche gehabt, er hätte sie gefunden, gedankenverloren und wartend), denn es könnte ja auch anders kommen, drei Tage auf einer Stelle stehen, Erdrutsch vor und hinter dem Fahrzeug, oder so.
Wir steigen aus und unterhalten uns mit den Passagieren des Busses so gut es geht, alles nette Leute, aber eben mit Mini-Spanisch, kein Sendero luminoso (ach, den gab es glücklicherweise nur in Peru, aber zu unserer Zeit schon noch, da stehen einem die Nackenhaare doch schon einmal hoch … Sie kennen gewiss »TOD IN DEN ANDEN« von Vargas Llosa, die Situation war damals eine fast gleiche … ach, wie schön ist es hier bei den vielen netten Leuten), wer jetzt daran denkt, dem stehen auch wirklich die Haare zu Berge, aber der Sendero hätte sich bestimmt ein besseres Wetter ausgesucht für seine Überfälle mit nachfolgenden Exekutionen. Nur nicht nass werden als Revolutionär, und die Revolution hat immer ein bisschen Zeit, vamos, vamos, pero lentamente. Aber lassen wir das.
Die Vegetation ist atemberaubend, dicht, es ist im wahrsten Sinne ein Dickicht sofort neben der Straße, in das man ohne Machete wohl kaum eindringen kann. Einige wenige Gräser begrenzen die Piste, Bäume und Bäumchen, Sträucher und Büsche glänzen in dunkelgrün, bewachsen mit Epiphyten (Pflanzen, die auf Pflanzen wachsen), dichten, schwarzgrünen Moospolstern, bunten Flechtenflecken, absonderlich bunten Pilzen, Farnen und Bromelien, Bromelien überall. Lianen kreuzen die freien Flächen, versperren einen Pfad, der keiner ist, reißen Brillen von den Nasen, benehmen sich wie die Affen in Indonesien. Ab und zu eine aufsitzende Orchidee mit kleinen Blüten und die häufig weiß, es gibt kaum Insekten hier, die sich für sie interessieren, sie überhaupt sehen, viel zu kalt für die kleinen. »Grüne Hölle« nennen manche diesen Dschungel, und es ist wahr, grün dominiert, Hölle nur für Dilettanten, Scharlatane und Feiglinge, »Grüner Himmel« für den kleinen Rest der Menschheit – hoffentlich.
Wir haben später die Ausläufer der Yungas in Bolivien kennengelernt, so sehr unterschiedlich war das hier nicht zu der wohl weltberühmten und wohl gefährlichsten Straße aller Straßen. Aber … was ich nicht weiß, das macht mich… und wir wussten es nicht, haben es nur etwas leicht abenteuerlich genommen.
Es geht weiter, Dank an die Straßenarbeiter, weiter, aber langsam, vorsichtig, der Hang ist glitschig, scheint noch beweglich, will sich bewegen, die Räder drehen schon einmal durch in den schleimigen Pfützen, Steine fallen mit Getöse die Hänge hinunter, Bäume und Sträucher brechen ab, stürzen vom Straßenrand in die Tiefe, sterben mit leisem, dumpfem Ton, nahezu schweigend. Fast unbemerkt.
Und es ist Tiefe, wirklich, niemand möchte dort hinab, bloß nicht zu nah heranfahren. Der Fahrer pfeift, Pfeifen im Walde? Nein, Rüdiger ist es gewohnt, hier zu fahren, er lebt lange genug in Ecuador, um das alles zu kennen. No es problema. Das einzige Problem, wir müssen tanken, und das eigentlich bald, mal sehen, wo.
Jahre später haben wir den Friendship Highway in Tibet befahren, als er noch im Bau war – ich glaube übrigens, das ist er immer noch, das große Erdbeben im Himalaya war etwas gegen seine schnelle Fertigstellung – so unterschiedlich waren die Straßen nun wirklich nicht (obwohl die Friendship-Fahrer sich immer mit ihrem Mut brüsten, sich dorthin getraut zu haben, das war schon was, aber sollen sie doch einmal hierhin kommen …).
Robbi hat nur einen Zweiradjapaner, aber Ahnung, und Schweizer scheinen in allen Lebenslagen ruhig zu sein, abgeklärt und kalt, wenn Sie wissen, was ich meine. Er fährt wie in einer Reise über das Matterhorn, locker, grinsend, und seine Familie reißt kein Auge auf. So muss es gehen!
Wir kommen bergab, die Straße wird nicht besser, aber wir nähern uns dem Tiefland. Eigentlich ist es nicht das richtige Tiefland Amazoniens, dafür sind wir noch viel zu hoch, es ist der Wolkenwald, der sich nach unten dem Bergnebelwald anschließt und in den Tieflandregenwald übergeht, aber es kommt uns so vor nach der zehrenden Bergfahrt. Es wird wärmer, die Kühle des Regenwaldes weicht langsam der Schwüle. Wolkenverhangen sind die Berge noch, die Wälder im dicken, driftenden Dunst, und das ist es – jetzt sehen wir es – weswegen wir die Wälder der Tropen brauchen. Wir brauchen sie (nicht nur) des Wassers wegen, des Wasserhaushalts wissenschaftlich prosaisch gesagt, denn ohne diese Wälder wäre die Welt anders, sie wäre am A…, egal, ob sie meine Wortwahl gut finden oder nicht, wahrscheinlich nicht, aber es ist so, wir brauchen den Wald dringend, er braucht uns (Deppen) nicht, ist er tot, wird er es nicht merken, wir aber schon, und nicht nur schon, sondern auch schnell.
Und wir brauchen aus vielen Gründen den ursprünglichen, den Primärwald, den, der immer hier war und der hier hin gehört und nicht den nachgepflanzten, den Wald der Ursprungszerstörer »Seht, was wir für Euch tun!«, nichts tun sie, denn den Gewinn haben sie schon gemacht und der Rest ist nur vorgeschoben, reine Schau, Malefitz!
Damals hatte man über das drohende Weltende noch nicht nachgedacht und angefangen, den Dschungel lustig abzuholzen, nicht wie die Holzfäller vergangener Jahrhunderte, Mann für Mann, Baum für Baum, was war das damals für ein »Knochenjob«.
Man hatte vor einiger Zeit angefangen, es großtechnisch zu tun, und macht bis heute unvermindert weiter, man nimmt sogenannte »Harvester«, man erntet den Wald im wahrsten Sinne des Wortes. Denn die Welt braucht Holz, Asien braucht Papier, die Snobs Möbel aus Edelholz, Südamerika braucht Flächen für MacDonalds-Rinder, für Bergwerke voll Gold und anderen Mist, für Palmöl, Palmöl, Palmöl … (wir waren Jahre später in Kalimantan, vormals Borneo, da, wo die Einheimischen das jämmerliche Grünzeug auf der Strecke zwischen Balikpapan und Samarinda an der Ostküste, das kein Wald mehr ist, »Suhartos hell« nennen, Palmöl everywhere (ich habe schon einmal geschrieben, dass ich glaube, dass selbst in Hostien Palmöl drinsteckt – das sollte man einmal überprüfen und wenn es zutrifft, sich beim Papst beschweren, er kommt ja von hier, also aus einer ähnlichen Gegend, aber ich glaube, Hostien mit Palmöl schmecken den Permanentgenießern einfach besser).
Und wie sagt schon Veerle Vandeweerd, die Direktorin von UNDP (UN Environment & Energy): » Die Bibliothek des Lebens brennt«, denn heute ist das Abholzen der Urwälder den späteren Nutznießern viel zu mühsam, sind die Bäume dünn und wertlos, wird großflächig abgebrannt, »mit Mann und Maus« heißt es, gemeint ist Baum, Strauch und Tierwelt (Mäuse sind auch dabei), und nicht zu vergessen die Indigenen (da nützt auch kein ehrenwerter alternativer Nobelpreis, wenn Sie jetzt nicht wissen, was gemeint ist, weiß Wikipedia es, wie immer).
Aber damals (auf unserer Fahrt) war uns der tropische Wald anscheinend (oder nur scheinbar? achten Sie auf die Wortwahl im Deutschen! Seien Sie beruhigt, nicht jeder versteht den Unterschied) sch…egal (leider schon wieder ein Begriff in Fäkalsprache, aber es war die Wahrheit), froh waren wir, dass der Wald sich etwas zurückzog von der Straße und den Blick freigab auf eine Flussniederung. Wir erreichen die Gegend von Archidona.
Einige Kilometer vor Archidona, dem fast Tieflandstädtchen auf 600 Metern Höhe, halten wir an den Höhlen von Jumandi, da, wo der Rio Misahualli in den Untergrund verschwindet.
Als Deutsche sind wir solche geologischen Vorgehensweisen von Flüssen und Bächen ja ziemlich gewohnt, es ist nichts Neues für uns, große Tropfsteinhöhlen gibt es landauf, landab, aber in Südamerika sind solche Untertage für die Touristen sehr bemerkenswert und deshalb meist auch stark frequentiert.
Und was erleben wir? Niemanden und nichts. Nur uns scheinen die geologischen Besonderheiten zu interessieren, es gibt keine Information, keine besonderen Hinweise, keine Sicherheitsratschläge, keine Führer lungern herum, kein Eintritt wird verlangt (wie man liest, ist das heute ziemlich anders und ebenso ziemlich teuer), aber einige anwesende Einheimische meinen, es wäre ganz gut, wir würden Badehosen anziehen, denn es hätte vor kurzem ganz nett geregnet, so wie immer eigentlich, und es könnte sein, dass wir untenrum ziemlich nass würden.
Ita est, wir verkleiden uns bademäßig, obwohl wir doch hauptsächlich wegen der Stalagmiten und Stalagtiten hier sind, doch nach wenigen hundert Metern im kalten, schwarzen Wasser bis zu den Hüften verlässt uns der Mut (peinlich aber wahr) trotz unserer Taschenlampen, Archidona soll uns … kann uns … ach, wir wollen weiter.
Tena, Hauptstadt der Region, heute voller Leben, Stadt mit fast 20.000 Einwohnern, war damals ein »Kaff«, wenn man es denn so nennen darf, eine kleine Gemeinde, aber eine mit Tankstelle. Und da sollten wir hin.
Ich biete Rüdiger an, die Rechnung zu übernehmen, es ist schon peinlich für einige Mitteleuropäer, immer mitzuschwimmen auf der Welle der südamerikanischen Gastfreundlichkeit, aber «es kostet nur wenig«, heißt es, denn die Gallone Benzin ist 10 Cent wert (US). Ich bin völlig platt, 10 Cent (später, viel später, konnte ich in Venezuela noch niedrigere Spritpreise kennenlernen – da sieht man, was man hat, nix hat man außer mächtiger Inflation und Ächtung in der Welt).
Jedenfalls ist das Auto wieder voll.
Man hatte übrigens gerade zu der Zeit die Spritpreise in Ecuador – immerhin ein recht ölreiches Land (OPEC) damals – etwas angehoben, verdoppelt, wir zahlten schon den neuen Preis, im Land war man darüber allerdings sehr ungehalten und es folgten reichlich Unruhen und Streiks.
Wir erreichen Puerto Misahualli und den Rio Napo, einen der größeren Quellflüsse des Amazonas im ecuadorianischen Amazonastiefland, den Fluss, an dessen Ufer wir das Hotel Jaguar besuchen wollen, um den Tieflandregenwald mit seinen Menschen, ihren Gebräuchen, den Pflanzen und Tieren kennen zu lernen, uns zu freuen, uns zu fürchten oder ….
Der Rio Napo ist im Vergleich zum Amazonas ein Flüsslein – jedenfalls eines auf der Landkarte Südamerikas, suchen Sie es einmal ganz unbedarft, na … wo haben Sie ihn gefunden? Im europäischen Vergleich wäre er hier ein ganz großer, in einer Reihe mit Rhein, Weichsel, Elbe, Loire und anderen. 950 Kilometer bis zur Mündung ist er lang, zum großen Teil schiffbar, entspringt am Osthang der Cordillera Real, der Königskordillere, in der Nähe des Vulkans Cotopaxi, desjenigen mit seiner nahezu konischen Form und der spitzen Eiskappe auf dem Gipfel das Idealbild eines Stratovolkans vorstellend. Wir waren da mal auf 5.000 Metern, ging ganz gut, wenn man bedenkt, dass wir ein gutes Stück mit dem Auto hoch fahren konnten. Ehre sei Alexander von Humboldt und Aimé Bonpland – wieder einmal – die es bis auf die gleiche Höhe schafften oder höher, Verzeihung – aber eben 180 Jahre früher und bestimmt weitaus schlechter ausgerüstet als wir, wie ich schon einmal geschrieben habe und vor allen Dingen ohne Auto, Humboldt würde sich über uns sicherlich schlapp lachen und er wäre im Recht, der Untergang des Abendlandes wäre nah, würde er glauben, das hat Oswald Spengler damals allerdings nicht gemeint.
Den Napo zu sehen, zum ersten Mal, bedeutet wahrscheinlich für alle, ihn größenmäßig unterschätzt zu haben. Hat »Vater Rhein« bei Köln einen Wasserabfluss (MQ) von circa 2.100 Kubikmetern pro Sekunde (da ist der Fluss breit und anscheinend auch träge, MQ heißt übrigens mittlere Wasserführung; bei Hochwasser (HQ) können aber schon einmal 11.000 m3 pro Sekunde vorbeifließen), so hat der Napo einen Abfluss im Mittel zwischen 4.600 und 6.300 m3 pro Sekunde – da sieht man doch schnell den so nicht erwarteten Größenunterschied – und er kann zulegen, und das schnell, »muy rapido«, das haben wir, auch »muy rapido«, bemerken müssen oder dürfen.
Für Amazonien ist der Fluss wahrlich ein Oberlauf, hat er doch steile Hänge, so wie bei uns die Flüsse im höheren Mittelgebirge und nicht im Tiefland, Hänge, die bestanden sind bis zur Wassergrenze – richtige Ufer gibt es nur selten und da, wo sie vorkommen, gern besiedelt – mit Dschungel, dicht und undurchlässig.
Der Rio Napo war der erste »richtige« Fluss, den der Conquistador Francisco de Orellana, der mit Pizarro (nicht mit dem Fußballspieler Claudio Pizarro, der ist ja aus Peru nach Bremen abgehauen) nach Südamerika kam und als erster den Kontinent von West nach Ost befuhr. Werner Herzog drehte übrigens mit seinem Lieblingsschauspieler Klaus Kinski 1972 den Film »Aguirre, der Zorn Gottes«, in dem er Lope de Aguirre als stellvertretenden Kapitän einer solchen Flussfahrt agieren lässt, die in Wahrheit nicht die erste war, sondern 20 Jahre später stattgefunden hat. Fiktion – aber sehr sehenswert, wenn man denn Kinski mag – und ein guter, wenn auch schwarz-weißer Einstieg in die Welt des Amazonas. Vor 500 Jahren – was sind wir für eine solche Gegend heute doch gut gerüstet – Aguirre würde sagen – Weicheier (wieder einmal) und er hätte Recht!
Puerto Misahualli war damals ein Flussstädtchen, schlecht angebunden, denn nur mit einem Straßenende ausgestattet, uninteressant, klein, feucht, unbedeutend, wenig bewohnt, eben ein Hafen für die, die am Ufer des Napo wohnten, oder ganz woanders lebten und dorthin fahren mussten, der Tourismus steckte in den Anfängen, wenn überhaupt, uns ist kein Tourist begegnet, das Wetter war aber auch für Begegnungen solcher Art nicht oder nur bedingt geeignet.
Heute sieht es dort vollkommen anders aus, für uns wäre er wahrscheinlich fremd, der Ort mit einer stark gewachsenen Einwohnerzahl, mit touristischer Infrastruktur, denn die Welt will in den amazonischen Regenwald – beinahe hätte ich pessimistisch gesagt, solange es ihn noch gibt, aber glücklicherweise murren auch hier Umwelt-NGO’s, wenn man versucht, zu viel vom Dschungel wegzunehmen – und ab Puerto Misahualli geht das vortrefflich, die Angebote sind da und eine weiterführende Straße – Piste – ebenfalls.
Wir tranken einen Kaffee, na ja, und gingen dann zu »Hector«, einem Laden, der Souvenirs verkaufte und Touren anbot, die wir nicht brauchten. Hector war ein einheimischer Führer, der die Gegend wie seine Westentasche kannte und die wenigen Touristen in die Besonderheiten des Napo einführte.
Und … er hatte ein Geschäft, das einheimische Besonderheiten verkaufte, indianische Waffen, ausgestopfte Tiere (damals schon bäh), indigenen Schmuck und manch anderen Krimskrams.
Ich kaufte ein Blasrohr der Auca, ein kurzes Kriegsblasrohr, das heute noch mein Arbeitszimmer ziert und das … für den kriegerischen Charakter dieser indigenen Menschengruppe steht … aber … Sie merken, ich zweifle an der pseudoethnologischen Bezeichnung »kriegerisch« und das aus vollem Grund. Die Auca (»Feinde« genannt wegen ihrer Unbezwingbarkeit schon zu Zeiten der Inca) oder Waorani oder Huaroni geheißen, waren (damals) ein indigenes Volk, das hauptsächlich den Missionierungsversuchen der Evangelikalen (Sie kennen meine Einstellung diesen Widerlingen gegenüber) sehr ablehnend entgegen stand, sie wollten eigentlich schon immer in Ruhe gelassen werden, und die schon 1956 fünf Missionare des »Summer Instituts of Linguistic« (typisch, der Name wird verbrämt widergegeben, so dass man den wahren Zweck dieses Instituts nicht sofort erkennt, aber – man (der Auca) merkt die Absicht und ist verstimmt, man glaubt es nicht, auch dafür ist Goethe wieder zuständig), also fünf Missionare (mehr waren leider nicht da) getötet hatten, weil sie ihnen eben auf den Wecker (sie hatten zwar keine – glücklicherweise gibt es noch Völker, die keine Wecker kennen, weil sie sie nicht brauchen) gefallen waren. Gut so!
Nachdem das Institut vom Staat Ecuador des Landes verwiesen worden war, glaubte man, dass endlich Ruhe um die Indigenen eingekehrt sei, aber dann kam … der Ölboom. Wie es weiter geht … bitte Wikipedia lesen und weiter pessimistisch sein, oder defätistisch oder an das Ende der Auca glauben oder es fast schon erahnen.
Im Laden von Hector konnte man alles erstehen, was der Regenwald hergab, eben auch präparierte Tierschädel.
»Ist das nicht ein Schweineschädel?«
»Ja doch, ein Schweineschädel, ein Schädel vom deutschen Schwein.« In gutem Deutsch! Da wissen wir es wieder. Unser Ansehen hat im Ausland doch schon deutlich gelitten, deutlich!
Wir fahren flussabwärts, fahren in einem mächtigen Einbaum von sicherlich 20 Metern Länge und ausgestattet mit einem Außenbordmotor von 150 PS. Wir müssen 50 Kilometer flussabwärts. Und der Fluss ist still, ruhig, ohne Stromschnellen, wie man es schon einmal ganz quirlig von Oberläufen erwartet, er ist so mächtig wie ein europäischer Tieflandfluss, das Wetter hat sich beruhigt, wir veranstalten ein »Sightseeing«, genießen den Fluss, die steilen Ufer, die Vegetation, die »grüne Hölle«, das El Dorado des Lebens und das Wetter und freuen uns auf das, was noch kommen wird, noch kommen mag. Der Fluss schleppt ab und zu einen Baumstamm mit, der – seines Lebens müde – über den Hang gestürzt ist und dem Amazonas zustrebt, und der Bootsfahrer weicht ihm geschickt aus, so etwas ist für ihn normal. Die Ufer sind ruhig, Vögel halten sich bedeckt – wer kommt dort? – denn die Jagden sind noch nicht vorbei, Affen springen durch die Baumkronen, zu weit entfernt, um sie zu bestimmen oder sie zu fotografieren, aber wir sind begeistert, schon, aus der Ferne, wie wird es erst im Innern der Retorte des Lebens aussehen?
Was werden wir sehen, was erleben, was wird uns passieren, wird uns etwas zustoßen, vieles geht uns durch den Kopf, Jürgen und mir, denn die anderen waren schon einmal hier, schon mehrfach, werden aber immer aufs Neue eingefangen vom Mythos des Regenwaldes, sehen, erleben auch immer wieder Neues, manchmal Unerwartetes.
Wir atmen durch, tief, denn wir freuen uns, sind gespannt. Was werden wir zuhause erzählen, erzählen können, werden den Zuhörern, die noch nie hier waren, die Haare zu Berge stehen vor lauter Jaguaren, Spinnen, Ameisen, Blutegeln, Schlangen, Skorpionen und Kopfjägern? Wer weiß?
An einem Prallhang hoch über dem Fluss liegt die Lodge, das »Hotel«, damals noch recht rudimentär im Vergleich zu den Luxusbuden von heute, die aber beileibe nicht hierhin passen, mittlerweile aber hier sind, eigentlich passen sie höchstens nach Saint Tropez oder nach Sylt aber nicht nach Amazonien, und deswegen fühlen wir uns auch direkt wohl hier, denn hier passt alles und wir passen auch hierhin.
Die Lodge, das »Hotel«, liegt ganz oben im Wald, besteht aus einigen offenen Gebäuden, wo man das Essen einnimmt, den Funktionsgebäuden und Häusern des Übernachtens wegen, Sammelunterkünfte auf Basisbasis, die Leute schlafen auf Feldbetten, auf solchen grünen Dingern, die man von den Militärs oder noch von den Pfadfindern kennt (ging aber ganz gut, man war abends aber auch anständig müde), zu mehreren (bei uns zu fünft), die Damen waren nicht besser dran, es war also sehr komfortabel (und das meine ich schon wahrheitsgetreu!).
Es sind noch andere Gäste hier, Ecuadorianer, die sich ihr Land mit Kind und Kegel (Kegel weiß ich nicht, glaube ich aber auch nicht) ansehen wollen, sehr löblich, wir haben nur oberflächlichen Kontakt.
Der Morgen, früh, ganz früh, noch ziemlich dunkel.
Es regnet, wer hätte das gedacht? Regenwald, aber von irgendetwas muss der Name ja herkommen.
Aber jetzt geht es los. Über das Dach unseres Domizils (Wellblech) tost eine unerkannte Horde, und wie wir schnell merken, es ist eine Horde Affen, die so, wie wohl jeden Morgen, so wie immer, den Tag einläutet, auf unserem Dach, einmal großen Lärm gemacht mit zwanzig Mann (und/oder Frau und Kind) und dann weg. Das war der lebende Wecker. Tschau oder doch Ciao! Dann bis zum nächsten Morgen.
Wir liegen auf unseren Pritschen, wach jetzt, notgedrungen, aber es geht weiter.
Die Tür knarrt, sie springt auf (dabei muss ich sagen, dass die Tür aufgrund der hohen Luftfeuchte stark verzogen ist, man kann sie mit »der der Mütze« öffnen) und eintritt ein halbwildes oder –zahmes Pekari, ein einheimisches Wildschwein, das so aussieht wie die unserigen Schwarzkittel, und dem es frühmorgens schon etwas langweilig zu sein scheint. Es schnuppert und grunzt jeden an.
»Jürgen, nimm das Tier und geht mit ihm eine Runde spazieren.«
Und Jürgen erhebt sich von seinem Lager und spaziert schlafanzuggewandet mit diesem Burschen (oder dieser Dame, es hat niemand so genau hingeschaut) drei Runden um unser Domizil, bis es dem Vieh doch zu langweilig wird und es abhaut in den Dschungel … Dann auch Ciao bis zum nächsten Morgen.
Der Tag ist verplant, man will uns natürlich vieles zeigen. Unser Führer, und ohne einen solchen den Dschungel zu betreten, wäre mehr als fahrlässig, denn außer der Himmelsrichtung, ich habe einen Kompass mit, der allerdings in einer undurchsichtigen Umgebung recht nutzlos ist, hätten wir nichts zu vermelden, weist uns ein in die Gepflogenheiten, den Dschungel kennenzulernen.
Unser Führer ist ein weißer Ecuadorianer, Adoptivsohn eines Shuar-Häuptlings, Mitglied eines indigenen Stammes, dem man in der Vergangenheit ein sehr kriegerisches Dasein nachgesagt hat, was natürlich stimmt, aber die Aussage gilt für nahezu alle Stämme Amazoniens, denn das, was wir unter »kriegerisch« verstehen, war für die unterschiedlichen Stämme nichts anderes als der Versuch, ihr Revier mit den Möglichkeiten für die Ernährung ihrer Mitmenschen zu erhalten, so wie im europäischen Mittelalter die Ritter, die Bediensteten eines Fürsten oder eines regionalen niederen Edelmanns, darauf achteten, die Souveränität ihres Reviers mit allen Bürgern, vor allem der Bauern, denn die brauchte man immer, zu gewährleisten.
Die Shuar waren für ihre schönen Schrumpfköpfe bekannt und beliebt (fragt sich nur, bei wem), die man als abschreckende Trophäen in vielen Völkerkundemuseen bewundern kann. Heute ist das Schrumpfkopfen (gibt es das Wort überhaupt? Ab jetzt, ja.) verboten, ab und zu findet man die Köpfe von Faultieren geschrumpft, was natürlich auch nicht schön ist, besonders nicht für die Faultiere.
Wir gehen in Gummistiefeln, was auch nur am Anfang der Tour angenehm und sinnvoll ist, hatte man uns doch gesagt, man könne nicht sicher sein, welche Lebewesen sich für unsere Füße und Beine interessierten, nie wieder, da sind Sandalen deutlich besser. Unser Führer geht barfuß, was er bestimmt nicht täte, wenn er Furcht vor seinem Fußtod hätte. Und wir erhalten Macheten, denn wir laufen ohne Rücksicht auf Wege und Pfade, die es hier eh nicht gibt, quer durch die Pampa (sage ich jetzt einmal, egal welcher botanischen Herkunft, Pampa steht bei uns in Deutschland ja für alles Unwegsame und Unbekannte).
Die Vegetation ist atemberaubend, grün, dicht, dunkel, nass, glitschig, der Boden braunrot, humus- und mineralstoffarm, eisen- und manganreich, alles Verwertbare ist im Umbruch, das mineralisch Nützliche und Notwendige für die Pflanzen steckt in der lebenden und absterbenden Biomasse. Ein herabfallendes Blatt wird quasi im Abfallen schon zersetzt, genutzt, von Bakterien, Pilzen, Insekten und Herbivoren (sorry, Pflanzenfressern, und noch einmal sorry, andere Reihenfolge).