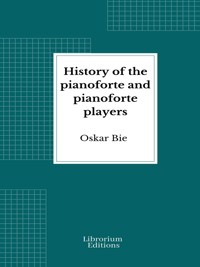Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: heptagon
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Schnellbahnen, Turbinendampfer und Goethe, Schubert und das Gordon-Bennet-Rennen, Nietzsche, Wagner, der moderne Tourismus und die Zeppeline: Die in dem Band versammelten sechsundzwanzig Essays, Feuilletons und Reiseberichte geben einen reichhaltigen Einblick ins Laboratorium des Denkens zur Wende des 20. Jahrhunderts.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 276
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Oscar Bie
Reise um die Kunst
Impressum
heptagon Verlag, Berlin 2015
www.heptagon.de
ISBN: 978-934616-31-8 Vorlage dieser E-Book-Ausgabe: Oscar Bie: Reise um die Kunst, Erich Reiss Verlag, Berlin 1910, 336 S. Die Orthografie wurde behutsam an die neue Rechtschreibung angepasst.
Vorwort
Ich habe in diesem Buch, ganz aus eigner Anregung, aus den von mir etwa in den letzten zehn Jahren geschriebenen Essays eine Auswahl getroffen. Die Essays wurden in verschiedenen Zeitschriften veröffentlicht, und ich dachte damals nicht daran, dass ich sie einst würde sammeln wollen. Jetzt scheint mir diese Sammlung nicht überflüssig. Denn solche Essays werden gleichsam von zwei Seiten aus verfasst. Einmal sind sie eine schnelle und oft improvisierte Aussprache zu Problemen und Ereignissen der Tage – das andere Mal aber sind sie unbewusste Stationen einer inneren Entwicklung. Diese Entwicklung kann gleichgültig oder sie kann exklusiv sein und darf dann keine allgemeine Geltung beanspruchen. Sie kann aber auch für die Charakteristik der Zeit eine Bedeutung haben, und dann ist die Reihenfolge der persönlichen Arbeit, so sehr sie zufälligen Anregungen entspricht, ein Teil des öffentlichen Interesses. Ich bin so unbescheiden, dies von den vorliegenden Essays zu glauben und darin das Recht zu sehen, sie noch einmal in der Einheit eines Buches zu veröffentlichen. Ja, ich möchte, wenn schon diese Unbescheidenheit sich als eine Entschuldigung des Entschlusses darstellt, ihr auch alle Konsequenzen auferlegen, auf die sie Anspruch zu haben scheint. Ich ließ die Aufsätze im wesentlichen so, wie sie waren, und wenn es sich nicht zeigt, dass sie in ihrer ursprünglichen, in der Atmosphäre der betreffenden Jahre eingehüllten Form als Zeugen von Erkenntnissen und Urteilen ihre Kraft bewahren, so wäre das die einzige Widerlegung, die sie sich gefallen lassen müssten.
Ich bin in jener konsequenten Forderung nach einiger Überlegung so weit gegangen, die Chronologie zu zerstören und nicht nur die Jahreszahlen der Entstehung zu unterdrücken, sondern auch die Folge ihres Erscheinens aufzuheben. Ich habe sie nach einem inneren Zirkel geordnet, der, wenn man die Einheit der persönlichen Auffassung verlangt, unbedingt vorhanden sein und zugrunde gelegt werden muss. Vielleicht ist dies die größte Unbescheidenheit, aber sie ist die notwendigste. Es stoßen in mir Interessen zusammen, denen man oft das Prädikat der Vielseitigkeit gibt, die mir als ein Vorwurf gilt, wenn sie nicht zentral begründet ist. Diese Aufsätze sind nicht vielseitiger, als es die Kunstinteressen unserer Zeit sind, oder, wie ich meine, sein sollten. Die Zusammenhänge musikalischer, architektonischer, literarischer, bildnerischer und nicht zuletzt der Lebensinteressen hegen heut offener als je da, sind mehr als je Programm und Sehnsucht geworden – wer sie spiegelt, darf dadurch eine erhöhte Mitgliedschaft am Kulturleben der Tage beanspruchen. Nach dieser Idee habe ich die Essays zusammengebunden, und es wird dem freundlichen Leser nicht schwer fallen, dieses Auseinanderwachsen, dieses Sichberühren und Fortpflanzen, diesen Kreisschluss, halb mit der ernsten Miene des sozialen Ehrgeizes, halb mit der lächelnden einer gütigen Mitwissenschaft, zu erkennen. Es ist darum eine Reise in meinem Geiste, zu der ich alle einlade, die mit mir fühlen oder diese Gemeinschaft versuchen wollen, die der einzige Grund und Sinn einer solchen Veröffentlichung bleibt.
Oscar Bie
Ästhetische Kultur
Der Tempel unserer Ideale liegt auf keiner wüsten Insel, sondern in einem Haine, der gleich den uralten Gärten der Päpste auf dem Vatikan vorn mit einigen zierlichen Blumenparterres und regelmäßigen Stiegen und Terrassen beginnt, um sich allmählich weiter hinten in einen Promenadenwald zu verwandeln mit geschlungenen Wegen, undurchsichtigem Dickicht und verborgen rauschenden Quellen. In ihm wandeln die Beschaulichen in feierlichen Gruppen, wie sie Feuerbach sah, oder im rhythmischen Gang platonischer Erhabenheit. Die Beschaulichen haben das Gebäude ganz oder zeitweise verlassen, gleichviel ob sie jung oder alt sind, sie wollen nur betrachten, lächeln, wissen, sogar ohne nach Eremitenart ihre Weisheit praktisch zu machen. Sie gehen in leichtem Gespräch den weiten langen Gang bis an das Ende des Hügels, wo ein freier Ausblick ist, die Weinberge vor den Augen liegen, die Peterskirche zurückbleibt und von der Stadt nichts mehr zu fühlen ist. Ihr Schritt ist nie geschäftig, selbst wenn sie sich einmal das Vergnügen gönnen, zur Tür des Hauses hereinzublicken.
Im Hause selbst sieht es wie im Parlament aus, sehr amphitheatralisch geordnet, und die Parteien sind unsere Temperamente. Wir sitzen in einem großen Kreis, die Organisatoren, die Denker, die Empfinder mischen sich nach ihrer Stufenordnung. Sie alle prophezeien aus ihrer Natur heraus und haben darum alle Recht, weil es nichts Rechteres gibt, als seine Natur zu entwickeln, diesen schimmernden Schatz ungeordneter Reichtümer. Aber es kommen Zeiten, da die eine Gruppe die Vorhand hat, die andere zurückbleibt, und es ist ein stetes, schönes und unterhaltendes Schwanken zwischen unsern Kräften, den drei großen inneren Sinnen, die uns gegeben sind, dem logischen Sinn, etwas begreifen zu können, dem praktischen Sinn, etwas formen zu können, und dem ästhetischen Sinn, etwas gern haben zu können. Heut hegt das Auge des Schicksals auf diesen Gernhabern, den starken Empfindern und den Händlern, den Organisatoren. Zwischen ihnen wird die Zukunft verhandelt, die bloßen Begreifer beginnen zu schweigen.
Philosophie ist Beruhigung über die großen Zusammenhänge. Wir Empfinder, die wir unser Tagewerk von Kunstgenuss, Kunstschöpfung, Kunsterweiterung, Kunstpropaganda selbst im Traume noch fortsetzen, müssen einmal vor die Frage kommen: was ist diese ästhetische Kultur, die unser Boden und unsere Heimat ist, die heute in aller Munde lebt und Millionen Hände und Köpfe beschäftigt, was ist sie uns wert, und wenn unser Leben eine Steigerung des Menschen ist, was steigert sie? Sind alle die Popularisierungen der Kunst ein Wahn, vielleicht nur ein vorübergehender Rausch, oder sind sie ein dauernder Besitz? Erziehung zur Kunst ist ein Schlagwort geworden. Man hat die kunstlosen Klassen geradezu in Kunst gezüchtet, hat die Arbeiter durch Volkstheater und vorstädtische Ausstellungen und populäre Vorlesungen mit diesem Präparat reichlich geimpft, man hat nicht einmal die Kinder in Ruhe gelassen, hat ihre alten geliebten Bilderbücher durch Kunstwerke ersetzt, hat ihre ersten Dilettantismen zu einer Offenbarung gestempelt, hat ihren Unterricht von aller Unanschaulichkeit zu befreien versucht, hat sogar Kinderkonzerte geschaffen. Und viele erste Kräfte haben sich an diesem Werk beteiligt, und die zweiten haben sich selbst wieder ästhetisch erzogen, indem von der Nahrung, die sie den Damen, den Arbeitern, den Kindern vorsetzten, reichlich für sie selbst abfiel. Es gibt nun niemanden mehr, den wir nicht zur Kunst erzogen hätten. Alle Menschenklassen und Menschenalter sind durchgenommen. Was heut im Künstlerkopf entspringt, ist morgen Mode. Was Mode ist, wird wohlfeil. Das junge Ehepaar kann sich heut für die Hälfte des Preises künstlerisch einrichten, den es vor zwanzig Jahren für Muschelnussbaum ausgab. Der Beamte kann sich Gravuren der Reichsdruckerei in grünen Rahmen an die Wände hängen und für ein Geringes sich gut gebundene Bücher sammeln. Die Bürgerstochter kann in Vorlesungen, Atelierbesuchen, Skioptikonproduktionen, populären Kammermusiken ihre Zeit wunderbar ausfüllen. Wie vieles scheint erreicht, selbst wenn man weiß, wie vieles nicht erreicht ist.
Dieses Niedersteigen des Geschmacks in unsere Wohnungen, dieses wachgerufene naive, ästhetische Empfinden gehört unter die positivsten Fortschritte, unter die Fortschritte, die nicht aus einem konstruierten Vervollkommnungswege der Menschen bewiesen werden, nicht aus dem grausamen Wechselspiel von Bedürfnissen und Erfindungen herkommen, sondern eine Veredelung sind, eine Erleichterung von Lebensgängen, die uns doch nicht erspart werden. Kultur heißt jene Förderung notwendiger Neuerungen, die in den großen Gesetzen der Umwandlungen beschlossen sind. Niemals können wir diese großen Gesetze ändern, wir können sie begreifen, bewundern, beweisen, aber niemals die Finger in ihre Räder legen. Wir können nur im Kleinen helfen, die Bewegungen, die wir erkannt haben, erleichtern, die Wege ebnen, die Übel scharf ansehn und die Schwächeren an der Hand nehmen. Das können wir stets und wir empfinden viel zu sehr die Wohltat dieser menschlich schönen Kontrolle der großen Maschine, als dass wir nicht wüssten, wie all unser Geist nur in dieser Aufgabe wirksam und erleuchtend wird. Mit einem sehr gerechten Stolz blicken wir auf diese neue Geschmackskultur zurück, durch keine Skrupel lassen wir uns das Vergnügen rauben, bei einem Sozialismus der Kunst selbst besser auszugehen. Gefühle sind entdeckt, die wir nicht kannten. Wir standen zu ihnen, wie zu den alten langweiligen und gleichgültigen Dingen, die unsere Zimmer füllten und zu denen wir gar kein Verhältnis hatten, nicht einmal ein feindliches. Jetzt sind die Augen aufgegangen, wir rissen die Tapete herunter und schufen uns zuerst einen neuen warmen Hintergrund, der nicht bloß den Kalk deckt, sondern sich darauf freut, mit den dunkeleichenen Schränken und den Karlsruher Lithographien und den japanischen Drucken ein Kammerkonzert zu geben. Die Spiegelsofas mit den Etageren, die Büffets mit den verlogenen Säulen, die so stumpfsinnig sind, sich mit den Türen herumzudrehen, die Stühle mit den Profilen, die keine Empfindung beseelt, und den Ornamenten, die ein gähnender Gewerbeschüler zeichnete, sie werden heruntergeschafft, wir senden ihnen keinen Blick nach, sie stehen frierend auf der Straße, sie ziehen mit dem Möbelwagen irgendwohin, weit in unklare Fernen, von unserer Seele nehmen sie nichts mit. Die ist schon im neuen Leben, bei den ersten aufregenden Versuchen, Stücke, die man liebgewann, noch ehe man sie besaß, zu ordnen, rote Damastdecken vom römischen Campo di Fiore auf alte friesische Truhen zu legen, Perserteppiche mit chinesischen Wandschirmen und Quattrocentofiguren und Delfter Tellern zu arrangieren, als Ausdruck unserer Wünsche – zu arrangieren, wie wir heut die Geschichte sehn und lieben, nicht als Chronologie, nicht als Deszendenz, nicht als Stil und Schule, sondern als die bunte Werkstatt der Kultur, die bald drüben in Ostasien, bald im kleinen Florenz der ersten Medici, bald in einer Fabrik der winzigsten holländischen Stadt die Kräfte zusammenschießen ließ zu zeitlosen Schönheiten. In dem kleinen Arrangierspiel in unserm Zimmer leuchtet auf einmal ein Geist, den es bisher nicht kannte, ein Kunstwerk entsteht da, wie jedes andere, aus den Instinkten des Einzelnen und der Überlieferung langer Kulturen gemischt, ein Kunstwerk, das nie in einem Kodex der Ästhetik Platz gefunden hat und doch so tief und selbständig ist, dass von dem Rausche, der bei seiner Schöpfung niederfuhr, in uns, die wir nicht heut und morgen, nicht hier und da, sondern immer und in allem ästhetisch stark empfinden müssen, ein Glanz zurückbleibt, der alles bestrahlt, was noch in dieser neuen Disposition unserer Lebensrequisiten vor sich gehen wird.
Es geht wieder ein Singen durch das Haus. Wie an lauen Sommerabenden, wenn die Fenster zum Hofe offen stehen und wir aus irgendeinem der Fenster die langsam singende Stimme eines Mädchens hören, das sich ihre gewöhnliche Hausarbeit leicht und lustig zu machen sucht, so ist dies neue Gefühl über uns gekommen, ein schlichtes, volksmäßiges Gefühl, das mit all dem Zurschaustellen und dem kalten Paradeschein früherer Requisiten nichts mehr zu tun hat. Wie der einfachste Mann, lieben wir wieder jedes Bildchen und Väschen, das wir besitzen, weil es ein Stück von uns wurde. Nicht mehr in der Sache, sondern im Verhältnis zu ihr liegt nun der Wert, die Sache kann die wohlfeilste sein, es ändert nichts, das Verhältnis ist ja noch wohlfeiler. Wir singen das Lied von der neuen Wahrheit, die wir gefunden haben, von der Unwiderleglichkeit unserer Empfindung und dem Reichtum unserer Phantasie.
Es ist ein großer Chor von Menschen, die dies heute singen. Philosophen, die sich vom Truge des Objekts befreiten, Dichter, die die Propheten subjektiver Urteile wurden, Theologen, die aus Lebenserstarkung am Dogma zweifelten, Künstler, die die Banalität des Naturalismus früh genug erkannten, Historiker, die die Historie mit einem einzigen Strahl ihrer inneren Erlebnisse beschämten. Es ist eine Phalanx von Empfindern, nicht von schwächlichen Nervösen oder hysterischen Perversen, sondern von Männern, die uns Verlorenes wiedergeben wollen, die uns vor der Nüchternheit des kalten Denkens und leblosen Begreifens retten wollen, indem sie den Weg wieder von innen beginnen lassen. Wo steht geschrieben, dass er von außen beginnen muss, dass wir uns Fabrikschränke, Industrieornamente, Spiegelsofas um den Horizont unserer Subjektivität zu stellen haben? Nein, geschrieben steht, dass wir mit dem Kleinsten glücklich werden, wenn wir es mit Leben düngten, und dass sich Leben lohnt, wenn wir seine Melodie auf dem Rhythmus unserer Empfindung singen. Die Zeit der Philologen und der Naturwissenschaftler deckte sich. Als sie herrschten, galt das empfindungsloseste Begreifen, Rechnen, Aufreihen für den Triumph menschlichen Geistes. Welchen Lebenswert hat es, den Pausanias herauszugeben, zu Horaz Anmerkungen zu machen oder Geschichtstabellen auswendig zu lernen? Ich meine es wirklich: welchen Lebenswert hat es? Wenn der Pausanias unkollationiert bleibt, verliert kein Hund etwas auf dieser Welt. Ein Dichter, der aus einer falschen Stelle des Pausanias eine schöne Phantasie über die Geburt der Tragödie entwickelte, wäre zehnmal mehr wert, als seine sämtlichen Richtigsteller. Welchen Wert hat es, zu wissen, wann irgendein salischer Kaiser gekrönt wurde? Wozu belasten wir unsern Kopf mit solchen Dingen? Es ist ein Belasten, weil es sich nicht umsetzt, wie etwa die Mathematik, die dem Einfältigen ein guter logischer Zwang, dem Phantasievollen ein Märchenland ist. Wir hassen die Philologen, weil sie uns den Brunnen der Schule vergiftet haben. Senkzweige uralter Kompiletik des 17. Jahrhunderts haben sie unter dem Namen Humanismus zum Baum der Erkenntnis auftreiben wollen. Sie haben vertrocknen und vermodern lassen, was jetzt eine Klasse liebenswerter Menschen in langsamer Arbeit wiedergutmachen soll. Wir haben an den Absolutismus der Antike geglaubt, als wir die Schule verließen, sind aus diesem Irrtum Archäologen geworden, sind als Archäologen gereist, bis das Reisen uns wieder gesund machte, haben die Antike verloren und auf dem Umwege von Jahrhunderten wiedergewonnen, ein Werfen, das nicht jede Natur verträgt. Wir haben die sündige zersetzende analytische Kraft der philologischen Kritik anzubeten geglaubt, man hat uns eingeredet, lateinische Dissertationen zu machen, weil die lateinische Sprache logischer sei als die unserer Eltern, wir reckten uns auf vor den Resultaten der Naturwissenschaft, die heute so, morgen so, Pflanzen und Menschen katalogisiert und deduziert und Kategorien der Anschauung für Lösung von »Welträtseln« ausgibt. Was half es uns? Wir mussten wieder durch Begeisterung und Empfindungsfähigkeit hindurch, um rückblickend den Wert der Kritik zu begreifen, ihr Kunstwerk zu sehen, den Sport Rousseauschen beschaulichen Botanisierens zu verstehen, Tatsachenfreude als Flucht zu erkennen. Alles, was uns ward, ward uns durch die Empfindung. Der Empfindung, als wir die Akropolis betraten, als wir Ruskin lasen, als wir den Champ de Mars zum ersten Mal besuchten, als wir die Luft der Freien Bühne atmeten, ihr danken wir unser Bestes, sie machte unsere Lebensabschnitte. Was ist dieser ganze, grässliche »Kampf ums Dasein«, den uns die Naturwissenschaft vorführt, gegen eine einzige süße Stunde, da wir irgendeine Kleinigkeit dieser Welt, den Blick eines Kindes, die Dämmerung eines einsamen Abends, den Klang einer tiefkolorierten Altstimme, wirklich einmal unbescholten gern hatten und das Blut rollen fühlten? Es gibt ein Gewissen des Bluts, das uns genau die Augenblicke bezeichnet, in denen wir Menschen sind.
Die Krankheit, von der uns die wachsende, ästhetische Kultur heilen soll, heißt das Wissen, das trockene, mechanische, leblose, sezierende, sondierende, tatsächliche Wissen. Das Wissen hat uns auf dem Wege der Philologie hundert Brunnen vergiftet, den der Natur, wie der alten Dichter, wie der Sprache, wie der Geschichte, ja beinahe den der Zukunft. Wie konnten wir Geschichte und Natur lieben, wenn wir nicht erzogen worden wären, sie gar nicht oder ganz erschrecklich objektiv aufzunehmen! Erinnert man sich der trüben Gasflammen, unter denen Cäsar und Hannibal mumifiziert und die Naturgeschichte verschlafen wurde, und wie dann plötzlich durch ein inneres Erleuchten der Mensch in Hannibal, das Drama in Cäsar, der Triumph in der Renaissance, die Seele in der Romantik von uns entdeckt wurde? Von einem unfruchtbaren Feld waren wir auf einmal in ein fruchtbares gekommen mit wirklich unbegrenztem Horizonte. Das tote Wissen gilt uns nun nichts mehr, nur die Liebe gilt, mit der wir das Objekt umfassen, das Wissen wurde mehr als gleichgültig, es wurde der Feind.
Ich denke mir manchmal mit einer geradezu Ellen Keyschen Zukunftsfreudigkeit, wie viel glücklicher unsere Jugend gewesen wäre, wenn wir durch Bilder, statt durch Bücher zu den Römern geführt worden wären, wenn wir gesungen, spazieren gegangen, gesehen und gelebt hätten, statt Tabellen zu trichtern. Ist es denn so ketzerisch, sich zu denken, dass die Kunst wirklich als Erziehungsmittel die Grammatik und Geschichte ersetzen könnte, in ganz großem Stile, so wie die Religion, ursprünglich ein Idealismus erster Geister, dann zu einer Erziehungsform umgewandelt, popularisiert wurde? Was würde es uns schaden, mit Plutarch die großen Männer lieben zu lernen, statt Ciceros Tusculanen zu lesen? Wir würden frisch und phantasievoll in der Liebe werden, wie es Pietro Bembo ist am schönen Schlusse des Castiglioneschen Cortegiano und wie es die Akademiker von Florenz waren. Sie wussten weniger von der Antike, als dass sie sie liebten, und schufen aus einem Missverständnis die große moderne Oper. Sie dachten, die Antike wäre farblos, und sie schufen aus missverständlicher Liebe die große, moderne, weiße Plastik. Was gilt dies Missverständnis? Sie schufen!
Nur verwechseln wir das Mittel nicht mit dem Zwecke. Der Gedanke wäre entsetzlich, die Menschen zur Kunst erziehen zu wollen, statt mit der Kunst. Dieser Fehler wird gemacht, man glaubt ihm zuerst, dann widerlegt man ihn und so streitet man sich um eine Illusion. Wer wird zur Kunst erziehen wollen? Soll es noch mehr Wunderkinder, unglückliche Dilettanten und verschrobene Tischlergesellen geben, die aus Bastelsucht ihr Leben mit einer undisziplinierten Kunst zubringen? Sollen Kinder Erwachsene werden? Nein, Erwachsene sollen Kinder werden, naiver in ihrer Genussfähigkeit und gläubiger in ihrer Phantasie.
Man mache sich klar, was dieses Wort »Kunst« eigentlich für ein Wechselbalg ist. Es bezeichnete zunächst nichts als die τέχνη, das Machenkönnen. Die Alten habens nie anders verstanden, die Künstler blieben ihnen Pinseler und Steinmetzen und nur in der Wirkung sahen sie das Göttliche. Erst die spätesten Philosophen achteten darauf, dass das Göttliche schon innen ruhen muss, wenn es außen wirkt. Langsam rückt nun der Begriff »Kunst« vom Technischen ins Geistige. Da das Machenkönnen von Kunstwerken durch eine starke Intuition gefördert, meist sogar erst in Szene gesetzt wird, so gewöhnt man sich daran, schon in der Empfindung etwas Künstlerisches zu sehen, womit gleichzeitig die Kunst selbst immer psychologischer wird. Die bloße Handwerklichkeit bleibt als Routine und weniger geschätzt beiseite. Das, was ursprünglich allein beachtet wurde, die technische Fähigkeit, das existierende Werk ist nun nur noch ein Mittel, um beim Autor Kunst zu finden, beim Empfänger Kunst zu erregen, um Zeuge und Anreger von Genuss zu sein.
Wir können heut das Wort Kunst streichen, wenn wir es nicht einfach mit Genuss gleichsetzen wollen. Es geht nicht mehr anders. In dem ersten Gernhaben irgendeines Vorgangs oder einer Erscheinung liegt bereits der Keim zur Kunst. In der Lustempfindung, mit der wir Zupassendes lieben, in dem Unlustgefühl, mit dem wir Nichtgenehmes abstoßen, liegt die Form unseres künstlerischen Temperaments. Darüber hinaus gibt es keine Entscheidung. Von da an aber einen Riesenweg von Genüssen, Produktionen, Reproduktionen, der durch das ganze Reich der ästhetischen Kultur geht, mit sichtbarer oder unsichtbarer Kunst, mit empfundener oder nachempfundener Schönheit, mit nur gefühltem oder in Wirklichkeit umgesetztem Inhalt – eine Welt von gepflegten Lustgefühlen, in der das reale Kunstwerk nur ein Leitungsdraht scheint.
Ich gehe in die Landschaft und empfinde die Farbe der braunen Stämme in der blauen Märzluft als Reiz. Es kann mir genügen, diesen Reiz in mir zu fühlen, aber er kann auch so stark werden, dass ich ihn umsetzen muss in etwas Wirklich-Bestehendes, wie die Natur Sichtbares, und ich male violette Stämme. Je schärfer ich sie innen sehe, desto überzeugender werde ich sie außen hinsetzen. Ich gehe den nächsten Tag wieder hinaus, finde einen neuen Reiz, steigere wieder diese Empfindung bis zur Schaffenslust, male eine zweite Landschaft. Eine dritte, zehnte, hundertste, durch Jahre hindurch, von Monat zu Monat freier, das ist innerlich bestimmter. Nun tritt eine neue Epoche ein. Wie das viele Empfinden zur Produktion führte, so führt das viele Produzieren zum Wirkenwollen. Wie das starke Empfinden starke Bilder schuf, schafft das starke Schaffen den Wunsch nach Individualitätssieg, nach Überredung, nach Resonanz. Ich finde endlich die Resonanz und meine Werke fließen in die Allgemeinheit ein. Ein Dichter sieht sie und reproduziert sie bewusst, unbewusst in seinen Werken, die wieder die Vorwerke anderer sind. Ein Maler sieht sie und nimmt die angesammelte Kultur ihrer Schönheit so bewusst oder unbewusst in seine Werke auf wie ich es wohl einst tat, als ich in meinem ersten Bild alle, die ich bisher gesehn, mitsprechen lassen musste. Ein Spaziergänger sieht sie, er nimmt ihren schärferen Ausdruck in seine schwächere Persönlichkeit auf, seine Augen richten sich danach, er sieht jetzt die blauen und roten Farben der Stämme, er kombiniert diese Reize mit Millionen anderen, die er auf dieselbe Art von allen bisher genossenen Kunstwerken empfand, eine Nebensache kann bei ihm die stärksten schlummernden Gefühle wecken, ja ein falscher Schluss ihn glücklich machen, aber er bleibt bei dieser – noch so verfeinerten Empfindung stehen, er muss nicht produzieren, er muss nicht wirken.
Die Kette von Genuss zu Genuss habe ich leicht hingelegt, denn wenn wir abstrahieren, glätten wir die Dinge und projizieren ihre Unebenheiten in eine schöne Fläche. Die Wahrheit ist nicht so kosend. In Wahrheit ist diese Kette vom Genuss über das Schaffen zum Wirken schütternd von Erregung, rot von Blut. Die Reize spitzen die Nerven, das Schaffen zerstört das Gleichgewicht, das Wirken beschämt tausend Hoffnungen. Missverständnisse bringen Erfolge, edle Säfte fließen in Abgründe, der Neid verschiebt Persönlichkeiten und niemand kann einen Schritt zurück. Unter schweren Geißelhieben wird diese Arbeit verrichtet und der Glaube wird verlacht, wenn er ausgenutzt ist, der Rausch verflucht, wenn er der Ironie des Schicksals gedient hat. Die Ungläubigen stecken ihren Witz auf aus der Lust, Geschaffnes zu sehn, reizen sie sich; aus der Lust, Wirkung zu üben, buhlen sie um Wirksamkeit im Schaffen. Auf einige Jahre scheinen diese Alberiche voraus zu sein, da keuchen schon hinter ihnen Rächerstimmen und sterbend sinkt ein Edler am Ziel hin. Aber wir fliegen auf, die Stimmen verhallen, die Bewegung scheint ruhiger, scheint bewusster zu werden – von oben sehen wir nicht das Los des Einzelnen, wir sehen nur die Richtung dieser gewaltigen, zwingenden, unhaltbaren Kraft, der Erhöhung des Genusses. Die Menschen arbeiten in jener Kette von Leiden an der Erhöhung des Genusses, von Jahr zu Jahr vielfältiger, wechselseitiger, verschlungener, ein Schauspiel, selbst um so grandioser, um je grandiosere Güter in ihm gestritten wird.
Ein neues Reich tut sich auf. Was einst die Religion besorgte, soll nun wirklich die Kunst vermitteln, die Auseinandersetzung des Einzelnen mit dem Gesetz. Die Religion gab den Einzelnen auf, Kunst gibt ihm im Gegenteil das Bestimmungsrecht. Um ihm das Bestimmungsrecht zu geben, musste vorher die Welt objektiviert werden. Der Weg ging von der Religion über das Wissen zur Kunst. Wer ging diesen Weg unter uns und wer wurde darum ein innerer Führer? Nietzsche ging von der Religion über das Wissen zur Kunst und darum wird sein Name in aller Munde geführt. Sein Leben ist ein Abbild der Gegenwart und der Zukunft. Pastoren, Philologen und Propheten ästhetischer Empfindung wechseln sich auf der Bühne seiner Seele ab. Wir gehen hinein in das Reich subjektiver Rausch-Ästhetik, der wahren Ästhetik, wie sie Nietzsche fühlte, wir werden zusehends dionysischer, wobei Dionysos immer noch ein Gott und immer noch ein Stück Altertumskunde bleibt, nur von uns aus gesehen. Nicht Nietzsches Inhalt wird bleiben, sondern seine Form. Sein Recht auf den feinsten und baumeisterlichsten Menschen. Seine Umwertung des Objektes ins Subjekt.
Das Kunstwerk hat seine Mission gefunden. Es löst die schlummernde Genussfähigkeit, die unentwickelte Empfindung und gibt eine Möglichkeit, durch einen neuen Glauben über die Widersprüche hinwegzukommen, indem wir nicht mehr uns in die Welt, sondern die Welt in uns eingehn lassen. Das Kunstwerk, in der edelsten Stunde eines schöpferischen Menschen geboren, scheint eine zweite Bestimmung zu erhalten, Gesetze der Schönheit zu verbreiten, Feinheiten der Stimmung zu verallgemeinern. Neben der ersten Natur wird es eine zweite Natur, mit Menschenblut gedüngt, und darum unmittelbarer. Alle großen Taten, alle inneren Befreiungen, alle tiefe Religiositäten wirken in ihm mit und predigen durch seinen Mund und, wenn nur eine Silbe von Idealität ins allgemeine Bewusstsein fließt, so ist schon ein Engel wieder gewonnen. Wenn die sanfte Schönheit eines gedämpften Streicherchors durch den vollen Saal tönt, in tiefer Ruhe, minutenlang gleichmäßig und süß verschwebend, so lösen sich zwei oder drei Herzen im Traume einer unnennbaren Glückseligkeit und sie bleiben auserwählt. Was klingt aus dieser Musik, aus diesem Drama, diesen Landschaften? Der alte und unzerstörbare Wunsch zur Idealität, über alles Handeln, alles Begreifen hinweg zu jener in sich gebetteten Empfindung von Rhythmus und höherer Reinheit zu gelangen, die uns heimzuführen scheint. Vielleicht bleibt uns ein Schimmer von ästhetischer Gesinnung zurück und hilft uns Dunkelheiten zu beleuchten, vielleicht lernen wir, das Leben in seinen Mischungen etwas mehr als ein Schauspiel, von uns selbst gedichtet, zu sehen und das Glück wie das Unglück als unser Werk zu nehmen, vielleicht werden wir ein klein wenig mehr Künstler und balanzieren sicherer, weil wir den Schwerpunkt in uns fühlen. Wir müssen trachten, der Kunst die Schönheit des Lebens zu verdanken.
Gefahren sind hier dieselben wie im Schaffen der produktiven Künstler. Ich nannte die Verschiebungen der Mittel und Zwecke: den Künstler, der sich reizt, um zu schaffen, statt dass er schafft, weil er den Reiz fühlt, und den, der schafft, um zu wirken, statt dass er wirkt, weil er des Schaffens voll ist. Die dritte Verschiebung liegt auf der Seite des Genießenden: es sind die schiefen Veranlagungen, die sich ästhetisch gereizt stellen und die Kunst dieser Lüge wegen aufsuchen, statt dass die Kunst von selbst und ohne Heuchelei den Empfinder in ihnen weckt. Es sind die Ästhetizisten, die Schöngeister, die überall auftauchen, wo ästhetische Kultur herrscht, wo romantische Feinfühligkeit sich verbreitet und künstlerische Religion gepredigt wird. Die Kunst nimmt an ihnen eine furchtbare Rache. Denn weil sie schon ohne Gleichgewicht ihren Schöpfungen gegenüberstehen, verlieren sie dieses ganz, wenn sich der Lebenswert ihrer ästhetischen Schule zeigen soll. Hier gelangt man nur weiter mit der peinlichsten inneren Ehrlichkeit. Ja sogar, wenn ich sagen soll, aus welchen Dramen, Symphonien, Bildern ich am sichersten etwas für die Ruhe des Lebens mitnahm, so waren es, selbst in der Wiederholung, meist solche, bei denen ich es nicht erwartet hatte, also auch nicht bestellen konnte.
Ich muss an dieser Stelle über den Begriff Alexandrinismus reden. Es ist eines der missverständlichsten Worte, die es gibt. Schon um das arme Alexandria tut es mir leid. Der Hellenismus war eine so gewaltige Kulturmission, eine durchaus eigene Form des Geistes und der Ökonomie, die die Despotie des alten Asien mit dem Inhalt Europas erfüllte, worauf das Imperium, das Christentum, der Sozialismus basierte – etwas Spätgebornes, Dekadentes ist das wahrlich nicht. Ihre gelehrten Dichter und dichtenden Gelehrten waren eine sehr fruchtbare Menschenklasse, Epigonen ja, aber nicht Dekadenten. Es gibt keine andere Dekadenz, als jenes Missverhältnis von Mittel und Zweck, das wir immer wieder brandmarken. Mittel nehmen für Zweck ist die einzige Sünde. Jede Wirkung rächt sich, die nicht ihren zureichenden Grund hat. Dies ist Verfall, dies Krankheit; die Heuchelei ist tödlich. Aber was ist sonst Alexandrinismus? Sind wir Alexandriner, wenn wir eine ästhetische Kultur predigen? Nicht einmal Epigonen sind wir. Jede neue Phase wird der vorhergehenden Generation gefährlich, geklügelt, geheuchelt erscheinen. Aber die vorhergehende Generation hat nie Recht. Wo ist ein Ende, wo eine Grenze? Meine ackerbautreibenden Vorfahren hätten mich sicher für einen Dekadenten erklärt, dass ich in einer Millionenstadt an einem Novemberabend über den Wert höherer Empfindungsfähigkeit schreibe. Ich bin nur in sehr trüben Stunden ihrer Meinung. Und wenn man will, kann man so trivial sein, die stolzeste Eigenschaft des Menschen, das Selbstbewusstsein, als Dekadenz gegen das Tier zu beweisen, kann man jeden Schritt weiter, jede Verfeinerung und Vergeistigung als Alexandrinismus höhnen. Was sich lebensfähig erweist, ist nie Dekadenz. Man hat Mozart, Wagner, Strauß jedes Mal mit denselben Worten vorgeworfen, dass sie zuviel Noten machen. Heut klingt mir Wagner oft schon mozartsch. Was ist das alles für Spielerei? Seht, wo Funken sprühen und der Geist sich regt, das ist Kultur; und wo Grimassen sind, das ist Dekadenz. Es ist unheimlich, wieviel Geist wir schadlos uns inkorporieren können. Was wird, liegt ja in unserer Hand. Es ist nicht wahr, dass nur im Handeln und Denken die Gesundheit ist, ohne Empfindung wären dieses zwei Leichname. Die Empfindung, das brüderliche Gefühl zur Welt, der Genuss am Wahrnehmen und Schaffen ist die Gesundheit, ist die Seele, das andere sind nur zwei Arme. Die gesteigerte Kunst wird den Genuss steigern, die Empfindung erhöhen, die Urkraft heraufbringen, und lebensfähiger machen, so wahr, als Genuss nicht Genüsslichkeit ist.
Wenn wir das Kunstwerk zu einem Erziehungsmittel machen, wenn wir die energetische Kraft des Genusses betonen, so tun wir ja nichts anderes, als das Seil weiterspinnen, das die Vorfahren unserer Kultur in unsere Hand legten. Einst haben sich die Menschen tausend Jahre ohne merkliche Kunstkultur begnügen können, sie sahen ornamental und nicht inhaltlich, weder die Musik noch Dichtung noch Malerei bringt tausend Jahre lang etwas inhaltlich Neues. Es ging auch so, ihr Idealitätsbedürfnis war ganz vom Religiösen erfüllt, darin waren sie glücklich. Man wurde aber weltlicher und brauchte eine neue Quelle des Idealismus. Jetzt gibt es auf einmal etwas, was ein Jahrtausend lang nicht existiert hatte: Kunstgeschichte. Aber wie man Jahrhunderte nötig hatte, eine religiöse Lehre zu bilden, so wird auch die Kunst an einer Krippe geboren, unbeachtet, eine Privatangelegenheit, Bestellung und Stiftung, und ganz langsam erst wird sie öffentliche Angelegenheit. Heut steht in der kleinen Kapelle des Palazzo Riccardi zu Florenz, wo Gozzoli seine holdseligen Dreikönigswunder malte, ein Beamter der italienischen Regierung mit einer großen elektrischen Blendlaterne, weil es so finster ist, dass man das nur künstlich sehen kann, was uns mehr entzückt, als alle robusten Dekorationen der Farnesina und Borgiagemächer. Aus finsteren Winkeln holen wir uns die ersten Ahnungen jenes heiligen Wahns, den wir heut Kunst nennen. Die Medici schrieben ihre Ordres aus, sie schätzten und diskutierten Kunst, aber Eitelkeit war das Motiv. Was von wahrer Kunst dabei unterlief, war gern geduldet, doch hieß es in der Hauptsache, Wände bemalen, Porträts anbringen, Pracht des Besitzes zeigen. Wir wandeln heut wie die drei Könige zum Stern im Quattrocento, in der Krippe finden wir das Knäblein der Kunst. Porträtbüsten, Friese, Statuetten, strenge Profile der fürstlichen Damen, Botticellische Frühlingskinder, Lippische Madonnen, Castagnosche Apostel und die weichen Reliefmedaillons des Rossellino – mit der Blendlaterne gehen wir umher und suchen sie. Was einst Schmuck und Auftrag war, oft an verborgenen, unansehnlichen Plätzen aufbewahrt, ward uns nun inneres Dasein, Lebenswert, Lebenserhöhung. Was die Medici und die Würdenträger bestellten, ist ein Stück unseres Heils geworden. Es gehört uns, gehört uns mehr, als all der geistig hohe, künstlerisch kühle Inhalt sämtlicher Stanzen Raffaels. Wir sind bescheiden geworden, als wir zum Kindlein traten. Im Drange, die Kunst zu sozialisieren, entfernten wir die Aristokratie des Cinquecento von uns, wir lernten die Niederlande lieben, wo unsere Liebhabereien geboren wurden, wo langsam in der Bürgerlichkeit, der Industrie, den Ausstellungen Beziehungen geknüpft werden zwischen Kunst und Leben, bis wir endlich uns reif fühlten, unsere Kunst und unser Leben ganz innig miteinander zu verschmelzen. Einst glaubte das Publikum an die Kunst, wie es an Gott glaubte, es nahm sie hin. Wir sind erwachsener geworden. Wir stellen uns zu ihr und fragen sie, ob sie Freund oder Feind sein will, dann machen wir Blutsbrüderschaft. Tot ist das Gemälde alter und neuer Zeit, das nicht in uns selbst auferstand; tot ist jeder Ton und jedes Wort, das nicht ein Zeuge von Empfindung ist. Dies ist der große Wechsel, dies die wunderbarste Vervollkommnung. Nun ist die Kunst, die als ein unschuldiges Kind in die gotische Welt eintrat, reif zur Mission. Der Leidensweg hegt hinter ihr.
Ja, ihre Leiden werden geringer werden. Wird das Kunstwerk, einst der Besitz weniger, heut ein öffentliches Kulturmittel, so mag zunächst die Kunst selbst, diejenige hohe Kunst, zu der niemand erzogen werden kann, feiner und immer geistiger werden. Es ist die natürliche Reaktion auf die Popularisierung. Aber dort, wo dann diese feine Werkstatt der noch unzerkleinerten, noch in keinen Kurs gesetzten Kunst ist, dort, wo dann die edelsten Schöpfer in der Keuschheit ihrer Persönlichkeit beharren, dort braucht keine Angst mehr zu sein um endgültige Vereinsamung, um Not und Untergang, nur um das Buhlen der Menge. Schuberts und Kleists und Kellers Schicksal ist heut schon ausgeschlossen. Es bedarf nur kleiner Geduld, und es macht heut jeder von sich reden, nur durch seine Kunst, auch ohne die geringste äußere Nachhilfe. Ja, zweifellos sucht man schon mehr Kunst, als man findet. Und fast noch zu Lebzeiten wird nach Gutem und Schlechtem die letzte Rechnung der Gerechtigkeit über dem Künstler vollzogen. Die Kunst wird stürmisch vom Leben begehrt. Noch überwiegen die Vorteile ihrer Öffentlichkeit die Schäden. Was sie an dauernder Isoliertheit verlor, gewann sie an Kulturkraft. Und, was sie an Lebenserhöhung dem Genießenden vermitteln will, davon strahlt nun auch, so gut es in dieser Welt geht, etwas mehr Heiterkeit auf die einsamen Stunden ihres Schaffens zurück. Wünschen wir: nicht zu viel, damit sie in Schmerzen gebäre.
Über den Genuss alter Kunst
Ich glaube, dass man drei Standpunkte unterscheiden kann, von denen wir Stellung zur alten Kunst, zu Kunstwerken vergangener Epochen nehmen. Der eine ist der der Kuriosität, der zweite der der Historie, der dritte der des Geschmacks.