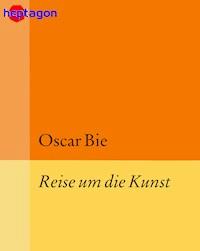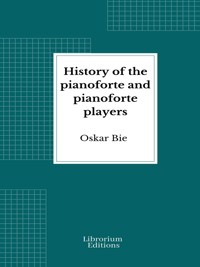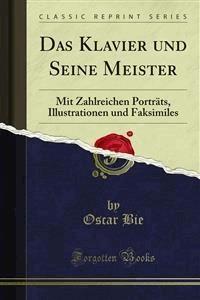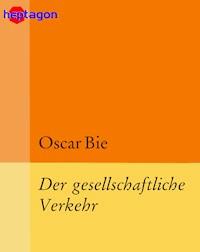
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: heptagon
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Oscar Bie, einer der bedeutendsten Feuilletonisten seiner Zeit, beschreibt in seinem 1902 erschienen kulturhistorischen Essay 'Der gesellschaftliche Verkehr' den großstädtischen Verkehr als ein Schauspiel, das in seiner Gesamtheit dem Ballett und der Symphonie ebenbürtig sei: 'Ein jeder Fußgänger mit dem Rhythmus seines Naturells oder seines augenblicklichen Geschäftes, ein jeder Privatwagen, das Automobil, das Rad, die Mietsdroschke, die öffentlichen Fuhrwerke, die Lastwagen, alles, was nach dem Stil der Zeit Verkehrsmittel ist, oder was vom Geschmack des Einzelnen dazu gewählt wird, verbindet sich zu diesem unbeschreiblichen Konzert.' Der Essay erschien 1905 als eigenständiges kleines Buch, das diesem E-Book als Vorlage diente.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 50
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Impressum
© heptagon Verlag, Berlin 2015 (www.heptagon.de)
Zuerst erschienen in: Zweiter Band v. DIE KULTUR. Sammlung illustrierter Einzeldarstellungen, hrsg. v. Cornelius Gurlitt, Bart, Marquardt & Co., Berlin o.J. (1905). Die Orthografie wurde behutsam an die neue Rechtschreibung angepasst.
ISBN: 978-3-934616-32-5
Der gesellschaftliche Verkehr
Ich weiß, dass mir nichts angehört, Als der Gedanke, der ungestört, Aus meiner Seele will fließen, Und jeder günstige Augenblick, Den mich ein liebendes Geschick Von Grund aus lässt genießen. Goethe.
Die freien rhythmischen Künste der Gesellschaft, die hohe Organisation des gesellschaftlichen Tanzes, hat sich in der modernen Welt an der Kultur des Verkehrs herausgebildet. Das ist ihr Gegensatz zur alten Welt, zu allem, was in der vorgermanischen Zeit Tanz und Gesellschaft hieß. Die Griechen kennen als Verkehrskultur nur das Symposion, die Peripatetik, das Konversieren von Männern. Sie kennen keine zweigeschlechtliche Gesellschaftsform, kein Balancieren der Sitten. Die Frau steht halb als liebliche Dekoration, halb als vertrauenswürdige Sklavin außerhalb, sogar im Falle der Aspasia und Diotima. Der Verkehr mit ihr musste erst den Schein der Sünde, die Gefahr der Verdammnis erhalten, ehe er sich zum Kunstwerk steigerte. Die Sünde hat die Liebe verfeinert, hat die Tugenden des Verkehrs geschaffen, den Leidenschaften Stil gegeben und die schöne Wandelbarkeit des Lebens gebildet. Wie die Madonna der goldgrundigen Byzantiner vom Throne aufsteht und in die Realistik der Renaissance eingeht, so erhebt sich die Königin des Herzens vom dekorativen Thron des Minnedienstes, der sie schwärmend adorierte, und geht in die Gesellschaft der Herren ein. Zuerst lächelnd und voll bescheidener Dankbarkeit. Dann aber, da die Herren ihre Reverenzen und Galanterien lernen und sie von der französischen Welt als Preis der ritterlichsten Passionen, hitzigsten Fehden und geistreichsten Unterhaltungen gelobt wird, ein Preis um so süßer, je grausamer seine Illusionen sind, da behauptet sie das Terrain, vergisst das Weib, vergisst die Dame und wird Frau. In dieser ganzen Zeit ist sie die Lehrmeisterin des europäischen Verkehrs in der Gesellschaft gewesen. Sie hat der Gesellschaft die Balance gegeben, das Pendeln von einem Geschlecht zum anderen, das heimliche Verstecken und das stilisierte Bekennen, das freie Spiel der persönlichen Willkür und die Feierlichkeit einer bewegten Menge, die Schule des Kavaliers und die Flucht zum offenen Bekenntnis. Nun waren die erotischen Gefühle in die Gesellschaft eingesetzt und jeder Verfeinerung preisgegeben. Nun war die Sitte zur Wächterin der Tugend geworden, und leuchtender lockte die Sünde. Ein Ja und Nein, ein Dürfen und Müssen, ein Strom Liebe und ein Strom Eifersucht bewegte die Gesellschaft, die Pole spitzten sich, die Drehung setzte ein, Gegensätze zogen sich an und stießen sich ab, das Leben fand einen silbernen Spiegel, und der Spiegel zitterte im Glanze der Öffentlichkeit – der Salon hatte seine Kulturmöglichkeit erhalten. Die Auseinandersetzung von Herr und Dame in den stilisierten Formen gesellschaftlichen Verkehrs hat die Geschichte des Tanzes geschaffen.
Das Schauspiel des menschlichen Verkehrs, ob wir es mit Emerson ethischer, mit Stendhal zynischer, mit Goethe musikalischer ansehen, ist ein Kunstwerk von so starken und so vielfachen rhythmischen Reizen, dass man es nicht zu Ende denken kann. In jeder Sekunde vollziehen sich auf Straßen und in Zimmern Bewegungsrhythmen verkehrender Menschen, die unter einheitlichen Gesetzen zu stehen scheinen und doch jeder Bestimmung spotten. Das Geräusch, das von der Straße heraufdringt, die Sinfonie von den ersten Weckrufern am Morgen bis zu den letzten Nachzüglern der Nacht, die Kurve der Mittagsstunden in Berlin, die der Avantdiner-Zeit in Paris, die Mischungen der Vorläufer und Nachzügler in der Frühe, wie sie Charpentiers »Louise« rhythmisiert, die hundertfachen Variationen des Kommens und Gehens in einem einzigen Mietshause, die verwirrenden Tempi des Lebens, die von der ersten bis zur vierten Etage gleichzeitig ablaufen – alles sind die Teile dieses unendlichen Verses, in dem die Welt ihr Geschäft zu besorgen scheint, stets vom gleichen Refrain ironisiert. Auch hier stilisiert die Masse. Wo die Masse in gleichen Zwecken sich bewegt, wo verschiedene einzelne Rhythmen zusammengefasst werden können, wird der Vers stärker skandiert, und die Zäsuren haben ihre Normalzeit. Über die Länder die Eisenbahnen, über die Meere die Schiffe, in der Stadt die Trams - sie sind Zusammenfassungen von Einzelrhythmen, und ihr Kursbuch ist das Buch ihrer künstlich stilisierten Bewegung, das Produkt einer unendlich schwierigen Kodifizierung des Massenverkehrs. Ästhetisch liegt kein geringerer Wert in diesen Verkehrsrhythmisierungen als in irgendeinem Arbeitsrhythmus. Wenn täglich vom Potsdamer Bahnhof 12 Uhr 55 Minuten der Pariser Schnellzug abgeht, nur an bestimmten Tagen der Orientexpress, alle drei Minuten der Tram und die Hochbahn und alle diese in Bewegung umgesetzten Riesennetze des sich kreuzenden und ablösenden Verkehrs ihren Mechanismus spielen lassen, so ist dies der Arbeitsrhythmus des Massenverkehrs, der ihn stilisiert, um ihn zu fördern, ihn skandiert, um ihn zu bezwingen. Der Einschlag in das feste Gewebe der uniformierten Verkehrsrhythmen ist die millionenfarbige Verschiedenheit des Einzelverkehrs. Ein jeder Fußgänger mit dem Rhythmus seines Naturells oder seines augenblicklichen Geschäftes, ein jeder Privatwagen, das Automobil, das Rad, die Mietsdroschke, die öffentlichen Fuhrwerke, die Lastwagen, alles, was nach dem Stil der Zeit Verkehrsmittel ist, oder was vom Geschmack des Einzelnen dazu gewählt wird, verbindet sich zu diesem unbeschreiblichen Konzert. Wer Rhythmen sehen kann, hat seine Erlebnisse, wenn er von den fernen Eisenbahnsträngen durch Unterführungen über städtisch werdende Chausseen durch Dörfer und Villenorte und Vorstädte bis zu einer Hauptader sich empfindend vorwärts bewegt. Dies Eintauchen in den gewaltigen Mechanismus, dessen einzelne Fäden man eben noch ruhig beobachten konnte, dies Auskriechen aus der kompliziertesten Knotung bis zum ruhig atmenden ersten Dorfe, über Wege, die die Kultur selbst schuf, auf einem Vehikel, das die Selbständigkeit bedingt, das kann dem nachfühlenden Beobachter zu einem Gedicht werden, das er nicht genug wiederholen mag.