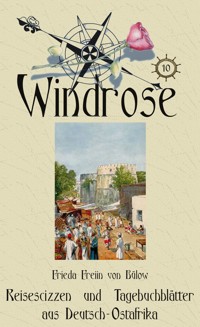
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Windrose
- Sprache: Deutsch
Dies ist eine Reisebeschreibung aus dem Jahr 1887. Ida von Bülow, Österreicherin, war eine Weltreisende, die sich hauptsächlich in Afrika aufhielt. Bald nach diesem Schicksalsschlag gründete Frieda als begeisterte Anhängerin der Kolonialidee den Frauenverein für Krankenpflege in den Kolonien. Als Vorstandsmitglied der Deutsch-Ostafrikanischen Evangelischen Missionsgesellschaft machte sie sich bereits 1886 um die Errichtung eines Missionskrankenhauses in Dunda am Kigan stark.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 164
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Herausgeber
Erik Schreiber
Windrose 10
Reiseerzählungen
Frieda Freiin von Bülow
Reisescizzen und Tagebuchblätter
aus Deutsch-Ostafrika
Saphir im Stahl
Reiserzählungen 10
e-book 203
Frieda Freiin von Bülow - Reisescizzen und Tagebuchblätter aus Deutsch-Ostafrika
Erstveröffentlichung 1889
Erscheinungstermin 01.12.2023
© Saphir im Stahl Verlag
Erik Schreiber
An der Laut 14
64404 Bickenbach
www.saphir-im-stahl.de
Titelbild: Archiv Andromeda
Bearbeitung: Simon Faulhaber
Lektorat Peter Heller
Vertrieb neobook
Herausgeber
Erik Schreiber
Windrose 10
Reiseerzählungen
Frieda Freiin von Bülow
Reisescizzen und Tagebuchblätter
aus Deutsch-Ostafrika
Saphir im Stahl
Meinen
wackeren Freunden und Gefährten
in Ost-Afrika
mit herzlichem Gruße
zugeeignet.
Reise-Erinnerungen.
Der Markusplatz lag in hellem Sonnenglanz, welcher in all dem blanken Marmor und in der Goldmosaik der wunderbaren maurischen Kirche funkelte und blitzte. Auf den Marmorplatten wogte eine festtägliche Menge mit nur in Venedig möglicher Geräuschlosigkeit. Tausende von schönen Augen sahen erwartungsvoll nach der berühmten Uhr hinauf, die heute ihr schönstes Kunststück machte, denn es war am Tage der Himmelfahrt Christi. Wir aber wandten uns, begleitet von einigen Kofferträgern nach der Piazzetta, von wo aus wir eine der langgeschnabelten schwarzen Gondeln bestiegen und nach dem Hafen hinausruderten. Dort lag, weit draußen, der große „Indienfahrer,“ ein Dampfer der „Peninsular and Oriental Steam Navigation Company“, der uns nach Aden bringen sollte. Mein Onkel und seine junge Braut geleiteten uns noch an Deck, doch mußten sie uns bald das letzte Lebewohl sagen, denn die Abfahrtsstunde war gekommen. So lange wir die sich Entfernenden sahen, winkten wir mit den Tüchern. Dann nahm das Rasseln der Ankerkette, das Hin- und Herlaufen dunkelfarbiger Matrosen, die Commandorufe der Schiffsofficiere, der lange, klagende Pfiff und das Schnaufen der in Thätigkeit gesetzten Maschine unsere Aufmerksamkeit gefangen.
Schönes heiteres Wetter und ruhige See begleiteten uns bis Alexandria, wo uns dicht am Schiff bereits der Eisenbahnzug nach Suez erwartete. Wir hatten indessen bis zur Abfahrtszeit noch eine oder zwei Stunden zu warten. Sowie das Schiff still lag, kamen zahlreiche Aegypter an Bord, um uns ihre Dienste anzubieten, oder Waren feil zu halten. Ihr Mienenspiel und ihr gebrochenes Englisch erschienen mir überaus komisch. Einem englischen Oberst, der nach Indien reiste, fiel es ein, Volksreden zu halten. Damit schien er den Geschmack des braunen Auditoriums getroffen zu haben. Sie scharten sich um den Redner, lauschten seinen Worten mit Aufmerksamkeit und waren mit pfiffigen Gegenbemerkungen stets bei der Hand. Der würdige Oberst, ein vornehm und selbstbewußt dreinschauender alter Herr, sagte diesem „süßen Pöbel“ übrigens keine Schmeicheleien. Er schalt sie vielmehr mit einer eines Bußpredigers würdigen Aufrichtigkeit aus wegen ihres Verhaltens gegen die Europäer während des letzten Aufstandes. Der Rede kurzer Sinn war ungefähr: „Ihr miserablen Kerls, schämt Ihr euch nicht, den Europäern das Geld abzunehmen und uns wie Fliegen zu umschwärmen, so lang ihr glaubt, noch etwas aus uns herausziehen zu können, und dann, wenn dieselben Europäer, denen Ihr Euren Lebensunterhalt verdankt, vor Euren Augen bedrängt werden, sie nicht mehr kennen zu wollen! Ihr nichtsnutzige Bande! Hat auch nur einer unter Euch Hand oder Fuß gerührt, um Euren Wohlthätern zu helfen?!“
Der Oberst redete im Tone gerechtester Entrüstung und sparte nicht mit dem „for shame!“ Seine Zuhörer, die von Zeit zu Zeit sehr intelligente Einwände laut werden ließen, lauschten im übrigen mit behaglichem Lächeln. Es war eine Scene, die in ihrer drastischen Komik einerseits, anderseits durch den historischen Ernst, den große Ereignisse wie einen Schatten darüber warfen, Shakespeare'schen Dramen entstiegen schien und zu mancherlei Betrachtungen Veranlassung gab.
Wir fuhren nun 12 Stunden lang per Schnellzug durch die Wüste, gegen deren gelben Sand wir uns vergeblich mittelst blauer Brillen und Tücher zu schützen suchten. In Suez angelangt, wurden wir bei sternenklarer Nacht auf einem Schlepper nach der weit außen liegenden „Malva“ befördert.
Das rothe Meer, in das wir am folgenden Tag gelangten, zeichnet sich, wie bekannt, durch eine Hitze aus, die nur noch von der Temperatur des persischen Meerbusens übertroffen werden soll. Die Herren suchten nachts auf dem Verdeck etwas Schlaf zu finden, die Damen auf der Tafel unter den „Sky lights“. Meine Gefährtin und ich hielten es in der Cabine aus und waren dabei doch die Einzigen, die schlafen konnten. Ich habe auf dieser Reise übrigens die Engländer von der liebenswürdigsten Seite kennen gelernt. Unter den Passagieren befand sich ein Oberst, nicht der Volksredner, der ein und ein halbes Jahr als Gefangener des Königs von Abessynien in Ketten gelegen hatte. Dieser war auch vor Jahren einmal „political agent“ in Zanzibar gewesen, hatte aber die Insel nicht in guter Erinnerung. Er beklagte mich meines Reiseziels halber und riet mir sofort und täglich Chinin zu nehmen. „Zanzibar is a sad place,“ meinte er, „it has such a churchyardy feeling about it.“
Ein anderer Herr, von dem man mir sagte, er sei einer der ersten Rechtsanwälte in Bombay, wurde mir von den Officieren als „a radical man“ bezeichnet. Die Dispute dieses Radikalen mit jenen, die äußerst loyal und conservativ gesinnt waren, amüsierten mich nicht wenig. Mir gegenüber liebte es der Radikale, Parallelen zwischen der deutschen und der englischen Nation zu ziehen und entwickelte dabei Ansichten, die mir bei einem Engländer neu waren. Er beklagte ernstlich, daß seine Landsleute an einem Uebermaß von Nationalgefühl krankten, welches schon mehr in verbohrte Beschränktheit ausgeartet sei. Engländer seien um kein Haar besser als irgend ein anderes Volk, vielmehr die menschlichen Fehler und Vorzüge überall die nämlichen. Ein vernünftiger Mensch müsse Kosmopolit sein, u. s. w.
Eines Abends zeigte mir der Oberst, der den Männern von Alexandria Moral gepredigt hatte, am Sternenhimmel das südliche Kreuz, welches ungefähr in der Mitte des roten Meeres zum ersten mal sichtbar wird. Ich erzählte ihm stolz und freudig, daß dies Kreuz auf der Flagge unserer Ostafrikanischen Kolonie prange. Da sah mich der Brite groß an und brach dann in lautes Lachen aus. Ich frug, warum er lache. „Sie haben Ihre Kolonialflagge ja recht bescheiden gewählt,“ sagte er, und lachte von neuem. Ich erklärte ihm darauf sehr bestimmt, das Thema deutscher Kolonisation würde von nun an nicht mehr zwischen uns berührt werden, da ich Spott über diesen Gegenstand nicht annehmen könne und wolle. Der Oberst ließ es sich sehr angelegen sein, mich zu begütigen, aber ich blieb meinem Vorsatz treu. Im stillen dachte ich: Lacht ihr nur. Wer aber zuletzt lacht, lacht am besten.
Außer den Engländern befand sich ein Pfeifenhändler aus Ostfriesland, der seit Jahren in Indien lebte und naturalisierter Engländer geworden war, sowie der italienische Konsul Zanzibar's, Cavaliere Vincencio Filonardi, an Bord. Mit dem Friesen sprach ich so lange von seiner Heimat, bis er zu meiner Befriedigung den angenommenen Engländer fallen ließ, und die deutsche Eigenart vorkehrte. Er sang uns abends am Clavier deutsche Volkslieder vor und erntete allgemeinen Beifall.
In Aden trennten wir uns von den liebenswürdigen Reisegefährten, die ihren Cours nach Bombay fortsetzten und ließen uns in Begleitung des italienischen Konsuls nach dem Dampfer der British India Line fahren, der auf seiner Route nach Madagaskar Zanzibar anläuft. Leider machte sich das Schiff schon aus einiger Entfernung durch widerlichen Geruch bemerkbar. Diese nach Lamu, Mombassa, Zanzibar und Madagaskar fahrenden Dampfer nehmen für jene Orte in Aden eine große Ladung geräucherten Haifisches an Bord, von dessen üblem Geruch man sich kaum eine Vorstellung machen kann. Trotzdem ist der „papa“ die Lieblingsspeise der Neger, Indier und Araber! Nun freilich, eine Schiffsladung aus Heringen und altem Käse bestehend möchte einen Nichtkenner dieser Delikatessen auch nicht durch ihr Parfüm anlocken. Während wir im Hafen lagen, kamen sieben algerische Mönche an Bord, die in langen, weißwollenen Gewändern, ebensolchen flatternden Mänteln, weiß überzogenen Korkhelmen und Kreuzen auf der Brust höchst malerische Gestalten waren. Wir begaben uns an Land, um uns die jetzt notwendig gewordenen Kork-Sonnenhüte zu kaufen. Der italienische Konsul, Herr Filonardi, bot uns Mangos an, eine beliebte Frucht, die leise nach Terpentin riecht und unter der dicken grünen Schale einen steifen, süßen orangegelben Crême enthält, den man mit dem Theelöffel ausißt. Wir konnten uns noch nicht mit dem Fremdartigen des Geschmacks befreunden.
Als wir uns abends auf unser Schiff zurückbegaben, hatte sich der große Sandplatz am Hafen in einen Schlafsaal verwandelt. Die Bewohner von Aden hatten dort ihre Betten aufgeschlagen, nicht auf der Erde, sondern meist in richtigen Bettstellen und lagen um uns her in guter Ruhe.
Am folgenden Morgen kamen mehrere deutsche Herren an Bord, die bis Aden mit dem Bremer Lloyd gefahren waren und nun in diesem schattenlosen Felsennest auf uns hatten warten müssen. Unter diesen Herren befanden sich der zur Vermessung der geplanten Eisenbahnlinie von der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft ausgesandte Regierungsbaumeister Wolf und sein Adjutant, Herr von Hake, etwas Amerikaner im Äußeren, von Gesinnung aber so deutsch, wie nur diejenigen es werden, die im Ausland unter dem steten zu kurz kommen der Unsrigen zu leiden gehabt haben.
Auch unser Missionar, Herr Pastor Greiner, mit seiner Frau und Nichte kam auf die Mecca und noch ein schwindsüchtig aussehender englischer Missionar. Der Kapitän, ein sehr behaglicher, wohlwollender alter Herr, schüttelte den Kopf über so viel „Propheten“ es waren in der That neun geistliche Herren an Bord, und sagte: „das wird eine stürmische Fahrt werden.“ Als ich es mir mittags schmecken ließ, sagte er halb wehmütig: „Essen Sie nur, Baronesse; morgen werden Sie es nicht mehr können.“
Vorläufig beunruhigte meine Gefährtin und mich der Sturm weit weniger, als die Unsauberkeit dieses Schiffes. Besonders graute uns vor den Kokerutschen, einer etwa zehnfachen vergrößerten Auflage der heimischen Küchenschwaben, die raschelnd überall umherliefen, leider auch scharenweise an den Wänden unserer Kabine. Diese Ungetüme machten uns große Not und wir wurden obendrein noch ob unseres Entsetzens ausgelacht. Indessen zogen sich die Tiere etwas zurück, als wir, den Golf von Aden verlassend, die hohe See erreichten. Zugleich aber, nämlich am Cap Gardafui, kamen wir in den Südwestmonsum. Die Mecca tanzte zwischen Wellenbergen, die das Schiff von allen Seiten ansprangen, weshalb der Kapitän meinte, wir seien in die letzte Wellenbewegung eines Cyclon gekommen. Ich war so krank, daß ich zeitweise sogar die Besinnung verlor und dann glaubte ich mich stets in einer Waldschlucht meiner Thüringer Heimat. Eines Abends zogen mich der Kapitän und der Schiffsarzt fast mit Gewalt auf's Verdeck, wo ich in einen mit Tauen befestigten Schiffsstuhl gelegt wurde. Es bot sich mir ein ganz eigentümlicher Anblick. Rings um das auf und nieder steigende Fahrzeug standen dunkle Wasserberge, die den Horizont dicht vor uns abgrenzten. Sonst war nichts zu sehen. Sturzwellen kamen von allen Seiten über das Verdeck und spülten zahllose Silberfische an Bord, die von dem Kapitän und den Matrosen mit den Händen gefangen wurden zum delikaten Frühstück. Der Kapitän lief mit dick verbundenen Füßen umher. Er war so unvorsichtig gewesen, wegen des auf Deck stehenden Wassers und der Schlüpfrigkeit Stiefel und Strümpfe wegzulassen, aber ehe er sich dessen versah, hatte ihm die Tropensonne arg schmerzende Brandwunden zugezogen. Die Passagiere lagen in kläglichstem Zustand umher, besonders litten die weißen Priester stark durch die Seekrankheit. Am tapfersten hielt sich der Regierungsbaumeister Wolf aufrecht, doch meinte auch dieser, so schlecht sei es ihm in seinem Leben noch nicht ergangen. Einige junge Deutsche (nachmals Angestellte der Deutsch-Ostafrikanischen Gesellschaft), die zweiter Cajüte fuhren, boten übrigens den Unbilden der stürmischen Fahrt mit beneidenswertem Frohsinn Trotz. Ich hörte sie täglich singen und jodeln. Jede Sturzwelle wurde mit ausgelassenem Hurrah begrüßt. Der erste Offizier, der die jungen Leute gelegentlich wegen der positiven Gefahr des Überbordgespültwerdens in die Cabine nötigte, konnte nicht umhin dieser unverwüstlichen Laune Bewunderung zu zollen. „'pon my word“, rief er aus, „I never saw such a jolly set!“
Am zehnten Tag unserer Fahrt langten wir vor Lamu an. Sowie die Schraube zu arbeiten aufhörte, fühlte ich mich frisch und munter, so daß ich mich ungesäumt auf Deck begab. Vom Lande her nahte sich ein Boot unter deutscher Flagge, das indessen des hohen Seegangs wegen nur langsam vorwärts kam. Bald konnten wir auch zwei weißgekleidete Europäer neben den schwarzen Ruderknechten erkennen. Es waren die Herren Gustav Denhardt und Lieutnant Ramsay, welche kamen, um ihre Postsachen zu holen. Sie konnten uns die neuesten Nachrichten von den Freunden in Zanzibar geben und wir mußten ihnen von Berlin erzählen.
Zwei Tage später machten wir noch eine Ruhepause in dem reizenden Hafen von Mombassa, um dann ohne weitere Unterbrechung unserem Ziele zuzusteuern.
Tagebuchblätter.
Zanzibar, den 16. Juni 1887.
Gestern Abend näherte sich unsere Mecca, nachdem sie am Morgen fünf Stunden auf einer Sandbank im Kanal von Pemba festgelegen, endlich der Stadt Zanzibar.
Stundenlang, ehe diese noch sichtbar, standen wir am Rande des Schiffes und sahen durch die Ferngläser nach dem bläulichen Küstenstreifen der Insel. Bald konnten wir Waldungen erkennen und die auf einem Landvorsprung errichtete Signalstange, deren Flagge dem Wächter auf dem Sultansturm unser Nahen frühzeitig ankündigte. Als es dunkelte, leuchtete vor uns das große electrische Licht auf, mit dem der Sultan in mondlosen Nächten seine Umgebung erhellt.
Kurz nach Sonnenuntergang ließ der Kapitän noch außerhalb des Hafens Anker werfen, da ihm das Einlaufen zwischen Korallenriffen und Sandbänken bei Nacht nicht ratsam schien. „The captain believes in safety“, sagten seine minder geduldigen Offiziere lächelnd.
Ich sehnte mich, festes Land unter den Füßen zu fühlen, aber von unseren Deutschen war nichts zu hören und zu sehen. Darum nahm ich es gern an, als Herr Filonardi dem Schiffsarzt, einem Irrländer namens Roß, und mir vorschlug, mit ihm an Land zu fahren, um wenigstens etwas spazieren zu gehn. Die italienische Kolonie, bestehend aus vier Herren, war pünktlich und vollzählig erschienen, um ihren Konsul zu begrüßen. In Gesellschaft dieser lebhaften Romanen ließen wir uns durch den Hafen rudern, wo zahlreiche Lichtchen auf den Schiffen grüßten, während die electrische Flamme auf dem Turm einen breiten Silberstreifen über die dunkle Wasserfläche warf.
Nachdem wir auf nassem Sand und Korallen gelandet, wurden wir durch die Stadt geführt. Die engen, krummen, dunklen und holperigen Gassen entsprachen nicht dem Bild, das die reich illuminierte Häuserreihe am Meer vom Hafen aus geboten. Ich war auch ermattet von der anstrengenden Seefahrt und stolperte jeden Augenblick über Schutt und Gerümpel oder versank bis zum Fußgelenk in irgend eine Vertiefung. Eingefaßt waren die Gassen von hohen, fensterlosen Mauern. Eine Seitenstraße, ebenso schön wie die anderen, wurde uns unter fröhlichem Lachen als „Boulevard des Italiens“ vorgestellt. Wir bogen in dieselbe ein und befanden uns auf einmal in einem von hohen Mauern umgebenen Hof, der in dem matten Licht einiger durch eine halboffene Gallerie schimmernder Lampen ganz romantisch aussah. Unter einem hohen Baum lagen Warenballen aufgeschichtet und eine Steintreppe führte von außen nach dem zweiten Stock des Hauses auf die einem Klosterkreuzgang ähnliche Gallerie. Ich sah mich verwundert um und frug, wo wir wären. Das ist unser Konsulat, sagten die Italiener. Ich forderte Mr. Roß auf, nun mit mir nach dem Schiff zurückzukehren, davon wollte aber der Konsul nichts hören. Ich müsse mich nach dem beschwerlichen Gang zunächst etwas ausruhen, meinte er, er werde uns dann selbst auf die Mecca zurückfahren.
Dr. Roß und ich freuten uns übrigens, bei dieser Gelegenheit gleich ein zanzibaritisches Intérieur kennen zu lernen. Wir stiegen unter Führung der Italiener die steile Treppe hinan und traten von der Gallerie aus in einen hellerleuchteten hohen Raum, dessen Einrichtung buntgewirkte Teppiche und Decken, schwere seidne Vorhänge, große Vasen, indisches Schnitzwerk und bequeme Sessel aus Rohrgeflecht ganz das von europäischem Geschmack durchsetzte orientalische Gepräge trug. Man rückte uns die behaglichsten Sitze zurecht und dann brachte ein schwarzer Diener auf den Wink des Hausherrn Champagnerschalen, in die unser Wirt italienischen Schaumwein goß. Zu meiner besonderen Freude machte ein schöner Bernhardiner, der dem Vicekonsul, Herrn Pietro Ferrari gehörte, seine Aufwartung. Erwähnter Herr, der uns durch den Konsul als Musikfreund und Inhaber einer schönen Stimme verraten wurde, mußte sich auf unsere Bitte an das Piano setzen und uns einige Arien vortragen, was er ungern, dann aber mit echt italienischer Lebhaftigkeit absolvierte. Nach einer auf solche Weise sehr angenehm verflossenen halben Stunde traten wir den Rückweg an. Noch einmal mußten wir beim Rascheln der Kokerutschen an Bord der Mecca übernachten und das sanfte Plätschern der an die Schiffswand schlagenden Dünung sang uns das Schlaflied.
Zanzibar, den 17. Juni 1887.
Gestern Morgen beeilte ich mich an Deck zu kommen, da um unser Schiff her, in starkem Gegensatz zu der gewohnten Stille auf hoher See, ein gewaltiges Lärmen und Treiben herrschte. Wir waren beim ersten Morgengrauen in den Hafen eingelaufen und befanden uns zwischen einer Menge großer Schiffe, Daus und Boote, ziemlich dicht an der Landungstreppe. Stadt und Hafen glitzerten in einer Flut hellen Sonnenlichts. Es war ein Bild, in dem als Farbe ein blendendes Weiß vorherrschte, eine Landschaft wie Wereschagin sie malt. Die weißen algerischen Mönche von Zanzibar kamen angerudert, um ihre Ordensbrüder in Empfang zu nehmen. Auch andere Europäer in weißem Anzug und weiß umhülltem Korkhelm näherten sich. Ich stand in unbehaglicher Empfindung des Alleinseins am Schiffsrand und sah hinunter auf die sich andrängenden Boote mit ihren lärmenden schwarzen, braunen und gelben Insassen, als auf einmal eine mir wohlbekannte Stimme „guten Morgen, Baronin!“ heraufrief. Da bemerkte ich in einem der Boote den Freiherrn von Gravenreuth, der mich mit seinen lustigen blauen Augen ganz so übermütig anlachte wie vormals in Berlin, wenn es galt eine Extratour zu tanzen. Meine trübe Stimmung war verschwunden. Es ist wahr, daß man sich sofort zu Hause fühlt, wo man Gesinnungsgenossen und Freunde findet.
Außer Herrn von Gravenreuth hatte Herr Dr. Peters die mir nur dem Namen nach bekannten Herren Braun und von St. Paul geschickt und das Konsulat seinen Dragoman, Mr. Michalla, der leider kein Wort deutsch spricht. Während sich nun die Herren Braun und von St. Paul der neuangekommenen Beamten und des nach der Duane zu dirigierenden Gepäcks annahmen, fuhren wir mit Herrn von Gravenreuth nach der steinernen Landungstreppe am Schloßplatz, von wo aus wir uns unter des Barons Führung nach dem einzigen anständigen Hôtel der Stadt begaben, dem am Meere gelegenen Hôtel d'Afrique Centrale.





























