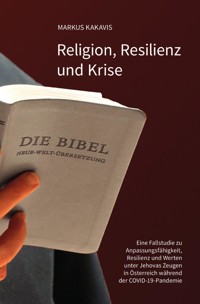
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Die vorliegende österreichweite Studie untersucht das Zusammenspiel von "Wertesystemen, Anpassungsfähigkeit und Resilienz in religiösen Gemeinschaften" in Zeiten der Veränderung auf der Basis eines spezifischen Wertesystems anhand einer "Fallstudie über Jehovas Zeugen in Österreich während der COVID-19 Pandemie" - so auch der Titel der zugrundeliegenden wissenschaftlichen Arbeit des Autors. Das Buch widmet sich dem sozioökonomischen und religiösen Kontext der frühen 2020er Jahre im Lichte der pandemiebedingten Einschränkungen und digitaler Transformation. Es beinhaltet eine qualitative Literaturrecherche zu Resilienz, Religiosität und zugrundeliegenden Werten und Normen der Religionsgemeinschaft. Es präsentiert und analysiert die Umfrageergebnisse, um diese im Kontext anderer Studien - etwa dem Religionsmonitor 2023 - einzuordnen und dabei einen Einblick in die religiösen Praxis der Religionsgesellschaft zu ermöglichen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 148
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Religion, Resilienz und Krise
Eine Fallstudie zu Anpassungsfähigkeit, Resilienz und Werten unter Jehovas Zeugen in Österreich während der COVID-19-Pandemie
Erstveröffentlichung: 30. November 2023
Abstract
Diese bundesweite Studie untersucht das Zusammenspiel von Anpassungsfähigkeit und Veränderung, einem dedizierten Wertesystem und Resilienz innerhalb der Zeugen Jehovas in Österreich während der COVID-19 Pandemie. Die Arbeit stellt zunächst das Forschungsproblem dar und adressiert Ziele und Methodik. Sie widmet sich dem sozioökonomischen und religiösen Kontext der frühen 2020er Jahre im Lichte der pandemiebedingten Einschränkungen und digitaler Transformation.
Der theoretische Teil umfasst eine qualitative Literaturrecherche zu Resilienz, Religiosität und zugrundeliegenden Werten und Normen der Gemeinschaft. Der empirische Abschnitt skizziert das Forschungsdesign, die Strategie, sowie die Analyse der Umfrageergebnisse, die einen Einblick in die religiösen Praktiken der Religionsgesellschaft bieten.
Der Forschungszweck besteht darin, durch andere Studien erhobenes bestehendes Datenmaterial zu erweitern und ergänzen, indem Jehovas Zeugen als Gruppe einbezogen werden. Der Schwerpunkt liegt auf ihren Kernwerten, Verhaltensweisen und insbesondere deren Veränderung während der Corona-Pandemie im Vergleich zu anderen Gruppen. Die Untersuchung prüft auch die Annahme, dass religiösere Menschen über eine höhere Widerstandskraft und Krisenbewältigungsfähigkeit verfügen und stellt fest, dass dieser vermutete Zusammenhang für Jehovas Zeugen in Österreich nicht nachweisbar ist.
Die vorliegende Studie kommt zu dem Schluss, dass die Gläubigen im Vergleich zu den bisher untersuchten Religionsorganisationen ein überdurchschnittlich hohes Gottvertrauen und persönliches Engagement in Verbindung mit ihrer Glaubensausübung aufweisen, die individuelle Resilienz jedoch weder mit der individuellen Ausprägung an Religiosität noch mit einzelnen religiösen Werten korreliert. Die Schlussfolgerung hebt Schlüsselergebnisse hervor, beantwortet die Forschungsfrage und schlägt künftige Ansätze zur weiteren Untersuchung vor.
Inhaltsverzeichnis
1Einleitung
1.1Problemstellung
1.2Ziel der Arbeit
1.3Forschungsfeld
1.4Forschungsfragen
1.5Methodik
1.6Aufbau der Arbeit
2Ausgangssituation
2.1Sozioökonomisches Umfeld im Jahr 2020
2.1.1Leben in einem BANI- und VUCA-Umfeld
2.1.2Digitale Transformation
2.2Religiöses Umfeld zu Beginn der 2020er Jahre
2.3Einfluss der COVID Pandemie
3Theoretischer Teil
3.1Wissenschaftliche Konzepte und Theorien
3.1.1Definition Resilienz
3.1.2Definition Religiosität
3.1.3Definition Werte & Normen
3.2Aktueller Stand der Forschung zu Religiosität und Resilienz
3.3Wertesystem von Jehovas Zeugen
3.3.1Historische Entwicklung und Einflüsse
3.3.1.1Weltweite Sicht
3.3.1.2Österreichische Perspektive
3.3.2Grundverständnis: Theologischer Rahmen
3.3.3Relevante christliche Werte
3.3.3.1Ausdauer / Ausharren
3.3.3.2Dankbarkeit
3.3.3.3Demut
3.3.3.4Ehrlichkeit
3.3.3.5Empathie
3.3.3.6Evangelisieren
3.3.3.7Fleiß
3.3.3.8Freigebigkeit / Hilfsbereitschaft
3.3.3.9Freundlichkeit
3.3.3.10Friedsamkeit / Gewaltlosigkeit
3.3.3.11Integrität / Selbstreflexion / Treue
3.3.3.12Mut
3.3.3.13Nachgiebigkeit
3.3.3.14Nächstenliebe
3.3.3.15Prinzipientreue (Grundsatztreue)
3.3.3.16Respekt
3.3.3.17Toleranz
3.3.3.18Unparteilichkeit
3.3.3.19Vergebung / Versöhnung
3.3.3.20Wertschätzung
4Empirischer Teil
4.1Forschungsdesign
4.2Forschungsstrategie und -methode
4.2.1Stichprobe
4.2.2Umfrageinstrument, Datenerhebung und Demografie
4.2.3Datenanalyse
4.2.4Ethik und Datenschutz
4.2.5Schlussfolgerung
4.3Auswertung der Umfrageergebnisse
4.3.1Gliederung der Erhebung
4.3.2Eintritt in die Religionsgemeinschaft und Zugehörigkeit
4.3.3Jehovas Zeugen und Gottesdienste
4.3.4Jehovas Zeugen und Evangelisation
4.3.5Jehovas Zeugen und die Bibel
4.4Interpretation der Umfrageergebnisse
4.4.1Einordnung von Jehovas Zeugen im direkten Vergleich zu anderen Bevölkerungsgruppen
4.4.1.1Familiäres Umfeld
4.4.1.2Facetten der Religiosität: Öffentliche und private Praxis
4.4.1.3Die Rolle verschiedener Gesellschaftsbereiche bei der Pandemiebewältigung
4.4.1.4Positive und negative Formen der Krisenbewältigung
4.4.2Interdependenz Religiosität und Resilienz unter Jehovas Zeugen
4.4.3Einflussfaktor „Religiöse Werte und Normen“
4.4.4Individuelle Einflussfaktoren
4.4.5Limitationen
5Fazit
5.1Hauptergebnisse und deren Bedeutung
5.2Rückblick auf und Beantwortung der Forschungsfrage
5.3Beantwortung der Teilfragen
5.4Betrachtung der Grundaussagen
5.5Kritische Reflexion, Ausblick und Handlungsempfehlung
6Glossar
7Abkürzungsverzeichnis
8Anhang: Kommunikation durch Messaging App Stories
9Literaturverzeichnis
In einer sich stetig wandelnden Welt, geprägt von sozialen und technologischen Veränderungen, ist die Resilienz von religiösen Gemeinschaften und ihren Mitgliedern in einer zusehends säkularisierten Gesellschaft von großer Relevanz. Insbesondere während der globalen COVID-19 Pandemie sahen sich religiöse Gruppen vor neue Herausforderungen gestellt, die eine Anpassung an die veränderten Umstände erforderten. Diese Arbeit widmet sich dem Zusammenhang zwischen Religiosität und Resilienz im Kontext religiöser Gemeinschaften und nimmt dabei Jehovas Zeugen in Österreich als Fallstudie in den Fokus.
Die folgenden Unterkapiteln bilden eine Einführung, in der die Problemstellung erörtert, das Ziel der Arbeit festgelegt, das Forschungsfeld definiert, die Forschungsfragen formuliert, die angewandte Methodik dargelegt und schließlich der Aufbau der Arbeit skizziert wird. Anhand einer Fallstudie soll die Arbeit einen spezifischen und konkreten Einblick in die Thematik „Wertesysteme, Anpassungsfähigkeit und Resilienz in religiösen Gemeinschaften“ am Beispiel von Jehovas Zeugen in Österreich im Kontext der Pandemie in einer Zeit digitaler Transformation bieten.
Die COVID-19 Pandemie hat wie kaum ein anderes Ereignis in den vergangenen Jahren zu erheblichen sozialen, ökonomischen und psychologischen Auswirkungen geführt – einschließlich Lockdowns, Einschränkungen des öffentlichen Lebens, wirtschaftlicher Unsicherheit, sozialer Isolation, Angstzuständen und einer verstärkten digitalen Transformation (vgl. Strauß et al, 2021).
In einer unsicheren und schwer fassbaren Welt beginnt der Mensch zu erkennen, dass individuelle Wahrnehmung mehr über uns auszusagen vermag als Realität, welche aufgrund von ungefilterter Informationsweitergabe immer schwerer erkennbar ist. Kraaijenbrink (2022) argumentiert daher, es wäre an der Zeit, die Illusionen von Stärke, Kontrolle, Vorhersehbarkeit und Wissen loszulassen.
Die Krise wird nolens volens zur neuen Normalität. Wenngleich El-Menouar (2023 [2]) attestiert, dass nur eine Minderheit in Deutschland Orientierung durch Religion findet, tritt die Sinnfrage in vielen Bevölkerungsschichten länderübergreifend in den Vordergrund. Dennoch kann Religion als soziale Ressource Begegnungsräume für Krisenbewältigung schaffen (vgl. El-Menouar, 2023 [1]).
Ein grundlegendes Wertesystem, das insbesondere im Kontext des Glaubens, der damit einhergehenden Geisteshaltung oder Weltanschauung zur Förderung von Resilienz beitragen kann, basiert auf Eigenschaften und Aspekten, welche die Überzeugung eines Menschen ausmachen.
Dazu zählt der Glaube an eine höhere Macht oder spirituelle Kraft, die Unterstützung, Trost und Hoffnung spendet. Optimismus ermutigt dazu, Herausforderungen zu überwinden und positive Zukunftsperspektiven zu entwickeln. Das Gebet oder die Meditation sind häufig angewendete Praktiken, die emotionale Stabilität, innere Ruhe und spirituelle Ausrichtung fördern können (vgl. Mauritz, o.D.; Bayern 2, 2023).
Dankbarkeit als Haltung, die dazu beiträgt, positive Aspekte des Lebens zu erkennen und sich selbst in schwierigen Zeiten auf das Gute zu konzentrieren, kann ebenso hilfreich sein wie Gemeinschaft und ein Gefühl der Zusammengehörigkeit, der sozialen Unterstützung, der emotionale Verbundenheit und gegenseitiger Unterstützung in Krisen (vgl. Mauritz, 2017).
Ernst (1994) sieht eine Gefahr darin, dass die Aufmerksamkeit des Menschen sich nur noch um sich selbst dreht und sich an stark egoistisch geprägten Werten orientiert (vgl. Ohm, 1996, S.147).
Nächstenliebe und Hilfsbereitschaft sind zentrale christliche Werte, ebenso wie Vergebung und Versöhnung, welche die Fähigkeit fördern können, Konflikte zu bewältigen und negative Emotionen loszulassen (vgl. WTBTS, 2009; vgl. Kap. 3.3.3).
Selbstreflexion und Selbsterkenntnis, um die eigenen Stärken und Schwächen zu erkennen, können persönliches Wachstum fördern. Nachgiebigkeit, Akzeptanz und Demut auf der anderen Seite haben das Potential dazu, Menschen zur Anpassung an neue Umstände zu leiten und Veränderungen anzunehmen. Eine höhere Bedeutung im Geschehen zu sehen, einen Sinn darin zu finden und eine übergeordnete Perspektive auf das Leben und seine Herausforderungen zu entwickeln, sind valide Bewältigungsstrategien (vgl. Mauritz, o.D.; Schiller, 2023).
Religiosität wird wiederholt als Ressource von Resilienz identifiziert, die einen Rahmen für Sinnstiftung, eine weltanschauliche Basis und Vertrauen in göttliche Vorsehung bietet. Religiöse Menschen zeigen eine gesteigerte Dankbarkeit und praktizieren Gebet, Studium und Achtsamkeit, was sich positiv auf ihre psychische Gesundheit auswirkt und ihre negative Affektivität verringert. Diese Erkenntnisse sind für die Forschung im Bereich der Resilienz und des psychologischen Wohlbefindens in religiösen Gemeinschaften relevant und könnten auch therapeutische Anwendungen beeinflussen (vgl. Deeg et al, 2023; Sarid et al, 2023; Rosmarin & Koenig, 2020; Hackney & Sanders, 2003)
Werte können individuell und im Kontext einer religiösen Gemeinschaft eine Rolle dabei spielen, Veränderung, Widrigkeiten und Herausforderungen zu begegnen und die eigene Widerstandskraft zu erhöhen. Dabei spielen im Organisationskontext interne Strukturen und Kommunikation in einer identitätsbildenden Funktion eine Rolle, ebenso wie die durch Vorbehalte gekennzeichnete Wahrnehmung durch Medien und die Allgemeinheit (vgl. Knox, 2018).
Die wissenschaftliche Literatur über die soziale, kulturelle und politische Entwicklung von Jehovas Zeugen ist begrenzt, abgesehen von einigen Studien über die Verfolgung von Mitgliedern unter den Regimen des Nationalsozialismus und des Kommunismus sowie über ihre rechtlichen Auseinandersetzungen insbesondere in Nordamerika im 20. Jahrhundert (vgl. Rota, 2023; Besier & Stoklosa, 2018; Chryssides, 2016; Holden, 2002).
Im Hinblick auf Kommunikation, Organisations- und Wertestruktur ist die österreichische Religionsgesellschaft im Vergleich zur internationalen Glaubensgemeinschaft von Jehovas Zeugen1 kohärent aufgestellt. Mitgliedschaft ist nicht vererbbar, sondern freiwillig. Sie wird erst durch die ausdrückliche Entscheidung der betreffenden Person in Folge eines Studiums der Lehre und Aufnahme in die Gemeinschaft nach Erkundung des freien Willens zur Taufe begründet (vgl. BMF, 2023; Reiss, 2022; Kern, 2014).
Diese wissenschaftliche Arbeit dient als einführender Überblick zum Themenbereich Religiosität und Resilienz in Zeiten von Pandemien und anderen disruptiven Ereignissen am konkreten Beispiel einer in Österreich aktiven Glaubensgemeinschaft. Sie zielt darauf ab, erste Erkenntnisse und Ansatzpunkte anhand einer Fallstudie über Jehovas Zeugen zu präsentieren, die als Grundlage für zukünftige Forschung und vertiefende Untersuchungen dienen kann.
Ziel der Arbeit ist es aufzuzeigen, ob und wie religiöse Normen, individuell gelebte Werte und Glaubenspraxis mit Resilienz zusammenhängen und welche besonders zur Stärkung selbiger beitragen. Dies soll anhand von zwanzig christlichen Werten am Beispiel von Jehovas Zeugen in Österreich untersucht werden.
Es gilt, Indikatoren – etwa Fluktuation, Teilnahme an gottesdienstlichen Aktivitäten, persönliches Engagement, persönliche Priorisierung förderlicher Eigenschaften und Verhaltensmuster – zu identifizieren, die verwendet werden können, um Religiosität im Hinblick auf Resilienz der einzelnen Mitglieder abbilden zu können sowie die Ergebnisse der Erhebung mit rezenten Forschungsergebnissen zu vergleichen und diese um die Gruppe von Jehovas Zeugen zu erweitern.
Die Ergebnisse der Analysen des Religionsmonitors 2023 der Bertelsmann Stiftung in Deutschland (Hillenbrand & Pollack, 2023; El-Menouar, 2023) sowie der Studien von Edara et al (2021) unter Lehrenden auf den Philippinen, Sarid et al (2023) unter religiösen Gruppen in Israel, das konzeptionelle Modell mit empirischer Erhebung unter Mitgliedern der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage2 von Cornwall et al (1986) sowie die Arbeit von Huber & Huber (2012) zur Skalierung von individueller Religiosität bieten einen validen Ausgangspunkt für die Gestaltung der empirischen Erhebung zur Klassifizierung und Evaluation von Aspekten der Krisenbewältigung unter Jehovas Zeugen in Österreich.
Nicht Ziele der Arbeit sind ein sozialpolitischer oder theologischer Diskurs zur Glaubensgemeinschaft oder Religionen im Allgemeinen, eine Bewertung der politischen Maßnahmen während der Pandemie vorzunehmen oder gesundheitspolitische Erwägungen zu bewerten.
Wie bereits dem Titel zu entnehmen ist und aus den einleitenden Erläuterungen zu Problemstellung und Ziel der Arbeit hervorgeht, versteht sich diese wissenschaftliche Studie als Erhebung an der Schnittstelle unterschiedlicher Disziplinen, insbesondere der Religionswissenschaften, der Psychologie sowie der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften.
Die Fallstudie berührt unterschiedliche Forschungsfelder. Aspekte wie digitale Transformation, Veränderungsmanagement und Kommunikation sind schwerpunktmäßig im wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Bereich verankert (vgl. Mattenberger et al, 2023; Hrynchak & Motuzka, 2023; Kraaijenbrink, 2021).
Die Soziologie der Religion beleuchtet die soziologischen Aspekte von religiösen Gemeinschaften, einschließlich ihrer Organisationsstruktur, ihrer internen Kommunikation und ihrer Beziehung zur Gesellschaft und ist daher primär dem sozialwissenschaftlichen Bereich zuzuordnen. Der Umgang mit Veränderung sowie Anpassungsverhalten und Krisenbewältigung sind ebenfalls grundlegend dieser Disziplin zuzurechnen (vgl. Moser & Häring, 2023; Wike et al, 2022; Schauer, 2014; JZÖ, 2011).
Die Betrachtung der religiösen Überzeugung und der Ausprägung von individueller Religiosität ist im kulturellen und sozialen Kontext religionsanthropologisch im weiteren Feld der Religionswissenschaft anzusiedeln. Diese versteht sich als kulturwissenschaftlich-anthropologische Disziplin, deren Ziel es ist, „aus einer methodischen Distanz heraus die Vielfalt der Religionen und die in ihr auftauchenden Phänomene historisch-kritisch und empirisch-deskriptiv zu erforschen. Aufgrund dessen, dass die Gegenwart in jüngerer Zeit verstärkt in den Fokus der Forschung geraten ist, bedient sie sich mit quantitativen und qualitativen Analysen auch sehr stark sozialwissenschaftlicher Methoden… [Sie vermittelt] Orientierungshilfen zur Einschätzung von Ereignissen und Phänomenen ... [und] fungiert von daher als Schnittstelle zu andren [sic!] nicht-theologischen Wissenschaften.“ (Universität Wien, 2023; vgl. Lehmann & Reiss, 2022; Grünschloß, 2021; Brabenec, 2020; Besier & Stoklasa, 2018; Malle, 2018; Kern, 2014).
Die Forschung auf dem Gebiet der Psychologie der Religionen kann den Zusammenhang von Resilienz und Wohlbefinden mit persönlichen Überzeugungen, spirituellen Praktiken, einem Wertesystem und dem Intensitätsgrad der Ausübung beleuchten (vgl. Batara et al, 2016; Baumeister & Leary, 1995; Ernst, 1994).
Die Verhaltenspsychologie gibt Aufschluss über die Interdependenz zwischen psychosozialen Faktoren, persönlicher Überzeugung, Spiritualität und dem Verhalten in Krisen. Als noch relativ junger Wissenschaftszweig befasst sich die Positive Psychologie mit der Analyse jener Faktoren, die zur Förderung positiver Entwicklung und erfolgreicher Bewältigung beitragen. Die Erforschung der Resilienz religiöser Gemeinschaften wie Jehovas Zeugen in Österreich im Kontext der COVID-19-Pandemie geht auf deren Fähigkeit, Herausforderungen zu bewältigen und sich an veränderte Umstände anzupassen, ein (vgl. Schwalm et al, 2021; Strauß et al, 2021; Aten et al, 2019; Rolfe, 2019; Batara et al, 2016; Barz, 1995).
Studien zu Teilaspekten der Wechselbeziehung zwischen Religiosität und Resilienz sowie weiterer Faktoren wie Zufriedenheit, Optimismus, subjektivem Wohlbefinden oder sozialem Verhalten wurden wiederholt verfasst und publiziert. Diese umfassen in der Regel eine beruflich, demografisch oder geografisch abgegrenzte Gruppe (vgl Hillenbrand et al, 2023; Edara et al, 2021; Schwalm et al, 2021; Manning & Miles, 2017). Studien zum gegenständlichen Thema im Kontext der Pandemie oder auch der digitalen Transformation insbesondere im Zusammenhang mit Jehovas Zeugen hingegen sind rar und für Österreich bisher noch nicht verfügbar (vgl. Rota, 2023).
Diese Arbeit versteht sich daher als empirische Studie mit sozialwissenschaftlichem Schwerpunkt im Kontext der Geistes- und Religionswissenschaften. Sie orientiert sich dabei an relevanten und anwendbaren Konzepten aus der Psychologie und berücksichtigt dabei Aspekte aus den Bereichen Medizin und Ethik. Sie erweitert das bisherige Forschungsfeld im Kontext von Religiosität und Spiritualität um die Gruppe von Jehovas Zeugen
Die Ergebnisse der Meta-Analyse von Schwalm et al (2021) deuten auf eine – wenn auch moderate – positive Korrelation zwischen Spiritualität/Religiosität und Resilienz hin. Im konkreten Fall von Jehovas Zeugen in Österreich und deren Erfahrungen während der Pandemie soll diese Arbeit dazu beitragen herauszufinden, ob und wie deren spirituelle und religiöse Überzeugungen zur Bewältigung der Herausforderungen der Krise beigetragen haben. Die nachstehenden Formulierungen, insbesondere die Hypothesen zur Forschungsfrage, stützen sich auf die publizierten Ergebnisse vorangegangener Studien. Es wird davon ausgegangen, dass diese Ergebnisse auch im spezifischen Fallbeispiel reflektiert werden können.
Forschungsfrage:
Gibt es einen Zusammenhang zwischen spezifischen religiösen Werten, Praktiken und Ritualen von Jehovas Zeugen in Österreich und Resilienz in Zeiten der Krise?
Hypothese 1:
Religiöse Werte und Normen korrelieren – auch unter Jehovas Zeugen – positiv mit der Resilienz von Glaubensgemeinschaften und deren Mitgliedern während Zeiten von Pandemien oder anderen disruptiven Ereignissen und Rahmenbedingungen.
Teilfragen:
Hypothese 2:
Der individuelle Grad der Religiosität ist mit der Resilienz der Mitglieder von Jehovas Zeugen in Österreich korreliert.
Teilfragen:
In Verbindung mit der oben angeführten Forschungsfrage und den damit verbundenen Hypothesen werden folgende zu verifizierende Grundaussagen zur Untersuchung in Betracht gezogen, die aus einer anfänglichen qualitativen Analyse der verfügbaren Quellen abgeleitet wurden und teils durch schriftliche Quellenanalyse, teils durch empirische Erhebung oder eine Kombination beider Erhebungsmethoden zu beantworten sind (vgl. WTBTS, 2023).
A-1. Jehovas Zeugen als Religionsgesellschaft legen einen starken Fokus auf Werte wie Regelmäßigkeit in der Glaubensausübung, Evangelisation, Gemeinschaft und Dienst am Nächsten, die das Fundament ihrer Resilienz bilden. (Wie) Haben sich diese im Zuge der Pandemie verändert?
A-2. Die Glaubensgrundsätze der Religionsgemeinschaft sind statisch und unbeeinflusst von Umfeld und Veränderung.
A-3. Die Wertorientierung von Jehovas Zeugen trägt dazu bei, dass sie Veränderungen erfolgreich bewältigen, da sie auf ihren fundamentalen Glaubenswerten aufbauen und daraus Kraft schöpfen.
A-4. Der Grad an Religiosität variiert innerhalb der Glaubensgemeinschaft.
B-1. Die verstärkte Nutzung digitaler Technologien und virtueller Plattformen hat die Resilienz von Jehovas Zeugen in Österreich während der COVID-19-Pandemie erhöht, indem sie Mitgliedern ermöglicht hat, ihre Gemeinschaftsbindungen sowie die Ausübung religiöser Praktiken aufrechtzuerhalten.
B-2. Die digitale Transformation hat es Jehovas Zeugen ermöglicht, ihre Botschaft und ihre religiösen Werte effektiver nach außen zu kommunizieren und eine größere Reichweite zu erzielen, was zu einer gesteigerten Resonanz und Anziehungskraft auf neue Mitglieder geführt hat. (Wie) Wirkt sich dies auf die Mitgliederzahlen aus?
Richter (2021, S. 9ff) konstatiert, dass Interdisziplinarität zur Erforschung von Interdependenz zwischen Glauben, Spiritualität, Religion einerseits und Resilienz andererseits wesentlich ist und sich unter anderem zwischen Theologie, Philosophie, Moralpsychologie und Psychosomatik bewegt. Hierbei stößt die Wissenschaft an die Grenzen des Messbaren, weshalb standardisierte Messinstrumente, etwa Fragebogenskalen, insbesondere für klar „definierte Fragestellungen anhand valider Definitionen … auf operationalisierbare Phänomene“ bezogen sein sollen und folglich „aus methodischen Gründen sehr präzise und daher vergleichsweise eng gefasst sein müssen.“ Eine Anzahl Parameter wie Mitgliederzahlen oder persönliche Überzeugungen sind quantitativ messbar (vgl. Hackney & Sanders, 2003).
Huber und Huber (2012) entwickelten eine Skala zur Messung von Religiosität (Centrality of Religiosity Scale, CRS) mit dem Ziel, die subjektiv empfundene individuelle Wichtigkeit religiöser Bedeutungen in der Persönlichkeit zu erfassen. Diese Skala diente bereits mehrfach als Basis für Studien in Soziologie und Psychologie der Religion und Religionswissenschaften in mehreren Ländern. Die Skala misst die allgemeine Intensität der fünf theoretisch definierten Kernbereiche der Religiosität: öffentliche Praxis, private Praxis, religiöse Erfahrung, Ideologie und die intellektuelle Dimension zur Repräsentierung des religiösen Lebens eines Individuums.
Auch Hillenbrand und Pollack (2023), El-Menouar (2023) oder Richter (2021) bieten eine Basis zu Kategorisierung und Setup einer empirischen Erhebung in diesem Themenumfeld. Eine Anlehnung an bereits erprobte Fragemuster erleichtert das Vergleichen, Interpretieren und Erweitern der Ergebnisse in Relation zu dem bisherigen Stand der Forschung.





























