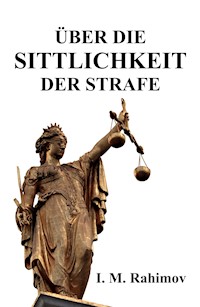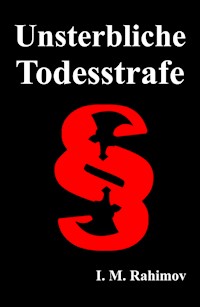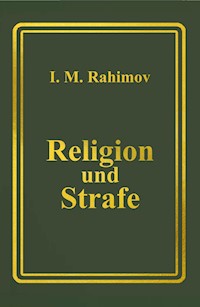
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Diese Monographie beleuchtet den Themenkomplex »Verbrechen und Bestrafung« im Zusammenhang mit Religion. Der Autor untersucht die verschiedenen Ansätze und Ansichten der prominentesten Vertreter der Weltreligionen zum Problem der Bestrafung. Das Buch ist für Studenten, Doktoranden und Lehrer der Rechtswissenschaften sowie für Philosophen, religiöse Führer und alle, die sich für die Problematik der Bestrafung interessieren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 405
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Juriditscheskij Zentr – Akademija
I. M. Rahimov
RELIGION UND STRAFE
UDK 343.2; 343.9
BBK 67.51
R50
I. M. Rahimov
Religion und Strafe. Vorwort von Prof. Dr. Dr. jur. A. I. Korobejev. Sankt Petersburg: Verlag „Juriditscheskij Zentr – Akademija“, 2020. – 217 S.
ISBN 978-5-94201-000-0
Verlag und Druck:
tredition GmbH
Halenreie 40-44
22359 Hamburg
978-3-347-33273-7 (Paperback)
978-3-347-33274-4 (Hardcover)
978-3-347-33275-1 (e-Book)
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar
Inhalt
VORWORT
EINFÜHRUNG
Religion
Strafe
Kapitel I
Allgemeine Grundsätze der Strafe Gottes in heiligen Schriften
§ 1. Biblische Geschichte der Strafenherkunft
§ 2. Göttlicher Ursprung des Bestrafungsrechts
§ 3. Die Gründe für die Strafe Gottes
§ 4. Das Wesen, Ziele und Arten der Strafe Gottes
Kapitel II
JUDAISMUS (Altes Testament oder Hebräische Bibel): „… Auge für Auge, Zahn für Zahn …“ Vergeltungsgesetz
§ 1. Bedeutung des Dekalogs und des Alten Testaments bei der Evolution der Vorstellung über die Strafe als Institution
§ 2. Das Wesen der Strafe laut dem Alten Testament
Kapitel III
CHRISTENTUM (Lehre von Jesus Christus) … dem Bösen nicht widerstehen…“ Das Gesetz von Glückseligkeit und Liebe
§ 1. «Ich aber sage euch: Leistet dem, der euch etwas Böses antut, keinen Widerstand.»
§ 2. Die Lehre Jesu als sittliche Grundlage für die Bestrafung
Kapitel IV
ISLAM (KORAN). Allahs Goldene Regel: widerfahrende Gerechtigkeit
§ 1. Bestimmung des Heiligen Korans und die ersten Anfänge der Institution Strafe
§ 2. Islam und die Evolution der Vorstellung über die Strafe als Institution in der muslimischen Welt
§ 3. Über die Verbrechen und Strafen laut dem Koran
Kapitel V
STRAFEN im HINDUISMUS und BUDDHISMUS
§ 1. Hinduismus: Karma-Gesetz – Sündentilgung und Errettung
§ 2. Buddhismus: das Verbrechen ist eine Krankheit und die Lehre des Buddha eine Medizin, die die Strafe ersetzt….
VORWORT
Bevor ich mit der essentiellen Analyse des neuen Werkes von Professor I.M. Rahimov beginne, ist es wichtig darauf hinzuweisen, dass dies der abschließende Band einer Pentalogie sei, die der Untersuchung des Phänomens „Verbrechen und Strafe“ gewidmet ist1. Deshalb sollte man die vorliegende Monographie im Kontext von vier Abhandlungen betrachten, die ihr vorangegangen sind.
Die Begriffe „Verbrechen“ und „Strafe“ gehören zusammen. Das eine kann ohne das andere nicht existieren. Dasselbe lässt sich auch über das Strafrecht insgesamt sagen: ohne das „Verbrechen“ wäre das Kriminalrecht gegenstandslos und ohne die „Strafe“ Das strafrechtliche Verbot einer für die Gesellschaft gefährlichen Tat setzt voraus, das diese nicht nur als kriminell, sondern auch als strafbar gilt. Daraus ergibt sich, dass unter den grundlegenden, systemrelevanten Kategorien der Strafrechts-Theorie nach der Institution Verbrechen an zweiter Stelle die gleichwertige Institution Strafe genannt wird.
Bis dato wurde eine Vielzahl verschiedenster Lehren über das Verbrechen in Umlauf gesetzt. Noch zahlreicher sind jedoch diverse Bestrafungs-Theorien. Das ist leicht zu erklären: die Vertreter des Menschengeschlechts haben doch immer versucht, mittels der Strafe das soziale Übel „Verbrechen“ einzudämmen, auszumerzen und zu vernichten.
Aus der Geschichte ist uns wohlbekannt, dass zu Beginn der Menschheitsentwicklung ausschließlich Vergeltung und Gotteslohn, d.h. die Ahndung in Reinform bevorzugt angewendet wurden. Später verlagerte sich der Akzent auf ein anderes Mittel: die Unabwendbarkeit der Haftung gemäß dem geflügelten Wort „Die Wirksamkeit der Strafe ist nicht durch deren Härte, sondern durch deren Unabwendbarkeit bedingt“. Aber auch dieser Weg brachte nicht die erwarteten Ergebnisse. Neuerdings wurden etliche neue Maßregeln vorgeschlagen. Dazu gehören die empfohlene Erweiterung der sozialrechtlichen Kontrolle über das Verhalten der Bevölkerung (W.W. Lunejev), die vorgeschlagene Nutzung der Restitutions-Rechtsprechung als eine Art Alternative zum herkömmlichen Modell beim Kampf gegen die Schmälerung von Privatinteressen (Standpunkt des 12. UN-Kongresses für Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege) und sogar der Vorschlag, jene Rechte und Interessen von Bürgern, die durch das Verbrechen verletzt wurden, auf dem schnellsten Wege zu gewährleisten (A.I. Boiko).
Manche romantisch veranlagte Rechtswissenschaftler – obwohl sie dessen bewusst sind, dass „die Verhängung der Strafe in Übereinstimmung mit den geltenden Rechtsvorschriften das Zufügen von Schmerz bedeute und gerade dafür bestimmt sei –, behaupten trotzdem: „Falls Schmerz zugefügt werden muss, dann nicht zwecks Manipulation, sondern in solchen sozialen Formen, zu denen die Menschen greifen, wenn sie tiefe Trauer empfinden. Dies könnte eine Situation herbeiführen, bei der die Strafe für ein Verbrechen verschwinden würde. Sobald das passiert, verschwinden auch die Haupteigenschaften des Staates. Auch wenn das nur eine Idealvorstellung sei, lohnt es sich, so eine Situation als das Reich der Menschengüte und Menschlichkeit zu vergegenwärtigen und im Auge zu behalten: ein unerreichbares aber erstrebenswertes Ziel“2.
In Russland gilt dem Thema Strafe traditionsgemäß ein großes Augenmerk, und zwar auf verschiedenen Ebenen. Angefangen bei der Wahrnehmung der genannten Probleme im alltäglichen Rechtsbewusstsein („Gegen Bettelsack und Gefängnis ist keiner gefeit.“ „Verurteilt nicht, damit ihr nicht verurteilt werdet.“ „Mitgefangen, mitgehangen!“ „Gott bestraft gerade denjenigen, den er liebt.“) bis zu deren philosophischen Erfassung. Auch die Suche nach dem tieferen Sinn einer Kriminalstrafe kann auf eine lange Geschichte zurückblicken. Das Leben und Schaffen zahlreicher herausragender russischer und ausländischer Kriminalwissenschaftler waren der Erforschung dieser Fragestellungen gewidmet. Auch die Gesetzgeber sind nicht abseits geblieben und haben nach Kräften und Möglichkeiten an der Kriminalstrafen-Leiter gebastelt.
Als Ergebnis jahrhundertelanger gemeinsamer Bemühungen einer ganzen Plejade von Wissenschaftlern und Praktikern wurde das geschaffen, was wir heute „Bestrafungslehre im Kriminalrecht“ nennen.
Kann aber etwa gesagt werden, das Ziel sei erreicht, die Arbeit komplett abgeschlossen und die genannte Lehre wahr geworden? Natürlich nicht. Anschaulicher Beweis dafür ist die neue Monographie von Prof. I.M. Rahimov, die hier den Lesern vorgestellt wird.
Am gnoseologischen Fundament, auf welches sich die von ihm entwickelte Bestrafungslehre stützt, sowie an deren Ursprungsquellen hat bisher ein einziger Grundstein bzw. eine einzige Schrifttafel gefehlt, und zwar die religiösen Grundlagen der Kriminalstrafe. Die vorliegende Monographie hat nun diese Lücke geschlossen.
Nach philosophischen und sittlichen Komponenten der Bestrafungslehre wurden vom Autor minutiös deren religiösen Grundprinzipien untersucht. Dabei ist es gesetzmäßig, denn der vielfältige Charakter des Phänomens Strafe führt zur Diversität von Ansätzen zwecks deren Verständnis unter verschiedenen Betrachtungsweisen. Zu diesen Richtungen gehört ein Ansatz, der auf religiösen, also göttlichen Grundfesten der Strafe beruht.
Hinsichtlich des gewählten Themas, des Riesenumfangs von gesammeltem und ausgewertetem Material sowie dessen Eindringtiefe ist dieses Buch unbestritten das erste und bisher einzige Werk in der zeitgenössischen strafrechtlichen Literatur, welches eine so gründliche und vielseitige Untersuchung des religiösen Vorläufers vom Phänomen Strafe liefert.
Beeindruckend ist vor allem die Dimension der geleisteten Arbeit. Der Forscher hat sämtliche heilige Schriften (Bibel, Koran, Karma-Gesetz etc.) der wichtigsten Weltreligionen (Judaismus, Christentum, Islam, Hinduismus, Buddhismus) untersucht.
Auch wenn der Autor in seinen anderen Schriften davon ausgeht, dass unter den Kräften, von denen die Wirklichkeit geprägt wird, die Sittlichkeit die allererste sei, weil sie den öffentlichen Anfangsgrund im Menschen bildet; sie verbindet die Menschen zu einer Gemeinschaft verbindet noch bevor all deren sonstigen Bande entstehen. Die Sittlichkeit umreißt jenes Universum, in deren Grenzen das menschliche Sein sich überhaupt in menschlicher Form zu entwickeln vermag. In der vorliegenden Monographie versetzt sich der Autor in dieselben von uns weit entfernten Zeiten, aber diesmal mit dem Ziel, die religiösen Wurzeln des menschlichen Verhaltens zu entdecken. Dies betrifft sowohl gesetzeskonformes Verhalten als auch die Abweichungen von den Sittlichkeitsnormen und religiösen Verboten. Der Wissenschaftler geht auf die biblische Herkunftsgeschichte der Strafe und den göttlichen Ursprung des Bestrafungsrechts ein, zeigt dessen Wesen, Ziele und Arten. Gestützt auf die Leitidee in punkto Strafbarkeit, die der jeweiligen Weltreligion zugrunde liegt, nimmt er dann unter die Lupe den Judaismus mit dessen Vergeltungsgesetz nach dem Motto «Auge für Auge, Zahn für Zahn», das Christentum (die Lehre Christi) mit dessen Glückseligkeits- und Liebesgesetz nach dem Motto „Du sollst dem Bösen nicht widerstehen“, den Islam mit dessen goldenen Allahs´ Regeln in Form der „widerfahrenden Gerechtigkeit“, den Hinduismus mit dem Karma-Gesetz – „Sündentilgung und Errettung“, den Buddhismus mit dem Postulat „Verbrechen sei eine Krankheit und die Lehre des Buddha eine Medizin anstelle der Strafe“.
Der Leitgedanke des Buches und zugleich die entscheidende Schlussfolgerung aus der Untersuchung besteht unseres Erachtens darin, zu zeigen, wie in drei wichtigsten Weltreligionen die Evolution des Phänomens Strafe von den zwei Extremen (ausgedrückt in den Formeln „Auge um Auge“ und „Wenn dir jemand auf die rechte Wange schlägt, dann halt auch die andere hin.“) zur Goldenen Regel gelangt war, die lautet: „Es sei die Vergebung möglich, falls das sowohl für den Straftäter als auch für das Gemeinwohl sinnvoll sei.“
Laut I.M. Rahimov wird die Institution Strafe in den heiligen Schriften (Altes und Neues Testament und der Koran) vom Allerhöchsten identisch verstanden. Es ist auch nicht erstaunlich, denn nach Ansicht der Verfechter theologischer Richtung der Schöpfer all der obengenannten Botschaften untrennbarer und ungeteilter Gott sei. Gerade deshalb kann man dem Autor beipflichten: das Wesen der Strafe entsprach grundsätzlich immer den jeweiligen Sitten und herrschenden Religionen, entwickelte und änderte sich gemeinsam mit der Entwicklung und Vervollkommnung von Völkern. Selbstverständlich war damit nicht ausgeschlossen die Evolution des Strafgedankens unter Berücksichtigung unterschiedlicher Entwicklungsebenen dieser Völker sowie der Besonderheiten von deren Religion, Kultur, Psychologie und Mentalität.
Nach Lektüre der neuen Monographie von Professor I.M. Rahimov erwischt man sich beim Gedanken: egal, zu welcher Religion wir uns bekennen und welcher Konfession angehören (bzw. weiterhin Atheisten bleiben), können wir unmöglich die unbestrittene Tatsache leugnen, dass die Weltreligionen einen gewaltigen Einfluss auf die Herausbildung und Entwicklung der Institutionen Verbrechen und Strafe ausgeübt haben.
Aufmerksame Leser werden ohne Zweifel auch zahlreiche weitere Vorzüge der vorliegenden Monographie entdecken. Sie findet ganz bestimmt starkes Interesse bei den russischen Wissenschaftlern, die das „ewige“ und „unsterbliche“ Thema Bestrafungslehre erforschen.
A.I. Korobejev,
Prof., Dr. Dr. jur.,
Verdienter Wissenschaftler
der Russischen Föderation
1Rahimov I.M.: 1) Kriminalität und Strafe. („Prestupnostj i nakasanije“), Moskau, 2012; 2) Philosophie von Verbrechen und Strafe („Filosofija prestuplenija i nakasanija“), Sankt Petersburg, 2013; 3) Über die Sittlichkeit der Strafe („O nrawstwennosti nakasanija“), Sankt Petersburg, 2016; 4) Unsterbliche Todesstrafe („Bessmertnaja smertnaja kasn'“), Sankt Petersburg, 2017.
2Kristi N. Indem man Schmerzen zufügt. Die Rolle der Strafe in der Kriminalpolitik. („Pritschinjaja bol'. Rol' nakasanija w ugolownoj politike“), Sankt Petersburg, 2011. S. 18.
EINFÜHRUNG
Religion
Durch die sämtlichen heiligen Schriften zieht sich wie ein roter Faden die Belehrung des Allerhöchsten: „Oh, Volk! Besprich den Gegenstand und du wirst die Wahrheit erfahren!“ Dieses Gebot hat einen Bezug nicht nur zu wissenschaftlichen Problemen, sondern auch dazu, was uns Herr Gott nahebringen will, was er von den Menschen gefordert hat, an die die Schriften gerichtet sind. Deshalb müssen sowohl die Atheisten als auch die aufrichtig Gläubigen ebenso wie die Zweifelnden all die heiligen Schriften in- und auswendig kennen und nicht davor zurückschrecken, über umstrittene und mitunter unverständliche Stellen in den göttlichen Botschaften zu diskutieren. Mit so einem Herangehen können sich leider jene Religionsvertreter nicht ganz anfreunden, die in den tieferen Sinn vieler Gottesgebote nicht eindringen und die Erörterung solcher Fragen vermeiden, die den Menschen gewisse Schwierigkeiten bereiten. Das von uns untersuchte Strafproblem gehört gerade zu jenen Themen, bei denen sowohl in der Wissenschaft als auch in der Religion die Ansichten und Herangehen in manchen Punkten auseinandergehen. Den rechtlichen und philosophischen Aspekten der Strafe gilt bekanntlich seit alters her großes Augenmerk. Leider lässt sich das Gleiche über das Verständnis dieses historischen Phänomens durch den Allerhöchsten in seinen Botschaften (im Alten und Neuen Testament sowie im Koran) nicht sagen. Eben das hat uns dazu veranlasst, die Institution Strafe in den Weltreligionen zu erforschen.
***
Gott, die heiligen Schriften und die Propheten (Moses, Jesus, Mohammed) waren schon immer Gegenstand verschiedener Erklärungen. In ausländischen Studien wird betont, dass in modernen Westgesellschaften erst vor kurzem sichere Prognosen über das Absterben von Religion im öffentlichen Leben gemacht wurden. Inzwischen hat sich jedoch die Situation offensichtlich und weitgehend überraschend gewandelt: die Religion nimmt heute einen wichtigen Platz sowohl innerhalb des Staates als auch auf internationaler Ebene. Deswegen halten wir die Erforschung des Phänomens Strafe unter dem Gesichtspunkt dessen Verständnisses in der Religion für hochaktuell. Aber jeder Forscher muss zuallererst die eigene Einstellung zu Gott, zu heiligen Schriften und zu Propheten klären, über die laut den Vertretern aller Religionen der Allerhöchste in verschiedenen Stufen der historischen Menschheitsentwicklung seine Anleitungen und Gebote an die Menschen geschickt hat. Manche haben bekanntlich sogar versucht, die Existenz Gottes „wissenschaftlich“, mit mathematischen Methoden zu beweisen. Die anderen wiederum leugnen Vorhandensein von Gott: beim sorgfältigen Studium der Bibel und des Korans haben sie dort Widersprüche gefunden und sind nun bemüht, zu beweisen, dass die heiligen Schriften von Menschen stammen. Dennoch bewahrt die Religion ihre Bedeutung bis heute und erfreut die Herzen von Millionen Menschen, die sich nicht nur durch Hautfarbe und physiologische Besonderheiten unterscheiden, sondern auch eine völlig unterschiedliche Entwicklungsgeschichte haben.
Der Mensch ist überhaupt seiner Natur nach religiös. Wenn etwa behauptet wird, dass irgendwelches Volk keine Religion habe, ist damit das Fehlen der richtigen, z.B. monotheistischen Religion oder solcher Religionen gemeint, die nicht auf heiligen Schriften beruhen, jedoch als Weltreligionen anerkannt sind. Die Völker des Altertums beteten die Naturgewalten an: das Feuer, den Wind, den Schnee, den Regen, Donner und Blitz. Dabei stellten sie sich vor, dass hinter jedem dieser Ereignisse jeweils ein Geist steckt. Die Ursprungsquelle solcher Gewalten sahen sie im Himmel und versuchten die eigenen Schicksale zu kontrollieren, indem sie die himmlischen Geister anbeteten und ihnen Opfer darbrachten. Auch heute appellieren die europäischen Christen unbewusst an den Himmel mit den Worten: „Unser himmlischer Vater!“ und die Muslims mit „Oh Allah im Himmel!“
Zur Zeit der Sowjetmacht, als versucht wurde, aus uns gottlose Atheisten zu machen, als es verboten gewesen, die Namen des Herren und seiner Propheten laut auszusprechen, und wir natürlich keine Möglichkeit hatten die heiligen Schriften kennenzulernen, dennoch spürten wir, ohne den Allerhöchsten mit dem äußeren oder inneren Blick zu begreifen, dass es eine unsichtbare Kraft gäbe, von der alle stets irgendwelche Hilfe in der Not erwarten, bei der sie wegen irgendwelcher Sünden um die Vergebung bitten sowie inständig darum bitten, jenen zu bestrafen, der sich Ungerechtigkeit und Gesetzlosigkeit gegenüber den anderen erlaubt.
Die Theologen erklären, Gott sei für das menschliche Verständnis unzugänglich und befinde sich in einer anderen, immateriellen Welt; zugleich aber existieren wird im göttlichen Bewusstsein und im Gottes Gedanken. Im Koran heißt es: „Wir waren niemals abwesend.“ (Sure 7, Vers 7) oder: „Er weiß wohl, was in den Herzen ist.“ (Sure 11, Vers 5). Die unbedingte und ständige Existenz des Herren ergibt sich auch aus dem Spruch vom Apostel Paulus: „Denn in ihm leben wir, bewegen wir uns und sind wir …“ (Apg 17,28).
D.V. SHCHedrovitskiy schreibt: „Unabhängig davon, ob man von der inneren oder von der äußeren Seite zur Erkenntnis Gottes gelangt, stellt sich heraus, dass Er für die Ihn anrufende Menschenseele wahrhaftig nah und „zugänglich“ sei. Konkreter ausgedrückt: Gott ist überhaupt das Allernächste, was ein Mensch durch Erkenntnis begreifen und wonach er streben kann, eigentlich eine Quelle des Lebens und der Erkenntnis als solcher“3.
Xenophanes hat bereits im 6. Jh. v. Chr. über Gott geschrieben: „Er bleibt stets an ein und demselben Ort, völlig bewegungslos; für ihn ziemt es sich nicht, an verschiedenen Orten zu verschiedener Zeit aufzutauchen. Aber er erschüttert mühelos alles Seiendes kraft seiner Vernunft. Überall sieht er, überall denkt er, überall hört er“4. Wenn es dem aber so ist, auf welche Weise hält er dann die Verbindung zu unserer Welt und zu den Menschen aufrecht? Auf welche Weise leitet er unsere Taten und lenkt unsere Handlungen? Auf welche Weise tröstet er uns und bietet uns geistliche Unterstützung? Warum verhindert Gott nicht Gewalt und Verbrechen seitens von Menschen, die er doch selber erschaffen hat? Was rät er uns im Kampf gegen derartige Erscheinungen? Wo findet man Antworten auf diese Fragen? Sind die Religion und die moderne Wissenschaft imstande, Antworten auf solche Fragen zu geben?
Die führenden Repräsentanten aller Religionen haben sich stets als Ziel gesetzt, zu beweisen, dass die Religion imstande sei, nicht nur die Herausforderung seitens der menschlichen Vernunft anzunehmen, sondern vielmehr die wissenschaftlichen Erkenntnisse hinsichtlich der obengenannten und vieler anderer Fragen, die sich aus den heiligen Schriften ergeben, zu widerlegen. Zugleich aber ist die Wissenschaft heute so ungemein mächtig, dass die Theologen sich nicht mehr leisten können, die weltlichen Kenntnisse leichthin von der Hand zu weisen, wie sie das im Mittelalter getan haben. Während viele Sachen, die vom Allerhöchsten in heiligen Schriften geheiligt wurden, sich weder beweisen noch widerlegen lassen, hat man für manche Vermutungen, die insbesondere im Koran beschrieben sind, in verschiedenen Entwicklungsperioden der Menschheit wissenschaftliche Beweise gefunden. Das ist ein Zeugnis für die Existenz Gottes sowie für die göttliche Herkunft dieser Botschaften, „sonst würden sowohl die Thora als auch das Evangelium und der Koran in den Regalen verstauben und so viele Herzen nicht erobern können“5.
***
2. Eine der besonders intensiv diskutierten Fragen ist wohl die Zugehörigkeit der heiligen Schriften zum Allerhöchsten. Dabei ist dieser Streit nicht heute, sondern in den Zeiten von Voltaire und Spinoza entstanden, die wegen ihrer Ansichten gegenüber der Religion von Geistlichen und Christen hart kritisiert wurden. Selbstverständlich wurde sowohl die Hebräische Bibel ebenso wie das Evangelium und der Koran durch Herrn Gott vorbereitet und über die aus der menschlichen Mitte auserwählten Propheten übermittelt. Das heißt jedoch keineswegs, dass sie die Autoren dieser heiliger Schriften sind, denn ein Mensch ist wohl kaum fähig, so etwas zu schaffen.
Der Papst Benedikt XVI. (Amtszeit von 2005 bis 2013) hat die Frage, was die göttliche Schrift bedeute, wie folgt beantwortet: „das ist ein Text, der von Gott herabgekommen ist, sowie die Macht, welche die Menschen lenkt“. Falls jedoch selbiger Gott der endgültige und einzige Urheber der Botschaften ist, warum gibt es dann in diesen Büchern so viele Widersprüche und Unstimmigkeiten. Warum sind alle heiligen Schriften so wirr und irre verfasst und der Koran gar in Verse, die für einen einfachen und ungebildeten Menschen schwer verständlich sind? Wenn sie doch für die einfachen Sterblichen bestimmt sind, dann müssen sie ganz klar und deutlich dargelegt sein, denn nur wenige Menschen verfügen Moskau, 2005. S. 56. über glänzenden Verstand und tiefe Kenntnisse. Selbst einem Menschen, der die göttlichen Botschaften wenig kennt, fällt auf, das Herr Gott neben seiner Barmherzigkeit, Tugendhaftigkeit und Gerechtigkeit sich in diesen Büchern (insbesondere in der Hebräischen Bibel) als grausam und manchmal auch als erbarmungslos zeigt.1 Das ist gerade ein Grund für die Zweifel an der göttlichen Herkunft der heiligen Schriften. Es ist erstaunlich, dass trotz der Entwicklung von Wissenschaft im weitesten Sinne, der es gelungen ist, zahlreiche Geheimnisse der Natur und der irdischen Lebewesen zu enträtseln, der menschliche Verstand immer noch keine Beweise liefern konnte, die die Zugehörigkeit dieser Bücher zum Allerhöchsten widerlegen würden. Es gibt eine simple und überaus wichtige Wahrheit, die darin besteht, dass der Herr der einzige Gott sei. Wenn es mehrere Götter, mehrere gleiche Kräfte, mehrere Gründer und Verwalter des Universums geben würde, dann könnten sich deren Gesetze nicht in voller Harmonie miteinander befinden.
Im Heiligen Koran erinnert uns der Allerhöchste: „Und euer Gott ist ein Einiger Gott; es ist kein Gott außer Ihm, dem Gnädigen, dem Barmherzigen“ (Sure 2, Vers 163). Dabei ist die Existenz von drei verwandten, sich jedoch voneinander unterscheidenden Religionen auf Wunsch von Herr Gott notwendig zum Vollbringen ausschließlich guter Taten durch jede von ihnen. Im Koran ist zu lesen: „Einem jeden von euch haben Wir eine klare Satzung und einen deutlichen Weg vorgeschrieben. Und hätte Allah gewollt, Er hätte euch alle zu einer einzigen Gemeinde gemacht, doch Er wünscht euch auf die Probe zu stellen durch das, was Er euch gegeben. Wetteifert darum miteinander in guten Werken. Zu Allah ist euer aller Heimkehr; dann wird Er euch aufklären über das, worüber ihr uneinig wart.“ (Sure 5, Vers 48). Aus diesem Gebot des Allerhöchsten kann man schließen, dass jeder Glaube eine eigene Heilige Schrift habe – das Wort Gottes, der unangefochtene Autorität genießt; je genauer und ergebener die Gläubigen dieser Religion ihm folgen, desto besser für sie und für alle, die sie umgeben6. Es ist wichtig im Gedächtnis zu behalten, dass die Befolgung der Gottesgebote, die in seinen Heiligen Schriften enthalten sind, nicht im Interesse des Allerhöchsten, sondern im Interesse von Menschen notwendig ist, „weil die Gottheit über eine vollkommene Natur verfügt und deshalb durch die menschlichen Handlungen weder etwas verliert noch etwas erwirbt“7.
***
3. Verschiedene Vertreter monotheistischer Religionen wollten in verschiedenen historischen Zeiträumen wissen, welche von heiligen Schriften, die der Einzige Gott geschickt hat, auf den moralischsten Positionen stehen. Diese Frage ist natürlich schwer zu beantworten. Das bedeutet jedoch nicht, dass man sie nicht ansprechen sollte. Wenden wir uns den Botschaften zu: „Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst“ (Hebräische Bibel); „Die Gläubigen sind ja Brüder“ (Koran). Der Apostel Paulus hat seinen Nachfolgern eingeflößt: „Segnet eure Verfolger; segnet sie, verflucht sie nicht!“. Im Koran ist zu lesen: „Wehre (das Böse) mit dem ab, was das Beste ist. Und siehe, wenn Feindschaft zwischen dir und einem anderen war, so wird der wie ein warmherziger Freund werden.“ (Sure 41, Vers 34).
Viele Christen und Juden sind damit nicht einverstanden, dass deren Gott ist jener, den die Muslims anbeten. Der Koran unterscheidet sich von der Bibel nicht nur inhaltlich, sondern auch nach seiner Herkunft. Die Hebräische Bibel (Altes Testament) ist eine wahre Fundgrube von Gattungen, wie R. Reit richtig gemerkt hat. Sie schließt ein sowohl die kosmische Mythologie des Seins, als auch eine Gesetzessammlung, das Levitikus-Ritual, eine mehrbändige Geschichte des antiken Israel mit zahlreichen blutigen Kriegen auf Geheiß von Gott Jahwe sowie Leben und Wirken jüdischer Propheten. Sowohl die Hebräische Bibel als auch das Evangelium sind ein Ergebnis jahrelanger Arbeit Dutzender von Autoren, Der Koran hingegen entstand innerhalb von 20 Jahren dank einem einzigen Menschen. Im Koran verlangt Allah eine Versöhnung christlicher und jüdischer Religionen.
***
4. Der Allerhöchste schickt immer wieder zu den Menschen einen aus deren Mitte Auserwählten, dessen Mission darin besteht, Herrn Gott – den Einzigen und Unteilbaren – zu verkünden sowie bringt über diese Propheten jene Ordnung ins Leben der Gesellschaft, die in seinen heiligen Schriften festgelegt ist. Es wäre jedoch falsch, die Propheten für Gesetzgeber, d.h. für Autoren der Heiligen Schrift zu halten. Deren Aufgabe ist es, die Gottesgebote den Menschen nahe zu bringen.
5. Mohammed hat vieles mit dem Moses gemeinsam. Beide waren empört über Ungerechtigkeit: Moses über den Umgang der Ägypter mit den Juden, Mohammed über den Umgang reicher Araber mit den armen. Beide haben aus Protest ihre Stimme erhoben. Christus und Mohammed haben auch als Propheten vieles gemeinsam: beide waren recht friedlich gestimmt und riefen zur religiösen Toleranz auf. „Euch euer Glaube, und mir mein Glaube.“ Jesus hat das Kommen des Reiches Gottes angekündigt. Der Tag des Jüngsten Gerichts sei schon nah: eine Zeit, wo die Sünder Reue zeigen und sich in ihrem Glauben an den einzigen echten Gott bestärken müssten. Den gleichen Gedanken versuchte auch Mohammed den Hörern nahe bringen: er forderte Ergebenheit, welche die traditionellen Bande durcheinander bringt: „O die ihr glaubt, wahrlich, unter euren Frauen und Kindern sind welche, die euch feind sind, so hütet euch vor ihnen.“ (Koran. Sure 64, Vers 14). „Denn ich bin gekommen, um den Sohn mit seinem Vater zu entzweien und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter; und die Hausgenossen eines Menschen werden seine Feinde sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig, und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig.“ (Мt 10,35-38)
Strafe
Aus der Vielfältigkeit dieses Phänomens ergibt sich auch die Vielfalt von Herangehensweisen an das Verständnis der Strafe in verschiedenen Aspekten. Zu einer dieser Richtungen gehört der Ansatz, der auf religiösen (göttlichen) Grundlagen der Strafe beruht.8 Wie V.S. Solovyov zu Recht festgestellt hat: “das Abgesondertsein der politisch-rechtlichen Normen und Institutionen von den religiösen ist ein relativ spätes Faktum, während ursprünglich diese beiden Gebiete sich miteinander verschmolzen“.9 Ein solcher Ansatz erscheint überaus wichtig zu sein, weil im Verlauf der jahrhundertealten Religionsgeschichte „viele derer Vorschriften neben anderen nichtinstitutionellen Normen als faktische Regulatoren von gesellschaftlichen Beziehungen fungieren. Mehr noch: sie haben weitgehend in die geltenden Gesetze Eingang gefunden“10. Deshalb wurde die Frage nach den religiösen (göttlichen) Ursprüngen des Strafphänomens in den Untersuchungen zum Wesen der Strafe wiederholt aufgerollt.
In den heiligen Schriften wird – wenn auch etwas verschwommen – darauf hingewiesen, dass in der Natur eine moralische Ordnung vorhanden ist. Diese Ordnung wurde vom Allerhöchsten geschaffen. Damit sie aber unverrückbar bestehen bleibt, ist ein extra Instrument notwendig, das dafür sorgen würde. Als einer dieser Mechanismen wirkt die Strafe, welche vom Schöpfer in den Schriften festgelegt wurde. Deshalb darf die Bedeutung theologischer Haltungen in Bezug auf die Entstehung und Evolution der Strafidee auf keinen Fall unbeachtet bleiben, weil diese Haltungen mit den Volksanschauungen über dieses historische Phänomen eng verbunden sind. Wie V.G. Grafskij zu Recht behauptet: „Die Religion hat einen großen Einfluss auf die Institution Kriminalstrafe ausgeübt, denn bereits in der Urgesellschaft die Strafen mit den religiösen Erlaubnissen und Verboten eng verbunden waren.“11. Die Ursprünge der Bestrafungslehre entdeckt man mit Sicherheit in der Religion; auch die ersten Versuche, das Wesen und die Grundlagen des genannten Begriffes zu bestimmen, findet man gerade in den religiösen Glaubensvorstellungen und Quellen. Beim Studium der Bibel und des Korans – dieser großartigen und einmaligen Bücher in der Menschheitsgeschichte – finden wir in geballter Form Ideen, die das Wesen der Anschauungen der Menschen im Altertum über Leben und Tod, Mord und Verbrechen, die Geißel Gottes und die Blutrache offenbaren.
Wenn Herr Gott auf natürliche Weise menschliches Bewusstsein zur moralischen Aufklärung und Vervollkommnung lenkt, so müssen Wesen und Zweck der Strafe unabhängig vom langsamen oder sprungartigen Entwicklungsprozess sich in Richtung der Milderung ändern. Die Geschichte des abrahamitischen Gottes und Religionen zeugt davon, dass die Einstellung des Allerhöchsten zur Frage über die Strafe, deren Wesen und Zweck mit jeder Gottesbotschaft sich verändert hat. Wenn Er etwa in der Hebräischen Bibel die Strafe nur als Vergeltung sieht, wandelt der Herr in der Lehre von Jesus Christus (d.h. im Neuen Testament) überraschend seine Einstellung zu diesem Mittel der Einwirkung auf die Menschen und verkündet ein anderes, völlig entgegengesetztes Gebot: „Leistet dem, der euch etwas Böses antut, keinen Widerstand“ (Mt 5,38-42).
Im 6. Jh. n. Chr. verkündet der Allerhöchste im Koran über den Propheten Mohammed die Rückkehr zur Vergeltung als Wesen der Strafe. Jedoch im Gegensatz zur Hebräischen Bibel und dem Christentum findet man hier keine Extreme von der Art „Auge um Auge“ oder „Wenn dir jemand auf die rechte Wange schlägt, dann halt auch die andere hin.“ Herr Gott legt die Goldene Regel fest, derzufolge Vergebung möglich sei, falls dies sowohl für den Straftäter selbst als auch für das Gemeinwohl sinnvoll sei. Damit beginnt die nächste Etappe der Idee Gottes über die Evolution der Strafe. In diesen drei Religionen sehen wir unterschiedliches Herangehen des Allerhöchsten gegenüber dem Phänomen Strafe und deren Anwendung. Zugleich aber muss man vermerken, dass, dass in allen heiligen Schriften die Grundprinzipien der Strafe – Begriffe, Ziele, Arten und der Charakter – für Herrn Gott grundsätzlich unverändert bleiben.
Abschließend möchte ich die Besonderheit dieser Arbeit für mich unterstreichen. Während nämlich meine vorherigen Bücher über strafrechtliche und philosophische Fragestellungen in meinem Kopf entstanden sind, so kommt die vorliegende Arbeit von der Tiefe meines Herzens.
Um das Verstehen des Untersuchungsgegenstandes zu erleichtern, wurde von uns folgende Darlegungsweise gewählt, was als sinnvoll erscheint. Zuerst sollen die Entstehung, die Evolution und das Wesen der Strafe nach dem Verständnis des Allerhöchsten in seinen heiligen Schriften behandelt werden. An zweiter Stelle wenden wir uns den Besonderheiten dieses Phänomens aus der Sicht der wichtigsten Postulate von Weltreligionen zu. Und schließlich wird es nützlich sein, als Drittes diese historische Institution in jenen Religionen zu betrachten, die nicht auf göttlichen Schriften, sondern auf Lehren beruhen, die weltweit anerkannt wurden.
3SHCHedrovitskiy D.V. Leuchtender Koran. Blick eines Bibelforschers. (Siyayushchiy Koran. Vzglyad biblista.). Moskau, 2016. S. 123.
4КM еI а1. (1983). S. 169-1670.
5Alekperov S. Das große Paradoxon oder zwei Handschriften im Koran.
6SHCHedrovitskiy D.V. Leuchtender Koran. Der Blick eines Bibelforschers. S.123.
7 Recht und Religion in fachübergreifender Auslegung / Hrsg. A.B. Didkin. Moskau, 2019. S. 17-18.
8 Siehe z.B.: Christliche Lehre über Verbrechen und Strafe: (Gemeinschaftsmonografie) /Arkadij Avakovich Ter-Akopov u.a.; wiss. Red.: Kharabet K.V., Tolkachenko А.А. 2009; Bachinin V.A. Sekuläre Kriminologie und biblische Konzeption der Kriminalität // Kriminologie: gestern, heute und morgen: Schriften des Sankt Petersburger Kriminologischen Klubs. Sankt Petersburg, 2008., Nr.2 (15). S. 165-166.
9Solovyov V.S. Ein Prediger in der Wüste: Predigten über das Recht (Ausgewählte Schriften). Moskau, 2014. S.172.
10Nikonov V.А. Kriminalstrafe. Die Suche nach der Wahrheit. (Ugolovnoe nakazanie. Poisk istiny.). Tjumen. S.16.
11Grafskij V.G. Die allgemeine Geschichte von Recht und Staat. Moskau, 2001. S.41.
Kapitel I
Allgemeine Grundsätze der Strafe Gottes in heiligen Schriften
§ 1. Biblische Geschichte der Strafenherkunft
Jede Konzeption kann nur dann richtig verstanden werden, wenn deren Geschichte bekannt ist. Was ist die Entstehungsgeschichte der Strafe von den theologischen Positionen aus? Wie wird die biblische Geschichte von Herkunft und Evolution der Vorstellungen über die Strafe seitens der Wissenschaft aufgenommen? Es sei gleich vermerkt: obwohl wir nicht den Standpunkt vertreten, das die primäre Grundlage der Strafe in den heiligen Schriften zu suchen ist, dennoch können wir die Bedeutung der Religion sowie der Anschauungen von führenden Religionsvertreten nicht außer Acht lassen, weil sie mit den Volksansichten über Begriff und Wesen dieses historischen Phänomens eng verbunden sind.
Oft haben wir keine klare Vorstellung über jene Schwierigkeiten, mit denen sowohl die Vertreter verschiedener wissenschaftlicher Richtungen als auch die Theologen konfrontiert werden bei ihren Versuchen, die Geschichte von Entstehung und Evolution der eigentlichen Idee der Institution Strafe genau zu beschreiben.
Gerade deshalb entsteht völlig verständliche und berechtigte Frage: von welcher Periode an beginnen die biblischen Wurzeln von Verbrechen und Strafe? Diese Frage können nicht allein die Theologen, sondern auch die Kriminalwissenschaftler nicht eindeutig beantworten.
Sowohl vor der Revolution als auch in der heutigen Zeit wird von manchen Forschern bei den Versuchen, göttliche Ursprünge von strafrechtlichen Verboten und entsprechenden Strafen nachzuweisen, gewöhnlich der im Alten Testament beschriebene Exodus von Juden aus dem Ägypten unter der Führung von Prophet Moses als zeitlicher Ausgangspunkt genommen.12
Einige Autoren verweisen darauf, dass das Alte Testament (insbesondere das Buch Exodus), schützende strafrechtliche Normen mit deutlich ausgeprägter Struktur (Hypothese, Disposition, Sanktion) und Merkmalen (allgemeiner Charakter, formelle Zuordnung) enthält)13. Nach Ansicht von V.G. Bespalko sind die fünf Bücher Mose ein Fundus am rechtlichen und historischen Stoff, der zum Glück nicht in ferner Vergangenheit geblieben ist, sondern noch lange Zeit rechtliche Kultur von gewaltigen Menschenmassen, deren Einstellung gegenüber Obrigkeit und Gesetzen, Verbrechen und Strafen bestimmen wird14.
In den Schriften von christlichen Rechtsgelehrten kann man die Behauptung treffen, das erste Wort Gottes über Verbrechen und Strafe wäre gerade im Gesetz des Propheten Moses gesprochen15. Dabei geht der Erzpriester Aleksander Sorokin davon aus, dass man das Gesetz des Moses „als das Wort Gottes aufnehmen muss, der im Gesetz selbst präsent ist16. Moses war tatsächlich nicht nur der erste unter den Propheten „Überbringer von Gottes Wort“17, sondern auch dessen Ausleger gewesen: „…Die Leute kommen zu mir, um Gott zu befragen. Wenn sie einen Streitfall haben, kommen sie zu mir. Ich entscheide dann ihren Fall und teile ihnen die Gesetze und Weisungen Gottes mit.“ (Ex 18,15-16). Soll es aber heißen, dass vor dem Gesetz Moses der Allerhöchste seine Einstellung zum Begriff Strafe noch nicht bestimmt hatte und als dessen Entstehungsbeginn die Zehn Gebote gelten müssen, welche Gott auf dem Berg Sinai dem Volk Israel geschenkt und in denen über die Maßregelung nicht gesagt wird? Vielen hat das als Anlass für die Behauptung gedient, der Begriff „Strafe“ ebenso wie der Begriff „Verbrechen“ habe seine Wurzeln nicht im Dekalog, sondern im Sündenfall von Adam und Eva18. V.A. Nikonov meint: „das Gesetz, insbesondere das Strafgesetz, wird in der Heiligen Schrift von Anfang an als Vorrecht Gottes betrachtet“19. Um sich jedoch davon zu überzeugen, dass in der alttestamentlichen Menschheitsgeschichte als erste strafrechtliche Vorschrift – wenn auch mit gewissen Einschränkungen – gerade ein biblisches Gebot gelten kann, welches Gott für Adam verordnet, nachdem sich dieser im Garten Eden angesiedelt hatte, muss man den kriminellen Charakter der Tat von Adam und Eva beweisen, für die sie bestraft worden sind. Sonst können wird die Entstehung und anschließende Entwicklung der Strafe Gottes sowie dessen Einstellung zum Begriff Verbrechen nicht nachvollziehen.
„Dann gebot Gott, der Herr, dem Menschen: Von allen Bäumen des Gartens darfst du essen, doch vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse darfst du nicht essen; denn sobald du davon isst, wirst du sterben.“ (Gen 2,16-17). Um also zu behaupten, die Strafe sei eben mit diesem Gebot Gottes entstanden, muss man nachweisen: ein Verbot, ein Verstoß gegen das Verbot, die Erklärung dieses Verbots zum Verbrechen bzw. zur Sünde, die Gefahr eines Verstoßes gegen das Verbot, Schadenszufügung durch den Verstoß sowie die entsprechende Maßregel. Eine Analyse des oben genannten Gebotes zeigt, dass die erste Norm, die in der Bibelgeschichte vom Allerhöchsten festgelegt wurde, zum Ziel hatte, die Verletzung der von Gott bestimmten Ordnung zu verhindern. Der dafür von Gott verwendete Begriff heißt: “Du darfst nicht essen“. Wir werden davon ausgehen, dass dies eben ein Verbot Gottes sei.
Dabei hat als erster die von Ihm als Gott geschaffene und eingerichtete Welt der erste Mensch namens Adam gestört. Kann aber dessen Benehmen als Verbrechen gelten? W.G. Bespalko meint, dass der Begriff „Verbrechen” als einer der wichtigsten in der Kriminalwissenschaft im Sündenfall von Adam und Eva seine Wurzeln hat, denn das erste Verbrechen war nichts anderes als Verstoß gegen ein Gebot Gottes. Sie wurde zum Archetyp für alle nachfolgenden Verbrechen, die die Menschen begangen haben bzw. begehen.20.
Weswegen werden eigentlich Adam und Eva von W.G. Bespalko beschuldigt? Seiner Meinung nach liegt die Schwere deren Sündenfalls nicht so sehr in der Gefährlichkeit ihrer Tat nach außen hin, sondern vielmehr in deren Geistestrübung, welche ein für religiöse Gesellschaft unerhörte Dreistigkeitsniveau erreicht hat: Ungehorsam gegenüber dem Willen Gottes, d.h. dem Willen des liebevollen Schöpfers21. Der Autor meint, Adams Handlung diene „als Prototyp einer konkreten strafbaren Tat – eines rechtswidrigen Übergriffes auf beliebige legitime Macht“22.
W.G. Bespalko vergleicht sogar das Verhalten von Adam und Eva mit gewaltsamer Machtergreifung oder Anmaßung der Befugnisse einer Amtsperson. Unverständlich ist: wie kann man überhaupt „sich an einer beliebigen legitimen Macht Gottes übergreifen“, wenn Herr Gott der alleinige Herrscher und Schöpfer nicht nur von Adam und Eva selbst, sondern auch vom gesamten Weltall? Die Religionsvertreter gehen in ihren Beschuldigungen gegenüber Adam für sein Verhalten noch weiter. Hlg. Ignatius (Brenganinov) ist der Meinung, Adams Verhalten sei der Versuch eines Menschen gottgleich zu werden.23. Loyaler äußerten sich G.P. CHistyakov, der in Adams Handlungen keinen Verstoß gegen ein Verbot, sondern „Verantwortungslosigkeit gesehen hat“24, sowie Alexander Men, der den Standpunkt vertritt: „der Sündenfall ist das erste Mal gewesen, wo der Machtwille beim Menschen triumphiert hat“25. Aus religiöser Sicht kann man sicherlich das Verhalten von Adam und Eva als Sünde betrachten. Aber wie Thomas Hobbes treffend beobachtet hat: „jedes Verbrechen ist eine Sünde, aber nicht jede Sünde ist ein Verbrechen“26. Worin besteht eigentlich die Gefährlichkeit der Tat von Adam und Eva für die Öffentlichkeit? Wem wurde schließlich Schaden zugefügt? Wie konnten überhaupt „geistig Nachlässige“, wie sie in der Bibel dargestellt sind, den kriminellen Charakter der eigenen Taten erkennen? Und wie konnte schließlich Adam nach der Vorstellung vom Hlg. Ignatius „gottgleich werden“, wenn der Allerhöchste ihn selber geschaffen hat?
Noch unsinniger klingt die Äußerung des deutschen Bibelforschers B. Salzmann, der Adam und Eva beschuldigt, Gottes Eigentum geklaut zu haben.27 Ist es denn nicht so, dass alles, was auf der Erde und im Himmel existiert, Gott gehört? Man kann G.P. CHistyakov Recht geben, der Adams Tat für „unverantwortlich“, aber keineswegs für die Ursünde hält. Adams Benehmen lässt sich mit dem Benehmen eines Kindes vergleichen, dem die Mutter verboten hat, das Handy oder den PC zu benutzen. Der hat aber nicht gehorcht und musste sich deshalb zur Bestrafung für unbestimmte Zeit in eine Ecke mit dem Gesicht zur Wand hinstellen. Mehr nicht. Deswegen kann die Handlung von Adam und Eva wohl kaum als Prototyp für jedes Verbrechen und zugleich als allererstes Verbrechen gelten, das der erste Mensch begangen haben soll, wie B. Bespalko behauptet. Recht interessant ist die Tatsache, dass Allah im Koran Jesus Christus dem ersten Menschen Adam gleichstellt: „Wahrlich, Jesus ist vor Allah wie Adam. Er erschuf ihn aus Erde, dann sprach Er zu ihm: „Sei!“, und er war.“ (Sure З, Vers 59). In diesem Vers erfährt die höchste Wertschätzung des Schöpfers nicht nur der Prophet Jesus Christus, sondern auch Adam als erster Mensch. Damit wird bestätigt, dass Adam für den Allerhöchsten nicht nur kein Verbrecher, sondern sogar kein Sünder ist.
Gott zufolge, während die Menschheit im Adam den Beginn ihrer physischen Entwicklung erhalten hat, so handelt es sich bei Jesus um den Beginn deren Geistigkeit, quasi um eine Wiedergeburt. Die Gottes Warnung "du wirst sterben" gilt eigentlich auch als ursprüngliche Art von Strafe Gottes. Man muss feststellen, dass diese Episode von vielen Erforschern der Strafherkunft buchstäblich aufgefasst wird: als Zeichen von Ungehorsam und darauf folgende Endlichkeit des Lebens (im Eden waren die Menschen unsterblich).
Versuchen wir zu klären, welchen Sinn der Allerhöchste in die Worte "du wirst sterben" sowie insgesamt in den Ausdruck „sobald du davon [vom Baum der Erkenntnis] isst, wirst du sterben“ gelegt hat.
An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass der religiöse, der gesamtphilosophische und der medizinische Ansatz zum Verstehen des Todes sich unterscheiden. Das religiöse Verständnis der Begriffe „Tod“ und „sterben“ bedeutet im Unterschied zu den philosophischen und medizinischen Definitionen das Lebensende eines Menschen, und zwar nicht als Gegenteil von der Geburt, sondern als unabdingbaren Teil der Auferstehung. Wenn man das Gebot "du wirst sterben" von rechtlicher oder genauer gesagt strafrechtlicher Position aus betrachtet, so kann man feststellen, dass der Allerhöchste in diese Wortverbindung Wesen und Zweck jener Strafe hineinlegt, die er gegenüber Adam verwendet. Gott verfolgt nicht das Ziel, ihn zu töten, denn sonst hätte er völlig andere Worte gebraucht: „ich werde dich hinrichten“, „ich werde dich töten“ oder schließlich „du wirst hingerichtet“. Solche Formulierungen werden jedoch in der Heiligen Schrift bezogen auf diese Situation nicht gebraucht. Gott hat Adam zu verstehen gegeben, dass der für seinen Ungehorsam in der Form von „du wirst sterben“ bestraft sein wird, was aus unserer Sicht bedeutet, sein Leben auf der sündhaften Erde zu beenden. Deshalb kann man schlussfolgern, dass die gesagten Worte keine Drohung oder gar Strafe beinhalten, sondern lediglich eine Warnung über unvermeidbare ungünstige Folgen für den Menschen sei – er vernichtet sich selber.
Somit ist das Wesen der Strafe Gottes gegenüber Adam als Übergang von Unsterblichkeit ins sterbliche Leben zu verstehen. Das Besondere des Ausdrucks „du wirst sterben“ besteht nicht darin, dass es der primäre, allererste Begriff sei, sondern im Wesen und der Vorgehensweise bei der Ausführung dieser Warnung. Der Begriff „das Leben“ wird übrigens von jeder Religion viel breiter aufgefasst: als vollwertiges geistiges Sein, dass auf einem festen Glauben an den Weltschöpfer, auf der Ergebenheit Ihm gegenüber und auf einem ständigen Dialog mit Ihm beruht28. Deshalb bedeutet der Ausdruck „du wirst sterben“ unseres Erachtens einen geistigen und keinen physischen Tod durch Gott und wird als „Tod für Gott“, als “geistiger Bruch des Menschen“ mit Gott sowie als Entziehung von Gottes Segen29 aufgefasst und enthält keine Strafgrundlage. Genauso hat Gott mit Adam verfahren, indem er ihn in ein anderes, sterbliches Leben überführte, obwohl er ihn gleich töten konnte.
In keiner Gottesbotschaft stößt man übrigens auf den Begriff „Todesstrafe“ oder „Hinrichtung“, obwohl klar ist, dass der Ausdruck „du wirst sterben“ ebenso wie die von Gott gebrauchten aufgezählten Begriffe auf jeden Fall den Tod meinen und dieser Tod kommt von Gott, denn ausgerechnet Er hat als erster diesen Ausdruck gebraucht, als er Adam bezüglich des Verbots warnte. Deshalb hat V.A. Nikonov recht mit der Behauptung, dass die Worte „du wirst sterben“ gar keine Drohung enthalten, sondern lediglich eine Drohung über unvermeidbare Folgen30.
Eine derartige Beendigung von Adams Lebenstätigkeit lässt sich kaum als Todesstrafe oder umso mehr als Strafe durch Hinrichtung im modernen Wortsinn bezeichnen. Eine solche Strafe Gottes kann man eher als Alternative für die Todesstrafe betrachten. Indem Herr Gott Adam wie in eine Haftanstalt ins sterbliche Leben schickt, begrenzt er somit dessen Aufenthalt dort durch den physischen Tod. Möglicherweise ist es Ausdruck von Liebe und Barmherzigkeit gegenüber der eigenen Erstschöpfung ohne jeglichen Racheakt. Kann sein, dass Gott ursprünglich gar nicht vorhatte, Adam zu bestrafen. Er wollte lediglich prüfen, wie die dem Menschen, den er geschaffen hat, innerwohnenden Eigenschaften wie innere Freiheit, Stolz und Furchtlosigkeit zum Ausdruck kommen. Klar ist eins: der Allerhöchste war sehr hart zu Adam gewesen, denn die Strafe entsprach nicht der Schwere der Tat. Adams Benehmen ist im Grunde ein Zeugnis dafür, dass Gott ein ziemlich vollkommenes Wesen geschaffen hat, dass eine Willensentscheidung selbständig zu treffen vermag. G.W. Leibniz hat seinerzeit festgestellt: „…die Welt ist der beste Staat dessen Monarch mit Wahrheit und Recht Gott als der vollkommenste unter den Geistern sein wird; falls einmal fest vorgeschrieben wurde, dass alle glücklich sein dürfen, so kann keiner unglücklich sein, außer durch eigene Schuld“31(Rückübersetzung aus dem Russischen – Anm. des Übersetzers).
Damit erscheint es uns, dass die Worte „du wirst sterben“ nicht buchstäblich als Strafe insgesamt bzw. als Todesstrafe insbesondere zu verstehen sind. Diesbezüglich hat Voltaire geschrieben: „Im Buch Genesis ist nicht mal gesagt, dass Gott Adam zum Tode verdammt habe, weil er den Apfel verschluckt hatte. Er hat zwar gesagt: „Du wirst unbedingt an dem Tag sterben, an dem du vom Baum der Erkenntnis gegessen hast“. Aber laut demselben Buch Genesis soll Adam nach diesem sträflichen Frühstück 930 Jahre gelebt haben“.32
Der Tod als Strafe, die in der Maßregel des Gebots „du wirst sterben“ angegeben ist, ist eben als geistiger Tod zu betrachten, dem von rechtlichen Standpunkt aus der Tod bedeutet, dass einem Menschen das physische Leben mittels Hinrichtung genommen wird; dabei ist die Hinrichtung ein strafrechtlicher und kein biblischer Begriff, der eine gerechte Vergeltung für das begangene Verbrechen im Namen der entsprechenden Einrichtung oder Amtsperson bedeutet. Gerade deshalb wird der Begriff „Hinrichtung“ nur im Zusammenhang mit der Vollstreckung von Todesstrafe gebraucht.
Apropos: im Alten Testament werden außer der Gottes Warnung „du wirst sterben“ auch andere Ausdrücke gebraucht: „Wer den Namen des Herrn schmäht, wird mit dem Tod bestraft; die ganze Gemeinde soll ihn steinigen.“ (Lev 24:16); „Ein Mann, der mit der Frau seines Nächsten die Ehe bricht, wird mit dem Tod bestraft, der Ehebrecher samt der Ehebrecherin.“ (Lev 20:10); „…wer aber einen Menschen erschlägt, wird mit dem Tod bestraft. (Lev 24:21); „… dann musst du geben: Leben für Leben.“ (Ex 21:23); «Jeder, der mit einem Tier verkehrt, soll mit dem Tod bestraft werden.“ (Ex 22:19); „… dann sollst du die Frau und das Tier töten. Sie werden mit dem Tod bestraft; ihr Blut soll auf sie kommen.“ (Lev 20:16); „Wer seinen Vater oder seine Mutter verflucht, wird mit dem Tod bestraft.“ (Ex 21:17).
Bemerkenswert ist auch die Tatsache, dass der Allerhöchste im Koran, im Gegensatz zur Bibel, die Sterblichkeit des Menschen nicht mit seinem Ungehorsam im Paradies verbindet und überhaupt nirgends die Formel „du wirst sterben“ gebraucht. Mehr noch: im Koran wird die Sterblichkeit im ewigen Leben mehrfach verneint: „Den Tod werden sie dort nicht kosten, außer dem ersten Tod.“ (Sure 44, Vers 56); „Tod wird nicht über sie verhängt, dass sie sterben könnten.“ (Sure 35, Vers 36), „Dann wird er darinnen weder sterben noch leben.“ (Sure 87, Vers 13). Während in der Bibel Gott Adam verbietet, von diesem Baum zu essen, indem er sagt: «…sonst wirst du sterben», – beschränkt sich Allah in seiner Botschaft im Koran auf eine Warnung: „O Adam, weile du und dein Weib in dem Garten, und esset reichlich von dem Seinigen, wo immer ihr wollt; nur nahet nicht diesem Baume, auf dass ihr nicht Frevler seiet.“ (Sure 2, Vers 35). An einer anderen Stelle im Koran mahnt der Allerhöchste nochmal vor dem Ungehorsam: „O Adam, dieser ist dir ein Feind und deinem Weibe; dass er euch nicht beide aus dem Garten treibe! Sonst würdest du elend.“ (Sure 20, Vers 117). Der Allerhöchste erinnert Adam an jenes Leben, das ihn erwartet, falls er Ihm nicht gehorcht: „Sonst würdest du elend. Es ist [im Garten] für dich (gesorgt), dass du darin weder Hunger fühlen noch nackend sein sollst. Und dass du darin nicht dürsten noch der Sonnenhitze ausgesetzt sein sollst.“ (Sure 20, Verse 118-119).
Die Beraubung des Lebens eines Menschen als Strafe existiert in der Heiligen Schrift der Moslems und in den Hadithen als Vergeltung unter anderen Namen: „Der Lohn derer, die Krieg führen gegen Allah und Seinen Gesandten und Unordnung im Lande zu erregen trachten, wäre der, dass sie getötet oder gekreuzigt werden sollten oder dass ihnen Hände und Füße abgeschlagen werden sollten für den Ungehorsam oder dass sie aus dem Lande vertrieben würden. Das würde eine Schmach für sie sein in dieser Welt; und im Jenseits wird ihnen schwere Strafe.“ (Koran. Sure 5, Vers 33).
Der Gesandte Allahs gebraucht anstelle der Begriffe „Todesstrafe” oder “Hinrichtung” auch den Begriff „Blut vergießen”. Wie Abdullah ibn Masud erzählt, hat der Gesandte gesagt: „Das Blut eines Moslems, der bezeugt, dass es keinen Gott außer Allah gäbe, und dass ich Allahs Gesandter bin, darf nur in drei Fällen vergossen werden: falls er Ehebruch begangen hat; falls er einen Menschen getötet sowie falls er dem Glauben abgeschworen und von der Gemeinde gebrochen hat“. Dieser Hadith wurde überliefert von Ahmad, al-Buchari, Muslim, at-Tirmizi, Abu Dawud, An-Nasai und Ibn Madscha. Als wahrheitsgetreu gelten auch die Worte von Aischi darüber, dass der Gesandter Allahs gesagt haben soll: „Ein Moslem kann getötet werden…“
Es gibt auch einen Hadith, wo der Prophet Mohammed zur Bezeichnung der Strafe das Wort „hinrichten“ gebraucht. Es wurde überliefert, dass Abu Bakr (Mohammed Amr Hazm) von seinem Vater und sein Vater seinerseits vom eigenen Vater erzählt bekam, dass der Prophet eine Botschaft nach Jemen geschickt hatte, wo geschrieben war: „Falls bewiesen ist, dass ein Mensch absichtlich und ungerecht einen Rechtgläubigen getötet hat, dann ist er hinzurichten“.
2. Wenn wir uns also auf den Bibeltext stützen, so kann als erste Strafe jene gelten, die Allerhöchster gegenüber Adam und Eva angewendet hat. Das ist jedoch keine Strafe im strafrechtlichen Sinne für eine kriminelle Tat, sondern eine geistige Strafe für das törichte und leichtsinnige Benehmen des ersten Menschen, welches dem Benehmen eines Kleinkindes ähnelt, welches Gott erschaffen und genauso geliebt hat, wie eine Mutter ihr unartiges Kind. Eine Tat, die in der Religion als Verbrechen bezeichnet wird, ist die Tötung durch Kain seines Bruders Abel. Falls diese Bibelgeschichte der Wahrheit entspricht, lässt sich Kains Tat als vorsätzlicher Mord definieren und damit auch als Verbrechen aus strafrechtlicher Sicht. Was war aber Gottes Strafe dafür? „Der Herr aber sprach zu ihm: Darum soll jeder, der Kain erschlägt, siebenfacher Rache verfallen. Darauf machte der Herr dem Kain ein Zeichen, damit ihn keiner erschlage, der ihn finde.“ (Gen 4:15). Etwas später hat Kains Nachkomme Laschech denselben Gedanken in Versen geäußert, deren Sinn nebelhaft. aber der Zweck offensichtlich ist: der Tod von Kain wird sieben und der von Laschech siebzig Mal gerächt. A.P. Lopukhin hat völlig Recht: Gott hätte Kain mit Tod bestrafen können, aber er „musste als mahnendes Beispiel für die anderen dienen“33.
Laut der jüdischen religiös-rechtlicher Tradition hat Gott Kain von der Strafe „du wirst sterben“ befreit, weil er ein Opfer gebracht und damit Gott begütigt und seinen Zorn gemildert hat (Josephus Flavius). Die christlichen Rechtsgelehrten vermuten, dass Kain seine Strafe als übermäßig und mit keiner anderen – selbst mit dem Tod – unvergleichbar empfunden hat. Eine Bestätigung dafür findet man in einem Zitat aus der Heiligen Schrift: „Kain antwortete dem Herrn: Zu groß ist meine Schuld, als dass ich sie tragen könnte.“ (Gen 4:13). Diese Strafe wird als härtere und außerordentliche wahrgenommen, weil Gott erstmals einen Menschen eben wegen Brudermordes mit einem Fluch belegt und damit zu verstehen gibt, Kains Verbrechen wäre schlimmer als die Erbsünde der Urahnen; deshalb fällt seine Strafe härter aus als die Vertreibung aus dem Paradies in das sterbliche Leben. Der Prediger John Chrysostom schildert die Verbüßung der göttlichen Strafe durch Kain wie folgt: „Und Kain ging überall herum wie lebendes Gesetz, wie ein sich bewegender Grundpfeiler, stumm, aber hörbarer als jede Posaune. Keiner sollte das tun, was ich getan habe, um nicht dasselbe erdulden zu müssen, was ich erdulde. So lautete seine Botschaft“34. Wie auch immer wir versuchen würden, die Einstellung des Allerhöchsten zur Kains Bestrafungsart zu erklären, diese Strafe ist im Grunde nicht strafrechtlicher, sondern religiöser Art. Während wir in Adams Handlungen kein Verbrechen sehen, aber dennoch eine Strafe, ist es im Falle Kains ganz umgekehrt: ein Verbrechen ist da, aber keine Strafe aus strafrechtlicher Sicht.