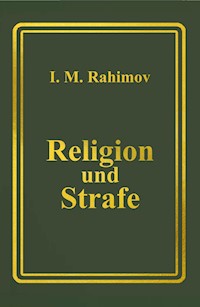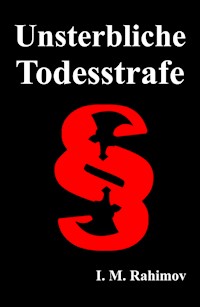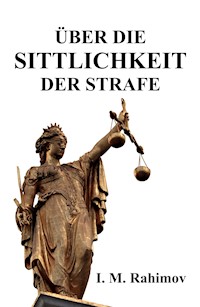
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die vorliegende Arbeit ist eine Fortsetzung der Überlegungen des Autors über das philosophische Wesen der Strafe, die er zuvor in den Büchern »Kriminalität und Strafe« (»Prestupnostj i nakasanije« - Moskau, 2012), »Philosophie der Straftat und der Strafe« (»Filosofija prestuplenija i nakasanija« - Sankt Petersburg, 2013) dargelegt hat. Darin wird behauptet, dass die Rechtswissenschaft lediglich eine formelle Definition der Strafe geben kann und unfähig sei, mehr zu bieten. Das Philosophieren über das Wesen dieses Phänomens gibt uns hingegen die Möglichkeit, zu versuchen, sich in dessen Sittlichkeit einzumischen, es den Kategorien zuzuordnen, welche in der Philosophie erarbeitet wurden. Ist die Strafanwendung überhaupt sittlich, insbesondere wenn es um die Todesstrafe geht? Handelt es sich bei der Strafe um Vergeltung, Abschreckung oder um psychologische Einwirkung? Worauf beruht die Sittlichkeit der Strafe? Vermag die Gesellschaft mittels Strafe jene Ziele zu erreichen, welche sie sich dabei gesetzt hat? Ist es in der heutigen Situation möglich, auf die Strafe gänzlich zu verzichten? Soweit eine unvollständige Liste von Fragen, die Prof. I. M. Rahimov in dieser interessanten Arbeit zu beantworten versucht. Das Buch richtet sich an Studierende, Forschungsstudenten und Dozenten juristischer Hochschulen, Mitarbeiter von Rechtsschutzorganen, an Theoretiker und Praktiker, die sich auf das Strafrecht spezialisiert haben, sowie an Philosophen, Soziologen und an alle, die sich für die Problematik »Straftat und Strafe« interessieren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 332
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Assoziation Juriditscheskij Zentr
I. M. Rahimov
ÜBER DIE SITTLICHKEIT DER STRAFE
Sankt Petersburg Verlag „Juriditscheskij Zentr“ 2016
Copyright: © 2017: I. M. Rahimov
UDK 343.2; 343.97
ББK 67.408
R14
Redaktionskollegium
Ju.W.Golik (Leit. Red.), M.T. Agammedow, N.A.Winnitschenko, I.H.
Damenija,
I.E. Swetscharowskij, A.W. Semskowa, A.W.Konowalow, S.F.Miljukow,
A.W.Saljnikow, A.W.Fjodorow, A.A. Eksarchopulo
Gutachter:
Prof. Dr. Dr. jur. A. I. Alexandrow
Prof. Dr. Dr. jur. A. I. Bastrykin
Prof. Dr. Dr. jur. A. I. Korobejew
Dr. Dr. phil. I. P. Mamedsade
I. M. Rahimov
Über die Sittlichkeit der Strafe / Vorwort von Prof. Dr. Dr. jur. H. D. Alikperow. — Sankt Petersburg: Verlag „Juriditscheskij Zentr“, 2016. — 224 S.
Verlag: tredition GmbH, Hamburg
978-3-7439-5427-4 (Paperback)
978-3-7439-5428-1 (Hardcover)
978-3-7439-5429-8 (e-Book)
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar
Die vorliegende Arbeit ist eine Fortsetzung der Überlegungen des Autors über das philosophische Wesen der Strafe, die er zuvor in den Büchern „Kriminalität und Strafe“ („Prestupnostj i nakasanije“ -Moskau, 2012), „Philosophie der Straftat und der Strafe“ („Filosofija prestuplenija i nakasanija“ - Sankt Petersburg, 2013) dargelegt hat. Darin wird behauptet, dass die Rechtswissenschaft lediglich eine formelle Definition der Strafe geben kann und mehr zu bieten unfähig sei. Das Philosophieren über das Wesen dieses Phänomens gibt uns hingegen die Möglichkeit, zu versuchen, sich in dessen Sittlichkeit einzumischen, es den Kategorien zuzuordnen, welche in der Philosophie erarbeitet wurden. Ist die Strafanwendung überhaupt sittlich, insbesondere wenn es um die Todesstrafe geht? Handelt es sich bei der Strafe um Vergeltung, Abschreckung oder um psychologische Einwirkung? Worauf beruht die Sittlichkeit der Strafe? Vermag die Gesellschaft mittels Strafe jene Ziele erreichen, welche sie sich dabei gesetzt hat? Ist es in der heutigen Situation möglich, auf die Strafe gänzlich zu verzichten? Soweit eine unvollständige Liste von Fragen, die Prof. I.M. Rahimov in dieser interessanten Arbeit zu beantworten versucht.
Das Buch richtet sich an Studierende, Forschungsstudenten und Dozenten juristischer Hochschulen, Mitarbeiter von Rechtsschutzorganen, an Theoretiker und Praktiker, die sich auf das Strafrecht spezialisiert haben, sowie an Philosophen, Soziologen und an alle, die sich für die Problematik Straftat und Strafe interessieren.
UDK 343.2; 343.97
BBK 67.408
© I. M. Rahimov, 2016
© H. D. Alikperow, Vorwort, 2016
ISBN 978-5-94201-709-5
© Verlag „Juriditscheskij Zentr“, 2016
INHALTSVERZEICHNIS
Sittliche Grundlagen der Strafe und harte Realitäten deren Funktionierens
EINFÜHRUNG
Kapitel I
Sittliche Grundlagen der Herkunft von Strafe
§ 1. Die Urquellen der Sittlichkeit von Strafe:
§ 2. Religion als sittliche Grundlage der Strafe
Kapitel II
Sittliches Prinzip der Strafe
§ 1. Strafe ohne ahndenden Inhalt
§ 2. Strafe als Vergeltung, Abschreckung und Zwang
Kapitel III
Die Bedingung für die Gewährleistung des sittlichen Prinzips von Strafe
§ 1. Die Nützlichkeit von Strafe: Probleme und Lösungswege
§ 2. Die Gerechtigkeit von Strafe und die „verdammte“ Leiter
Kapitel IV
SITTLICHKEIT UND TODESSTRAFE
§ 1. Das Wesen von Todesstrafe und die Sittlichkeit
§ 2. Die Todesstrafe im 21.Jh. als sittliches Problem
Theoretische und praktische Empfehlungen an den Gesetzgeber
Sittliche Grundlagen der Strafe und harte Realitäten deren Funktionierens
Als im Herbst 2015 Professor I.M. Rahimov (И.Г. Рагимов) mich darum gebeten hatte, das Manuskript seines Buches über die sittlichen Aspekte der Strafe durchzulesen und eine Rezension zu schreiben, willigte ich ein, stand jedoch ehrlich gestanden recht skeptisch dieser Aufgabe gegenüber.
Mein Skeptizismus war leicht zu erklären: im Sommer hatte ich gerade die bekannte Schrift von Albert Berner „Lehrbuch des deutschen Strafrechts“ erneut gelesen, wo meines Erachtens die grundsätzlichen Fragen der Strafe erschöpfend untersucht worden sind. Angesichts eingehender Bekanntschaft auch mit dem Inhalt grundlegender Werke von Cesare Beccaria und Sergej Hessen, Stanisław Budzyński und Sergej Posnyschew, Igor Karpez, Nikolai Strutschkow und anderen Autoren zum Thema Straftat und Strafe dachte ich selbstverständlich, dass die Monographie von I.Rahimov wohl kaum etwas Neues in die bisherigen Lehren über die Strafe einbringen kann.
Ich habe mich aber geirrt. Als ich das Manuskript zu lesen begann, spürte ich auf einmal unterbewusst den Hauch von etwas Neuem, Unerforschtem – jedenfalls für mich, obwohl ich mich seit über vierzig Jahren im Rahmen der Kriminologie und des Strafrechts mit dem Thema Straftat und Strafe beschäftige.
Mit Rücksicht auf die Aufgaben eines Vorworts möchte ich mich nicht länger über das Wechselbad meiner Empfindungen ausbreiten, sondern nur ein Beispiel aus dem neuen Buch von Ilham Rahimov (Ильгам Рагимов) anführen, welches meine Vorstellung über die Möglichkeiten der Strafe völlig umgekrempelt und mich an den weisen Spruch von Sokrates erinnert hat: “Scio me nihil scire” („Ich weiß, dass ich nichts weiß“).
Es handelt sich um die auf den ersten Blick paradoxe These darüber, dass „je weniger das Sozium (d.h. eine Menschengemeinschaft) über die Strafe für die eine oder andere Tat (z.B. über deren Art, die Fristen, die Härte der Haftbedingungen etc.) informiert ist, desto weniger solche Taten es in der Gesellschaft geben wird“.
Solch eine antikriminogene Wirkung des Unwissens über die ahndenden Eigenschaften der Strafe scheint unglaubwürdig zu sein – nicht zuletzt, weil sie dem allgemein anerkannten Rechtsparadigma widerspricht, welches vorsieht, dass nur jene Gesetze Kraft erlangen, die vorher veröffentlicht und somit der Bevölkerung bekanntgegeben wurden. Denn, wie der Autor zu Recht feststellt: „gerade seit Inkrafttreten eines Gesetzes, falls die Bevölkerung davon überhaupt weiß, beginnt die Umsetzung der psychologischen Abschreckungswirkung der Strafe“.
Aber so scheint es nur auf den ersten Blick, weil die Analyse dieses Paradoxons1 durch das Prisma der Psychologie – darunter auch des abweichenden Verhaltens – zeigt, dass dem behandelten Phänomen vermutlich das genetische Gedächtnis des Menschen über die Selbstmäßigung bzw. Selbsteinschränkung zugrunde liegt.
Der Mensch ist bekanntlich das einzige lebende Wesen auf der Erde, welches spontan mit sich selbst redet. Gegenstand der Kommunikation mit dem Unterbewusstsein sind in solchen Fällen gewöhnlich seine Zweifel, Schwankungen etc. Diese Selbstkommunikation ist eventuell auch bedingt durch die Suche nach einem Ausweg aus der entstandenen Situation oder nach einer Antwort auf bestimmte Fragen, die er auf der Unterbewusstseinsebene nicht finden kann.
Deswegen ist es so, dass bevor Homo sapiens etwas unternimmt, er manchmal einen Meinungsaustausch mit seinem inneren „Ich“ führt und dabei mit ihm die Vor- und Nachteile der geplanten Tat analysiert, einschließlich krimineller Taten2.
Je mehr Informationen über diese beiden Pole ihm bekannt sind, desto mehr Möglichkeiten hat sein inneres „Ich“, alle Pro und Contra abzuwägen, eine Kombination positiver und negativer Folgen der erwogenen Tat nachzubilden sowie das optimale Lösungsmodell für das Bewusstsein des Homo Sapiens zu ermitteln.
Bei mangelhaften Informationen über diese Polen – insbesondere über die negativen Folgen – entsteht auf mentaler Ebene ein Vakuum: der Fluss von Informationen und die Generierung von Gedanken, die erforderlich sind, um eine Entscheidung auf der Ebene des inneren „Ich“ zu treffen, stoppen.
Nach Ansicht von Psychologen führt dies auf Unterbewusstseinsebene zu einer Störung des Mechanismus der Entscheidungsfindung. Denn die Unvollständigkeit von Informationen bringt die Position des inneren „Ich“ so stark ins Schwanken, dass es unmöglich wird, für das Bewusstsein des Homo Sapiens eine konkrete Entscheidung zu treffen. Deshalb spricht bei ihm in dieser Phase der Instinkt der Selbstmäßigung an.
Mit anderen Worten: wie I.Rahimov richtig feststellt, in solchen Situationen „hält die Ungewissheit über die künftige Strafe stärker vom Begehen einer Straftat zurück als das genaue Wissen über eine bestimmte Strafe“.
Ausgehend von dieser These kann man vermuten, dass der genetische Code, welcher den Aktivierungsmechanismus des betrachteten Phänomens in Gang setzt, wohl mit dem Reflexbogen des Gehirns verbunden ist, mittels dessen Rezeptoren die davon ausgehenden Impulse in das Unterbewusstsein übertragen und von dort aus nach dem Einlesen und logischer Auswertung in Form einer konkreten Entscheidung an das Bewusstsein von Homo Sapiens weitergegeben werden.
Meine Reflexionen über die Natur des „Phänomens der Unkenntnis der Strafe“ sind jedoch nur als eine Vermutung zu sehen, weil dieses Problem noch nicht Gegenstand einer besonderen Untersuchung geworden ist.
Ich habe das Augenmerk der Leser auf dieses Phänomen nur gelenkt, um auf dessen Grundlage Tiefe und Dimension der rezensierten Abhandlung zu veranschaulichen.
* * *
Die neue Monografie von Prof. I.Rahimov ist eine logische Fortsetzung zwei vorher erschienener grundlegender Werke.
Von der Fabel und Komposition her sehe ich die Dreieinigkeit dieser Werke darin, dass es dem Autor im Vorfeld gelungen ist, für deren Substanzen eine universelle Matrix „Straftat und Strafe“ aufzustellen. Damit war er in der Lage, während der Arbeit an diesen Büchern einerseits die Integrität und Kontinuität des Forschungsgegenstandes und andererseits das Zusammenwirken und die wechselseitige Übereinstimmung der Strukturelemente mit der einheitlichen Konzeption des Autors zu erreichen.
Dabei ist kennzeichnend, dass das gegenständliche Sein dieser Werke sich jeweils qualitativ voneinander unterscheidet. Wie aus dem Inhalt der Arbeiten ersichtlich, werden jedoch durch eine solche Autonomie deren Korrelationszusammenhänge keineswegs zerrissen.
Während das erste Buch3 von I.Rahimov den konzeptuellen Fragen der Kriminalität und des Täters und das zweite4 der Philosophie von Straftat und Strafe gewidmet war, hat sich der Autor in seinem dritten Buch auf die sittlichen Grundlagen der Strafe konzentriert, auf deren innere Struktur sowie auf das Problem der Implementierung dieser Grundlagen in die Gesetzgebung und Rechtspraxis.
Die neue Monografie von I.Rahimov fasziniert den Leser durch eine lange Liste origineller Ansichten des Autors auf die Kriminalstrafe aus der Sicht deren Genesis und der gegenwärtigen Trends zur Kriminalisierung und Entkriminialisierung, Pönalisierung und Entpönalisierung.
Die Arbeit hat einen innovativen Charakter, zeichnet sich durch einen facettenreichen Untersuchungsgegenstand sowie eine umfassende faktologische und empirische Basis aus, besticht den Leser sowohl durch unverwechselbare Stilistik und milde Tonalität, als auch durch die Art und Weise, wie der Autor seine Ideen in Worte kleidet.
Ein aufmerksamer Leser merkt bestimmt auch die eigenartige Methode, mit welcher der Autor seine Untersuchung architektonisch gestaltet, sich Ziele setzt und die passenden Instrumente auswählt, um diese Ziele zu erreichen.
Dank seiner konvergenten Denkmethode (die Problemlösung mittels Synthese des vorhandenen Wissens) wählt Prof. I.Rahimov häufig als Ausgangspunkt für seine Untersuchung zunächst einzelne - auf den ersten Blick lokale – Erscheinungen und Prozesse aus, welche durch Rechtsschöpfungs- und Rechtsanwendungspraxis aus den vielschichtigen Gegebenheiten des Alltagslebens herausgegliedert worden sind. Dann kristallisiert er aus deren Inhalt durch akribische Analyse ein theoretisches oder angewandtes Problem und verleiht ihm den Status eines eigenständigen Forschungsgegenstandes. Danach unternimmt er ein massiertes „Brainstorming“ auf dieses Problem und erarbeitet als Ergebnis Empfehlungen, die zur Problemlösung führen.
Ein Beispiel dafür sind die aufschlussreichen Urteile des Autors über die Zulässigkeit und Zweckmäßigkeit der Todesstrafe im vierten Kapitel der Monografie.
Die anderen immanenten Eigenschaften der Werke von Prof. I.Rahimov sind: die unbestrittene Aktualität und wissenschaftliche Novität des Forschungsgegenstandes, leichte Lesbarkeit, ein Minimum an linearen Urteilen, keine abgenutzten Formulierungen und keine langen Ausschweifungen zu unbedeutenden Fragen sowie die Fähigkeit, seine Betrachtungen an richtiger Stelle zu stoppen. Dieses Buch macht in diesem Sinne keine Ausnahme.
Eine weitere positive Eigenschaft seiner neuen Arbeit sehe ich darin, dass je mehr man sich in die Logik der Feststellungen des Autors vertieft, desto öfter muss man auf verschiedene Literaturquellen zurückgreifen, weil einer mitunter einen Mangel an eigenen Kenntnissen spürt, um den Gedanken des Autors in voller Tiefe zu folgen.
Diese Pointe seines Buches bringt mehrere positive Momente mit sich: einerseits lernt der Leser zusätzliche Literatur kennen, was im Zeitalter von Informationsboom und chronischem Zeitmangel ohnehin äußerst nützlich ist, andererseits bereichert er sein intellektuelles Gepäck um neue Gedanken und Ideen zum behandelten Thema.
Wie ein bekannter aserbaidschanischer Theologe Elmir Quliyev während der Präsentation der vorangehenden Monografie des Autors treffend vermerkt hat, „das Buch von Prof. I.Rahimov regt den Leser zum Nachdenken an.“
Unter den positiven Eigenschaften des neuen Werkes von I.Rahimov möchte ich auch die einzelnen wertmäßig-rationellen Aspekte seiner rechtlichen Weltanschauung besonders hervorheben.
So akzeptiert der Autor weder eine Verwestlichung im Rechtsbereich noch eine monolineare Sicht der Entwicklungswege der modernen strafrechtlichen Gesetzgebung und tritt gegen die gewaltsame Installierung „westlicher Werte“ in die Rechtssysteme anderer Staaten unter dem Motto einer Demokratisierung der strafrechtlichen Politik auf.
Ihm widerstrebt auch das blinde Kopieren ausländischer Erfahrung bei der Rechtsanwendung und Gesetzschöpfung auf dem Gebiet der Kriminalitätsbekämpfung. Er vertritt die Ansicht, dass solche Rezeption einen kreativen Charakter haben muss sowie selektiv und unter Berücksichtigung nationaler Traditionen und moralischsittlicher Grundprinzipien der Gesellschaft anzuwenden ist.
Der enge Rahmen des Vorwortes gestattet es mir nicht, mit der Darlegung anderer Aspekte der allgemeinen Konzeption des Buches fortzufahren. Deshalb beschränke ich mich auf eine einzige Replik: das neue Buch von Prof. I.Rahimov wird genauso wie seine Vorgängerwerke wohlwollend durch die juristische Öffentlichkeit empfangen werden und ein breites Leserecho sowohl in Aserbaidschan als auch weit über dessen Grenzen hinaus finden.
Eine Gewähr dafür ist nicht nur eine beeindruckende Liste von kompliziertesten theoretischen und angewandten Fragen – darunter von philosophischen, sittlichen und rein rechtlichen Problemen der Bestrafung, die Gegenstand der Monografie sind, sondern auch deren spannende Systemanalyse ausgehend von der bisher gesammelten historischen Erfahrung und den harten Realitäten der Gegenwart.
* * *
Zu Beginn einer inhaltlichen Analyse des neuen Werkes von I.Rahimov möchte ich das erste Kapitel hervorheben, welches den sittlichen Grundlagen der Herkunft von Strafe gewidmet ist, und kurz auf jene darin enthaltene Thesen eingehen, die mir besonders zusprechen.
Äußerst interessant und recht informativ finde ich den Streifzug des Autors durch die Entstehungsgeschichte, den Werdegang und die Entwicklung der Gerichtsstrafe mit paralleler Vorführung der Anschauungen großer Geister auf die Natur der Strafe und deren sittlichen Prinzip.
Durch diesen Streifzug im ersten Kapitel der Monografie kann der Leser die klassischen Werke solcher schillernder Denker kennenlernen wie Aristoteles und Plato, Pythagoras und Diderot, Plutarch und Solon, Kant und Hegel, Beccaria und Montesquieu, Berner und Feuerbach, S.Mokrinskij und W.Solowjow u.a., deren Ansichten zu den philosophischen Problemen der Strafe weitgehend auch heute aktuell bleiben.
Gestützt auf so reichhaltiges historisches Erbe im behandelten Sachgebiet stellt der Autor fest: „der Sinn und Zweck der Strafe sind völlig unabhängig von den konkreten Bestrafungsarten, die sich im Laufe der Geschichte ablösen; es ist unmöglich, das wahre Wesen der Strafe ohne Hilfe der Wissenschaft zu erfassen“.
Dabei ist er der Ansicht, dass „die strafrechtliche Wissenschaft nur eine formelle Erklärung der Strafe liefern und zeigen kann, wegen welcher Voraussetzungen der jeweilige Übergriff gegen eine bestimmte gesellschaftliche Beziehung als kriminell und strafbar anerkannt wird. Das Philosophieren über das Wesen der Strafe gibt uns hingegen die Möglichkeit, zu versuchen, sich in das Wesen dieses historischen Phänomens einzumischen, es den Kategorien zuzuordnen, welche in der Philosophie erarbeitet worden sind und aus denen die Strafe im Grunde besteht.“
Wie wir sehen, packt I.Rahimov gleich von den ersten Seiten seines Buches den Stier bei den Hörnern und stimmt somit den Leser auf einen ernsthaften Ferndialog über das Wesen der Strafe ein.
Zum Beispiel fällt es schwer, ihm zu widersprechen, als er behauptet, dass die Erkenntnis der Natur der Strafe nicht nur und nicht so sehr aus der Position bestehender theoretisch-rechtlicher Anschauungen, sondern vor allem auf der Grundlage dialektischer Methoden wissenschaftlicher Erkenntnis möglich sei, die im Prozess der Erkenntnis des Wahren das „Organon“ darstellen.
Er führt diese Überlegungen weiter und verweist darauf, dass „die Philosophie eben zur Aufgabe hat, zu klären und herauszufinden, was für alle Bestrafungsarten – seit diese Institution auf dem historischen Schauplatz aufgetaucht - gemeinsam ist“.
Ein anderer roter Faden, der sich unsichtbar durch die mentale Hülle der Monografie hinzieht und ins Unterbewusstsein des Lesers eindringt, ist der Gedanke des Autors, dass die Strafe nicht nur ein rechtliches, sondern in erster Linie ein sittliches Problem sei, „obwohl die Menschheit und zwar seit langem sich der Frage gestellt hat, ob die Bestrafung moralisch sei“.
Im Kontext des Gesagten fallen seine Aussagen über die moralischen Aspekte der Blutrache etwas aus dem Rahmen. Dieses Problem wurde in der Monografie nicht nur eingehend analysiert, sondern auch durch interessante historische Angaben bereichert. Dabei zieht I.Rahimov die Begründetheit der bestehenden archaischen Ansätze bei der Bewertung dieser Bestrafungsart in Zweifel, bringt überzeugende Argumente über die soziale Bedingtheit deren weiten Verbreitung und Anwendung in vielen Ländern der Welt in verschiedenen Etappen historischer Entwicklung.
Auf dem Höhepunkt dieser Überlegungen geht I.Rahimov nahtlos zur Untersuchung des sittlichen Prinzips der Strafe über: durch das Prisma der Wertvorstellungen, die im Alten und Neuen Testament, im Koran und Zoroastrismus, Buddhismus und Konfuzianismus, Maoismus und Legalismus etabliert worden sind. Nebenbei macht er die Leser mit den Ansichten verschiedener Konfessionen auf das Wesen der Strafe bekannt.
Die Hinwendung des Autors zu den Ursprüngen der Religion ist vermutlich durch seine Überzeugung bedingt, dass „die Religion eine kolossale Auswirkung auf Mensch und Gesellschaft, Geschichte und Kultur, Alltagsleben und Sitten hat. Sie hatte nicht nur schon immer die Art der Strafe beeinflusst, sondern auch ein Recht auf Strafanwendung gehabt. So wird die Strafe seit dem Beginn der Verbrechenswahrnehmung als Gottheitsbeleidigung zu einem Mittel der Reinigung von Sünde und der Buße von Schuld. Seit dieser Zeit bildeten die moralische Grundlage der Strafe nicht mehr die Bräuche und Traditionen, sondern die Religion“.
Es ist erfreulich, dass I.Rahimov in diesem Teil der Untersuchung auch das Problem des jahrhundertelangen religiös-sittlichen Antagonismus zwischen den Ansichten des Alten und des Neuen Testaments auf die Natur der Strafe nicht beiseitegelassen hat. Hier meine ich das alttestamentliche Talionsprinzip „Auge um Auge“ und das neutestamentliche Prinzip des Verzichts auf gewaltsamen Widerstand gegen das Böse.
Nach den Ausführungen des Autors zu urteilen bevorzugt er doch das Prinzip der Vergeltung des Gleichen mit dem Gleichen, jedoch mit einem wesentlichen Vorbehalt: sie muss in angemessenem Umfang und auf der Grundlage des Prinzips der gerechten Vergeltbarkeit realisiert werden, wie dies im Koran vorgeschrieben, in der Sunna verankert, in der Idzhma gebilligt und im Kijas empfohlen ist.
Bei der Behandlung dieser und einer ganzen Reihe anderer religiös-sittlicher Grundlagen der Strafe nutzt I.Rahimov kreativ seine profunde Kenntnis nicht nur des Korans, sondern auch der Bibel und anderer heiliger religiöser Quellen. Das bringt den Leser in die Lage, eine klare Trennungslinie zwischen komplizierten und mitunter sich gegenseitig ausschließenden Herangehensweisen verschiedener Glaubensgemeinschaften an das behandelte Problem zu ziehen.
Genauso wie in seinen vorangegangenen Forschungen bleibt der Autor auch in dieser Arbeit ein Verfechter des moralischen Paradigmas, das lautet: die Strafanwendung darf nicht das Ziel verfolgen, dem Täter Leiden und Qualen zuzufügen, sondern muss seiner moralischen Heilung oder Besserung dienen. „Wie ein Arzneimittel sein Ziel verfehlt, falls die Dosis zu groß oder zu klein ist, zeigt auch die Strafe nicht die gewünschte Wirkung, falls sie das notwendige Maß überschreitet. Deshalb agiert der Gesetzgeber unmoralisch, wenn er im Voraus weiß, dass diese Leiden der begangenen Tat nicht entsprechen und somit die Vergeltung nicht der Idee von Recht, Gerechtigkeit und Sittlichkeit der Strafe dient“.
* * *
Ein beachtlicher Platz ist in der Monografie der Behandlung von Strafe als vordergründig moralisches Problem eingeräumt, einschließlich deren Wesens und Eigenschaften sowie des Verhältnisses zwischen der Bestrafung und der straflosen Einwirkung etc.
Diesen Fragen ist das zweite Kapitel gewidmet, wo verschiedene Aspekte dieses überaus schwierigen philosophischen Problems eingehend analysiert werden, welches jahrhundertelang die wissenschaftliche Welt in zwei Lager spaltet.
Es ist kein Geheimnis, dass trotz der Wichtigkeit der Strafe für das normale Funktionieren jeder Gesellschaft deren moralischer Sinn („nrawstwennaja sustschnostj“) immer bezweifelt wurde und auch heute bezweifelt wird. Das ist dadurch bedingt, dass viele angesehene Philosophen und Soziologen, Juristen und Psychologen der Vergangenheit und der Gegenwart den Standpunkt vertreten: „Jede Strafe an sich ist das Böse, die Gewalt, die Vergeltung und somit unmoralisch und kann unmöglich gegen das Verbrechen angewendet werden“.
Über die Unsittlichkeit der Bestrafung schrieben: herausragender Soziologe Jeremy Bentham, großer Schriftsteller Leo Tolstoi, russischer Philosoph Wladimir Solowjow und norwegischer Kriminologe Nils Christie. Sie schlugen vor, der Strafe deren ahndende Eigenschaft, die Elemente von Abschreckung und Angst zu nehmen.
Die Idee einer nichtahndenden Einwirkung ist nicht neu und hat eine reichhaltige Historie. Der Kreis deren Verfechter wird mit jeder Epoche immer größer. Mehr noch: wie die heutige Gesetzgebungs- und Rechtspraxis ausländischer Staaten auf dem Gebiet der Kriminalitätsbekämpfung zeigt, findet diese Idee nach und nach den Weg auch auf die Gebotstafeln der Gesetzgeber und auf die Waage der Gerechtigkeit einzelner Länder.
Der Autor ist grundsätzlich mit der Konzeption einer nichtahndenden Einwirkung der Strafe einverstanden, lehnt jedoch ein lineares Herangehen an diese ziemlich komplizierte und widersprüchliche Idee ab. I.Rahimov gibt zwar das ahndende Wesen der modernen Strafe zu, ist jedoch der Ansicht, dass die Leiden und Entbehrungen, welche die Strafe zufügt, deren immanente Eigenschaft sind, wobei die Strafe im Interesse anderer Menschen angewendet wird, die Opfer einer Straftat geworden sind. Die Wegnahme der Schmerzeigenschaft ist deshalb einer Negierung der Strafe gleich.
In Anbetracht dieser Tatsache hält der Autor den vollständigen Verzicht auf die Strafe für eine Utopie, weil sie in der gegenwärtigen Etappe ein wichtiges Mittel der Kriminalitätsbekämpfung darstellt. „Der Liberalismus der strafrechtlichen Politik“, schreibt er, „hat seine Grenzen, deren Überschreitung von destruktiven Folgen für Mensch, Gesellschaft und Staat begleitet wird. Etwas anderes ist die Regulierung des Schmerzens, die zu einer wichtigen moralischen Frage wird“.
Eine solche Regulierung ist in der gegenwärtigen Etappe durchaus real – beispielsweise durch einen schrittweisen Übergang zum Beschließen von Alternativmaßnahmen mit nichtahndender Einwirkung bei gleichzeitiger Einschränkung der Anwendung von Kriminalstrafen („ugolownyje nakasanija“) – insbesondere solcher, die einen Freiheitsentzug vorsehen.
Die heutige strafrechtliche Politik ausländischer Staaten zeigt, dass viele europäische Staaten gerade über diesen Weg zu weniger Strafverfolgungs-Repressionen bei der Kriminalitätsbekämpfung übergehen, was in unserem Land leider nicht der Fall ist.
Die Gerichtsstatistiken Aserbaidschans besagen, dass in den letzten Jahren ein stabiler Trend zum jährlichen Anstieg der Anzahl jener zu beobachten ist, die zu einem realen Freiheitsentzug verurteilt werden. Als Ergebnis ist im Zeitraum 2004 bis 2014 der Anteil solcher Gerichtsurteile um 41 % angestiegen und hat 2014 ca. 55 % erreicht.
Einen derart hohen Anteil der Freiheitsentzugsfälle unter den Kriminalstrafen, die vom Gericht beschlossen werden, findet man nur schwer anderswo auf der Welt. In vielen GUS-Staaten variiert diese Kennzahl z.B. zwischen 25 und 33 %. So wurden im Jahr 2014 in Russland 719.000 Personen verurteilt, davon nur 29 % zum Freiheitsentzug.
Eine übermäßig hohe Anwendung des Freiheitsentzugs durch die Gerichte hat dazu geführt, dass heute die Anzahl der Häftlinge in den Haftanstalten des Landes sich weitgehend der erfassten Kriminalitätsrate angenähert hat.
Das ist, milde gesagt, völliger Nonsens, weil in anderen Staaten das Niveau der Verurteilten pro 100.000 Einwohner mindestens drei bis vier Mal niedriger ist als jährliche erfasste Kriminalitätsrate.
So betrug 2014 in Russland das Niveau der Verurteilten 29,6 % (447 Personen) an der gesamten Kriminalitätsrate (1508). Eine ähnliche Relation findet man in den Nachbarländern wie die Türkei (91 Verurteilte pro 100.000 Einwohner), Georgien: 165 Verurteilte, Armenien: 89 Verurteilte etc.
Eine niveaumäßig niedrige Anzahl von Verurteilten gab es in Norwegen (66), Finnland (71), Schweden (82) sowie ihn solchen führenden Ländern Westeuropas wie Deutschland (95), Frankreich (85), Italien (98) etc.
In Aserbaidschan hingegen betrug 2014 die Anzahl der Häftlinge (einschließlich vorgerichtlicher Verwahrungshaft) 252 Personen. Dies entspricht ca. 98 % der erfassten Kriminalitätsrate (2014 waren es 257 Straftaten).
Eine dermaßen hypertrophe Kriminalrepression bei der Bekämpfung von Kriminalität mit einem Anteil von Schwer- und Schwerstverbrechen von lediglich 14 bis 16 % widerspricht natürlich den Grundprinzipien strafrechtlicher Politik und dem sittlichen Prinzip („nrawstwennyje natschala“) der Strafverhängung.
Der Autor tritt entschieden gegen eine derart übermäßige Kriminalrepression auf, lehnt aber zugleich manche ultrahumane Methoden des Reagierens auf die Kriminalität ab, welche mitunter, milde gesagt, über den Rahmen des rechtlichen Feldes und der in der Strafrechts-Theorie bestehenden Paradigmen weit hinausgehen.
Aufschlussreich sind in diesem Zusammenhang die Ergebnisse, die der Autor bei der Erforschung des Südeuropäischen Modells (Italien, Frankreich, Portugal, Spanien) und des Nordeuropäischen Modells (Norwegen, Schweden, Dänemark, Island, Irland, Finnland) der Einwirkung auf die Kriminalität erhalten hat.
Die von ihm durchgeführten Forschungen haben ergeben, dass für das erstgenannte Modell medizinisch-psychiatrische Formen der Einwirkung auf die Person des Straftäters und die Vorbeugung des kriminellen Verhaltens typisch sind.
Beim zweitgenannten Modell wird der Schwerpunkt auf die Kriminalitätsvorbeugung gelegt, der die Doktrin eines „Wohlfahrtsstaates“ zugrunde liegt. Das Wesen dieses Modells besteht darin, dass der Staat weder die Bestrafungsart noch deren Ausführungsmethode bestimmen darf. Diese Aufgabe müssen die Verwandten und Angehörigen des Täters und des Opfers gemeinsam lösen.
Wie zu sehen ist, sind diese Modelle bei äußerer Attraktivität mit grundsätzlichen Mängeln behaftet.
Das betrifft in erster Linie das Nordeuropäische Modell, welches im Grunde das allgemein anerkannte Prinzip “Nulla poena sine lege” („keine Strafe ohne Gesetz“) durchkreuzt, weil dieses Modell das rechtliche Gerüst des normativen Status einer Straftat einengt, weil diese ihres obligatorischen Merkmals – der Strafbarkeit – beraubt wird. Dies zieht seinerseits die Notwendigkeit nach sich, die Struktur der Normen der strafrechtlichen Gesetzgebung zu überprüfen und ein solches unabdingbares Element wie die Sanktion daraus zu streichen.
Zur Umsetzung des Nordeuropäischen Modells der Einwirkung auf die Kriminalität muss man demzufolge vorher die „Motherboard“ des Strafrechts völlig abbauen und die seit Jahrhunderten geltenden Kanons der Theorie von Straftat und Strafe ändern. Und das ist kaum zulässig, weil es offensichtlich absurd ist.
Außerdem, wenn man die Frage über die Verhängung einer konkreten Strafe für den Schuldigen dem Ermessen von Verwandten und Angehörigen des Täters oder des Opfers überlässt, wird somit im analysierten Modell Tür und Tor geöffnet für die Verletzung solcher Grundprinzipien der Strafverhängung wie Gesetzlichkeit, normative Differenziertheit etc. – ganz zu schweigen von solchen Kategorien wie Unparteilichkeit, Objektivität, Humanismus etc.
Deshalb pflichte ich I.Rahimov bei, dass „diese Ideen ihrem Wesen nach eine Negierung der Strafe bedeuten, weil kriminelles Verhalten eines Menschen aus der Sicht von Anthropologie, Psychologie und Psychiatrie betrachtet wird. Ist es aber überhaupt möglich, mit diesen Mitteln der Einwirkung auf den Täter jene Aufgaben zu lösen, die vor uns stehen?“
Der Autor gibt darauf eine negative Antwort, weil er völlig zu Recht meint, dass ein solcher Ansatz nicht zuletzt „in einen Widerspruch zu den sittlichen Grundlagen des Zwangsrechts gerät, das allein der Staat auf der Basis eines freiwilligen Gesellschaftsvertrages ausüben darf“.
Angesichts dieser Äußerungen des Autors sind seine anschließenden Botschaften zum behandelten Problem zweifelsohne interessant, denn sie führen den Leser unbemerkt an das Problem des übergesetzlichen Rechts heran.
I.Rahimov schreibt zum Beispiel: „… das sittliche Prinzip als eine Art Garant dafür, dass der Staat selbst die eigenen Vollmachten nicht überschreitet, erfordert von ihm, dass bei der Zwangsanwendung die Grenzen dieses Rechts nicht überschritten werden, denn gegen übermäßigen Zwang ist ein Gegenzwang berechtigt“.
Dieser Gedanke des Autors steht im Einklang mit der berühmten Radbruchschen Formel5, deren Sinn darin besteht, dass ein Gericht berechtigt sei, auf die Einhaltung jener geltenden Gesetze zu verzichten, die mit der Gerechtigkeit unvereinbar sind. Somit spricht die Radbruchsche Formel solchen Gesetzen rechtliche Natur ab, weil sie meint, dass darin bewusst die Gleichheit nicht anerkannt wird, die das Wesen der Gerechtigkeit ausmacht.
Leider gilt die „Radbruch-Rechtsprechung“ in Aserbaidschan nicht. Deshalb können wir nur die Weisheit unseres Gesetzgebers heraufbeschwören. Es würde auch nicht schaden, ihn an Folgendes zu erinnern: „… mittels Strafe ist es unmöglich, die innere Welt eines Menschen umzugestalten oder zu vervollkommnen, denn die Strafe bedeutet den Zwang und nicht das Überzeugen. Deshalb, bevor die eine oder andere Strafe beschlossen wird, muss er im vollen Maße nicht nur deren juristischen Notwendigkeit, sondern in erster Linie deren sittlichen Bedeutung bewusst werden“.
Von diesen Positionen aus behandelt der Autor auf der Grundlage strafrechtlicher Haftung für den Drogenkonsum das Problem der Umsetzung des sittlichen Prinzips der Strafe in der Tätigkeit des aserbaidschanischen Gesetzgebers.
Im Bewusstsein der völligen Absurdität der Kriminalisierung einer biologischen Krankheit6 und der Festsetzung einer strafrechtlichen Haftung für den Träger dieser Krankheit hebt I.Rahimov hervor: „…es gibt kaum einen Nutzen von der Bestrafung eines Drogensüchtigen wegen Drogenkonsum, falls wir sicher sind, dass sein Freiheitsentzug keinen Nutzen bringt, weil für ihn eine Therapie am Zweckmäßigsten ist“.
Leider sind die übermäßige Kriminalisierung, unbegründet hohe Sanktionen für die einzelnen Straftaten etc. heute das Aushängeschild des Strafgesetzbuches der Republik Aserbaidschan.
Darunter fällt der Artikel 234.1 des Strafgesetzbuches von Aserbaidschan besonders auf, wo die Einnahme von Drogen als Straftat anerkannt wird und dafür eine Haftung in Form des Freiheitsentzugs bis zu drei Jahren vorgesehen ist.
Unser Gesetzgeber will immer noch nicht einsehen, dass die Haftanstalten kein Allheilmittel gegen diese Krankheit sind, weil sie nicht imstande sind, drogensüchtige Häftlinge von dieser Krankheit zu heilen.
Ganz umgekehrt: das Leben zeigt, dass die Koloniehaft die Situation von Drogensüchtigen meistens nur verschlimmert. Denn beim Aufenthalt in einer Haftanstalt lernen viele von ihnen nicht nur die kriminelle Subkultur näher kennen, eignen sich das kriminelle Handwerk an, werden zu Trägern von Ideologie der kriminellen Welt etc., sondern nehmen weiter Drogen ein. Das wird auch durch die Statistiken belegt: jedes Jahr werden in den Haftanstalten bei den Häftlingen und deren Besuchern große Mengen an Drogen beschlagnahmt.
Wegen übermäßiger Verhängung durch die Gerichte von Haftstrafen für Drogenkonsum sind die Haftanstalten heute überfüllt mit Drogensüchtigen und verwandeln sich nach und nach in eine Art spezielle Wohnheime für Drogensüchtige und Drogenhändler. Die Statistiken besagen, dass der Anteil von Personen, die wegen Drogenhandel eine Haftstrafe bekommen haben, mindestens ein Drittel von der Gesamtzahl der Verurteilten ausmacht.
Dieses Einzelbeispiel (und solche Beispiele gibt es leider mehr als genug) unterstreicht ein weiteres Mal die gesamte Tiefe und Bedeutung des neuen Grundlagenwerkes von Prof. I.Rahimov für die Vervollkommnung der einheimischen Strafgesetze, die Humanisierung des strafgerichtlichen Verfahrens, die Zügelung übermäßiger Kriminalisierung und der Verhängung zu harter Strafen.
Es ergibt sich jedoch die Frage: „Wird der aserbaidschanische Gesetzgeber diese wertvollen Vorschläge und Empfehlungen von Prof. I.Rahimov beherzigen oder – wie früher schon der Fall gewesen – einfach ignorieren, so dass diese wissenschaftliche Ideen und Konzepte nur auf Papier bleiben?“
Wie Prof. I.I.Karpez geschrieben hat: „...auf jeden Fall muss man auch nach vorne schauen. Jeder Vorschlag, der zur besseren Kriminalitätsbekämpfung beiträgt, ist in diesem Sinne ein Blick nach vorne. Es kann nicht sein, dass die Gesellschaft keine Kraft findet, wieder auf die Beine zu kommen. Aber auch wenn sie wirtschaftlich, politisch und sozial auf die Beine kommt, wird sie einen Kampf gegen die Kriminalität führen müssen. Und wenn es dem so ist, werden die heute aufkommenden Vorschläge helfen, seine Sache morgen besser zu tun.“7
* * *
Auch die beiden nachfolgenden Kapitel des Buches sind zweifelsohne von Interesse. Darin wird das sittliche Prinzip der Strafe, deren Gerechtigkeit und vernünftige Anwendung sowie die Problematik der Todesstrafe erörtert.
I.Rahimov beginnt die Behandlung dieser philosophischer, moralischer und rechtlicher Fragen mit einer Analyse der Äußerungen von Philosophen und Schriftstellern, Juristen und Psychologen über die Strafe sowie mit der Suche nach einem Algorithmus, der für eine vernünftige Strafanwendung sorgen, „Vorteile, einen Nutzen und das Gute bringen sowie einen Schaden und das Böse abwenden“ würde, denn „eine Strafe ist nützlich, falls sie imstande ist, ein größeres Übel als sie selbst zu beseitigen“.
Als eine Vorbedingung für die Lösung dieses Problems wird vom Autor eine Überprüfung der Zielsetzung von Verbrechensbekämpfung vorgeschlagen, „denn ein Kampf setzt letztendlich den Siege einer der kämpfenden Seiten (im gegebenen Fall entweder des Staates oder der Kriminalität) oder ein Unentschieden voraus (in diesem Fall hört der Kampf auf). Aber dieser historischer „Kampf“ wird bis heute fortgesetzt und wird nach unserem Dafürhalten kaum durch den Sieg einer der beiden Seiten beendet, solange die Menschheit existiert“.
Die zweite grundsätzliche These des Autors besteht im Folgenden: der Staat und dessen Rechtsschutzorgane müssen ihre überhöhte Vorstellungen über die Rolle der Strafe bei der Verbrechensbekämpfung überprüfen und die Strafe nicht als ein Allheilmittel gegen alle sozial-rechtlichen Erscheinungen krimineller Art ansehen.
„Die Strafe“, schreibt I.Rahimov, „ist nicht imstande, nur mit eigenen Kräften die böswillige Absicht einer Person lahmzulegen, weil sie nicht auf die äußere Ursache einer Straftat, sondern auf den inneren Willen des Täters einwirkt. Deshalb müssen wir nicht nur Strafe und Abschreckung nutzen, sondern auch solche Mittel einsetzen, welche imstande sind, die eigentlichen Ursachen zu beseitigen, den Charakter von Verbrechensfaktoren zu verändern“.
Zu unbestrittenen Vorzügen der neuen Monografie von Prof. I.Rahimov zähle ich die Tatsache, dass darin erstmals in der aserbaidschanischen strafrechtlichen und kriminologischen Literatur das Problem der Prognostizierung strafrechtlicher Gesetzesschöpfung formuliert und behandelt wird, deren Aufgabe darin besteht, eine effektive und zweckmäßige Strafe zu bestimmen. Und dies bedeutet: „… beim Aufbau einer strafrechtlichen Sanktion muss der Gesetzgeber ein entsprechendes Programm zusammenstellen, das eine klare und konkrete Darlegung von Etappen und Zielen, von Methoden zur Erfassung und Auswertung von Primärdaten bezüglich der Struktur, der Dynamik und des Gesamtzustandes der Kriminalität sowie einer konkreten Verbrechensart enthält“.
Nach Ansicht des Autors, „gibt die praktische Prognostizierbarkeit in der strafrechtlichen Gesetzesschöpfung die Möglichkeit, den Nutzungsgrad einer Strafe zu erhöhen, und macht somit die Strafe effektiver“.
Ein anderes Schlüsselthema im dritten Kapitel der Monografie ist das Problem der Gerechtigkeit der Strafe, deren Angemessenheit dem Schweregrad der begangenen Straftat und des Ausreichens zur Gewährleistung sozialer Gerechtigkeit.
Bei der Analyse dieses Problems geht der Autor davon aus, dass „eine gerechtе Vergeltung, d.h. eine sichtbare Gleichheit zwischen Straftat und Strafe, muss quasi eine Grenzlinie sein, die der Gesetzgeber nicht überschreiten darf. Das Überschreiten dieser Linie würde ein Überschreiten der Grenze zwischen moralischer und unmoralischer Nutzung der Strafe als Mittel zur Erreichung politischer und wirtschaftlicher Ziele und nicht zur Prävention krimineller Erscheinungen bedeuten“.
Die Monografie enthält eine detaillierte Analyse der „Bentham-Regeln“ über die Angemessenheit der Strafe, mathematischer Methoden zur Gewährleistung einer Gleichheit zwischen Straftat und Strafe, der Skalierungsmethode von N.Orangirejew sowie weiterer Ansichten zu dieser Frage.
Ausreichendes Augenmerk hat der Autor auch der Erforschung von Gerichtspraxis in den USA gewidmet, wo seit 1985 die Bundesrichter bei der Verhängung der Strafe sich nicht allein von entsprechenden Gesetzen, sondern auch von den Empfehlungen einer Kommission zur Verhängung von Strafen leiten lassen müssen. Diese Kommission besteht aus Experten auf verschiedenen Gebieten von Recht, Wirtschaft und Psychologie und wirkt im USamerikanischen Gerichtssystem als unabhängiges Organ.
Zum Schluss meiner ausführlichen Analyse der neuen Monografie von Prof. I.Rahimov möchte ich auch auf einige Thesen des vierten Kapitels kurz eingehen.
Darin behandelt der Autor die Problematik der Todesstrafe, darunter auch deren Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte, Anwendungspraxis und –häufigkeit in verschiedenen Ländern der Welt etc. Dabei gilt besonderes Augenmerk der Behandlung sittlicher Grundlagen der Existenz und Anwendung von Todesstrafe für ausgewählte Verbrechensarten sowie deren Auswirkung auf Dynamik und Struktur von Gewaltverbrechen.
Prof. I.Rahimov geht von den heute verbreiteten Ansichten zur Todesstrafe aus und bestreitet nicht, dass sie „ohne Zweifel ekelhaft, schädlich und unmoralisch ist“, stellt sich aber zugleich der Frage: „Ist denn die Todesstrafe wirklich nutzlos und schädlich, ungerecht und somit unmoralisch?“.
Wie verfährt man aber dann mit den unmittelbar Schuldigen an der Tragödie von Beslan, wo am 1. September 2004 als Folge eines Terroranschlags 334 Menschen ums Leben gekommen sind, darunter 186 Kinder? Oder: inwieweit entspricht den Grundprinzipien von Gerechtigkeit jene Strafe, die ein norwegisches Gericht dem Terroristen Anders Breivik verhängt hat und die er in einer Luxus-Suite in einem Gefängnis verbüßt? Durch seinen Terroranschlag starben doch am 22. Juli 2011 im Zentrum von Oslo 77 Menschen, 151 wurden verwundet…
Und was macht man mit den Terroristen, die am 31. Oktober 2015 in Ägypten in den Laderaum der russischen Passagiermaschine Airbus A321 Flugnummer 9268 eine Bombe gelegt hatten, durch deren Explosion 224 Passagiere und Besatzungsmitglieder ums Leben kamen?
Oder: haben ein Recht auf Leben die Terroristen, die am 13. November 2015 im Zentrum von Paris eine Serie von Terroranschlägen durchgeführt haben, als deren Ergebnis über 150 Menschen getötet und über 300 verwundet wurden?
So grauenhafte Vorfälle gab es in zurückliegenden Jahren mehr als genug sowohl in einzelnen Regionen als auch weltweit.
Ist es nicht so, dass in jedem dieser Fälle die Terroristen durch die grausame Tötung unschuldiger Menschen, darunter auch von Kindern, sich über den Rahmen von Mensch stellen? Wieso ist dann die Gesellschaft verpflichtet, Rechte und Freiheiten, die eben Menschen und Bürgern zustehen, auch für diese Leviathane gelten zu lassen?
Nicht zu leugnen ist innere Logik auch in folgender Fragestellung: „Auf welcher Gerechtigkeitswaage haben die Befürworter der Aufhebung von Todesstrafe ermittelt, dass in dieser Angelegenheit das Prinzip der Sittlichkeit gegenüber den Terroristen eine höhere Priorität hat als die sittliche Haltung gegenüber den unschuldigen Opfern ihrer Gräueltat?“
Vielleicht handeln die Regierungen von einem Dutzend Länder (China, USA, Japan u.a.) weise, indem sie die Pyramide der Sittlichkeit von Todesstrafe nicht auf den Kopf stellen, sondern in ihrer Strafgesetzgebung die Todesstrafe für die schwersten Straftaten gegen die Person beibehalten haben?
Ich glaube, dass auch für uns die Zeit gekommen ist, auf die im politischen Treibhaus Europas künstlich gezüchtete Pseudosittlichkeit und auf den Pseudohumanismus gegenüber Terroristen, Serien- und Lustmördern etc. zu verzichten, die schonungslos unschuldige Menschen töten, und im Interesse der Sicherheit der überwiegenden Mehrheit von Bevölkerung für einzelne Arten besonders schwerer Verbrechen, die den Tod unschuldiger Menschen verursacht haben, die Todesstrafe wiedereinzuführen.
Deshalb bin ich solidarisch mit der Meinung von Prof. I.Rahimov darüber, dass „viele moderne Staaten es mit ihrer Entscheidung über die Aufhebung von Todesstrafe überstürzt haben …“.
Allerdings ist hier ein ziemlich starkes Argument in Erwägung zu ziehen, welches die Gegner von Todesstrafe parat haben und welches sich praktisch unmöglich entkräften lässt, weil es auf der Hand liegt. Gemeint sind zahlreiche Gerichtsfehler, welche die Strafrechtsprechung in keinem Land der Welt vermeiden konnte.
Als Beispiele für das Gesagte können der berühmte Rechtsfall von Witebsk, der Rechtsfall des Serienmörders Tschikatilo sowie viele andere Rechtsfälle dienen, wo während des Gerichtsverfahrens unschuldige Menschen für schuldig befunden und zum Tode verurteilt wurden, was erst nach der Vollstreckung der Todesstrafe festgestellt wurde.
* * *
Natürlich wäre es naiv zu erwarten, dass es im engen Rahmen eines Vorwortes gelingen kann, den gesamten Komplex grundlegender Probleme im Zusammenhang mit den sittlicher Grundlagen der Strafe zu analysieren, die Gegenstand der Monografie sind.
Diese Probleme sind so groß und vielfältig, dass selbst deren Stichpunktanalyse erfordert, eine Rezension zu schreiben, die dem Umfang nach jedenfalls größer als das begutachtete Werk sein würde.
Deshalb möchte ich meine Überlegungen über die neue Monografie von Prof. I.Rahimov damit abschließen und die Gewissheit zum Ausdruck bringen, dass sie bei mehreren Generationen von Strafrechtlern und Kriminologen gefragt sein wird und die darin enthaltenen Empfehlungen auch nach Jahrhunderten aktuell bleiben.
Prof. Dr. Dr. jur. H.D. Alikperow
EINFÜHRUNG
Ich bin das, was jetzt ist, was früher gewesen und was sein wird – und keiner hat bisher mein Inneres erkannt.
Aufschrift an einem antiken Tempel
Kein anderes strafrechtliches Problem hat wohl so kompliziertes, rätselhaftes und uraltes Schicksal wie die Strafe. Diese entstand zeitgleich mit der Entstehung der Spezies Mensch. Was ist das aber für ein Phänomen? Ist denn die Rechtswissenschaft imstande, die Frage über den Begriff und das Wesen der Strafe eigenständig zu beantworten? Manchmal scheint es, dass die Strafe mit zu jenen Begriffen gehört, die für jeden recht einfach und einleuchtend sind. Wir machen uns jedoch keine Gedanken über die Schwierigkeiten, mit denen nicht nur die Rechtswissenschaft, sondern auch die Philosophie und die Geschichte konfrontiert werden bei einem Versuch, diesen scheinbar klaren Begriff genau zu beschreiben. Selbst dem eigentlichen Wort „Strafe“ werden nicht nur in der Alltagssprache, sondern auch in der Literatur – darunter auch in strafrechtlichen Fachbüchern – ganz verschiedene Bedeutungen zugeordnet. Dabei hängt gerade von der Eindeutigkeit oder Ambivalenz dieses Begriffes die Wahrhaftigkeit oder Falschheit, Konsequenz oder Inkonsequenz der gesamten Strafrecht-Theorie sowie Nachhaltigkeit oder Hinfälligkeit strafrechtlicher Politik ab.
Wir können sagen: die Strafe sei ein ganz besonderes Mittel in der Hand des Staates, um Menschen von Straftaten abzuhalten. Mit dieser Definition wird lediglich die historische unauflösliche Verbindung der Strafe mit der Straftat hervorgehoben sowie die Tatsache, dass der erstgenannte Begriff dank dem Zweiten entstanden ist. Solch eine formelle Definition des Strafe-Begriffes, wie sie in der Dogmatik des Strafrechts üblich ist, lässt aber leider viele Fragen bezüglich des Wesens und der sozialen Zweckbestimmung dieses Phänomens offen. Bereits die antiken Philosophen gaben sich mit der juristischen, formellen Definition des Strafe-Begriffes nicht zufrieden und sprachen davon, dass die Wahrheit dieses Phänomens sich ausschließlich durch philosophische Kategorien erkennen lässt, denn ausgerechnet diese Kategorien stellen methodologisch universelle Mittel, Instrumentarien und Methoden dar, um die Natur vieler Dinge zu erkennen. Deshalb hat gerade die Philosophie damit begonnen, die Strafe als einen philosophischen Begriff zu betrachten. Es galt nämlich, dass solche Elemente der Strafe wie die Vergeltung, das Böse und das Gute, das Leiden, die Gerechtigkeit, das Ziel, die Nützlichkeit etc. zur Ethik gehören. Und Ethik ist bekanntlich eine philosophische und keine rechtliche Kategorie. Plato verstand zum Beispiel die Strafe als eine Wohltat für den Täter, als Läuterung der Seele8. Andere Philosophen hatten umgekehrt behauptet, die Strafe sei ein Übel, weil sie doch dem Täter Schaden zufügt.9 Wenn die Philosophen die Strafe als das Gute oder das Böse hinstellen, tangieren sie die Welt der Sittlichkeit, weil beides keine rechtlichen, sondern ethische Begriffe sind.