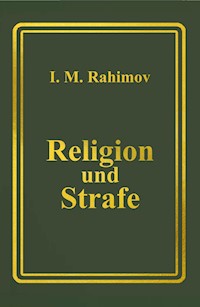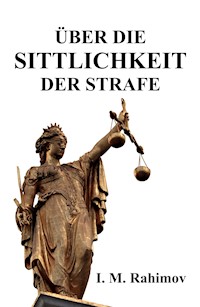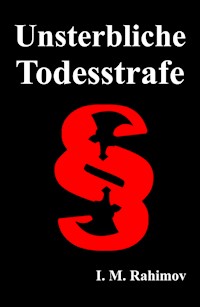
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die vorliegende Arbeit ist eine Fortsetzung der Überlegungen des Autors über das philosophische Wesen der Strafe, die er zuvor in den Büchern »Kriminalität und Strafe« (»Prestupnostj i nakasanije« - Moskau, 2012), »Philosophie der Straftat und der Strafe« (»Filosofija prestuplenija i nakasanija« - Sankt Petersburg, 2013) dargelegt hat. Darin wird behauptet, dass die Rechtswissenschaft lediglich eine formelle Definition der Strafe geben kann und unfähig sei, mehr zu bieten. Das Philosophieren über das Wesen dieses Phänomens gibt uns hingegen die Möglichkeit, zu versuchen, sich in dessen Sittlichkeit einzumischen, es den Kategorien zuzuordnen, welche in der Philosophie erarbeitet wurden. Ist die Strafanwendung überhaupt sittlich, insbesondere wenn es um die Todesstrafe geht? Handelt es sich bei der Strafe um Vergeltung, Abschreckung oder um psychologische Einwirkung? Worauf beruht die Sittlichkeit der Strafe? Vermag die Gesellschaft mittels Strafe jene Ziele zu erreichen, welche sie sich dabei gesetzt hat? Ist es in der heutigen Situation möglich, auf die Strafe gänzlich zu verzichten? Soweit eine unvollständige Liste von Fragen, die Prof. I. M. Rahimov in dieser interessanten Arbeit zu beantworten versucht. Das Buch richtet sich an Studierende, Forschungsstudenten und Dozenten juristischer Hochschulen, Mitarbeiter von Rechtsschutzorganen, an Theoretiker und Praktiker, die sich auf das Strafrecht spezialisiert haben, sowie an Philosophen, Soziologen und an alle, die sich für die Problematik »Straftat und Strafe« interessieren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 262
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Assoziation Juriditscheskij Zentr
I. M. Rahimov
UNSTERBLICHETODESSTRAFE
UDK 343.2; 343.97
BBK 67.408
R14
Redaktionskollegium
Ju.W.Golik (Leit. Red.), M.T. Agammedow, N.A.Winnitschenko, I.H. Damenija,
I.E. Swetscharowskij, A.W. Semskowa, A.W.Konowalow, S.F.Miljukow, A.W.Saljnikow, A.W.Fjodorow, A.A. Eksarchopulo
Gutachter:
Prof. Dr. Dr. jur. K.N.Salimow
E.Kulijew – Übertragung der Koranstellen ins Russische sowie die Auslegung deren Kommentare
I.M. Rahimov
Unsterbliche Todesstrafe / Vorwort von Prof. Dr. Dr. jur. Sch.T. Samedowa. — Sankt Petersburg: Verlag „Juriditscheskij Zentr“, 2017. — 192 S.
ISBN 978-5-94201-756-9
Verlag und Druck:
tredition GmbH
Halenreie 40-44
22359 Hamburg
978-3-7469-3858-5 (Paperback)
978-3-7469-3859-2 (Hardcover)
978-3-7469-3860-8 (e-Book)
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar
Die vorliegende Arbeit ist eine Fortsetzung der Überlegungen des Autors über das Wesen von Straftat und Strafe sowie über die Problematik der Todesstrafe, die er zuvor in den Büchern „Philosophie der Straftat und der Strafe“ („Filosofija prestuplenija i nakasanija“ – Sankt Petersburg, 2013), „Über die Sittlichkeit der Strafe“ (O nrawstwennosti nakasanija“ – Sankt Petersburg, 2016) dargelegt hat. Während der Autor in den vorangegangenen ausschließlich auf das philosophische Wesen der Strafe generell und insbesondere der Todesstrafe eingeht, wird im vorliegenden Buch dieses Thema als ein multifunktionelles Problem behandelt und somit im Zusammenhang wechselseitiger Abhängigkeit historischer, religiöser, philosophischer, soziologischer und psychologischer Faktoren untersucht. Der Autor bietet den Lesern die Möglichkeit, nicht nur seine eigenen Betrachtungen über das Phänomen Todesstrafe, sondern auch diverse Meinungen kennenzulernen, die in der wissenschaftlichen Literatur ausgesprochen werden. Durch ein solches Herangehen bekommt jeder einzelne Leser die Möglichkeit, die Frage über das Sein oder Nichtsein von Todesstrafe selber zu beantworten.
Das Buch richtet sich an Studierende, Forschungsstudenten und Dozenten juristischer Hochschulen, Mitarbeiter von Rechtsschutzorganen, an Theoretiker und Praktiker, die sich auf das Strafrecht spezialisiert haben, sowie an Philosophen, Historiker, Soziologen, Psychologen sowie an alle, die sich für die Problematik Straftat und Strafe interessieren.
UDK 343.2; 343.97
BBK 67.408
© I.M. Rahimov, 2017
© Sch.T. Samedowa, Vorwort, 2017
ISBN 978-5-94201-756-9
© Verlag „Juriditscheskij Zentr“, 2017
INHALTSVERZEICHNIS
Vorwort
Einführung
Kapitel I
Geschichte der Todesstrafe
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
Kapitel II
Philosophie der Todesstrafe
2.1
2.2
2.3
Kapitel III
Soziologie der Todesstrafe
3.2
Kapitel IV
Psychologie der Todesstrafe
4.1
4.2
Kapitel V
Die Zukunft der Todesstrafe
5.1
SCHLUSSWORT
Vorwort
In vitium ducit culpae fuga
(In Fehler führt uns Flucht vor Fehlern)
Horaz
Mit dem prägnanten und zugleich aussagekräftigen Titel ist es dem Autor gelungen, gleich den Kern des Problems zu erfassen. Dadurch wird sicherlich erhöhte Aufmerksamkeit auch „zufälliger“ Leser auf das Buch gelenkt. Wir hingegen als getreue Leser wissenschaftlicher Abhandlungen von Professor I. M. Rahimov waren schon seit geraumer Zeit auf das Erscheinen einer wissenschaftlichen Schrift gespannt, die voll und ganz einem der grundlegendsten und strittigsten Probleme der strafrechtlichen Institution Strafe – nämlich der Todesstrafe – gewidmet wäre.
Die in den letzten Jahren erschienenen Monographien des hochgeehrten Professors „Straftat und Strafe“ (Moskau, 2012), „Philosophie der Straftat und der Strafe“ (Sankt Petersburg, 2013), „Über die Sittlichkeit der Strafe“ (Sankt Petersburg, 2016) sind als eine fachübergreifende Trilogie zu betrachten, wo Schritt für Schritt die fundamentalen Grundlagen von Strafrecht und Kriminologie untersucht werden: Straftat und Strafe, die Kriminalität nicht nur aus der Sicht des Rechts, sondern auch aus der Sicht von Philosophie, Geschichte, Religion, Psychologie und Soziologie. Als Fazit der Herausgabe einer Trilogie wird den Lesern eine Fachuntersuchung präsentiert, die komplett einer einzelnen Bestrafungsart – der Todesstrafe – gewidmet ist, wobei die Einstellung zur Todesstrafe in allen Zeiten und in allen Gesellschaften nicht eindeutig gewesen ist.
Die Todesstrafe gehört zu den ältesten Bestrafungsarten. Ursprünglich entstand sie im Zuge der Umsetzung des Talionsprinzips „Auge um Auge“. Gemäß diesem Prinzip gilt die Todesstrafe als eine gerechte Bestrafung für denjenigen, der den Tod eines anderen Menschen verursacht hat. Als Kriminalstrafe war die Todesstrafe in der Gesetzgebung so gut wie aller Länder vorgesehen. Im Laufe der Zeit haben jedoch manche Staaten beschlossen, die Todesstrafe aus dem System der Strafarten auszuschließen. Aber auch in diesem Fall war die Politik von Staaten, die so einen Beschluss gefasst hatten, Schwankungen ausgesetzt: die Zeitperioden ohne Todesstrafe wurden durch deren Wiedereinführung abgelöst. Ende des 20. Jahrhunderts gab es weltweit nur 35 Staaten, die auf die Todesstrafe verzichtet hatten. In den vergangenen dreißig Jahren hat sich deren Zahl verdreifacht. Die Todesstrafe wird heute in 39 Ländern angewendet. Das sind vor allem Länder Afrikas, des Nahen Ostens und Asiens. Dazu gehören jedoch auch solche hochentwickelte Staaten wie die USA, Japan, Singapur und unter den europäischen Staaten Weißrussland (Belarus) – das einzige Land auf dem Kontinent, welches die Todesstrafe nicht nur beibehalten hat, sondern diese auch immer wieder vollstreckt. Wissenschaftliche Aufmerksamkeit und Umdenken verdienen die Angaben der Menschenrechtsorganisation Amnesty International, die besagen, dass im Jahr 2015 die Anzahl der Hingerichteten deutlich gestiegen ist und das höchste Niveau seit 1989 erreicht hat.
Somit ist die Relevanz der Monographie von Prof. I.M. Rahimov unbestritten. Der Autor bleibt sich treu und betrachtet das Problem Todesstrafe als Kriminalstrafart in einem breiten Zusammenhang, in wechselseitiger Abhängigkeit sämtlicher sozial-ökonomischer, politisch-rechtlicher und geistig-sittlicher Faktoren.
Das erste Kapitel der Monographie beschäftigt sich mit der Geschichte der Todesstrafe. Darin werden Entstehung und Evolution der Institution Todesstrafe aufgezeigt. Der Autor hat völlig Recht mit der Behauptung, dass das biblische Gebot „Du sollst nicht töten!“ sich nicht auf die Anwendung der Todesstrafe zur Ahndung von Verbrechern, sondern auf Personen bezieht, die vorsätzlich Mord an anderen Mitgliedern der Gesellschaft begehen. Deshalb wird die Todesstrafe von der uralten Gesellschaft insgesamt akzeptiert und entspricht deren Vorstellungen über Sittlichkeit und Gerechtigkeit. Weder die Unterschiede in den Bedingungen und Umständen deren historischer Entwicklung, noch deren geografischer Standort oder unterschiedliche religiöse Anschauungen haben sich auf deren Einstellung zur Todesstrafe ausgewirkt. Unterschiedlich waren zu verschiedenen Zeiten lediglich die Methoden der Anwendung von Todesstrafe sowie der Kreis von Straftaten, die mit der Todesstrafe geahndet wurden. Es ist zu vermerken, dass der Blutrache-Brauch, der in vielen Ländern existiert hatte, traditionell als Prototyp der Todesstrafe betrachtet wird, die im Namen des Staates ausgeübt wird. Professor I.M. Rahimov beweist jedoch mit der ihm eigenen wissenschaftlichen Gründlichkeit, dass die Blutrache und die Todesstrafe in der Geschichte der Menschheitsentwicklung ihrem Wesen nach zwei völlig unterschiedliche Erscheinungen sind. Die Blutrache sei nicht in die Todesstrafe umgewandelt worden, sondern schlechthin verschwunden als Ergebnis eines gesetzmäßigen und objektiven Prozesses der gesellschaftsökonomischen Entwicklung der Menschheit.
Das zweite Kapitel dieser Monographie ist tiefen philosophischen Einblicken in die Todesstrafe als Kriminalstrafe gewidmet. Angesichts des hohen akademischen Niveaus, welches dem wissenschaftlichen Schaffen von I.M. Rahimov eigen ist, war seine Hinwendung zu einer Studie, die sich mit der Todesstrafe auseinandersetzt, zu den Kategorien Sittlichkeit, Gerechtigkeit und Humanismus durchaus zu erwarten. Der Autor appelliert an die Ideen von Hegel und Plato darüber, dass „die Jura ein Teil von Philosophie sei“, wendet sich aber zugleich gegen „die Spekulationen mit der Sittlichkeit als philosophische Kategorie“ und polemisiert mit manchen Philosophen, Juristen und sogar mit klassischen Schriftstellern (W.S. Solowjow, A.Ju. Kisilow, Émile Durkheim, Ernst Haeckel, Cesare Beccaria, A.P. Tschechow, L.N. Tolstoi, W.D. Nabokow u.a.). In dieser Diskussion imponieren mir offen gestanden mehr die im Buch aufgeführten Standpunkte von Plato, Horaz, Seneca, Kant und Hegel: „Die Todesstrafe wird nicht um der begangenen kriminellen Tat willen, sondern dazu auferlegt, deren Wiederholung in der Zukunft zu verhindern“; „das Böse ist mit dem Bösen zu bezahlen, allein die Vergeltung nach dem Gleichheitsprinzip vermag das Maß und den Umfang der Strafe bzw. die Gleichheit nach der Einwirkungsstärke zu bestimmen“, weil sie den Zielen der Kriminalstrafe im zeitgenössischen Strafrecht – spezielle und allgemeine Prevention und soziale Gerechtigkeit – am meisten entsprechen.
Deshalb halte ich die Schlussfolgerung von Professor I.M. Rahimov, dass „die Anwendung der Todesstrafe, d.h. das Recht auf diese Strafart nur dann berechtigt sei, wenn es eine gerechte Vergeltung ist“, für korrekt und angemessen begründet – sowohl vom philosophischen als auch vom rein rechtlichen Standpunkt aus. „Je höher ein Menschenleben bewertet wird, desto härter muss auch die Bestrafung für dessen Auslöschen sein“; „die Todesstrafe … darf nur bei vorsätzlicher Tötung angewendet werden, nur so lässt sich die Gerechtigkeit der Vergeltung spüren“ – mit diesen Behauptungen wehrt sich der Autor gegen die Todesstrafe-Gegner, welche die eigene Position mit der Unsittlichkeit der genannten Strafart begründen, und hält dabei die Gegenüberstellung des Gerechtigkeitsprinzips und der Sittlichkeitskategorie für unzulässig.
Das dritte Kapitel der Monographie gilt der Untersuchung der Soziologie der Todesstrafe, wo doch der Autor bereits im vorangegangenen Kapitel zur Schlussfolgerung gelangt ist, dass zum Nachweis der Gerechtigkeit des Bestehens der Todesstrafe als Kriminalstrafe die Nützlichkeit und Wirksamkeit dieses Mittels im Kampf gegen die schwersten Mordfälle zu klären ist, was eine soziologische Untersuchung der praktischen Anwendung der Todesstrafe erfordert. Zur Ermittlung der Wirksamkeit von Todesstrafe wird vorgeschlagen, die Wirksamkeit des lebenslänglichen Freiheitsentzugs als Ersatz für die Todesstrafe zu ermitteln. Zur Ermittlung der Wirksamkeit einer Strafe wird vom Autor wiederum vorgeschlagen, jeweils die Zahl von Straftaten zu nutzen, bei denen lebenslängliche Freiheitsstrafe vorgesehen ist: falls die Kriminalitätsrate systematisch zunimmt, kann man annehmen, dass die Todesstrafe wirksamer als deren Alternative gewesen ist. Weiter werden in der Monographie vier Wirkungsgrade unterschieden sowie konkret darauf hingewiesen, dass „die Nützlichkeit der Todesstrafe in der Regel durch deren Wirkungsgrad in Bezug auf die vorsätzlichen Mordfälle bestimmt wird“. Dabei wird vom Autor an vielen Beispielen völlig zu Recht auf die Manipulierung statistischer Daten über die Wirksamkeit der Todesstrafe verwiesen – je nachdem, welchen Standpunkt gegenüber dieser Strafart jene Person vertritt, die sich mit der Erfassung und Auswertung der Statistiken befasst. Professor I.Rahimov bezieht sich auf zahlreiche Untersuchungen über die Wirksamkeit der Todesstrafe, die in verschiedenen Staaten (die USA, die Schweiz, Belgien, Russland, Polen u.a.) vorgenommen worden sind, und gelangt dabei zum Schluss, dass kein direkter Zusammenhang zwischen der Abschaffung bzw. Anwendung der Todesstrafe und dem Rückgang bzw. Anstieg der Zahl begangener vorsätzlicher Morde besteht. Eine Analyse der Kriminalitätslage in der Republik Aserbaidschan in den Jahren 1992-2016, die vom Autor aufgeführt wird, lässt ihn feststellen, dass nicht das Aussetzen der Vollstreckung der Todesstrafe die Ursache für die gestiegene Anzahl vorsätzlicher Mordfälle im Zeitraum 1992 bis 1999, sondern die instabile Lage in der Stadt sowie das Vorhandensein bei der Bevölkerung gesetzwidrig gekaufter Schusswaffen gewesen ist. Ebenso ist die Ursache für den Rückgang vorsätzlicher Mordfälle seit 1999 nicht die Abschaffung der Todesstrafe, sondern die Stabilisierung der Situation im Land.
Im vierten Kapitel, das der Psychologie der Todesstrafe gewidmet ist, wird der Mechanismus der Einwirkung der Todesstrafe auf das Verhalten von Menschen untersucht. Es werden folgende Bestandteile des Einwirkungsmechanismus genannt: Überzeugung, Abmahnung und Abschreckung. Dabei vermerkt der Autor gleich am Anfang, dass es manchmal unmöglich sei, auf wenig entwickelte Menschen logisch einzuwirken, so dass der Überzeugungsmechanismus, der die Logik anspricht, keine Wirkung zeigt. Daraus schließen wir, dass am Mechanismus der psychologischen Einwirkung der Todesstrafe auf das menschliche Verhalten Abmahnung und Abschreckung die wichtigste Rolle spielen. Die Bedeutsamkeit und Nützlichkeit der psychologischen Abschreckung mittels Bestrafung – darunter auch mittels Todesstrafe – sind unmittelbar mit der Klärung der wichtigsten Frage verbunden: ist das kriminelle Verhalten eines Menschen mit seinem Wesen, also mit ihm selbst verbunden oder ist es ein Resultat äußerer Faktoren? Nach der Ansicht von Professor I.Rahimov lässt sich ein enges Zusammenwirken zwischen den Naturwissenschaften und den gesellschaftlichen Wissenschaften über den Menschen und sein Wesen unmöglich vollständig ohne die Psychologie gewährleisten, die imstande ist, alle Einzelfächer für die Zwecke der Erkenntnis eines immer noch unerforschten Wesens – nämlich des Menschen – zu vereinen. In diesem Zusammenhang möchte ich auf eine Besonderheit bei der Darlegung des Untersuchungsstoffes durch Prof. I.M. Rahimov hinweisen. Er baut die Architektonik seiner wissenschaftlichen Untersuchung stets auf solche Art und Weise, dass der Leser stets angeregt wird, sich über die Einschätzung des Dargelegten und die Schlussfolgerungen Gedanken zu machen. Und erst nachher -nachdem der Leser selber seine eigene Einschätzung der angeführten Fakten und der Positionen aus diversen Quellen gegeben hat – folgt der Standpunkt des Autors selbst. Von diesem Kunstgriff des Autors bin ich wirklich fasziniert, weil die Übereinstimmung der Standpunkte zu den jeweiligen Aspekten einer wissenschaftlichen Untersuchung mit einem herausragenden Wissenschaftler und Theoretiker des zeitgenössischen Strafrechts die eigene Wertschätzung als Wissenschaftler erhöht.
Das abschließende Kapitel der Monographie heißt „Die Zukunft der Todesstrafe“, In diesem Teil seines Werkes wendet sich der Autor erneut den Ideen von großen Denkern verschiedener Epochen hinsichtlich der Einstellung zur Todesstrafe zu. Dabei vertritt er den Standpunkt, dass das Auftreten von neuen Ideen, Ansichten und Theorien über das Wesen und die Bedeutung der Todesstrafe als strafrechtliche Sanktionsform mit den beiden großen Erscheinungen in der Menschheitsgeschichte – Humanismus und Reformation – verbunden sind, die in den europäischen Gesellschaften seit dem 17. Jahrhundert beginnen. Das 18. und das 19. Jahrhundert lassen sich bereits als eine Zeit der Einschränkung und sogar des zeitweisen Verzichts auf die Todesstrafe in manchen europäischen Staaten charakterisieren. Seit Mitte des 20. Jahrhunderts beschleunigt sich der Prozess des Verzichts auf die Todesstrafe als Bestrafungsart, bedingt durch die zunehmende Rolle des Völkerrechts und dessen integrative Einwirkung auf die Nationalgesetzgebungen von Einzelstaaten. Eine wichtige Rolle gehört dabei insbesondere dem Europa-Rat: eine Voraussetzung für den Beitritt ist die Unterzeichnung des 6.Zusatzprotokolls zur Europäischen Menschenrechtskonvention über die Abschaffung der Todesstrafe außerhalb der Kriegsgerichtsbarkeit. Die Republik Aserbaidschan hat übrigens bereits ein paar Jahre vor dem Beitritt zur Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten und zum Europa-Rat die Todesstrafe abgeschafft. Als Grund für die Abschaffung der Todesstrafe im Jahr 1998 diente der Beitritt zum Zweiten Fakultativprotokoll zu dem Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte, das auf die Abschaffung der Todesstrafe gerichtet war. Zugleich verweist Prof. I.M. Rahimov völlig zurecht darauf, dass die UdSSR-Nachfolgestaaten (ebenso wie die Staaten Osteuropas) aus politischen Erwägungen auf die Todesstrafe verzichtet haben. Im gleichen Atemzug rechtfertigt er selber ein solches Herangehen: „…das Problem Todesstrafe ist nicht nur mit ethischen, historischen, sozialen, religiösen und kriminogenen Aspekten, sondern unter den heutigen Bedingungen in einem stärkeren Maße mit der politischen Zweckmäßigkeit unmittelbar verbunden“.
Man kann nicht umhin, auch den Schlussfolgerungen des Autors zuzustimmen, dass der Verzicht auf die Todesstrafe keineswegs ein Kennzeichen für das Niveau der sittlichen und kulturellen Entwicklung des Volkes sei. Er stellt ziemlich deutlich und in etwas scharfen Tönen fest, dass „wenn die Europäer, die als erste die Todesstrafe abgeschafft haben, behaupten, dieses Strafmaß sei unmoralisch, ist diese Behauptung nur in dem Sinne gerechtfertigt, dass zwischen den Europäern und den anderen bestimmte Unterschiede bestehen, was das Verständnis des Sittlichkeitsbegriffes insgesamt und bezogen auf diese Strafart insbesondere betrifft“. Diese Behauptung stimmt hundertprozentig. So bin ich der Ansicht, dass es unmoralischer und sogar blasphemisch ist, dass der Terrorist und Nationalist Anders Breivik, der 77 Menschen vorsätzlich getötet hat, lediglich eine Freiheitsstrafe von 21 Jahren zu verbüßen hat (mit der Option, dass diese Haftfrist danach eventuell um weitere 5 Jahre verlängert wird). Aufgrund einer einfachen arithmetischen Kalkulation können wir feststellen, dass die europäische Justiz die Tötung jedes einzelnen Breivik-Opfers mit einer Freiheitsstrafe von nur 3,3 Monaten bewertet hat. Ganz zu schweigen davon, dass der Mörder seine Haftstrafe in einer komfortablen Gefängniszelle verbüßt, die aus drei Zimmern besteht; damit wird der Sinn der Bestrafung als Ahndung praktisch zunichte gemacht. Es gibt auch ein anderes Beispiel. Neulich ging durch die Medien die Nachricht über die Anwendung der Todesstrafe im Fall von Ismail Dschafarsade, der im Iran ein 7jähriges Mädchen missbraucht und getötet hat. Ich stelle eine rhetorische Frage. in welchem der beiden Fälle entspricht das verhängte Strafmaß dem Schweregrad des verübten Verbrechens, so dass wir über das Erreichen sozialer Gerechtigkeit reden können?
Zum Schluss sei vermerkt, dass ich mit der Hauptschlussfolgerung der monographischen Untersuchung völlig solidarisch bin: die Todesstrafe darf nur in jenen Fällen zur Anwendung kommen, wenn sie notwendig und nützlich ist; der wichtigste Gradmesser hinsichtlich der Todesstrafe muss eben das Gerechtigkeitsprinzip sein. Es ist ungerecht, einen wegen der Tötung von zwei und mehr Personen unter erschwerenden Umständen zu einer lebenslänglichen Haftstrafe Verurteilten jahrelang zu Lasten des Staatshaushalts zu versorgen, wo doch dieser Haushalt unter anderem auch aus den Mitteln von Opferangehörigen gebildet wird. Der humane Charakter des Strafrechts muss nicht im Verzicht auf das Prinzip der Übereinstimmung des verhängten Strafmaßes mit dem Schwergrad des verübten Verbrechens, sondern im Ausschließen der Anwendung von Todesstrafe gegenüber bestimmten Personenkategorien (Minderjährige, Frauen und Senioren) sowie in der Auswahl humaner Vollstreckungsmethoden zum Ausdruck kommen.
Wie wir sehen: trotz des vor sich gehenden Absterbens der Todesstrafe ist dieser strafrechtlichen Sanktionsart die Unsterblichkeit gesichert. Es werden noch mehrere Generationen von Philosophen, Juristen, Soziologen, Psychologen und Politikern das eigene Verständnis von Pro und Contra die Todesstrafe verteidigen. Es werden neue diesbezügliche Theorien entwickelt und neue wissenschaftliche Werke herausgebracht werden. Der Monographie von Prof. Ilham Mamedhasan oğlu Rahimov gebührt in dieser Reihe ein würdiger Platz dank ihrer Wissenschaftlichkeit und Verständlichkeit.
Dr. Dr. jur. Sch.T. Samedowa,
Prof. am Lehrstuhl für Strafrecht und Kriminologie, Stellv. Dekanin für Forschungsarbeit der Jurafakultät an der Staatsuniversität Baku
Bevor im Menschen der erste Funke
der Einsicht geblitzt hat,
warum und wozu die Strafe existiert,
hat diese bereits seit langem existiert und gewirkt.
A.F. Kostjakowskij
Einführung
Die Geschichte der Todesstrafe ist ohne Zweifel eine Geschichte menschlicher Vorstellungen über diese Bestrafungsart. Obwohl der Begriff Todesstrafe auf den ersten Blick recht simpel, zugänglich und verständlich erscheint, gibt es keine einheitliche, für alle Zeiten allgemein anerkannte Definition für das Wesen und die Bedeutung dieses Phänomens. Oft haben wir keine klare Vorstellung über jene Schwierigkeiten, mit denen die Vertreter verschiedener Forschungsrichtungen konfrontiert werden, wenn sie versuchen, diese Bestrafungsart genau zu beschreiben. Das ist nicht verwunderlich, denn im Strafrecht-Bereich gibt es kein anderes Problem, das in ihrer kultur-historischen Bedeutung wenigstens annähernd mit dem Problem Todesstrafe vergleichbar wäre. Keine andere Frage bringt die Gedanken, Gefühle und Sitten des Volkes beliebiger Epoche besser zum Ausdruck, keine andere Strafform ist so eng mit allen Phasen der sittlichen Entwicklung des Volkes verbunden, wie die Todesstrafe. Gerade in dieser Strafform widerspiegelt sich die Individualität des Volkes, dessen Ruhe und Leidenschaften sowie dessen Entwicklung, also seine Seele. Falls die Geschichte keine Zeugnisse über irgendwelches Volk bewahrt hat – außer der Dimensionen der Anwendung von Todesstrafe und deren Vollstreckungsformen -, so ist das bereits ausreichend, um eine klare Vorstellung über das Niveau dessen sittlichen und kulturellen Entwicklung in einer bestimmten Etappe des historischen Prozesses zu gewinnen.
Die Todesstrafe als Strafart ist ein multifunktionelles und ungewöhnliches Mittel nach dem Verständnis der Altgriechen bzw. ein „Ding in sich“ laut Immanuel Kant. Einerseits ist es eine historische Erscheinung, weil die Todesstrafe als Institution der Bestrafung nicht durch ein einziges Volk und nicht durch eine einzige historische Epoche geschaffen worden, sondern ein Produkt der gesamten Menschheit ist. Andererseits ist es ohne philosophische Aufarbeitung unmöglich, den wahren Sinn des Begriffes und des Wesens der Todesstrafe zu begreifen, weil doch die Grenzen, der Inhalt und die Ziele jeder Strafe eben auf der Grundlage sittlicher Grundprinzipien aufzubauen sind. Wenn man dabei diese Strafe vom Standpunkt deren Entwicklung betrachtet, fällt sofort auf, dass deren Charakter in der Wirklichkeit seit jeher durch deren „Philosophie“ bestimmt wird, während sich diese Philosophie ständig wandelt in Abhängigkeit von der allgemeinen Entwicklung des menschlichen Denkens in Richtung zu einem immer humanistischeren Blick auf den Inhalt, die praktische Anwendung und Ausführung der Todesstrafe. Des Weiteren, ohne sich auf jene Angaben zu beschränken, die uns die Entwicklungsgeschichte der Strafarten insgesamt und der Todesstrafe insbesondere sowie die theoretische philosophische Erkenntnis dieses Phänomens liefert, macht es sich erforderlich, im Interesse einer tiefgründigeren Erforschung auch die Angaben von Soziologie und Psychologie heranzuziehen.
Kurz ausgedrückt: das Problem Todesstrafe muss man in einem größeren Zusammenhang, in wechselseitiger Abhängigkeit historischer, religiöser, philosophischer, soziologischer und psychologischer Faktoren betrachten und untersuchen. Wie es im Falle einer schweren Krankheit vorkommt, wird hier ein „Konsilium“ aus Vertretern verschiedener Wissenschaften benötigt. Bekanntlich wurden über kein anderes Problem des Strafrechts oder anderer Rechtsgebiete so viele Bücher verfasst wie über die Todesstrafe. Kein einziger namhafter Philosoph hat dieses Problem verschmäht und es unterlassen, seine Einstellung zum höchsten Strafmaß zu äußern. Wir sind uns dessen bewusst, dass es schwer erfüllbare Aufgabe sei, etwas Neues über die Todesstrafe zu sagen. Indem wir unseren Beitrag zur Erörterung dieses schwierigen Problems leisten wollen, erheben wir selbstverständlich keinen Anspruch auf die erschöpfende Darlegung aller Fragen und erst recht auf die Wahrhaftigkeit und Unbestreitbarkeit eigener Ansichten. Unser Anliegen ist bescheidener: den Lesern die Möglichkeit zu bieten, nicht allein unsere Betrachtungen über dieses komplizierte Phänomen, sondern auch die wichtigsten Standpunkte kennenzulernen, die in der wissenschaftlichen Literatur vertreten werden. Damit jeder die Frage über das Sein oder Nichtsein der Todesstrafe selber beantworten kann. Wir verstehen, dass es heute bequem ist, ein Gegner dieser schrecklichsten, widerwärtigsten und für den Staat unbeschwerlichsten Strafart zu sein. Aber selbst die bedeutendsten Wissenschaftler und Denker, die gegen diese Strafmaßnahme auftreten, haben stets ihre Meinung mit bestimmten Vorbehalten und Bedenken vorgebracht. Wir hingegen, wobei wir die Todesstrafe vom sittlichen Gefühl aus ablehnen, haben im Grunde immer noch große Zweifel hinsichtlich Nützlichkeit und Gerechtigkeit dieser Strafart als Mittel gegen die grausamsten vorsätzlichen Morde, die in unserer heutigen Wirklichkeit leider immer noch vorkommen.
Kapitel I
Geschichte der Todesstrafe
Der Autor des Werkes „Die positive Philosophie“ Auguste Comte hat sehr treffend gesagt: jede Konzeption kann nur dann richtig verstanden werden, wenn deren Historie bekannt ist. Demzufolge muss das Begreifen des Wesens und der Bedeutung der Todesstrafe mit der Betrachtung der Entstehung und Evolution der Idee dieses historischen Phänomens beginnen. Auch wenn wir der Ansicht sind, dass die Frage über die Entstehung und Existenz der Todesstrafe von theologischen Positionen aus nicht zu lösen ist, darf deren Bedeutung bei der Erörterung dieses Problems dennoch nicht unbeachtet bleiben, weil sie mit den Anschauungen des Volkes auf diese außerordentliche Strafart, bei der einem Menschen das gottgegebene Leben genommen wird, aufs Engste verbunden sind. Es sei darauf hingewiesen, dass beim Fehlen von Rechtsnormen die Brauche und Traditionen schon immer von der Religion geheiligt wurden, somit eine verbindliche Kraft erlangten und nämlich von allen Religionen legitimiert wurden. Die Unanfechtbarkeit eines Brauchs wurde durch die heidnische Religion der Urmenschen aufrechterhalten, laut deren Aberglauben „der Schatten eines getöteten Menschen keine Ruhe finden kann, solange der Mörder nicht mortifiziert ist“1 Deshalb kann man der Behauptung zustimmen, dass die Religion sich auf die Traditionen und Bräuche – also auf die Erfahrung Hunderter von Generationen – stützt, was deren Normen einen sakralen Charakter verleiht und damit diese in der Regel in eine rigorose Verhaltensnorm, in ein für alle verbindliches Stereotyp verwandelt.
Die Texte der Göttlichen Botschaften zeugen davon, dass die Bräuche und Traditionen mit der Religion verschmelzen und in der Epoche des Zerfalls der klassenlosen Gesellschaft und der Herausbildung von Staaten eine Göttliche Sanktion bekommen. Derartige Sanktionen waren dringend erforderlich, um die Autorität von Geburtsadel aufrechtzuerhalten. Indem die Religion die Köpfe eroberte, verwandelte sie sich in eine mächtige Kraft und übte einen gewaltigen Einfluss auf Mensch und Gesellschaft, Geschichte und Kultur, Lebensweise und Sitten aus. Selbstverständlich beeinflusste sie stets nicht bloß den Charakter der Strafe und deren Ausführung, sondern hatte auch das Recht auf deren Anwendung.
W.G. Grafskij behauptet zurecht, dass „die Religion einen großen Einfluss auf die Institution Kriminalstrafe ausgeübt hat, weil bereits in der Urgesellschaft die Strafen mit religiösen Erlaubnissen und Verboten eng verbunden waren“2 .
Es gab Zeiten, als die Kränkung als persönliche Beleidigung wahrgenommen wurde, während die Gegenreaktion darauf als grobe und ungebundene Rache betrachtet wurde, die den Moralvorstellungen jener Zeit entsprach und von ihnen gebilligt wurde. Als aber damit begonnen wurde, diese Kränkung (Verbrechen) als eine Beleidigung der Gottheit zu betrachten, war nunmehr die Reaktion darauf eine Aussöhnung mit Gott, die Reinigung von der Sünde und die Buße. Seit dieser Zeit traten als Grundlage der Strafe und insbesondere einer solchen Strafform wie die Todesstrafe bereits nicht mehr die Bräuche und Traditionen, sondern die Religion. Die biblische Sicht der Entstehung und darauffolgenden Entwicklung dieser Strafsanktion geht davon aus, dass der Begriff „Todesstrafe“ im Gottesgebot „Du wirst des Todes sterben“ verwurzelt ist, während das Buch Genesis die älteste alttestamentliche Quelle des Begriffs Strafe ist. Deshalb lassen sich die Anfänge der Rachelehre zweifellos in der Religion nachweisen, wobei die ersten Versuche, das Wesen und die Gründe der Todesstrafe als Strafsanktion zu definieren, eben in religiösen Glaubensvorstellungen und Quellen zu finden sind. Bei der Erforschung der Bibel und des Korans – dieser großartigen und unikalen Bücher bzw. Schriften in der Menschheitsgeschichte – stoßen wir unter anderem auf eine Fülle von Ideen, die das Wesen der Anschauungen des Urmenschen auf Leben und Tod, Mord und Verbrechen, Ahndung und Blutrache widerspiegeln.
Die ältesten Strafgesetze (die Gesetze von König Hammurabi, das Gesetzbuch des Manu u.a.) haben als Tötung eines Menschen jene Tatbestände fixiert, die im Leben seit langem existiert hatten und eine Reaktion der Gesellschaft hervorriefen. Deshalb kann man feststellen, dass diese Gesetze lediglich in schriftlicher Form die Todesstrafe festgeschrieben hatten, die bereits seit langem beim Mord oder Diebstahl angewandt wurde, da diese als gefährlich für die Gemeinschaft galten.
Henry Maine schreibt: „Es gibt buchstäblich kein einziges System des geschriebenen Rechts – von China bis Peru -, welches bei ursprünglicher Entstehung keine Summen religiös-sittlicher Vorschriften und ritueller Regeln enthalten hätte. Über das Römische Recht hatte man gedacht, dass die weltliche und pontifikale Jurisprudenz darin seit Altertum völlig isoliert gewesen waren. Aber das Wenige vom Zwölftafelgesetz, was uns überliefert worden, enthält vieles, was eben als religiöser Ritus eingestuft werden kann“3. Dabei handelt es sich nicht nur um offizielle, anerkannte Göttliche Botschaften, sondern auch um religiöse Lehren und Ideen, ohne Klärung von deren Wesen und Inhalt, sozialer Rolle und Bedeutung es praktisch unmöglich ist, die Bedeutsamkeit der Institution Todesstrafe und deren Werdegang im Leben jedes Volkes zu verstehen. Deshalb kann man behaupten, dass die Idee der Geißel Gottes sich grundlegend auf die Evolution der Idee über diese Strafe ausgewirkt hat, der nicht nur die Jahrhunderte alten religiösen, sondern auch die nationalen, historischen, psychologischen und sozialen Besonderheiten jedes Volkes zugrunde liegen. Der Einfluss der Religion, religiöser Quellen, religiösen Rechts und Lehren auf das Werden und Wachsen der Idee über die Todesstrafe wurde sowohl direkt als auch indirekt ausgeübt.
Zugleich aber hatten die Altmenschen keine Zweifel hinsichtlich der wohltätigen Wirkung dieser allerhärtesten Strafe auf die religiössittliche Vervollkommnung des Menschen. Und dies wurde von ihnen, soweit möglich, auf verschiedene Art und Weise gerade in religiösen Systemen zum Ausdruck gebracht. Obwohl die Begriffe „der Tod“ und „sterben“ dieselbe Bedeutung haben, gewinnt das Gottesgebot „Du wirst des Todes sterben“ in dieser zusammengefügten Form eine völlig andere, kompliziertere Bedeutung. Vom philosophischen Standpunkt aus bedeutet „der Tod“ ebenso wie „sterben“ nicht das Fehlen des Lebens, sondern dessen Ende und Abschluss. Vom medizinischen Standpunkt aus zeugen diese Erscheinungen von einer gesetzmäßigen Beendigung des Lebens, d.h. vom Aufhören und völligem Stillstand biologischer und physiologischer Prozesse der Lebenstätigkeit des Organismus wegen Alterung, Krankheit, Selbstmord, Mord, Unfall. Es gibt auch eine religiöse Deutung für die Begriffe „der Tod“ und „sterben“: das Lebensende eines Menschen ist nicht das Gegenteil von der Geburt, sondern ein fester Bestandteil der Auferstehung. Wenn man das Gebot „Du wirst des Todes sterben“ von rechtlicher oder genauer gesagt von strafrechtlicher Position aus betrachtet, lässt sich feststellen, dass der Allerhöchste in diese Wortverbindung das Wesen und Ziel jener Strafe legt, die er gegenüber Adam anwendet. Gott hat nicht das Ziel gehabt, ihn zu töten, denn in solchem Fall würde er was anderes als Gebot verkünden: „Ich werde dich hinrichten“, „Ich werde dich töten“ und schließlich „Du wirst hingerichtet werden“. Gott hat Adam zu verstehen gegeben, dass der für seinen Ungehorsam in der Form „Du wirst des Todes sterben“ bestraft sein wird, was aus unserer Sicht bedeutet, sein Leben auf der sündhaften Erde zu beenden. Somit ist der Sinn Göttlicher Strafe für Adam als Übergang von der Unsterblichkeit zum sterblichen Leben zu verstehen.
Im Alten Testament werden außer der Göttlichen Verfügung „Du wirst des Todes sterben“ auch andere Ausdrücke gebraucht: „Wer den Namen des HERRN schmäht, wird mit dem Tod bestraft; die ganze Gemeinde soll ihn steinigen“. (Lev 24,16); „Ein Mann, der mit der Frau seines Nächsten die Ehe bricht, wird mit dem Tod bestraft, der Ehebrecher samt der Ehebrecherin.“ (Lev 20,10); „Wer einen Menschen erschlägt, wird mit dem Tod bestraft.“ (Lev 24, 21); „..dann musst du geben: Leben für Leben“ (Ex 21, 23); „Jeder, der mit einem Tier verkehrt, soll mit dem Tod bestraft werden.“ (Ex 22, 18); „…dann sollst du die Frau und das Tier töten. Sie werden mit dem Tod bestraft; ihr Blut soll auf sie kommen.“ (Lev 20, 16)Б „Wer seinen Vater oder seine Mutter verflucht, wird mit dem Tod bestraft.“ (Ex 21, 17).
Bekanntlich haben sich sowohl die Theologen als auch die Rechtswissenschaftler stets bemüht, die religiösen Wurzeln der Todesstrafe als Strafart herauszufinden. Dabei beziehen sie sich selbstverständlich darauf, dass in der alttestamentlichen Menschheitsgeschichte als der allererste strafrechtliche Rechtssatz das Bibelgebot gilt, welches Gott für Adam verkündet hat, nachdem sich dieser im Garten Eden angesiedelt hatte: „Dann gebot Gott, der HERR, dem Menschen: Von allen Bäumen des Gartens darfst du essen, doch vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse darfst du nicht essen; denn sobald du davon isst, wirst du sterben“ (Gen 2,16-17).
Es ist üblich, gerade diese Verfügung Gottes mit dem Beginn der Strafgesetzgebung in Verbindung zu bringen, die Todesstrafe als ursprüngliche Strafart und die Bibel in gewissem Sinne als Geschichte menschlicher Verbrechen und der Entstehung von Strafen anzusehen. Geht man von so einer logischen Erklärung des Gebotes Gottes, so gelangt man zur Schlussfolgerung, dass es bei der Todesstrafe um eine Strafe handelt, die ausgerechnet von Gott ausgeht. Worin besteht aber der eigentliche Sinn des Ausdrucks: „Du wirst des Todes sterben“? Kann man behaupten, dass dieses Gebot vom Sinn und Inhalt her mit dem Begriff „Die Todesstrafe“ identisch ist? Nirgends stoßen wir in den Göttlichen Botschaften auf den Begriff “Todesstrafe”, auch wenn es verständlich ist, dass der Ausdruck “Du wirst des Todes sterben” ebenso wie die aufgezählten Begriffe, die von Gott gebraucht werden, auf jeden Fall wie der Tod aussehen, und dieser kommt vom HERREN, denn ausgerechnet Er gebraucht als erster diesen Ausdruck, als er Adam über das Verbot warnt. Die Besonderheit des Ausdrucks „Du wirst des Todes sterben“ besteht allerdings nicht darin, dass es der ursprüngliche, allererste Ausdruck sei, sondern im Wesen und im Vorgehen bei der Tötung Adams. Der Begriff „Leben“ wird von Gott sehr weit gefasst – als vollwertiges geistiges Sein, das auf festem Glauben an den Schöpfer, auf Demut Ihm gegenüber sowie auf einem ständigen Zwiegespräch mit Ihm beruht4