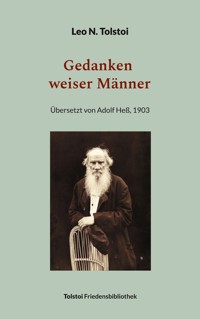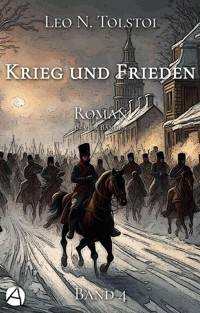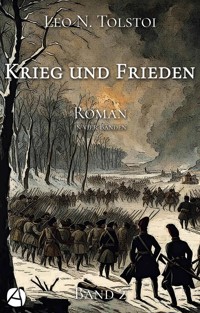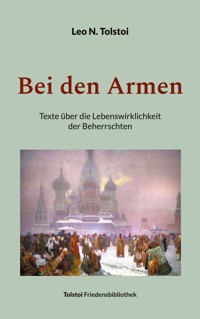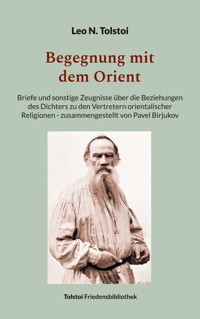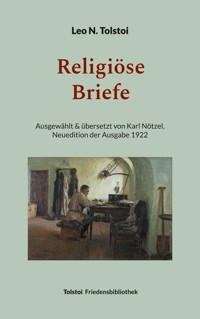
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Der deutsch-russische Schriftsteller Karl Nötzel hat 1922 eine Auswahl von 237 Briefen religiösen Inhalts von Leo N. Tolstois zusammengestellt, die hier als ungekürzte Neuedition dargeboten wird. "Solange ich über Nichtigkeiten Bücher schrieb - nach dem Munde redete - lobte man alles, was aus meiner Feder kam, erlaubte es zu drucken, und sogar der Zar hat es gelesen und gelobt. Als ich aber erst einmal Gott zu dienen und den Menschen zu beweisen suchte, dass sie nicht nach dem Gesetze Gottes leben, da stürzten alle über mich her, meine Bücher lässt man nicht mehr durch die Zensur, man verbrennt sie, und die Regierung hält mich für ihren Feind." (Leo N. Tolstoi: Brief an den Bauern T. M. Bondarreff, 1885) "Ich stelle mir die Welt vor wie einen gewaltigen Tempel, in dem das Licht von oben fällt, gerade in der Mitte. Wenn sich alle vereinigen wollen, so müssen alle auf dieses Licht zugehen, und dort werden wir alle, die wir aus verschiedenen Richtungen kommen, uns treffen und zwar mit ganz unerwarteten Menschen." (Aus einem Brief L. N. Tolstois, 1890) "Von mir wenigstens weiß ich, dass in den heiligen Augenblicken meines Bewusstseins auf jedem Punkte meines Lebensweges das Nichtübereinstimmen meiner Lebensführung mit meiner Erkenntnis und meine Unzufriedenheit mit mir selber immer die gleichen waren und niemals von mir ließen." (Brief L. N. Tolstois, 1900) "Die uralte, einfache Wahrheit, dass es den Menschen eigentümlich ist, einander zu helfen und sich zu lieben, keineswegs aber einander zu quälen und zu morden, begann immer häufiger zum Ausdruck zu gelangen, und immer weniger vermochten die Menschen den lügenhaften Erklärungen Glauben zu schenken, durch die das Abweichen von dieser Wahrheit gerechtfertigt werden sollte." (Aus L. N. Tolstois "Brief an einen Inder", 1908) Tolstoi-Friedensbibliothek Reihe B, Band 11 (Signatur TFb_B011) Neuedition von Ingrid von Heiseler und Peter Bürger
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Tolstoi-Friedensbibliothek Reihe B | Band 11
Herausgegeben von Peter Bürger
Editionsmitarbeit: Ingrid von Heiseler
Inhalt
Vorbemerkungen des Herausgebers der Tolstoi-Friedensbibliothek
Vorwort des Übersetzers Karl Nötzel
T
OLSTOIS RELIGIÖSE
B
RIEFE
aus den Jahren 18591010
Nachwort des Übersetzers Karl Nötzel zur Erstausgabe 1922
_____
Anhang
Bibliographie.
Editionen von Briefen und Tagebüchern Tolstois für eine deutschsprachige Leserschaft
Verzeichnis der religiösen Briefe Tolstois von 1859-1910 in diesem Band
Wladimir Grigorjewitsch Tschertkow (1854–1936) und Leo N. Tolstoi (1828-1910), Aufnahme vom 29. März 1909 (commons.wikimedia.org; Bildausschnitt)
VORBEMERKUNGEN DES HERAUSGEBERS
der Tolstoi-Friedensbibliothek
„Ich glaube nicht, dass Galilei tiefer überzeugt war von der Zweifellosigkeit der von ihm entdeckten Wahrheit, als ich ungeachtet ihrer allgemeinen Verneinung überzeugt bin von der Zweifellosigkeit der nicht von mir, auch nicht von Christus allein, vielmehr von allen größten Weisen der Welt entdeckten Wahrheit: dass das Übel nicht durch das Übel, vielmehr nur durch das Gute überwunden wird.“ (Leo N. Tolstoi: Brief an die Polin N. N. Krenschino, 8. September 1909)
„Wenn ich sage, Gott sei nicht im Himmel, vielmehr in jedem Menschen, so will ich damit nur äußern, dass Gott keine Persönlichkeit ist, die sich an einem ganz bestimmten Orte aufhält, vielmehr jene höchste geistige Grundlage, die wir in uns selber anerkennen und erleben. Diese Worte bedeuten durchaus nicht, dass Gott im Menschen sei, und Sie haben durchaus recht, wenn Sie mit einem solchen Sinn nicht einverstanden sind.“ (Brief Tolstois an Alexej Markowitsch, 13. November 1909)
In der Reihe B der Tolstoi-Friedensbibliothek erschließen wir u. a. gemeinfreie Übersetzungen von Selbstzeugnissen des Russen Leo N. Tolstoi (1828-1910), darunter Brief- und Tagebuchtexte. Nach unserer Neuedition der von Petr Aleksěevič Sergejenko zusammengestellten Ausgabe „Briefe 1848-1910“1 folgt hier zunächst die Sammlung „Religiöse Briefe“, bearbeitet vom ‚deutsch-russischen‘ Schriftsteller Karl Nötzel2 (1870-1945) und erstmalig erschienen im Jahr 1922. Nötzel hat für die Übersetzungen 237 Texte ausgewählt und beansprucht bezogen auf das ihm vor hundert Jahren zugängliche „Gesamtbriefmaterial Tolstois“ eine Vollständigkeit seiner Sammlung von Briefmitteilungen religiösen Inhalts (→S. 9).
Mit einem gewissen Unbehagen dokumentieren wir in dieser weithin unveränderten Neuausgabe auch das zu Weihnachten 1922 unterzeichnete Nachwort des Übersetzers (→S. 432-438). Karl Nötzel möchte „Tolstois Lehre in ihrer mildesten Form, als Briefe“ darbieten und „nur leise […] auf die hier drohenden Klippen“ hinweisen (→S. 432). Die ausgeführte Kritik verfällt jedoch in einen durchaus lauten Ton, wenn der Bearbeiter etwa feststellt: „in dem ewigen Wechsel seiner Ausgangsstellungen offenbart Tolstoi am peinlichsten, dass ihm eigentliche Denker-Veranlagung abgeht“ (→S. 435).3 Bezogen auf Staat, Kirche und religiöses Aufklärungsideal vertritt der Übersetzer andere Standpunkte als Tolstoi. Während der Dichter dem staatlich-kirchlichen Machtkomplex die Rechtfertigung bzw. Durchführung von Morden (Todesstrafe, Kriegsapparat) zur Last legt, betont der Protestant Karl Nötzel, dass aus seiner Sicht „der Staat mithin einen rein sittlichen Wesenskern hat“ (→S. 436), unterlässt es hierbei jedoch tunlichst, die Leser darüber aufzuklären, dass er selbst von 1917 bis 1918 als Russlandexperte im preußischen Kriegs-Ministerium (!) tätig gewesen ist.
Der Anhang des vorliegenden Bandes enthält als Beigabe eine bibliographische Übersicht zu „Editionen von Briefen und Tagebüchern Tolstois für eine deutschsprachige Leserschaft“ (→S. 439-443).
pb
1 Leo N. TOLSTOI: Briefe 1848-1910. Gesammelt von P. A. Sergejenko – vollständige Ausgabe (1911), mit einem Vorwort des Übersetzers Dr. Adolf Heß (= Tolstoi-Friedensbibliothek: Reihe B, Band 10). Norderstedt: BoD 2023.
2 Vgl. zu Karl Nötzel die im Wikipedia-Personeneintrag aufgeführte Sekundärliteratur: Heinrich STAMMLER, Karl Noetzel, 30. August 1870 – 29. Dezember 1945. In: Jahrbücher für Geschichte Osteuropas/Neue Folge. 4, 1956, S. 227–229; Heinrich STAMMLER, In memoriam Karl Noetzel, * 30. August 1870 in Moskau, † 29. Dezember 1945 in München. In: Osteuropa. Zeitschrift für Gegenwartsfragen des Ostens. 20. Jg. (1970), S. 879 f.
3 Die – z. T. aberwitzige – Tolstoi-Kritik in der nachfolgend genannten Rezension des Briefbandes könnte auch als ein ‚Aufgreifen‘ solcher Vorgaben des Herausgebers gelesen werden: Karl HOLL, Rezension „Tolstoi, Leo: Religiöse Briefe, übers. u. hrsg. v. Karl Nötzel“. In: Theologische Literaturzeitung Band 51, Nr. 2/1926, Sp. 38-39. [https://idb.ub.uni-tuebingen.de]
VORWORT DES ÜBERSETZERS
Karl Nötzel(1922)
Die vorliegende Sammlung erhebt den Anspruch, nach dem bis heute – russisch – vorliegenden Gesamtbriefmaterial Tolstois (drei grosse Sammelbände, zwei Spezialkorrespondenzen, sowie in verschiedenen Erinnerungsbüchern an Tolstoi Zerstreutes), vollständig zu sein. Aus diesem Gesamtmaterial wurden alle Briefe religiösen Inhalts ausgesucht und den Jahreszahlen nach geordnet. Von einer ursprünglich beabsichtigten Anordnung nach den Inhalten musste abgesehen werden – weil einerseits diese stets wechselnde Behandlung erfahren – entsprechend der religiösen Entwicklung Tolstois, – und weil zudem auch die allermeisten Briefe eine ganze Reihe von Gegenständen berühren. Immerhin ward versucht, bei den Briefen innerhalb eines Jahres eine gewisse, den Inhalten nach gebotene Ordnung einzuhalten – wobei natürlich wechselnde Gesichtspunkte in Anwendung kamen.
Aus dieser allgemeinen Ordnung heraus fallen die in der Sammlung zunächst gebrachten Briefe an die Gräfin A[lexandra] A[ndrejewna] Tolstoi [→Nr. 1-9]: sie beginnen freilich mit Tolstois frühesten religiösen Briefen, reichen aber bis in seine letzten Lebensjahre. Hier sollte – gleichsam als Einleitung – ein gedrängtes Gesamtbild der religiösen Entwicklung Leo Tolstois gegeben werden. Daran schliessen sich die wenigen religiösen Briefe aus Tolstois religiöser Übergangszeit: Er hatte sich bekanntlich Anfang der 70er Jahre wiederum der orthodoxen Kirche zugewandt. Der Bruch mit ihr und die Festigung des eigentlichen Bekenntnisses Tolstois fällt gegen das Jahr 1880. Die einzelnen – nicht gerade tiefgehenden – Wandlungen, die dann in den dreissig Jahren bis zu Tolstois Tode sein religiöses Weltbild noch erfuhr, ergeben sich aus den Briefen dieser Zeit.
Grosse Schwierigkeit bot die Übersetzung, da Tolstoi bei der ungeheuren Ausdehnung seiner religiösen Korrespondenz, von der wohl nur das Wenigste gerettet ist, (vornehmlich das, wovon er Abschriften zurückbehielt), und bei der Leidenschaft, zu der ihn der Gegenstand veranlasste, fast stets sehr eilte. Er selber bittet immer wieder die Adressaten um Nachsicht mit seiner unklaren Ausdrucksweise und spricht die Hoffnung aus, man werde ihn auch so verstehen. Der gleichen Hoffnung gibt sich der Übersetzer und Herausgeber hin: durch jahrzehntelanges Studium von Tolstois Originalwerken und umfangreiche Übersetzungen aus ihnen auf Tolstois Schreibweise vorbereitet, war er bestrebt, bis zur letzten Verdeutlichung vorzuschreiten und dabei doch nach Möglichkeit den seelischen Reiz des alle Ungeduld eines rastlosen Gottsuchers in sich tragenden Stils wenigstens ahnen zu lassen.
Ein reifer Leser dürfte hier stärkste religiöse Anregung erfahren. Freilich muss er prüfend bleiben, und darf er sich auch nicht durch Bewunderung und Ehrfurcht den Blick trüben lassen: denn hier handelt es sich um Heiligstes!
Bei der Verdeutlichung einzelner besonders flüchtig hingeworfener Stellen schulde ich tiefen Dank meiner lieben Frau, um deren Muttersprache es sich hier handelt.
Pasing, Weihnacht 1922.
Karl Nötzel.
Tolstois religiöse Briefe aus den Jahren 1859-1010
Nr. 1 | An die Gräfin
A. A. Tolstoi
1
, 3. Mai 1859.
Mein Gott! Wie haben Sie mich heruntergemacht! Bei Gott, ich kann noch gar nicht zu mir kommen! Aber Scherz beiseite, liebe Babuschka, ich bin ein übler, nichtsnutziger Bursche, ich habe Ihnen weh getan, aber war es denn nötig, mich so grausam zu bestrafen? Alles, was Sie da sagen, ist richtig und auch wiederum falsch. Die Überzeugungen eines Menschen – nicht diejenigen, die er kundgibt, vielmehr diejenigen, die er durch sein ganzes Leben erworben hat – kann schwerlich ein anderer verstehen, und Sie kennen auch nicht die meinigen. Würden Sie sie kennen, so wären Sie nicht so über mich hergefallen. Gleichwohl will ich versuchen, Ihnen mein Glaubensbekenntnis abzulegen. Als ich noch ein Kind war, glaubte ich feurig, sentimental und ohne mir irgend welche Gedanken zu machen. Später, ich war gegen 14 Jahre alt, begann ich über das Leben ganz im allgemeinen nachzudenken und stiess dabei auf die Religion. Sie fügte sich nicht meinen Theorien, und natürlich hielt ich es für ein Verdienst, sie zu verneinen. Ohne sie lebte ich 10 Jahre ganz ruhig: Alles lag mir klar, logisch und in Zusammenhang miteinander vor Augen – und für die Religion war dabei kein Platz. Es kam dann eine Zeit, wo mir alles offenbar zu sein schien, Geheimnisse gab es überhaupt nicht für mich im Leben, aber das Leben selber begann seinen Sinn zu verlieren. Zu dieser Zeit war ich einsam und unglücklich – ich lebte damals im Kaukasus. Ich fing an, so tief nachzudenken, wie der Mensch nur einmal im Leben die Kraft findet. Ich besitze Aufzeichnungen aus jener Zeit, und wenn ich jetzt darin blättere, kann ich gar nicht begreifen, wie ein Mensch bis zu einem solchen Grad von geistiger Überspanntheit zu gelangen vermochte, wie ich damals. Diese Zeit war sowohl qualvoll wie schön. Niemals, weder vordem noch nachdem, erreichte ich eine solche Höhe des Gedankens wie in jener Zeit, die ungefähr zwei Jahre währte. Und alles, was ich damals fand, wird für immer meine Überzeugung bleiben. Anders kann ich nicht. In zweijähriger geistiger Anstrengung fand ich etwas ganz Einfaches und Uraltes, ich bin dessen aber so gewiss wie niemand gewisser sein kann – ich fand, dass es eine Unsterblichkeit gibt, dass es eine Liebe gibt, und dass man den Nächsten lieben muss, wenn man ewig glücklich sein will. Diese Entdeckungen setzten mich in Staunen durch ihre Ähnlichkeit mit der christlichen Religion. Aber statt ihr selber auf den Grund zu gehen, begann ich sie im Evangelium zu suchen; dort fand ich aber wenig. Ich fand weder Gott, noch den Erlöser noch die Sakramente, mit einem Wort gar nichts; ich suchte mit allen Kräften meiner Seele, ich weinte und quälte mich und hatte keinen anderen Wunsch als nach Wahrheit. Glauben Sie um Gotteswillen nicht, Sie könnten aus diesen, meinen Worten auch nur ein ganz klein wenig die ganze Kraft und Insichgeschlossenheit meines damaligen Suchens begreifen. Das ist eines jener Geheimnisse der Seele, wie sie jeder von uns besitzt; ich kann aber wohl sagen, dass ich selten bei anderen eine solche Leidenschaft nach der Wahrheit fand, wie sie damals in mir lebte. So blieb ich denn bei meiner Religion und ich kam dabei gut aus im Leben. Ich muss zugeben auch jetzt noch.
(4. Mai):Dieses hatte ich sogleich geschrieben, nachdem ich Ihren Brief empfangen hatte. Ich unterbrach mich, weil ich mich überzeugte, dass dies alles nur ein Geschwätz sei, das Ihnen nicht zum hundertsten Teil einen Begriff dessen geben werde, was eigentlich vorliegt, und es deshalb keinen Zweck hat, fortzufahren. Da ich mir aber ein für allemal das Wort gegeben habe, niemals die Briefe an Sie zu überarbeiten, so schicke ich Ihnen auch diesen. Die Sache ist die, ich liebe und achte die Religion, ich glaube, dass der Mensch ohne sie weder gut noch glücklich sein kann. Ich möchte sie lieber haben als alles andere auf der Welt, ich fühle, dass ohne sie mein Herz mit jedem Jahre trockener wird, ich hoffe noch, und in frommen Augenblicken scheint es mir so, als glaube ich, ich habe aber tatsächlich keine Religion, und ich glaube auch nicht – ausserdem macht bei mir das Leben die Religion, und nicht die Religion das Leben. Wenn ich gut lebe, bin ich, so scheint mir, ihr näher, es kommt mir dann so vor, als werde ich gerade im nächsten Augenblick in diese Welt des Glückes eingehen; lebe ich aber schlecht, so scheint es mir, als sei die Religion überhaupt nicht nötig. – Jetzt auf dem Lande bin ich mir so widerlich, fühle ich eine solche Trockenheit im Herzen, dass es mir furchtbar und eklig zumute ist, und ich die Notwendigkeit einer Religion stärker empfinde. Gott gebe, die Zeit wird kommen. – Sie lachen über die Natur und die Nachtigall, sie ist aber für mich – der Führer zur Religion. Jede Seele hat ihren Weg, und dieser Weg ist unbekannt und wird nur in der Tiefe des Herzens empfunden. Vielleicht liebe ich auch Sie bloss deswegen. – Ach mein lieber Freund, meine Babuschka! Schreiben Sie mir doch häufiger. Mir ist es jetzt so eklig und traurig zumute auf dem Lande. So trocken und kalt ist es mir in der Seele, dass es mir selber schrecklich vorkommt. Ich habe nichts, wofür ich leben könnte. Gestern kamen mir diese Gedanken mit solcher Kraft, dass ich mich gründlich zu fragen begann: Wem erweise ich eigentlich Gutes? Wen liebe ich? Niemand! Und ich kann mich sogar nicht einmal mehr über mich selber grämen und über mich weinen. Selbst meine Reue ist kalt! Das ist nur ein Räsonnieren. Einzig und allein die Arbeit bleibt mir. Aber was bedeutet sie eigentlich? Eine Kleinigkeit – man wühlt da herum, man macht sich Sorgen und Mühe, aber das Herz wird kalt, es trocknet aus und stirbt ab. Ich schreibe Ihnen das nicht deshalb, damit Sie mir sagen, was das zu bedeuten hat, was man tun soll, und damit Sie mich trösten möchten, das ist ganz unmöglich. Ich schreibe Ihnen ganz einfach deshalb, weil ich Sie liebe, und Sie mich verstehen werden; öffnen Sie ein Fensterchen in Ihrem Herzen, lassen Sie da allen diesen Unsinn Ihres Enkels hinein, schliessen Sie dann das Fensterchen wieder zu – und damit gut! Bitte antworten Sie mir nicht einmal hierauf. Die Hauptsache ist, dass ich mich selber nicht belügen kann. Ich habe eine kranke Schwester, eine alte Tante, Leibeigene, denen ich nützlich sein, und die ich verwöhnen könnte, aber mein Herz schweigt, und absichtlich das Gute zu tun – schäme ich mich. Um so mehr, als ich das Glück empfand (wenn auch sehr selten), tatsächlich Gutes zu tun, ohne das zu wissen, ganz zufällig, nur aus meinem Herzen heraus. Es vertrocknet jetzt, es wird hölzern, es zieht sich zusammen, und ich kann gar nichts dagegen tun. Sie haben keinen Grund auf unsersgleichen böse zu sein und uns zu schelten, Sie sollten mich bedauern und freundlich behandeln. Sie haben es gut. Sie haben stets einen Ort, wo Sie Ihre Seele erwärmen können, bei uns aber vertrocknet die Seele, man fühlt das, man entsetzt sich darüber – und hat kein Mittel dagegen. Leben Sie wohl, grüssen Sie die Ihrigen und vergessen Sie mich nicht … Jetzt möchte ich lachen und Luftsprünge machen und nur deshalb, weil ich vor fünf Minuten weinen wollte und weil ich Ihnen schreibe.
L. Tolstoi
Nr. 2 | An die Gräfin
A. A. Tolstoi,
April 1876.
Nicht umsonst schrieb ich Ihnen, liebe Freundin Alexandrine, und forderte Sie auf zu einem Briefwechsel mit mir, und mein Irrtum war mir dabei noch förderlich – was für schöne Briefe habe ich von Ihnen erhalten, besonders den letzten!
Ich dachte gar nicht daran, Ihnen einen Vorwurf daraus zu machen, dass Sie mich zu überzeugen oder zu bekehren suchten; ich schrieb Ihnen nur, indem ich Sie ein wenig aufzog: Suchen Sie mich nicht zu bekehren, denn in solchen Bemühungen finde ich häufig etwas Falsches; aus Ihrem letzten Brief ersehe ich aber, dass Sie selber dieses falsche Empfinden viel besser kennen als ich. Meine Warnung war also überflüssig; ich entschuldige mich deswegen. Ich gestehe indes, dass ich dies schrieb, um (wie ich bereits sagte) Sie zu möglichstem Eifer zu veranlassen in einer Frage, die mir jetzt sehr, sehr wichtig ist, und in welcher ich stets von Ihnen Hilfe verlangte.
Sehr erfreulich war es mir auch zu erfahren (wenn ich Sie richtig verstand), dass auch Sie der Meinung sind, plötzliche Bekehrungen kämen nicht vor, oder doch nur selten – (ich meine solche in einem Augenblick) und dass man durch Mühe und Qualen hindurchgehen muss. Dieser Gedanke erfreut mich, denn ich habe mich viel gequält, und mir viel Mühe gegeben, und in der Tiefe meiner Seele weiss ich, dass diese Mühe und diese Qualen das allerbeste sind von dem, was ich auf der Welt habe. Auch muss diese Tätigkeit ihren Lohn haben: Wenn das auch nicht in der Beruhigung des Glaubens geschieht, so ist doch das Bewusstsein, sich gemüht zu haben, an sich schon ein Lohn, jene Theorie aber von der Gnade, die im Englischen Klub oder auf einer Versammlung von Aktionären auf den Menschen herabfällt, kam mir nicht nur stets dumm, vielmehr unsittlich vor.
Sie sagen, Sie wüssten nicht, woran ich glaube. Es ist mir seltsam und schrecklich es zu sagen: An gar nichts von dem, was uns die Religion lehrt; aber dabei hasse und verachte ich nicht nur den Unglauben, ich sehe auch gar keine Möglichkeit, ohne Glauben zu leben und noch weniger, ohne Glauben zu sterben. Und so baue ich mir denn allmählich meine Glaubenssätze auf, sie sind nur alle – zwar fest gegründet, aber sehr unbestimmt und wenig tröstlich. Wenn der Verstand fragt – antworten sie gut; tut aber das Herz weh und bittet es um Antwort, so gibt es keine Stütze und keinen Trost. Mit den Forderungen meines Verstandes und den Antworten, die mir die christliche Religion erteilt, befinde ich mich in der Lage, wie zwei Hände, die sich ineinander legen möchten, aber nur mit den Fingern aneinander stossen. Ich hege den Wunsch, sie in Einklang zu bringen, aber je mehr ich mich bemühe, um so schlechter geht es damit; und dabei weiss ich sehr wohl, dass dies möglich ist, dass eines für das andere geschaffen ward.
Ich wollte eigentlich gar nichts von mir erzählen, aber unwillkürlich liess ich mich fortreissen. Bitte, folgen Sie meinem Beispiel, d. h. sprechen Sie von sich selber und nicht von mir … Ich küsse Ihre Hand Ihr L. Tolstoi.
Nr. 3 | An die Gräfin
A. A. Tolstoi,
Februar 1877.
Sie beleidigen mich, meine teure Freundin Alexandrine, wenn Sie bei mir eine falsche Scham annehmen in Fragen der Religion. Soeben habe ich Urussoff von ganzer Seele folgendes geschrieben, und ich wiederhole es Ihnen: Für mich ist die Frage der Religion ganz die gleiche Frage wie für einen Ertrinkenden die Frage, woran er sich halten kann, um dem drohenden Verderben zu entgehen, das er bereits mit seinem ganzen Wesen empfindet. Und gerade die Religion offenbart sich mir schon zwei Jahre als dieser mögliche Weg zur Rettung. Deshalb kann von einer falschen Scham gar nicht die Rede sein. Die Sache ist aber die, sobald ich nur nach diesem Brett greife, fange ich mit ihm zusammen zu sinken an; und dabei halte ich mich noch irgendwie an der Oberfläche, solange ich nicht nach diesem Brett greife. Wenn Sie mich fragen, was mich eigentlich hindert, werde ich darauf nicht antworten, denn ich würde fürchten, Ihren Glauben zu erschüttern, und ich weiss, dass er das höchste Heil ist. Ich kann mir vorstellen, wie Sie darüber lächeln werden, dass meine Zweifel Sie erschüttern könnten. Es handelt sich hier aber gar nicht darum, wer besser urteilt, vielmehr darum, nicht zu versinken, und deshalb werde ich Ihnen das nicht sagen, mich vielmehr für Sie freuen und für alle, die in diesem Boot fahren, das mich nicht trägt. Ich habe einen Freund, den Gelehrten Strachoff, einen von den besten Menschen, die ich kenne. Wir gleichen einander ausserordentlich in unseren religiösen Anschauungen. Wir sind beide überzeugt, dass die Philosophie gar nichts gibt, dass man ohne Religion nicht leben kann, und dabei können wir nicht glauben. In diesem Sommer wollen wir beide nach dem Kloster Optina wallfahrten, dort will ich den Mönchen alle Gründe angeben, derentwegen ich nicht glauben kann. Ich küsse Ihre Hand
Ihr L. Tolstoi.
Nr. 4 | An die Gräfin
A. A. Tolstoi,
Ende März 1879.
Deshalb habe ich Ihnen solange nicht geantwortet, meine teure Freundin, weil ich dieser Tage in Moskau war und mich wie stets das schreckliche Stadttreiben sehr verdrossen hat.
Ich verstehe nicht, wie Sie das Wort „Kreuz“ auffassen, das wir tragen. Wenn es Gott gefällig sein wird, so werden Sie das, was ich im Sinne habe, herauslesen. Bei einer Unterhaltung kann man sich über einzelne Worte klar werden, schriftlich ist das nicht möglich. Ich möchte nur sagen, dass „nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach“ – ein einziges unteilbares Wort darstellt. „Nimm dein Kreuz“ – hat einzeln genommen, meiner Meinung nach, gar keinen Sinn, weil es durchaus nicht in unserem Willen liegt, das Kreuz zu nehmen oder nicht zu nehmen; es liegt auf uns, man darf nur nichts Überflüssiges tragen – nichts von dem, was nicht Kreuz ist. Auch darf man das Kreuz nicht irgend wohin tragen, man muss vielmehr damit Christus auf dem Fusse folgen, d. h. indem man sein Gesetz der Liebe zu Gott und dem Nächsten erfüllt. Ihr Kreuz – ist der Hof. Mein Kreuz – die Arbeit des Gedankens. – Das ist eine üble, hochmütigmachende Tätigkeit voller Verführungen … aber mag es nur so sein …
Möge Ihnen Gott alles Beste geben. Ich küsse Ihnen die Hand. Sonja dankt Ihnen für alle Liebe und vergilt Ihnen mit dem Gleichen.
Ihr L. Tolstoi.
Nr. 5 | An die Gräfin
A. A. Tolstoi,
Februar 1880.
Zwei Tage sind es her, seit ich Ihren Brief empfing, meine teure Freundin, und ich habe bereits mehrmals, während ich noch im Bett lag, meine Antwort an Sie überdacht; jetzt weiss ich aber selber nicht, wie ich sie schreiben werde. Die Hauptsache ist, dass Ihr Glaubensbekenntnis dasjenige unserer Kirche ist. Ich kenne es und teile es nicht. Ich habe aber kein einziges Wort gegen diejenigen zu sagen, die diesen Glauben haben. Besonders wenn sie hinzufügen, das Wesen dieser Lehre beruhe in der Bergpredigt. Deren Lehren verneine ich nicht nur keineswegs, im Gegenteil: würden Sie mir sagen: Was ich lieber wünschte: dass meine Kinder ungläubig wären wie ich war, oder an das glaubten, was die Kirche lehrt, so würde ich, ohne einen Augenblick zu zögern, den Glauben der Kirche wählen. Ich weiss z. B., dass das ganze Volk nicht nur daran glaubt, was die Kirche lehrt, vielmehr auch noch eine Menge von Aberglauben hineinmischt, und ich (überzeugt, dass ich aufrichtig glaube) unterscheide mich nicht von einem Weibe, das glaubt, der Freitag bringe Unheil, und behaupte, dass dieses Weib und ich ganz genau in gleicher Weise (nicht mehr und nicht weniger) die Wahrheit wissen. Das kommt daher, weil jenes Weib und ich in gleicher Weise von ganzer Seele die Wahrheit lieben, sie zu erreichen streben und glauben. Ich unterstreiche das Wort „glauben“ deshalb, weil man nur an das glauben kann, was wir nicht verstehen können, was wir aber auch nicht zu widerlegen imstande sind. Doch an das zu glauben, was mir wie eine Lüge vorkommt – das ist unmöglich. Nicht nur das; mir einzureden, ich glaubte an das, woran ich nicht glauben kann, und auch nicht zu glauben brauche, um meine Seele zu begreifen, um Gott zu verstehen, und die Beziehungen meiner Seele zu ihm – sich dieses einzureden, wäre etwas dem wirklichen Glauben durchaus Entgegengesetztes. Das ist Gotteslästerung – und ein Dienen dem Fürsten dieser Welt. Die erste Voraussetzung des Glaubens ist die Liebe zur Menschheit, zur Wahrheit, zu Gott und ein reines Herz ohne Lüge. Das alles sage ich in Hinsicht darauf, weil ich jenes an das Unheilbringen des Freitags glaubende Weib verstehe, und ihr einen wirklichen Glauben zuerkenne, weil ich weiss, dass sie nicht einzusehen vermag, dass der Begriff des Freitags mit dem Gottesbegriff gar nichts gemein hat, dass sie sich die grösste Mühe gibt zu erkennen und nicht imstande ist weiter zu sehen. Sie schaut dahin, wohin man schauen muss, sie sucht Gott, und Gott wird sie finden. Und zwischen mir und ihr besteht vor Gott gar kein Unterschied, denn meine Vorstellung von Gott, die mir so erhaben vorkommt, ist im Vergleich mit dem wirklichen Gott ebenso nichtssagend und missgestaltet, wie die Vorstellung jenes Weibes vom Freitag. Würde ich mich aber an Gott wenden vermittelst des Glaubens an den Freitag …, würde ich an den Sonntag glauben und an dergleichen mehr, so würde ich lästern, lügen und das zum Erreichen irgendwelcher irdischer Ziele tun, wirklicher Glaube aber würde und könnte dabei gar nicht im Spiele sein.
Und wie ich mich in voller Eintracht weiss mit den aufrichtig Gläubigen aus dem Volke, ganz ebenso fühle ich mich auch in Eintracht mit dem Kirchenglauben und mit Ihnen, wenn der Glaube aufrichtig ist, und Sie Gott mit dem vollen Blick Ihrer Augen anschauen, nicht durch Brillen, und ohne die Augen zusammenzukneifen. Ob Sie aber auf Gott so hinschauen oder nicht, ob Sie eine Brille stört, die Sie aufsetzten oder nicht – das kann ich nicht wissen. Ein Mann mit Ihrer Bildung ist dazu nicht imstande, so denke ich wenigstens. Von den Frauen weiss ich das aber nicht. Und deshalb staune ich über mich selber und tadle mich deswegen, dass ich alles das gesagt habe, was ich Ihnen sagte.
Vielleicht habe ich es aber nur deshalb gesagt, weil ich Sie liebe und fürchte, Sie möchten nicht feststehen, und wenn es Ihnen nötig wäre (es ist das aber stets nötig), würden Sie nicht Stütze und Halt dort finden, wo Sie solche zu finden hoffen. Ich sage aber „vielleicht“; wahrscheinlich habe ich aus Eitelkeit geschwätzt und Sie durch mein Geschwätz beleidigt und gekränkt. Dafür bitte ich Sie um Verzeihung. Ist dem so, und ich wünsche das von ganzem Herzen, so brauche ich Sie gar nicht zu belehren, Sie wissen alles selber. Wenn ich aber versuchte, Ihnen irgend etwas auseinanderzusetzen, so kann der Sinn meiner Worte nur der sein „Schauen Sie zu, ob das Eis fest ist, über das Sie schreiten; wollen Sie nicht versuchen, es zu zerbrechen? Wenn es bricht, dann wäre es besser auf dem festen Lande zu gehen, hält es Sie aber, so ist das vortrefflich. Wir werden dann den ganzen Weg zusammengehen!“
Aber auch Sie sind gar nicht berechtigt mich zu belehren. Ich habe bereits bis zum festen Lande alles Eis, das sich als brüchig erwies, zerbrochen und jetzt fürchte ich schon gar nichts mehr, weil ich keine Kraft habe, das Eis zu zerbrechen, auf dem ich jetzt stehe – demnach ist das der richtige Boden. Leben Sie wohl. Zürnen Sie mir nicht und bemühen Sie sich, auf mich ebenso hinzublicken wie ich auf Sie hinschaue, und wünschen Sie mir das Gleiche, was ich mir selber, Ihnen und allen Menschen wünsche – nämlich nicht rückwärts zu gehen. Ich werde schon nicht das von mir selber zerbrochene Eis betreten und werde nicht auf ihm leicht und lustig dahingleiten. Doch mein vorwärts gerichteter Weg führt nicht dazu, mit Worten meine Beziehungen zu Gott: durch die Erlösung usw. zu bestimmen, vielmehr im Leben voranzuschreiten, jeden Tag, jede Stunde, indem ich den mir offenbar gewordenen Willen Gottes erfülle. Das aber ist sehr schwer, sogar unmöglich, wenn man sich sagt, dies sei unmöglich, dagegen ist das nicht nur möglich, vielmehr wird es als Pflicht empfunden und als leicht auszuführen, wenn ich mir nicht selber die Augen zuhalte, vielmehr ohne sie niederzuschlagen, Gott ins Angesicht schaue.
Ich begann kaum eben vom gestrigen Tage an so zu tun, und schon ward mein ganzes Leben anders, und alles, was ich vordem wusste, scheint mir sich umgekehrt zu verhalten, und alles, was mir vordem auf dem Kopf zu stehen schien, steht jetzt mit dem Kopf nach oben. Ihr Sie aufrichtig liebender L. Tolstoi.
Ob ich an den Mensch-Gott oder an den Gott-Menschen glaube, kann ich Ihnen nicht sagen, und könnte ich das, so würde ich es nicht tun. Hiervon erzählen diejenigen, die auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurden, und diejenigen, die sie verbrannten: „Wir haben Dich doch gerufen, indem wir Dich Gott nannten!“ „Ich kenne Euch nicht, hebet Euch hinweg, Ihr, die Ihr Gesetzlosigkeit verübtet!“
Nachdem ich diesen Brief geschrieben hatte, fiel mir ein, Sie könnten mir den Vorwurf machen: „Ich sagte ihm doch, woran ich glaube, er aber hat es mir nicht gesagt!“ Man kann aber gar nicht seinen Glauben in Worte fassen, Sie konnten das nur deshalb tun, weil Sie das wiederholten, was die Kirche sagt. Aber gerade das darf man nicht, soll man nicht, geht gar nicht an und ist Sünde. Wie kann man denn das aussprechen, wovon man lebt? Trotzdem will ich Ihnen sagen – nicht woran ich glaube, vielmehr welche Bedeutung Christus und seine Lehre für mich haben. Mir scheint, das ist es auch, wonach Sie mich fragen.
Ich und wir alle leben wie das Vieh und verrecken auch ebenso. Um uns aus dieser furchtbaren Lage zu erretten, ward uns durch Christus die Rettung geboten.
Wer ist Christus eigentlich? Ein Gott oder ein Mensch? – Er ist das, was er selber von sich sagt. Er sagt, er sei Gottes Sohn, er sagt, er sei des Menschen Sohn, er sagt: „Ich bin das, was ich euch sage, ich bin der Weg und die Wahrheit!“ Er ist demnach gerade das, was er von sich selber sagt. Wollten aber dies alle auf eine einzige Bedeutung bringen und sagen: Er und …, so würde Gotteslästerung herauskommen, Lüge und Dummheit. Wäre er das gewesen, so hätte er das auch gesagt. Er gab uns Rettung. Wodurch? Dadurch dass er uns lehrte, unserm Leben einen solchen Sinn zu geben, der nicht zunichte gemacht wird durch den Tod. Das lehrte er uns durch alle seine Worte, durch sein Leben und durch seinen Tod. Um sich zu erretten, muss man dieser Lehre folgen. Sie kennen sie. Sie ist nicht nur in der Bergpredigt beschlossen, vielmehr im ganzen Evangelium. Für mich beruht der Hauptgedanke dieser Lehre darin: Um uns zu erretten, müssen wir jede Stunde und jeden Tag unseres Lebens an Gott und an unsere Seele denken, und darum die Liebe zum Nächsten über unser tierisches Leben stellen. Dazu bedarf es keines Kunststücks, das ist vielmehr so einfach, wie dass man schmieden muss, um ein Schmied zu sein.
Und deshalb ist das auch die göttliche Wahrheit, weil sie so einfach ist, dass gar nichts einfacher sein kann, und dabei doch so wichtig und bedeutsam für das Heil des Menschen und aller Menschen zusammen, dass gar nichts über ihr zu stehen vermag.
Nr. 6 | An die Gräfin
A. A. Tolstoi.
Im Jahre 1886
.
Sie haben mich durch Ihr Schreiben sehr erfreut, meine teure und liebe Alexandra Andrejeffna. Ich wollte Ihnen immer selber schreiben und mich nach Ihnen erkundigen, und ich habe Ihnen das alles sagen lassen durch diejenigen, die Sie sehen konnten.
Sie erkundigen sich nach mir. Wie seltsam es auch klingen mag, ich fühle mich sehr, sehr wohl. Von meinem Fusse sagt man, die Knochenhaut sei entzündet, und es liege eine Rose vor usw., ich weiss aber sehr wohl, dass die Hauptsache darin liegt, dass ich „durch den Fuss sterbe“, wie die Bauern sagen, d. h. mich in einer dem Tode ein wenig näheren Lage befinde wie gewöhnlich, und gerade infolge meines Fusses, der sich als krank erweist. Und diese Lage (wie Sie sich so schön ausdrücken: „Man fühlt sich in der Hand Gottes“) ist sehr schön und ich habe den Wunsch, mich stets in solcher Lage zu befinden und ich wünsche nicht, jetzt eine andere anzunehmen.
In der Tat: Sehr starke und andauernde körperliche Leiden und danach der körperliche Tod, das ist eine so unerlässliche und ewige und allgemeine Lebensbedingung, dass es für einen Menschen, der die Kinderschuhe ausgetreten hat, eigentlich seltsam ist, wenn er das auch nur einen Augenblick vergisst. Um so mehr, als die Erinnerung hieran, die ständige Erwartung hiervon, nicht nur keineswegs das Leben vergiftet (wenn man vom Leben so sprechen kann), vielmehr ihm erst Festigkeit und Klarheit verleiht. Wenn ich auf mein Leben hinschaue wie auf mein Eigentum, das mir zu meinem eigenen Glück gegeben ward, so kann man durch keinerlei Listen und durch keinerlei Betrug erreichen, dass ich im Angesichte des Todes ruhig leben könnte. Nur dann kann man völlig gleichgültig sein zum körperlichen Tod, wenn einem das Leben lediglich als Verpflichtung erscheint – den Willen des Vaters zu erfüllen. Dann liegt das Interesse am Leben nicht darin, ob ich mich gut oder schlecht fühle, vielmehr darin, ob ich das gut erfülle, was mir befohlen ward. Dazu aber bin ich imstande bis zu meinem letzten Atemzuge, und bis zu meinem letzten Atemzug kann ich ruhig und froh sein. Ich sage nicht, dass ich bereits so ein Mensch bin – ich möchte nur ein solcher sein, und wünsche Ihnen das gleiche und dabei hoffe ich, Sie werden mit einer solchen Fragestellung einverstanden sein. Damit Sie aber nicht glauben, ich verstehe unter der Erfüllung des göttlichen Willens etwas ganz Besonderes, möchte ich betonen, dass der Wille des Vaters einer und derselbe und allbekannt ist – die Liebe zu allen Menschen und die Vereinigung mit ihnen, angefangen von den uns am nächsten bis zu den uns am fernsten Stehenden. Nicht wahr, Sie sind einverstanden?
Von ganzer Seele küsse ich Sie und danke Ihnen für Ihren guten Willen.
Nr. 7 | An die Gräfin
A. A. Tolstoi,
August bis Sept. 1887.
Ich fürchte, ich werde nicht dazu kommen, Ihnen einen langen Brief zu schreiben, meine liebe Freundin Alexandrine, aber mehr noch fürchte ich – Ihren schönen von Liebe erfüllten Brief unbeantwortet zu lassen. Freilich, Ihre Vorwürfe sind ungerecht, liebe Freundin. Sie sagen: „Suchen Sie nicht auf andere einzuwirken, denn Ihre Überzeugungen können ja Irrtümer und schädliche Irrtümer sein.“ Dieses Argument ist unrichtig, vor allem aber kann es auch gegen die Lehre der Kirche angewandt werden, und mit bei weitem grösserem Recht: Wenn man die kirchliche Lehre für falsch hält, wie schmerzlich muss es einem dann sein, dieses fürchterliche Lügennetz der Propaganda (wie es einem dann scheint) mit anzusehen – in dem einfache, unschuldige Menschen und sogar kleine Kinder eingefangen werden. Bei Meinungsverschiedenheit kann man gar nicht von den Folgen sprechen, die falsche Anschauungen hervorbringen werden; man muss von den Anschauungen selber sprechen; die Lüge aber wird stets Lüge sein und stets Verderben bringen.
Zu meinen Gunsten sage ich nur das Eine, und ich bitte Sie gar sehr, in demselben Geiste der Liebe, in dem Sie mir schrieben, auch diese Worte aufzunehmen und zu erwägen: Ich behaupte gar nichts, was Sie nicht anerkennen, und deshalb habe ich die Freude, zu wissen, dass Sie mit mir in allem einverstanden sind, was mich am Leben erhält. Sie dagegen behaupten viele solche Dinge, die ich ausserstande bin anzuerkennen, und deshalb sind Sie in der bittern Lage, zu wissen, dass nicht nur ich, vielmehr Millionen anderer Leute das nicht anerkennen, was Sie behaupten. Wo liegt die Ursache dieser Unstimmigkeit? Sie sind nicht einverstanden mit den Mohammedanern, weil diese Vielweiberei anerkennen und anderes mehr, die Mohammedaner sind aber mit Ihnen darin einverstanden, dass das Gesetz Christi die Wahrheit ist. Wer ist an der Unstimmigkeit schuld? Aber ich wollte eigentlich nicht das sagen, vielmehr folgendes: „Ich wünsche Gutes zu tun und tue Schlechtes.“ Wenn ich wirklich in meinem Leben nichts als Böses tue und um kein Härchen besser werde, d. h. wenn ich nicht anfange, ein ganz klein wenig weniger Böses zu tun, so lüge ich unbedingt, wenn ich sage, ich wünschte das Gute zu tun. Wenn der Mensch wirklich nicht für die Menschen, vielmehr nur für Gott das Gute tun will, so schreitet er ständig auf dem Wege des Guten voran. Diese Bewegung ist aber – eine Annäherung an Gott (wie gering sie auch sein mag, wenn sie überhaupt nur vorhanden ist) und kräftigt auf dem Wege und gibt Hoffnung und Freude und die Erkenntnis dessen, dass man wenigstens ein klein wenig das tut, was Gott wünscht. Auf der Badewanne des Kaisers von China stand geschrieben: „Erneuere Dich jeden Tag, jede Stunde von Anfang an und immer wieder von Anfang an.“ Klopfet an, so wird euch aufgetan, bittet um den Geist und er wird euch gegeben – das bedeutet ganz dasselbe. Das ganze Leben ist nur eine einzige Fortbewegung auf diesem Wege – eine Annäherung an Gott (damit sind Sie doch einverstanden?). Und diese Bewegung erfüllt mit Freude, erstens deshalb, weil, je mehr man sich dem Lichte nähert, man sich um so besser fühlt; zweitens deshalb, weil man bei jedem Schritt voran ersieht, wie wenig man noch getan hat, und wie viel von diesem freudeerfüllten Weg einem noch bevorsteht. Sie aber sagen: Meine Sünden, meine Unvollkommenheit, meine Schwäche? Aber ich gehe doch gar nicht ins Kreisgericht, vielmehr zum Gerichte Gottes. Gott ist aber die Liebe. Gott kann ich mir gar nicht anders vorstellen als allweise, allwissend und vor allem nicht nur als keineswegs- nachtragend (wie auch ich mich zu sein bemühe), vielmehr als unendlich mitleidig. Wie sollte ich dann aber, vor einem solchen Richter, meine Schwächen und meine Sünden fürchten? Das ganze Evangelium ist angefüllt mit mittelbaren und unmittelbaren Hinweisen auf die Vergebung, auf das Nichtvorhandensein von Sünden vor Gott für den Menschen, der ihn liebt. – Sie sagen, Gott habe im voraus eine solche – ich weiss gar nicht wie ich mich ausdrücken soll – Verfügung getroffen oder einen solchen Einfall gehabt, mir meine Sünden zu verzeihen … (Ich kann gar nicht ruhig an solche Gotteslästerung denken. Verzeihen Sie mir um Christi willen!) Wäre es aber nicht einfacher für Gott, dem ich völlig angehöre, von dem ich ausging, der mich kennt und mich liebt, für Gott, der die Liebe und das Mitleid ist, – wäre es nicht einfacher für Gott, mir ohne weiteres meine Sünden zu verzeihen? Und ist es denn keine furchtbare Gotteslästerung zu sagen, Gott könne oder wolle nicht meine Sünden verzeihen, wenn ich glaube, dass er das will, und dass er es tut, und wenn es für mich ganz unmöglich ist, zu glauben, er habe die Menschen dafür gestraft, er strafe sie und werde sie dafür strafen, dass sie nicht daran glauben, dass er ihnen im Voraus verzieh … (Ich kann gar nicht ohne Entsetzen diese gotteslästerlichen Worte wiederholen.) Gott werde mich dafür strafen, dass ich nicht daran glaube, dass er ein unvernünftiger und böser Gott ist. Würden Sie dem habgierigsten Menschen sagen: Willst du eine Erbschaft erlangen, – so gib zu, dass deine Mutter (von der dieser Mensch weiss, dass sie eine Heilige war) mit irgend einem sehr reichen Mann in sträflichen Beziehungen stand – so müsste jeder Mensch eingestehen, dass dies Lüge ist, und eine Beleidigung des Allerheiligsten, was es nur für ihn gibt.
Ich habe viel Unnötiges geschrieben, ich wollte aber eigentlich nur eines sagen: Wir all leben, wenn wir als Menschen leben, indem wir zu Gott hinstreben, indem wir uns ihm annähern, durch seinen Vermittler zwischen ihm und den Menschen: Jesus Christus. Wenn wir uns auch aus dem tierischen, verdorbensten Zustand befreiten und die höchste Höhe der Heiligkeit erlangten, so fühlen wir gleichwohl, dass unser Leben voller Sünden ist. Wenn aber der Mensch dieses wirkliche Leben begann, so weiss er stets und vermag zu glauben, wenn er zurückblickt, dass er sich, wenn auch noch so langsam, dem Lichte nähert, die Richtung nach ihm erkennt und in der Hinbewegung in dieser Richtung den Sinn des Lebens begreift. Die Sünden und die Schwächen des Menschen sind gross, und in unendlicher Ferne liegt vor ihm die Vollkommenheit; aber gleichwohl strebt er ihr nach. Und hierbei stärkt gerade der Glaube an die Gnade Gottes, an sein Mitleid und seine Liebe zu uns die Kräfte des Menschen und beweist ihm, dass jede Befreiung von seinen Sünden, die ihm aus eigener Kraft unmöglich erscheint, und das Erlangen der Vollkommenheit und der Seligkeit mit Gottes Hilfe möglich ist. Sie sagen, dieses Heil sei vor 1880 Jahren geschehen, ich aber glaube, dass Gott stets so war, wie er jetzt ist, und dass er zu jeder Zeit den Menschen half, dass er von jeher mitleidig war und ihre Rettung will, d. h. das Heil der Menschen, und dass er stets denen, die ihn suchen, nahe ist.
Ich begreife, dass Ihnen jene Form der Vorstellung Gottes und seiner Liebe, an die Sie gewöhnt sind, teuer ist, eines aber kann ich nicht begreifen; weshalb wünschen Sie eigentlich, dass alle anderen genau die gleiche Anschauung haben sollen? Man könnte das noch verstehen, wenn es sich um etwas Neues, eben erst Entdecktes handeln würde, dies aber ist eine längst, längst schon allen, nicht nur mir, sehr wohl bekannte Vorstellung und die tröstlichste, wie Sie selber zugeben. Weshalb sollen denn diejenigen Menschen, die Gott suchen und die Lehre Christi kennen, nicht diese Vorstellung annehmen? Ich begreife, dass diese Lehre auch den befriedigen kann, der niemals an Gott und an Christus dachte, und ich freue mich deswegen sehr für diejenigen, die diese Lehre annehmen. Weshalb soll man aber glauben, dass Menschen, die Gott suchen, so ohne jede Ursache diese Lehre verwerfen, die so viel Trost gewährt? Offenbar haben sie Gründe, nur kommen sie Ihnen ungenügend vor. Nun, was soll man da machen, lassen Sie sie schon in Ruhe, verzeihen Sie und lieben Sie sie, wie sie sind, wenn Sie aber mit jenen in Einklang stehen wollen, so denken Sie ernsthaft nach über diese Ursachen, und untersuchen Sie diese ganze Angelegenheit ganz von vorne an und nehmen Sie dabei an, dass vielleicht auch Ihr Glaube irrtümlich sein könnte, Sie werden das aber nicht tun, das weiss ich, Sie wollen das nicht und können es nicht. Ihnen ist es auch so wohl. So gehen Sie denn Ihren Weg. Alle, die zu einem Ziele schreiten, werden sich in ihm treffen. Von ganzer Seele liebe ich und küsse ich Sie.
L. Tolstoi.
Nr. 8 | An die Gräfin
A. A. Tolstoi,
31. März 1895.
Wie oft habe ich mich früher gefragt, und viele fragen so: Weshalb sterben Kinder? Und niemals fand ich eine Antwort. In der letzten Zeit aber, als ich schon überhaupt nicht mehr an die Kinder dachte, vielmehr nur an mein eigenes Leben und überhaupt an das Leben des Menschen, kam ich zu der Überzeugung, dass die einzige Aufgabe im Leben eines jeden Menschen – nur darin besteht, in sich selber die Liebe zu mehren, und indem man das tut, auch die andern anzustecken und auch in ihnen die Liebe zu mehren. Und da stellte mir nun das Leben selber diese Frage: Weshalb lebte dieser Knabe und starb er, noch bevor er den zehnten Teil des üblichen Menschenlebens erreicht hatte? Die für alle Menschen gültige Antwort, zu der ich gelangte, ohne überhaupt an Kinder zu denken, passt nicht nur auf diesen Tod, vielmehr bestätigte sie durch das, was sich jetzt mit uns allen zutrug, die Richtigkeit dieser Antwort. Dieses Kind lebte dafür, um in sich die Liebe zu mehren, um in der Liebe zu wachsen, wie das Der wollte, Der es gesandt hatte, und zu dem Zweck, um uns alle, die wir das Kind umgaben, mit dieser Liebe anzustecken – und um, indem es das Leben verliess, und zu Dem zurückkehrte, Der die Liebe selber ist, in uns die ganze in ihm erwachsene Liebe zurückzulassen und uns durch sie nur fester aneinander zu schliessen. – Niemals waren wir einander so nahe wie jetzt, und niemals fühlte ich in Sonja und in mir ein solches Bedürfnis nach Liebe und einen solchen Widerwillen gegen jede Trennung und jedes Böse. Niemals habe ich noch Sonja so geliebt wie jetzt, und deshalb ist es mir wohl.
Leben Sie wohl, meine liebe, teure Freundin, verzeihen Sie mir, dass ich immer nur von mir und den Meinigen schreibe. Schreiben Sie mir auch über sich ein Wörtchen. Sonja, ich und alle Kinder küssen Sie. L. Tolstoi.
Nr. 9 | An die Gräfin
A.A. Tolstoi
,
Jassnaja Poljana, 26. Januar 1903
.
Verurteilen Sie mich nicht, meine liebe Freundin, deswegen, weil ich, mit dem einen Fuss schon im Grabe stehend, mich immer noch mit solchen Nichtigkeiten beschäftige. Diese Nichtigkeiten füllen meine freie Zeit aus und geben mir Erholung von allen wirklichen, ernsten Gedanken, die meine Seele erfüllen.
Ja, wahrscheinlich werden wir uns nicht mehr in dieser Welt wiedersehen; so ist es Gott gefällig, und demnach ist es gut so. Auch glaube ich nicht, dass wir uns dort so wiedersehen, wie wir uns ein Wiedersehen vorstellen, ich glaube aber und bin durchaus davon überzeugt, dass auch in jenem Leben alles das Gute, Liebevolle und Schöne, das Sie mir in diesem Leben sagten, mir bleiben wird und vielleicht auch ebensolche Krümchen, die ich Ihnen gab, Ihnen bleiben werden. Überhaupt, indem ich mich dem unvermeidlichen und guten Ausgang nähere, fühle ich, dass, je bestimmter meine Vorstellungen von dem sind, was dort sein wird, ich um so weniger an sie glaube, und umgekehrt: je unbestimmter sie sind, um so stärker und fester ist mein Glaube daran, dass das Leben hier nicht endet, vielmehr ein neues und besseres Leben dort beginnt. So, dass sich alles vereinigt im Glauben an die Gnade Gottes. – Alles, was bei Ihm ist und von Ihm ist, alles das ist Heil. Wie ich bei meiner Geburt von ihm ausging, so werde ich auch sterbend zu ihm zurückkehren, und hieraus kann nur Gutes erstehen. „In deine Hände befehle ich meinen Geist.“
Leben Sie wohl, meine liebe, liebe Freundin. In brüderlicher Zärtlichkeit küsse ich Sie und danke Ihnen für alle Ihre Liebe.
_______
Nr. 10 | An
A. A. Fet,
Januar 1872.
… Über Nirwana muss man nicht lachen und noch weniger sich erzürnen. Uns allen (wenigstens mir, das fühle ich) ist Nirwana bei weitem interessanter als das Leben, ich bin aber darin mit Ihnen einverstanden, dass, wie sehr ich auch über es nachdenke, mir gar nichts anderes in den Kopf kommt, als dass dieses Nirwana – eben das Nichts ist. Ich stehe nur für eines ein – für eine religiöse Ehrfurcht, für einen religiösen Schauer vor diesem Nirwana.
Etwas Wichtigeres als es kann es ja gar nicht geben.
Was ich unter religiöser Ehrfurcht verstehe? – Das will ich Ihnen sagen: Unlängst fuhr ich zu meinem Bruder, er hatte ein kleines Kind verloren, und die Beisetzung sollte stattfinden. Die Popen kamen, der kleine rosafarbene Sarg stand da und alles, wie es sich gehört. Unwillkürlich gestanden mein Bruder und ich uns einander ein, dass wir fast Widerwillen empfanden gegen diese Zeremonien. Später fiel mir aber ein: Nun, was hätte denn mein Bruder getan, um schliesslich den verwesenden Körper des Kindes aus dem Hause zu schaffen? Wie soll man überhaupt so etwas in anständiger Weise vollbringen? Da ist doch nichts besser (mir würde wenigstens nichts einfallen) als die Feier einer Totenmesse, Weihrauch usw. …
Wollte ich Ihnen ausführlich die Bedeutung, die Wichtigkeit, die Feierlichkeit und den religiösen Schauer vor diesem höchsten Ereignis im Leben jedes Menschen zum Ausdruck bringen, so könnte auch ich gar nichts ausdenken, was besser passen würde für alle Altersstufen, für alle Grade der Bildung, als die religiöse Zeremonie. Wenigstens in mir lösen diese kirchenslawischen Worte durchaus die gleiche metaphysische Begeisterung aus, die ich empfinde, wenn ich mich in Nirwana versenke. Die Religion verdient schon darum Ehrfurcht, weil sie im Laufe so vieler Jahrhunderte so vielen Millionen Menschen diesen Dienst erwies, und das ist doch der grösste, den bei dieser Gelegenheit der Mensch dem Menschen zu erweisen vermag. Wie soll sie denn bei einer solchen Aufgabe auch noch logisch sein? Trotzdem liegt etwas in ihr. Nur Ihnen erlaube ich mir solche Briefe zu schreiben. Ich hatte gerade Lust Ihnen zu schreiben und es ist mir etwas traurig zumute, besonders infolge Ihres Briefes. Schreiben Sie mir bitte bald von Ihrer Gesundheit.
Ihr Leo Tolstoi.
Nr. 11 | An
T. A. Kusminskaja,
Mai 1873.
Meine liebe Freundin Tanja! Ich kann Dir gar nicht den Eindruck schildern, den die Nachricht vom Tode meiner prächtigen lieben (wie angenehm ist es mir jetzt, mich dessen zu erinnern), meiner geliebten Dascha auf mich ausübte. Den ganzen Tag kann ich gar nicht an sie und Euch denken, ohne dass mir die Tränen in die Augen kommen. Ich habe dabei jene Empfindung, die wahrscheinlich jetzt auch Euch quält: Man vergisst das, dann erinnert man sich und fragt sich mit Entsetzen, ob das denn auch wirklich wahr ist. Noch lange Zeit hindurch werdet Ihr Euch morgens heim Aufwachen fragen, ob es denn auch die Wahrheit ist, dass dieses Kind nicht mehr am Leben ist … Lies bitte den 130. Psalm, lerne ihn auswendig und sage ihn Dir jeden Tag her … Ja, nur die Religion vermag zu trösten. Und ich bin überzeugt, Du hast zum erstenmal ihre ganze Bedeutung erfasst, – und ums Himmelswillen, um Gotteswillen vergiss sie nicht, bemühe Dich nicht, sie zu vergessen: Jene schweren Augenblicke, die Du durchlebtest, und halte sie Dir immer vor Augen. Du hast mir einmal gesagt, ich entsinne mich, der Tod sei Dir furchtbar. Doch in dem Tode eines nahestehenden Wesens, besonders wenn es sich um ein so prächtiges Geschöpf handelt wie ein Kind, liegt eine erstaunliche, wenn auch unwillkürliche Feierlichkeit. Wozu lebt und stirbt ein Kind? Das ist ein furchtbares Rätsel. Und für mich gibt es nur eine Erklärung: Dem Kinde ist es besser so, und wie banal auch diese Worte sein mögen, sie sind stets neu und tief, wenn man sich in ihren Sinn vertieft. Auch uns ist es besser so, und wir müssen alles besser machen nach solchem schweren Kummer. Ich bin durch das hindurchgegangen … Du wirst es, wie es sich gehört, vor allem ohne zu murren und in dem Gedanken, dass wir nicht zu erfassen vermögen, wer wir sind und wozu wir leben, und dass wir uns nur in Demut fügen sollen …
Nr. 12 | An
N. N. Strachoff.
Jassnaja Poljana, Januar 1873.
Über das Suchen nach dem Glauben … Sie schreiben, alle Kompromisse mit dem Gedanken seien Ihnen zuwider, mir gleichfalls. Sie schreiben aber noch, dem Gläubigen komme jede Sinnlosigkeit gelegen, wenn sie nur nach Ehrfurcht rieche. (Ich hatte gesagt: Wenn sie nur erfüllt ist von Glaube, Liebe und Hoffnung.) Der Gläubige fühle sich inmitten aller Sinnlosigkeiten wie der Fisch im Wasser, ihm sei das Klare und Bestimmte zuwider. Mir geht es gerade so. Ich begann hierüber zu schreiben und habe ziemlich viel geschrieben, jetzt habe ich es aber sein lassen, da mich andere Tätigkeiten davon abbrachten; indem ich aber auf Ihre (ungewöhnliche) Fähigkeit rechne, andere zu verstehen, will ich versuchen, in diesem Briefe zum Ausdruck zu bringen, weshalb ich der Ansicht bin, dass das, was Ihnen seltsam vorkommt, durchaus nicht seltsam ist. Die Vernunft antwortet mir gar nichts und kann auch gar nichts antworten auf drei Fragen, die man leicht in eine einzige zusammenfassen kann: Was bin ich eigentlich? Antworten auf diese Fragen gibt mir in der Tiefe meines Bewusstseins ein ganz bestimmtes Gefühl. Die Antworten, die mir dies Gefühl gibt, sind aber dunkel, unklar und nicht wiederzugeben mit Worten (den Werkzeugen des Gedankens); doch nicht ich allein suchte und suche Antworten auf diese Frage. Die ganze lebende Menschheit ward in jeder einzelnen Seele von ganz den gleichen Fragen gequält, und erhielt in ihrer Seele ganz dieselben dunklen Antworten. Milliarden gleichbedeutender dunkler Antworten gaben diesen Antworten Bestimmtheit. Diese Antworten heissen – die Religion.
Vom Standpunkt der Vernunft sind diese Antworten sinnlos. Sinnlos sogar schon aus dem einen Grunde, dass sie mit Worten ausgedrückt wurden, – aber gleichwohl antworten sie allein auf die Fragen des Herzens. Als Ausdruck, als Form, sind sie sinnlos, als Inhalt dagegen sind sie allein wahr. Wenn ich meinen ganzen Blick auf die Form richte – entschwindet der Inhalt, richte ich aber meinen vollen Blick auf den Inhalt – so habe ich nichts mehr mit der Form zu schaffen.
Ich erstrebe Antwort auf diese Fragen, meinem Wesen nach, im Namen der Vernunft und verlange dabei, dass diese Antworten sich durch das Wort, das Werkzeug der Vernunft, ausdrücken lassen, und deshalb wundere ich mich, dass die Form der Antworten die Vernunft nicht befriedigt. Sie werden aber sagen: Deshalb kann es auch gar keine Antworten geben. Nein, Sie werden das nicht sagen, denn Sie wissen, dass es Antworten gibt, dass nur durch diese Antworten alle Menschen und Sie selber leben und gelebt haben. Wollte man sagen, diese Antworten kann es gar nicht geben, so wäre das ebenso, als würde man sagen, während man über das Eis geht: Die Flüsse können gar nicht zufrieren, weil sich die Körper von der Kälte zusammenziehen, nicht aber sich ausdehnen. Zu sagen, diese Antworten seien sinnlos – ist ebenso als wollte man sagen: „Ich bin ausserstande, etwas in ihnen zu verstehen.“ Und mir scheint, die Ursache, weswegen Sie diese Fragen nicht verstehen, ist folgende: Diese Antworten werden nicht auf Fragen der Vernunft verlangt, vielmehr auf Fragen ganz anderer Art. Ich nenne diese Fragen: Fragen des Herzens.
Auf diese Fragen antworten die Menschen, so lange das Menschengeschlecht besteht, nicht mit Worten, den Werkzeugen der Vernunft und einem Teile der Offenbarung des Lebens, – vielmehr mit dem ganzen Leben, mit Taten, von denen das Wort wiederum nur einen Teil darstellt.
Alle die Glaubensinhalte, die ich habe, Sie und alles Volk – gründen sich nicht auf Worten und Überlegungen, vielmehr auf eine Reihe von Handlungen und auf der Lebensführung solcher Leute, die unmittelbar (wie ein Gähnen ansteckt) einer auf den anderen einwirken, angefangen von Abraham, Moses, Christus, den heiligen Vätern, ihrer Lebensführung und sogar ihren äusseren Handlungen – ihren Verneigungen, Fasten, Beobachtungen ganz bestimmter Vorschriften usw. Aus dieser ganzen Masse zahlloser Handlungen dieser Menschen hoben sich aus irgend einem Grunde gewisse Handlungen hervor und bildeten eine einzige Überlieferung, die zur einzigen Antwort auf die Fragen des Herzens dient. Und deshalb liegt für mich in dieser Überlieferung nicht nur durchaus nichts sinnloses, ich verstehe sogar nicht einmal, wie man an diese Erscheinungen den Massstab des Sinnvollen oder Sinnlosen anlegen kann. Die einzige Nachprüfung, der ich diese Überlieferungen unterwerfe und stets unterwerfen werde, liegt darin, ob die von ihr gegebenen Antworten übereinstimmen mit jener dunkeln, mir allein gewordenen Antwort, die in der Tiefe meines Bewusstseins eingegraben ist (und von der ich weiter oben sprach). Wenn mir daher diese Überlieferung sagt, ich solle einmal im Jahre einen Wein trinken, der Gottes Blut genannt wird, so führe ich das aus, indem ich diese Handlung in meiner Weise verstehe oder überhaupt nicht begreife. In ihr liegt aber gar nichts, was meinem dunkeln Bewusstsein widersprechen würde. Ebenso esse ich an bestimmten Tagen Kohl, und an anderen – Fleisch; wenn mir aber eine Überlieferung (die entstellt ward durch Missverständnisse im Kampf mit verschiedenen Auslegungen) sagt: „Lasst uns alle zusammen dafür beten, dass wir möglichst viele Türken totschlagen“, oder wenn sie mir auch nur sagt, derjenige, der nicht glaubt, dies sei wirkliches Blut usw., dann befrage ich zwar nicht meine Vernunft, wohl aber eine zwar dunkle, aber zweifellose Stimme meines Herzens und behaupte, diese Überlieferung sei falsch, – so dass ich also ganz sowie ein Fisch im Wasser in Sinnlosigkeiten schwimme und mich nur dann nicht füge, wenn mir die Überlieferung Handlungen vorschreibt, die nicht im Einklang stehen mit der grundlegenden Sinnlosigkeit meines dunklen Bewusstseins, die in meinem Herzen ruht. Wenn Sie ungeachtet der Ungenauigkeit meines Ausdrucks meinen Gedanken verstehen, so schreiben Sie mir bitte, ob Sie mit mir einverstanden sind oder nicht, und im letzteren Falle auch weshalb. Es ist mir peinlich, von diesen Dingen zu reden, aber ich spreche mich so aus, wie ich empfinde. Ich bin derart überzeugt von dem, was ich sage, und diese Überzeugung ist so erfreulich für mich, dass ich Ihr Urteil nicht in meinem Interesse wünsche, vielmehr in dem Ihrigen. Ich wünschte, Sie möchten ganz die gleiche Ruhe und geistige Freiheit empfinden, die ich jetzt erlebe. Ich weiss sehr wohl, die Wege, um auch nur zu den rein formalen, mathematischen Wahrheiten zu gelangen, sind für jeden Geist ganz besondere, um so mehr müssen sie in jedem Falle eigenartig sein, wo es sich um das Erfassen metaphysischer Wahrheiten handelt, – mir ist das aber so klar (wie ein Taschenspielerkunststück, das man mir erklärte), dass ich gar nicht zu begreifen vermag, worin dieser Zusammenhang für andere noch unverständlich sein kann. Auch weiss ich, dass, wenn ich nach Moskau in nördlicher Richtung fahren muss und ich mich in Tula in den Eisenhahnwagen setze, dies keineswegs zur allgemeinen Regel gelten kann für alle Menschen, die sich in den verschiedensten Gegenden der Welt befinden und nach Moskau zu fahren wünschen, – um so weniger für Sie, weil ich weiss, dass Sie viel Bagage mit sich führen (Ihr Wissen und alle Arbeiten, die hinter Ihnen liegen), ich aber mit leichtem Gepäck fahre – ich kann Sie indes versichern, dass ich in Moskau bin, sonst nirgendshin zu fahren wünschen kann, und dass es in Moskau sehr schön ist.
L. Tolstoi.
Nr. 13 | An
N. N. Strachoff.
Jassnaja Poljana, April 1878.
Ich habe heute gebeichtet und das Abendmahl genommen, ich las dann im Evangelium und darauf Renans „Leben Jesu“2. Ich las es ganz durch, ich las ohne Unterbrechung und wunderte mich über Sie. Ich kann mir Ihre Voreingenommenheit für Renan bloss so erklären, dass Sie sehr jung waren, als Sie ihn lasen. Wenn Renan überhaupt eigene Gedanken hat, so sind das die zwei folgenden: 1. Dass Jesus nicht die Entwicklung und den Fortschritt kannte und in dieser Hinsicht bemüht sich Renan, die Lehre Jesu zu verbessern und kritisiert ihn von der Höhe dieses Gedankens herab. Das ist furchtbar, wenigsten für mich; meiner Ansicht nach ist der Fortschritt der Logarithmus der Zeit, d. h. gar nichts, die Konstatierung der Tatsache, dass wir in der Zeit leben, – und plötzlich wird das zum Kriterium der höchsten Stufe, die wir kennen! Der Leichtsinn oder die Gewissenlosigkeit dieser Anschauungen sind wahrhaft erstaunlich. Die christliche Wahrheit, d. h. der höchste Ausdruck des absoluten Guten, ist der Ausdruck des Wesens selber jenseits der Form, der Zeit usw.
Leute wie Renan verwechseln aber ihren (der christlichen Wahrheit) „absoluten“ Ausdruck mit ihrer Offenbarung in der Geschichte, und so führen sie die christliche Wahrheit auf eine zeitliche Erscheinung zurück und urteilen dann. Ist aber die christliche Wahrheit erhaben und tief, so nur deshalb, weil sie subjektiv absolut ist. Betrachtet man hingegen ihre objektive Offenbarung, so steht sie auf einer Stufe mit dem Code Napoléon usw. Der zweite neue Gedanke bei Renan ist folgender: Wenn diese Lehre die Lehre Christi ist, so gab es einen ganz bestimmten Menschen und dieser Mensch schwitzte zweifellos und ging umher … Für uns verschwanden aus dem Christentum alle rein menschlichen, erniedrigenden, realistischen Einzelheiten deshalb, weil wir gar keine Einzelheiten mehr kennen von allen Juden, die irgendwann lebten usw. Mit einem Worte deshalb, weil alles schliesslich verschwindet, weil es nicht ewig ist; d. h. der Sand, der nicht nötig ist, wird weggewaschen, es blieb nach einem unabänderlichen Gesetz nur das Gold zurück. Mir scheint, was sollen wir Menschen anders tun, als dieses Gold ergreifen? Nein! Renan sagt, wenn Gold da ist, so muss auch Sand dagewesen sein, und er bemüht sich nun herauszufinden, was das für ein Sand war. Und das alles mit tiefsinnigster Miene. Was aber noch amüsanter wäre, wenn es nicht so furchtbar dumm wäre, das ist, dass man keinerlei Sand findet und nur behauptet, er müsse dagewesen sein. Ich habe alles durchgelesen, lange gesucht und mich gefragt, was habe ich eigentlich aus diesen geschichtlichen Einzelheiten neues gelernt? Besinnen auch Sie sich hierauf und gestehen Sie, dass es gar nichts ist, rein gar nichts. Ich habe die Absicht, Renan zu ergänzen und Untersuchungen darüber anzustellen, was es für körperliche Vergiftungen gab und worin sie bestehen. Alles ist Fortschritt, alles Evolution. Vielleicht muss man, wenn man eine Pflanze kennen lernen will, ihre Umgebung kennen, und sogar um einen Menschen zu verstehen, sofern er ein staatliches Wesen ist, seine Umgebung, ihre Bewegung und ihre Entwicklung verstehen, – um aber das Wahre, Schöne und Gute zu begreifen, dazu verhilft einem keinerlei Erforschung der Umgebung. Ja, und sie hat auch gar nichts gemein mit dem, was da erforscht werden soll. Dort schreiten wir auf einer Ebene, hier dagegen herrscht eine ganz andere Richtung – in die Tiefe und in die Höhe. Die sittliche Wahrheit kann und muss man erforschen und darf nie damit aufhören, diese Erforschung geht aber in die Tiefe und so wird sie von religiösen Menschen betrieben, während hier bei Renan ein kindischer, banaler und niederträchtiger Unfug vorliegt.
Nr. 14 | An
M. A. Engelhart,
August 1882.
Mein teurer M. A.! Ich schreibe Ihnen „mein teurer“ nicht deshalb, weil das üblich ist, vielmehr deshalb, weil ich seit Empfang Ihres ersten und besonders Ihres zweiten Briefes fühle, dass Sie mir sehr nahe stehen, und ich Sie liebe. In dem Gefühl, das ich zu Ihnen hege, liegt viel Egoistisches. Wahrscheinlich glauben Sie das nicht, Sie können sich aber gar nicht vorstellen, in welchem Masse ich einsam bin, bis zu welchem Grade das, was mein wirkliches „Ich“ ist, von allen verachtet wird, die mich umgeben. Ich weiss, dass dem Menschen nur in Kleinigkeiten das Recht gegeben ward, die Früchte seiner Mühen zu nutzen oder wenigstens diese Frucht zu sehen, – dass aber da, wo es sich um Gottes Wahrheit handelt, die ewig ist, es dem Menschen nicht beschieden sein kann, die Frucht seiner Tätigkeit zu erschauen, und ganz besonders in einer kurzen Periode seines kurzen Lebens. Das weiss ich alles, und trotzdem bin ich häufig mutlos, und deshalb war die Bekanntschaft mit Ihnen und die Hoffnung, fast die Gewissheit, in Ihnen einen Menschen zu finden, der aufrichtig den gleichen Weg geht wie ich und nach dem gleichen Ziele hin, für mich sehr erfreulich.
Ich antworte Ihnen, dass ich nicht predige, und das auch gar nicht kann, obgleich ich es leidenschaftlich wünsche. Predigen kann ich nur durch die Tat, und meine Taten sind schlecht. Das aber, wovon ich spreche, ist keine Predigt, vielmehr nur die Widerlegung einer falschen Auffassung der christlichen Lehre und die Darlegung ihrer wirklichen Bedeutung.