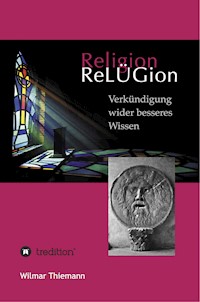
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
In diesem Buch geht der Autor der Frage nach, inwieweit die Vertreter der christlichen Kirchen wider besseres Wissen ihren Glauben bekennen und die christliche Botschaft verkünden. Die damit unterstellte "Lüge", wie sie im Titel dieses Buches zum Ausdruck kommt, ist wertfrei gebraucht. Der Begriff dient weniger dem Vorwurf an die Adresse der religiösen Eliten als vielmehr der Diagnose ihres Verhaltens in der Gegenwart aber auch in der Vergangenheit. Der Autor behauptet begründet, dass während der letzten zweieinhalb Jahrtausende Glaubensinhalte konstruiert und wider besseres Wissen als göttliche Offenbarungen weitergegeben wurden. Er belegt dies mit Forschungsergebnissen der universitären Theologie und der Religionswissenschaft. Er betrachtet zudem das Konstrukt der jüdisch-christlichen Religion unter dem Aspekt menschlicher Wünsche nach Macht, Meinungsführerschaft und Deutungshoheit, wie sie von den jeweiligen religiösen Eliten seit jeher erhoben wurden. Er zeigt, wie die Geschichten des Alten und Neuen Testaments so verfasst wurden, dass sie den aktuellen religiösen Intentionen der Eliten entsprachen und wie sie mit Verweis auf erfundene Reden Gottes beglaubigt wurden. Er untersucht den Umgang der Kirchen mit wissenschaftlichem Allgemeingut, dass perspektivisch den tradierten Glauben in seine Bedingtheiten auflösen muss. In seinem Lösungsansatz arbeitet er differenzierend mit den Begriffen Wahrheit, Wahrhaftigkeit und Lüge und kommt zu Ergebnissen, die versuchen der Komplexität des Themas gerecht zu werden. Ungeachtet seiner Diagnosen drückt der Autor seine Wertschätzung der Schriften des Alten und Neuen Testaments als Zeugnisse menschlichen Denkens aus, die in Teilen ihren Anspruch nicht verloren haben. Sie stellen ohne Zweifel auch heute noch relevante anthropologische Grundfragen und beleuchten viele Aspekte des Menschseins. Er bedauert aber, dass die "zeitlosen Wahrheiten" von den Kirchen für ihre eigenen Ziele instrumentalisiert wurden und werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 455
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Wilmar Thiemann
ReLÜGion
Verkündigung wider besseres Wissen
Werder / Havel 2021
© 2021 Wilmar Thiemann
Verlag und Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN
Paperback:
978-3-347-26446-5
Hardcover:
978-3-347-26447-2
e-Book:
978-3-347-26448-9
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Umschlagbild: Das Relief stellt den „Bocca de la veritá“ (Mund der Wahrheit) dar und befindet sich in der Vorhalle der römischen Kirche Santa Maria in Cosmedin. Der Legende nach wird jedem die Hand abgeschlagen, der sie in den „Mund“ legt und dabei lügt.
Danksagung
Zu Beginn möchte ich mich bei all den Menschen bedanken, die mich in meiner Absicht dieses Buch zu schreiben, unterstützt haben. In vielen Gesprächen mit Freundinnen und Freunden, Kolleginnen und Kollegen über die Diskrepanz zwischen den Inhalten des Religionsunterrichts und der kirchlichen Verkündigung wurde ich immer wieder darin verstärkt, meine Gedanken in einem Buch zu veröffentlichen. Besonders intensiv habe ich mich mit meinen Freunden Johannes Eggers und Wolf Reuter über die unterschiedlichsten Inhalte ausgetauscht. Während der Abfassung haben sie mir viele Anregungen gegeben, mit Kritik nicht gespart und mich so über die gesamte Zeit motiviert, meine Arbeit zu vollenden. Besonders danke ich beiden, dass sie das fertige Buch noch einmal durchgesehen und mich auf manche Redundanzen hingewiesen haben.
Johannes Eggers, ebenfalls Religionslehrer, verfolgte mein Anliegen unter theologischer Perspektive, Wolf Reuter vertrat die religionskritische Sichtweise und bewahrte mich nicht nur einmal davor, selbst in die von mir kritisierte aber auch vertraute Theologensprache abzugleiten.
Ohne diese Freunde hätte ich dieses Buch nicht in die vorliegende Form bringen können.
Nicht zuletzt möchte ich meiner Frau für die Geduld danken, mit der sie ertrug, dass ich mich auch nach meiner Pensionierung nur schwer von meinem Schreibtisch trennen konnte.
Besonders bedanken möchte ich mich bei Uwe Stephan, der den Buchumschlag gestaltet hat.
Inhaltsverzeichnis
Danksagung
Inhaltsverzeichnis
Provokation
Vorwort
1
Zur Rolle der Kirchen und ihrer Legitimation
1.1
Präsenz der Kirchen und ihre gesellschaftliche Akzeptanz
1.2
Rückfrage an die theologische Legitimation der Rolle der Religion in unserer Gesellschaft
2
Religion als Lebensthema
3
Der unangemessene Wahrheitsanspruch
3.1
Wahrheit, Wahrhaftigkeit und Lüge
3.2
Wahrheit, Wahrhaftigkeit und Lüge in der jüdisch-christlichen Religion
4
Der Wahrheitsanspruch des Alten Testaments und seine Bestreitung
Vorbereitende Thesen zu Kapitel 4
4.1
Jahwe – eine Lokalgottheit wird zum Herrn der Welt
4.1.1
Jahwe - ein Gott unter vielen im Alten Orient
4.1.2
Die Fiktion Jahwes als des alleinigen Gottes Israels
4.2
Die Fiktion einer Geschichte Jahwes mit Israel
4.2.1
Die religionswissenschaftliche Perspektive
4.2.1.1
Die Geschichte Israels
4.2.1.2
Die Entwicklung des Monotheismus in Israel und Juda
4.3.
Die Geschichtsdeutung der Verfasser des Tanach nach Christoph Levin
4.3.1
Die Verfasser des Tanach
4.3.2
Die erzählte Geschichte Israels und Judas in der Darstellung des Tanach
4.3.2.1
Die Tora – die Rolle und Ursprünge ihrer Mythen
4.3.2.2
Der Inhalt der Samuel- und Königsbücher
4.4
Fazit
4.5
Die Rezeption des Tanach in den christlichen Kirchen der Gegenwart
5
Der Wahrheitsanspruch des christlichen Glaubens und seine Bestreitung
Vorbereitende Thesen zu Kapitel 5
5.1
Ein kurzergeschichtlicher Überblick
5.1.1
Die Vorgeschichte des Christentums
5.1.2
Das Christentum als „Neujudentum“ und seine Abgrenzung vom „Altjudentum“
5.2
Die Frage nach der Existenz Jesu
5.3
Die Quellenlage
5.3.1
Paulus – ein potenzieller, aber ignoranter Zeuge des Menschen Jesus
5.3.2
Die Quelle Q (Logienquelle) - Worte Jesu ohne Handlung
5.3.3
Die Evangelien – Verkündigung des auferstandenen Gottessohnes
5.4
Die Bedeutung der Titel Jesu
5.4.1
Jesus als Knecht Gottes
5.4.2
Sohn Gottes
5.4.3
Herr und Erlöser
5.4.4
Jesus als der Christus /Messias
5.4.5
Jesu als Held
5.5
Auferstehung
5.5.1
Die Entstehung des Auferstehungsglaubens und seine Ausformung zum Mythos von der Auferstehung Jesu Christi
5.5.2
Der Umgang mit der „Auferstehung Jesu Christi“ in den Werken neutestamentlicher Theologen, in Verlautbarungen der Evangelischen Kirchen und in Predigten Geistlicher
5.6
Vermutungen zur Entwicklung des Christus-Glaubens
5.7
Der christliche Glaube in Auseinandersetzung mit den Mysterienreligionen
5.8
Die prinzipielle Austauschbarkeit Jesu
5.9
Fazit
Exk.I
Die Geburt des Judentums und des Christentums aus der Katastrophe
Exk.II
Eine Erfindung mit fatalen Folgen – die Sünde
6
Die Frage von Wahrhaftigkeit und Lüge
Vorbereitende Thesen zu Kapitel 6
6.1
Das Bemühen um Kohärenz und Glaubwürdigkeit in der Gestaltung des Alten und Neuen Testaments in Anlehnung an die Interpretation von Carel von Schaik und Kai Michel
6.2
Die Komplexität des Problems von Wahrhaftigkeit und Lüge innerhalb der Theologie der Gegenwart
6.3
Der authentische Glaube und der systematisierte Glaube in Theologie und Kirche
6.3.1
Die Unterscheidung zwischen intuitiv-individueller Religiosität und der intellektuell-institutionellen Religion nach Schaik / Michel
6.3.2
Authentische und doktrinale1 Form der Religion
6.4
Der Ideologiecharakter der doktrinalen Form der Religion
6.4.1
Die Ideologie in der christlichen Religion
6.4.2
Das Festhalten an Dogmen und Bekenntnissen wider besseres Wissen als Kennzeichen einer Ideologie
6.4.3
Die strukturelle Lüge als Wesensbestandteil der Ideologie
6.4.4
Die Verbindung von Ideologie und Macht
6.4.5
Die Konsequenzen der strukturellen Lüge
7
Das „Wort Gottes“ - zwischen Mythos, Halluzination, Unwahrheit und Lüge
7.1
Die verpasste Entmythologisierung des biblischen Gottes
7.2
Die Rede vom Wort Gottes als Grundlüge der christlichen Verkündigung
7.2.1
Die Macht des geschriebenen Wortes
7.2.2
Die Ursprünge der Illusion der Götterreden
7.2.3
Die objektive Unwahrheit der Rede von Gottes Offenbarung im Alten Testament
7.2.4
Die Bibel als „Wort Gottes“ in Theologie und Kirche
7.2.5
Mundus vult decipi – die Welt will betrogen werden2
7.3
Nachgedanken zu Gott
7.3.1
Die Evolution der Götter
7.3.2
Gott als personalisierte Abstraktion
7.3.3
„Eigenschaften“ des christlichen Gottes
7.3.4
Gott als „höchstes Wesen“ jenseits der Spekulation der Religionen
8
Religion als kulturelles Gut der Menschen. Die anthropologische Bedeutung der Religion
8.1
Die Prägekraft der Religionen und ihrer Schriften
8.2
Die anthropologische Bedeutung des Glaubens an einen Gott
8.2.1
Das geschossene und das offene Weltbild
8.2.2
Gott als Symbol für das, was fraglos gültig ist
8.2.3
Mythen und Symbole als Quelle der Orientierung
8.2.4
Sinnfrage als Suche nach dem fraglos Gültigen
8.2.5
„Zeitlose Wahrheiten“ und ihre Instrumentalisierung
8.2.6
Die verratene Nächstenliebe
9
Persönliches Fazit zur Rolle der Religion in unserer Gesellschaft
9.1
Antwort auf den Wahrheitsanspruch der Kirchen in der Gegenwart
9.2
Plädoyer für einen konfessionsfreien Religionsunterricht
10
Schlussbemerkung
Anhang
Zeittafel
Überblick über die Götterwelt Kanaans
Literaturverzeichnis
1 Die Begriffe „authentisch“ und „doktrinal“ habe ich bei I. Kant entlehnt. Er gebraucht sie allerdings in einem anderen Zusammenhang. In: Immanuel Kant, Werke in sechs Bänden, Band VI, S.115ff
2 Dieses Zitat wird ursprünglich Sebastian Franck (1499 – 1542) zugeschrieben. Nach: Georg Büchmann. Geflügelte Worte. Frankfurt am Main, 1957. S.45
kol haadam kosev
Die ganze Menschheit lügt.
Psalm 116,11
Wen schützt man wirklich, wenn man wohltuende Lügen unbequemen Wahrheiten vorzieht?
(Der Autor)
Vorwort
„Relügion – Religion“ – Mit dieser provokanten Verbindung von Religion und Lüge möchte ich eine Diskussion darüber anstoßen, wie wahrhaftig die Vertreter von Kirche und Theologie in ihren Worten sind. Nicht die Wahrheit steht im Mittelpunkt. Denn die Frage nach der Wahrheit ist letztlich schon lange entschieden, seit sich wissenschaftlich arbeitende Theologen und Religionswissenschaftler mit den Bedingtheiten von Religionen, so auch dem Judentum und Christentum, beschäftigt haben. Es geht vielmehr um die Frage, ob Vertreterinnen und Vertretern der Kirche bedenkenlos der Glaube an ihre Bekenntnisse zugestanden werden kann, wenn man bei ihnen zugleich ein hohes Maß an Intelligenz und Kenntnissen voraussetzen darf.
Meine Position zu dieser Frage habe ich in meinem Beruf als ehemaliger Religionslehrer auch durch Selbstreflexion meiner eigenen Tätigkeit, meiner eigenen Sprache im Unterricht gewonnen. Ich behaupte, dass wissenschaftlich ausgebildete Theologen es in ihren Worten, Predigten und Veröffentlichungen an Wahrhaftigkeit mangeln lassen. Sie sprechen, schreiben und verkünden oft wider besseres Wissen. Eine Rede wider besseres Wissen nennt man Lüge. Dennoch, integre Menschen (anders kenne ich diese Berufsgruppe nicht) der Lüge zu bezichtigen, scheint ein Widerspruch in sich zu sein. Diesen Widerspruch zu analysieren, werde ich mich im Folgenden bemühen.
Die Frage steht im Raum, ob ich selbst in meinem Unterricht immer wahrhaftig war. Ich war es, wenn es darum ging, wissenschaftliche Forschungsergebnisse weiterzugeben, religionshistorische Zusammenhänge erarbeiten zu lassen und so Erkenntnisse zu ermöglichen, die die Inhalte der kirchlichen Verkündigung weit hinter sich ließen. Ich war es, wenn ich die Werte des sozialen Miteinanders vermittelte, wie sie in vielen theologischen und biblischen Texten zu finden sind und wie sie im Begriff der Nächstenliebe ihren klarsten Ausdruck finden. Ich war es besonders im Bemühen, Lebensfragen der Schülerinnen und Schüler aufzunehmen und zum Thema des Unterrichts zu machen. In diesem Bereich wurde ich dem Anspruch an einen Religionslehrer gerecht, der die Grundlagen der christlichen Religion vertreten können sollte. Die religiöse Orientierung in der Form eines Bekenntnisses zu Jesus Christus und dem biblischen Gott Jahwe konnte ich allerdings nicht geben. Damit lag ich aber durchaus auf einer Ebene mit der universitären Theologie, sofern sie die Ergebnisse der Religionswissenschaft und der Archäologie aufgeschlossen verarbeitet.
Meine Wahrhaftigkeit muss ich allerdings in Frage stellen, wenn ich Forschungsergebnisse so vermittelte, dass streng gläubige Kinder nicht in ihren religiösen Gefühlen verletzt wurden. Wider besseres Wissen habe ich aus Rücksichtnahme nicht in allen Fällen die Dinge beim Namen genannt und dadurch vieles verschleiert.
Außerhalb des Begriffes der Wahrhaftigkeit habe ich möglicherweise durch meinen zu Fragen anregenden Religionsunterricht den Eindruck erweckt, als sei die evangelische Kirche, der ich angehörte, zugleich der Ort, an dem religiöse Grundsätze hinterfragt werden.
Die Frage nach Lüge und Wahrhaftigkeit, der ich mich in diesem Buch widme, richtet sich somit nicht nur an die, die die christliche Botschaft verkündigen, sondern auch an mich selbst.
In diesem Buch geht es zunächst darum nachzuweisen, dass die Kirche wider besseres Wissen Inhalte des christlichen Glaubens verkündet. Dazu werde ich in einem ersten Schritt den Forschungsstand der Theologie und Religionswissenschaft zu den Ursprüngen der jüdisch-christlichen Religion darstellen, um in einem zweiten Schritt zu untersuchen, warum die Kirche keine Konsequenzen aus den Forschungsergebnissen der eigenen Wissenschaft, der Theologie, zieht.
Ich stelle gezielt die Frage nach der Wahrhaftigkeit der Kirchen. Die Wahrhaftigkeit, nicht die Wahrheit, verstehe ich als Gegenbegriff zur Lüge. Mit diesen drei Begriffen werde ich mich im Rahmen dieses Buches zentral beschäftigen.
Vielleicht gelingt es mir, etwas an Einstellungen und Meinungen zur Geschichte und den Grundlagen der jüdisch-christlichen Religion, die über Jahrhunderte gewachsen sind und sich verfestigt haben, zu verändern. Vielleicht werden unreflektierte Vorurteile, auch wenn sie im kulturellen Gedächtnis verankert zu sein scheinen, zu reflektierten Urteilen. Zum Schluss erreiche ich hoffentlich, dass Werte, die mit der jüdisch-christlichen Religion verbunden sind, hinterfragt und, wenn sie lebensfreundlich sind, weitergetragen werden.
Kapitel 2
Religion als Lebensthema
Als Kind einer evangelischen Mutter, im katholischen Niederrhein aufgewachsen, erfuhr ich sehr früh und leidvoll, welche Bedeutung Religion im Alltag haben kann. Ich lernte schnell, dass es zwei „Religionen“ gab, eine richtige und eine falsche. Obwohl ich die richtige Religion hatte, behaupteten meine Spielkameraden, dass meine Religion die falsche sei und ihre die richtige. Zu meinem Nachteil waren die anderen in der Mehrheit.
Anfangs spielte Religion im Umgang mit den Nachbarskindern keine Rolle. Kinder sind unbekümmert und spielen sorglos ohne Vorurteile mit anderen Kindern, allein weil sie da sind. Eines Tages jedoch erfahren sie zuerst von ihren Eltern, dann von Pfarrern oder Priestern, dass sie nicht nur Kinder sind, die Freude am Leben haben, sondern dass sie einer religiösen Konfession angehören - und es ändert sich alles, nicht sofort, aber nach und nach.
Religion wird irgendwann bewusst als etwas wahrgenommen, das die Menschen trennt. Die katholische Leitkultur im Niederrhein der 50er Jahre sah Protestanten nicht vor. Flucht und Vertreibung nach dem Zweiten Weltkrieg aber zwangen die Einheimischen dazu, sich mit der Existenz von „Ketzern“ in ihrer nächsten Umgebung abzufinden. Dies wurde dadurch erschwert, dass die „zugereisten“ Protestanten ihrerseits die neue katholische Umgebung ebenfalls schwer akzeptieren konnten. Der konfessionelle Glaube wurde damals noch gelebt. So dauerte es nicht lange, bis meine Spielkameraden mir vorwarfen, gar kein Christ zu sein. Halb scherzhaft wurde gesagt, dass man mich ja ungestraft schlagen könne, da ich ja nicht katholisch und damit ungläubig sei. Die Kommunionszeit meiner Spielgefährten führte dann zu „Erkenntnissen“, dass man im Garten nicht zu tief graben dürfe, da dort der Teufel wohne, und dass man im Keller durchaus Verbotenes tun könne, da Gottes Blick nicht bis dorthin reiche. Wenn doch, stehe einem ja immer noch die Beichte offen, die alles wieder ungeschehen macht. Damit wäre man wieder mit Gott im Reinen. Für mich als Kind war dies alles verstörend.
Wie weit das ökumenische Verständnis damals gediehen war, zeigt sich darin, dass einmal der Wagen eines uns bekannten evangelischen Pfarrers vor unserer Wohnung mit dem Wort „Heide“ beschriftet wurde. All das spielte sich Ende der Fünfziger, Anfang der Sechziger Jahre des vorigen Jahrhunderts ab.
Obwohl - oder vielmehr -, weil ich von meiner Mutter nicht religiös, sondern eher religionskritisch erzogen wurde, war Religion immer ein Thema. Meine Mutter hatte einen sehr kritischen Blick auf die Katholiken, besonders auf den Klerus und die Rolle des Papstes und sprach auch mit mir darüber. Kirchenbesuche waren eher selten, ich fand sie auch wenig interessant, eher langweilig. Wenn ich unsere Religiosität beschreiben soll, so war sie eher pantheistisch: Gott war überall, vor allem in der Natur. Ein Spaziergang durch den Wald war ein vollgültiger Ersatz für einen Gottesdienst.
Anfang der 60er Jahre zogen wir nach Mönchengladbach, einer der größeren Städte des Niederrheins. Durch den Konfirmandenunterricht bei einem ausgesprochen freundlichen und empathischen Pfarrer, dessen Name, Bruno Weiß, hier durchaus genannt werden soll, „fand ich zum Glauben“ an den christlichen Gott. Dieser Pfarrer war es auch, der in mir das Interesse an einem Theologiestudium entstehen ließ. Als ich in der Schule Altgriechisch wählen konnte, entschied ich mich auch aus diesem Grunde dafür. Mit der möglichen Perspektive, Pfarrer zu werden, lernte ich in der Schule neben Latein und Altgriechisch später noch Hebräisch und war somit für das Theologiestudium bestens gerüstet.
Rückblickend war es weniger der Wunsch, den Beruf des Pfarrers auszuüben, als das Verlangen danach, mehr über die Hintergründe der Religion zu erfahren. Mit der endgültigen Entscheidung, Theologie zu studieren, war das Ziel verbunden, irgendwann in meinem Leben wissen und sagen zu können, ob es einen Gott gibt oder nicht. Genau so habe ich dies damals in jugendlicher Naivität formuliert. Ob diese Zielsetzung wirklich so naiv war, wird sich in den nächsten Kapiteln zeigen.
Religion und Theologie waren also für mich eher mit Fragen als mit Antworten verbunden. Und die Fragen nahmen mit dem Verlauf des Theologiestudiums zu.
Zunächst war ich überrascht, wie sachlich an der Kirchlichen Hochschule Wuppertal, meinem ersten Studienort10, mit den Themen des christlichen Glaubens umgegangen wurde. Etwas mehr Spiritualität hatte ich schon erwartet. Biblische Texte wurden nüchtern wie jede andere Literatur mit den gleichen Methoden untersucht. Von göttlicher Inspiration war keine Rede.
Thematisiert wurden literarische Abhängigkeiten, die unterschiedlichen Intentionen der Autoren, unter denen sie biblische Texte formuliert haben, die verschlungenen Wege der Überlieferung und die historische Bedingtheit der sogenannten „Glaubenszeugnisse“. Ich wurde schlicht mit dem konfrontiert, was man historisch-kritische Forschung nennt.
Natürlich spielte im Hintergrund meines Denkens immer noch die Melodie der göttlichen Inspiration. Zudem war Jesus doch der Sohn Gottes – oder etwa nicht? Ich erklärte mir die Wege der Überlieferung, die unterschiedlichen Theologien und historisch bedingten Aussagen der biblischen Texte damit, dass die Menschen eben verschiedene Wege zu Gott gesucht und gefunden hatten, und dass die Offenbarungen Gottes – so es denn welche gab - immer in der beschränkten menschlichen Sprache geschehen mussten, damit Menschen sie verstehen konnten. Missverständnisse und Fehlinterpretationen waren wohl so gleichsam vorprogrammiert.
Ein damals äußerst umstrittener Theologe namens Rudolf Bultmann hatte bereits in den 40er Jahren des 20. Jahrhunderts den Versuch gemacht, die biblischen Texte zu entmythologisieren, um ihre eigentliche Aussage herauszuarbeiten. Seine Position war auch Thema unter den Professoren und Studenten, seine Gedanken waren sozusagen an den Universitäten Allgemeingut. Für die bibeltreuen Studenten waren sie jedoch blanke Häresie, für mich ein Anlass, über vieles neu nachzudenken.
Wenn von Bultmann die Jungfrauengeburt und die Wunder Jesu als zeitbedingte Mythen herausgearbeitet wurden, stellte sich natürlich für viele Studenten die Frage, inwieweit denn wirklich noch von Jesus als dem Sohn Gottes geredet werden konnte. Dafür hatte Bultmann selbst eine Antwort. Es gehe primär nicht um die Historizität der Auferstehung und um die Wahrheit von Mythen, z.B. der Himmelfahrt, sondern um die Botschaft, das sogenannte Kerygma Jesu Christi, in dem der Herr der christlichen Kirche heute noch präsent sei. Der Christ sei vor die Entscheidung gestellt, der Botschaft gläubig zu folgen.
Diese Antwort konnte mich nicht zufrieden stellen. Ich sollte glauben, obwohl die theologische historisch-kritische Forschung gerade Grundlagen dieses Glaubens in Frage stellte. Ich wollte mehr über den historischen Jesus wissen. Je mehr ich mich mit ihm beschäftigte, desto deutlicher erschloss sich mir das Bild eines jüdischen Predigers, dessen Botschaft in dem Satz zusammengefasst werden kann: „Denkt um, denn das Reich der Himmel ist nahe“11 (Matth. 4,17). Alle Hoheitstitel (Messias, Gottessohn, Menschensohn, Herr) – so wurde es gelehrt - waren Bildungen der Gemeinde, die sich natürlich an den zur Verfügung stehenden Begriffen des Judentums und anderer Glaubensrichtungen orientiert haben. Die Religion kann auch ein Forschungsgebiet für Linguisten sein.
Mich wunderte, dass trotz der Erkenntnisse der Exegeten des Alten und Neuen Testaments und scheinbar völlig unbeeindruckt von religionshistorischen Forschungsergebnissen im Bereich der Systematik und Homiletik (Predigtlehre) von Jesus Christus als dem letztgültigen Wort Gottes gesprochen wurde, davon, dass Gott sich in Jesus ein für alle Mal offenbart habe. Selbst sogenannte moderne Theologen und Theologinnen wie Dorothee Solle sprachen davon, dass Jesus Christus den nicht mehr sichtbaren Gott vertrete. Eigentlich hätte meiner Ansicht nach sich die Botschaft der Kirche den historischen Erkenntnissen anpassen müssen. Anstelle des Glaubens an Jesus Christus hätte der Glaube Jesu an einen liebenden und gnädigen Gott stehen müssen.
Die Diskrepanz zwischen den wissenschaftlichen Erkenntnissen und der systematischen Lehre der evangelischen Kirche war für mich schließlich unerträglich. Leider habe ich damals nicht gefragt, warum die offensichtlichen Widersprüche für Theologen und Pfarrer erträglich waren, (vergl. Kap.6)
Je länger ich mich mit der Frage des Glaubens, der Religionsgeschichte und den verschiedenen theologischen Strömungen beschäftigte, wurde auch Gott selbst eher zu einer Frage denn zu einer Antwort. Aufgrund meiner immer größeren Distanz zu den Inhalten der Vorlesungen und Seminare konnte ich es nicht mehr ertragen, dass Theologen an allen religionswissenschaftlichen und auch theologischen Erkenntnissen vorbei, das „Dennoch“ des Glaubens mit verklausulierten und missverständlichen, nach allen Seiten offen scheinenden Argumenten verteidigten. Schließlich war es für mich nicht nur intellektuell unerträglich, diesen Gedanken zu folgen, sondern auch physisch. Der Ärger ging so weit, dass ich mitten in einer Vorlesung den Hörsaal der Bonner Universität verlassen musste, um im Hofgarten wieder erleben zu können, dass trotz der theologischen Lehren die Sonne immer noch scheint, und es ein wahres Leben jenseits abstruser weltfremder Spekulationen gibt. Ich zog die Konsequenzen, vielleicht passender ausgedrückt, die Reißleine. Kurz vor dem Examen, mit sämtlichen Voraussetzungen inklusive des Biblikum12, brach ich mein Studium ab.
Wie sehr ich auch von der Richtigkeit meiner Entscheidung überzeugt war, so deutlich empfand ich mein „Nicht-glauben-können“ unterschwellig als Defizit. Die verkomplizierende, verschleiernde, dann wieder überzeugend erscheinende theologische Sprache wirkte offensichtlich weiter. Insgeheim bewunderte ich meine Kommilitonen, dass sie trotz allem, vielleicht auch trotz besseren Wissens, glauben konnten. Ich ging davon aus, dass sie einen Weg gefunden hatten, beides, Wissen und Glauben, zu verbinden, einen Weg, der mir verschlossen geblieben war. Dass dies ein Weg war, den man nur mit Krücken begehen konnte, erschloss sich mir erst später. Erstaunt war ich allerdings, dass die Krücken sogar als Vorzug angesehen werden konnten.
Krücken ermöglichen es einem Menschen trotz Behinderung vorwärtszukommen. Hätten mich Sachzwänge, z.B. familiäre Verantwortung, dazu veranlasst, den Beruf des Pfarrers auszuüben, dann hätte ich aufgrund meines Handicaps intellektuelle und moralische Hilfen gebraucht, um diesen Weg zu gehen. Vielleicht hätte ich mich darauf gestützt, dass gerade mein Zweifel mir ermöglicht, Solidarität mit den vielen Menschen zu erleben, die ebenfalls in ihrem Glauben an Gott unsicher sind. Ich hätte die ethischen Ansprüche des christlichen Glaubens in den Vordergrund gerückt und versucht, sie in der Gemeindearbeit zu realisieren. Vielleicht hätte ich gute therapeutische Fähigkeiten gehabt, um Menschen in Nöten helfen zu können. In Predigten hätte ich mich auf soziale Themen konzentrieren und derart von Gott reden können, dass er zum Symbol für Mitmenschlichkeit geworden wäre.
Damit aber hätte ich, um es mit den Worten Buggies auszudrücken, versucht, „das defizitäre Ethos der Wahrhaftigkeit, der intellektuellen Redlichkeit … durch das Ethos der mitmenschlichen Solidarität, Hilfe, Zuwendung und des politisch-sozialen Engagements (zu) kompensieren“13.
All dies wären, wie gesagt, Krücken einer misslingenden Kompensation gewesen, mit denen ich als Glaubensbehinderter meinen Lebensweg hätte gehen müssen. Dieser sublimierte Glaube an Gott wäre eine Krücke gewesen, die mich mein Leben lang behindert hätte, obwohl ich sie wohl euphemistisch als „Stecken und Stab“ (Psalm 23) verstanden hätte.
Um mein weiterhin bestehendes Interesse an Fragen der Religion mit einem Beruf verbinden zu können, entschied ich mich - nach reiflicher Überlegung und mit einem gewissen zeitlichen Abstand - Religionslehrer zu werden. Zum einen war ich von der Last befreit, einen nicht vorhandenen Glauben bekennen zu müssen, zum anderen sah ich für mich die Möglichkeit, Schüler mit den Erkenntnissen der Theologie und Religionswissenschaft vertraut zu machen. Als zweites Fach wählte ich Russisch.
Im Religionsunterricht war es mein zentrales Anliegen, Schülerinnen und Schüler über die Bedingtheiten des christlichen Glaubens aufzuklären. Viele meiner Schüler hatten ohnehin kaum noch Kontakt zur Kirche, trugen aber tradierte Vorstellungen von Gott, Jesus und Bibel aus dem Kindergottesdienst und der Konfirmandenzeit – selten verstanden und allzu oft missverstanden - mit sich herum, die einer Richtigstellung bedurften. Viele empfanden einen aufklärenden Religionsunterricht als Gewinn. Bei Schülerinnen und Schülern, die im christlichen Glauben verwurzelt waren, stieß ich verständlicherweise wiederholt auf Ablehnung, besonders bei Kindern mit evangelikalem Hintergrund.
Erschreckend war es zu erleben, dass gerade diese Kinder von jeder naturwissenschaftlichen Bildung abgeschnitten waren oder diese bewusst auf Weisung ihrer Eltern ignorierten. Während meiner gesamten Tätigkeit als Religionslehrer von 1982 bis 2015 hatte ich in meinen Klassen immer wieder mit dem wörtlichen Verständnis der Bibel zu kämpfen. Als Offenbarung Gottes hatte die „Bibel“ in den Augen bestimmter Schülerinnen und Schüler immer Recht. Sowohl die wissenschaftliche Theorie der Weltentstehung als auch die Evolutionstheorie wurden bestritten. Rationalen Argumenten waren diese Schülerinnen und Schüler nicht zugänglich. Für die anderen, die in ihrer Schulzeit gelernt hatten kritisch zu denken, war diese Auseinandersetzung sinnvoll, da sie auf diese Weise sehen konnten, wie wissenschaftliche Erkenntnisse von Fundamentalisten einfach ignoriert werden. Die Fundamentalismuskritik wird allerdings dadurch erschwert, dass auch die von den Kirchen vertretenen Bekenntnisse auf einer „fundamentalen Wahrheit“ beruhen, auf dem „einen Wort Gottes in Jesus Christus“.
Auch wenn wissenschaftlichen Forschungsergebnissen kirchlicherseits nicht widersprochen wird, so werden sie zugleich dadurch relativiert, dass sie – völlig korrekt - als vorläufiges Wissen hingestellt werden. Zudem hätten sie keine Bedeutung für Wert- und Sinnfragen. Orientierung gäben allein die verkündeten und eben ganz und gar nicht vorläufigen Glaubenswahrheiten.
Durch mein Eintreten für das natürlicherweise immer „vorläufige Wissen“, stellten manche Schüler berechtigterweise meinen Glauben an Gott in Frage. Ich forderte in solchen Situationen die Schüler auf zu erklären, woran sie glauben, wenn sie ihren Glauben an Gott betonen. Im Vergleich mit meinen Vorstellungen stellte sich dann meist heraus, dass wir gemeinsam an vieles glauben, was nicht immer und überall sichtbar ist, z.B. eine gerechte Welt, Friede, Nächstenliebe und, dass der Unterschied zwischen ihnen und mir darin besteht, dass ich nur nicht an das Eingreifen überirdischer Mächte, sprich: an Götter, glaube.
Mit einer einfachen Distanzierung vom Gottesglauben, ohne nach meiner ethisch-moralischen Haltung gefragt zu sein, hätte ich immer mehr kommuniziert als ich wollte. Sehr leicht wird die Absage an die Existenz eines Gottes so interpretiert, als sei alles, was der Glaube an einen Gott noch beinhaltet, ebenso hinfällig.
Die Fragen aber, die sich Menschen im Medium der Religion und ebenso in der Philosophie stellen, sind eben nicht obsolet und irrelevant. Es geht um Sinnfragen und Möglichkeiten der Lebensgestaltung, um die Frage, welche Werte in einer Gesellschaft gelten sollen und schließlich um die Auseinandersetzung mit der Tatsache unserer Endlichkeit. Zu diesen Fragen müssen junge Menschen angeleitet werden. Erzogen werden müssen sie zugleich dazu, Antworten in Frage zu stellen. All dies war das Anliegen meines Unterrichts.
Auch wenn es korrekt ist, wenn ich sage, dass ich nicht an Gott glaube, so vermeide ich es, mich darüber zu definieren. Ebenso distanziere ich mich von dem Begriff „Atheist“. In der betonten Verneinung des Glaubens an einen Gott und in dem hervorgehobenen Bekenntnis „gott-los“ zu sein würde ich bestätigen, ein Defizit zu haben, so, wie ich es während des Studiums empfand.
Meiner Ansicht nach haben die Kirche und der an Götter Glaubende ein Defizit, nicht derjenige, der den Wahrheitsanspruch der Kirche ablehnt. Der glaubende Laie hat - meist unverschuldet - ein Informationsdefizit, die Vertreter der christlichen Kirchen – auf diese möchte ich mich hier beschränken – haben ein Defizit ganz anderer Art, da sie über die entsprechenden Informationen verfügen (können).
Die Absage an Gott und Götter ändert nichts an meiner Hochachtung gegenüber den Schöpferinnen und Schöpfern kultureller Denkmäler der verschiedenen Religionen aller Epochen. Die Verachtung der Religionen und ihrer materiellen und immateriellen Werte wäre gleichbedeutend mit der Verachtung der Menschen und des Menschseins.
Ich bin fasziniert von der Schönheit vieler Kirchen, Moscheen und Tempel, ich genieße die Ruhe von Kreuzgängen, lasse mich gern auf den Klang einer Orgel und die Stimmen der Chöre ein. In den aus den Religionen hervorgegangenen Texten lese ich gelebte Menschheitsgeschichte und nicht die Geschichten eines oder mehrerer Götter mit Menschen. Der Mensch ist immer Subjekt seiner Geschichte und nie Objekt numinoser Mächte.
Ich empfinde mich als Angehörigen des jüdisch-christlichen Kulturkreises. Auch mit der Verneinung jedes Gottes kann und will ich mich von dieser Kultur nicht lösen, da ich ihre Sprache spreche und in ihr denke. Kultur verstehe ich in diesem Zusammenhang als eine jeweils spezifische Art der Gestaltung und Deutung der Welt, des Nachdenkens über die Welt und deren Veränderung.
Bei aller Kritik an der Kirche und ihren Vertretern in den Gemeinden, in Forschung und Wissenschaft und in den Schulen möchte ich hervorheben, dass ich unter den Theologen im weitesten Sinne fast nur Menschen gefunden habe, die trotz der genannten und zu nennenden Kritikpunkte in ihren grundlegenden Einstellungen und ihrem Verhalten integer waren und denen man in jeder Hinsicht vertrauen konnte. (Und dieses Vertrauen ist nicht missbraucht worden. Dies verdient angesichts der Skandale der Vergangenheit eine besondere Erwähnung.)
Ich habe Pfarrerinnen und Pfarrer erlebt, die in ihrer Menschenliebe für mich Vorbild waren. Ich habe hohen Respekt vor vielen Frauen und Männern der Geschichte dieses Kulturkreises, die sich aufopferungsvoll für ihre Mitmenschen einsetzen und eingesetzt haben und durch ihr Wirken und ihre Worte ihren Mitmenschen in vielen Bereichen zum Segen wurden. Ihre Autorität erhielten sie durch ihre unbedingte Menschenliebe. Viele Predigten von Pfarrerinnen und Pfarrern waren und sind sprachlich und inhaltlich brillant formuliert, ansprechend und für viele auch in schwierigen Situationen tröstlich. Die Empathie und die Humanitas dieser Menschen überzeugten. Von ihnen trennen mich ihre Antworten auf die Frage nach Gott, die Fragen, die Theologen stellen, verbinden mich mit ihnen.
Gerade aufgrund dieser Erfahrungen fällt es mir schwer, deren Wahrhaftigkeit bei der Formulierung ihrer Bekenntnisse in Frage zu stellen, obwohl sie meines Erachtens „wider besseres Wissen“ gesprochen werden. Mit diesem Problem und seiner Lösung werde ich mich im 6. Kapitel ausführlich befassen.
10 Danach studierte ich noch an den Universitäten Basel, Zürich, Tübingen und Bonn.
11 Eigene Übersetzung. Das griechische Verb lautet „metanoein“= anders denken
12 Der Nachweis detaillierter Bibelkenntnisse.
13 Buggle, Denn sie wissen nicht, was sie glauben, S.353
Kapitel 3
Der unangemessene Wahrheitsanspruch
3.1 Wahrheit, Wahrhaftigkeit und Lüge
Ein Blick auf verschiedene Zitate zum Thema „Lüge“ zeigt, dass sie jenseits ihres negativen Images auch durchaus positiv bewertet wird.
„Die Lüge als Mittel der Barmherzigkeit, um die Enttäuschung erträglich zu machen.“14 (Christa Schyboll) (geb. 1952)
„Nehmen Sie einem Durchschnittsmenschen seine Lebenslüge, so nehmen Sie ihm zugleich sein Glück.“ (Henrik Ibsen) (1828 – 1906)
Im Allgemeinen wird in unserer Kultur wohl eher das folgende Zitat Zustimmung finden:
„Ich kenne nichts Lasterhafteres, Gemeineres als das Lügen. Es ist entweder ein Produkt der Bosheit, der Feigheit oder der Eitelkeit.“ (Philip Stanhope, 4. Earl of Chesterfield) (1694 – 1773)
Lüge ist trotz der genannten „positiven“ Zitate, in unserer Gesellschaft ohne Frage negativ konnotiert, und es fällt schwer, die Lüge wertfrei oder gar positiv zu verstehen. Von ihrem Wesen her bedeutet eine Lüge, etwas auszusagen, von dem man weiß, dass es nicht der Wahrheit entspricht.15
Wenn ich behaupte, gestern in Berlin gewesen zu sein, obwohl ich zu Hause war, ist dies klar eine Lüge. Diese Lüge ist aber ohne Berücksichtigung ihrer möglichen Konsequenzen zunächst weder gut noch schlecht. Ob sie nützt oder schadet, zeigt erst ihre Wirkung.16
Wenn die Lüge aufgedeckt ist, bin ich als Lügner offenbar und mein Ansehen nimmt Schaden. Habe ich etwas beobachtet, was ich lieber nicht gesehen hätte, kann die Lüge dazu führen, dass der Verursacher eines möglichen Unfalls nicht zur Rechenschaft gezogen wird. Ein Unfallopfer wird mein Verhalten verurteilen, der Verursacher wird es eventuell positiv bewerten. Hat die Lüge Bestand, verändert sie die Wahrnehmung der Wirklichkeit.
Ein zentraler Punkt für die Bewertung der Lüge ist ihre kommunikative Bedeutung. Nach Friedemann Schulz von Thun17 geschieht menschliche Kommunikation unter vier Aspekten, dem Sachaspekt, dem Beziehungsaspekt, dem Selbstoffenbarungsaspekt und dem Appellaspekt. Mit Blick auf die Lüge kann die „Sache“ prinzipiell geklärt werden. Sie stimmt oder stimmt nicht. Der Appell besteht darin, die Lüge zu glauben. Entscheidend sind der Beziehungsaspekt und der Selbstoffenbarungsaspekt.
Was bedeutet es für die Beziehung zwischen zwei Menschen, wenn einer den anderen belügt. Der Verlust des Vertrauens ist wohl zentral. Hinzu kommt aber das, was derjenige, der lügt, über den anderen aussagt. Er hält ihn im negativen Sinn für jemanden, der zu dumm ist, eine Lüge zu enttarnen, oder, falls die Lüge doch aufzudecken ist, für jemanden, der so unbedeutend, eventuell verachtenswert ist, dass man ihn belügen kann. Im positiven Sinn - für jemanden, der die Wahrheit nicht ertragen kann.
Unter dem Aspekt der Selbstoffenbarung bedeutet eine Lüge, dass sich der, der sie ausspricht, seinem Gegenüber überlegen fühlt und so viel an Arroganz besitzt, dass er sich das Recht anmaßt, lügen zu dürfen oder – wieder im positiven Sinn - als jemand, der seine Verantwortung für das Schicksal seines Gegenübers ernst nimmt und deshalb die Unwahrheit sagt. Der eigentlichen Lüge gehen so Entscheidungen über die Beziehung zum anderen und das Selbstbild des Sprechers voran, die bereits lange vorher gefallen sind.
In der Kommunikation mit anderen erwartet man von seinem Gesprächspartner, dass er wahrhaftig ist, dass er das, was er sagt, auch selbst glaubt. Die Wahrhaftigkeit ist somit das eigentliche Gegenteil von Lüge und nicht die Wahrheit.18 Wenn ein Mensch der Antike behauptete, die Erde sei eine Scheibe, hatte er zwar nicht die Wahrheit gesagt, aber er hatte auch nicht gelogen, denn er wusste es nicht besser. Roswitha Rust bringt es auf den Punkt: „Lügen ist also subjektiv, es kommt nur darauf an, was jemand glaubt oder zu wissen vermeint, nicht auf eine objektive Wahrheit.“19
Die Funktionen der Lüge
Die Funktionen der Lüge sind ebenso ambivalent wie ihre Folgen. Sie dienen dazu, Mitmenschen zu betrügen und zu täuschen, Tatsachen zu verschleiern und Verbrechen zu verdecken, aber ebenso können sie ein Mittel sein, um einen Aufruhr nicht zum Bürgerkrieg werden zu lassen, oder um sich als Schwächerer gegen einen Stärkeren durchzusetzen.20 Sie kann den Herrschaftsanspruch sichern oder eine Niederlage zum Sieg werden lassen.
Lügen sind zu jeder Zeit und in allen gesellschaftlichen Institutionen nachzuweisen. Sie sind ein probates und opportunes Mittel der Kommunikation.
Im vierten Jahrhundert v.u.Z. gibt Platon im „Staat“ den Politikern ausdrücklich das Recht zu lügen, denn die Lüge sei in den Händen des Herrschers ein Medikament, dessen er sich aus Gründen der Staatsraison bedienen kann und sogar muss21.
Im Mittelalter haben die Päpste wahrheitswidrig behauptet, Kaiser Konstantin habe der Kirche die Westhälfte des römischen Reiches geschenkt. Es ging um die Stärkung der eigenen Macht gegenüber dem mittelalterlichen Staat in einem jahrhundertelangen Streit, um deretwegen offensichtlich kirchlicherseits jeder Betrug und jede Irreführung gerechtfertigt war.
In der Neuzeit haben in den Vereinigten Staaten Pharmazieunternehmen ein opioidhaltiges Schmerzmittel22 auf den Markt gebracht, dessen bekannte Suchtgefahr heruntergespielt und dessen Wirksamkeit übertrieben wurde. Aus ökonomischen Gründen wurden die Zusammenhänge verschleiert und so Zweifel an einer negativen Expertise genährt. Dies konnte nur gelingen, da die Wahrheit über dieses „Medikament“ noch nicht Allgemeingut geworden war.
Zu allen Zeiten wurde in der Auseinandersetzung zwischen den Herrschenden und dem Volk, zwischen Unterdrückern und Unterdrückten mit dem Medium der Lüge gekämpft. Die Auseinandersetzung mit den Ideologien des 20. Jahrhunderts und die innerideologischen Kämpfe legen hierfür ein beredtes Zeugnis ab.
Lügen halfen den Schwächeren, sich gegen die Stärkeren zu behaupten. Die Beherrschten konnten sich so der Allmacht des Herrschers oder der Kirche entziehen.23
Neben diesen Funktionen wäre noch die Verteidigung des Selbstwertgefühls zu nennen: Fakten werden ignoriert, bestätigende Informationen bevorzugt und das eigene Denksystem für das einzig richtige gehalten, um offensichtliche logische Widersprüche zu vermeiden.24
Eine besondere Form der Lüge, die sich ebenfalls auf die genannten Funktionen bezieht, zeigt sich darin, dass jemand vorgibt, einer Information zu vertrauen und sie deswegen als wahre Aussage weitergegeben zu haben.
Was sind Motive der Lüge?
Zum Teil überschneiden sich Funktionen der Lüge mit ihren Motiven. Gelogen wird, um zu betrügen, um des eigenen Vorteils willen, um zu täuschen und, um das eigene Ansehen zu wahren. Dass Angst ein zentrales Motiv ist, ist einleuchtend, wenn die Aufdeckung einer Tat zu Strafen führt oder den Lügner lächerlich macht. Ein mögliches weiteres, sehr triviales Motiv wäre die Bequemlichkeit.25 Man lügt, wenn die Offenlegung der Wahrheit kompliziert und mit erheblicher Anstrengung verbunden wäre. Eventuell wird die Lüge von den Adressaten eher akzeptiert als die Wahrheit. Gelogen wird darüber hinaus auch aus Verantwortung, wenn durch das Aufdecken der Wahrheit Schaden für andere entstehen könnte.
Wann hören Lügen auf, Lügen zu sein?
Lügen, die sich selbst als solche präsentieren, sind keine mehr, sie heben sich auf. In der Literatur machen entsprechende sprachliche Signale wie zum Beispiel die Einleitungsformel „Es war einmal …“ im Märchen, Gattungsbezeichnungen wie „Gedicht“ oder „Roman“ oder die Aufführung im Theater dem Leser, Hörer oder Zuschauer klar, dass es sich hier um fiktive Geschichten handelt. Sie können keine Lügen sein, da sie eben nicht verborgen sind.
Die „Lüge“ als unbewusste Methode der Natur und bewusste Methode des Menschen …
Zwischen unbewusster und bewusster Lüge gibt es offensichtlich Abstufungen. Verhaltensforscher haben herausgefunden, dass Affen absichtlich lügen können - ob dies bewusst geschieht, muss dahingestellt bleiben. Jedenfalls ist die Fähigkeit zu lügen wohl nicht das Charakteristikum, das den Menschen vom Tier unterscheidet.26
Vergleichbare Phänomene lassen sich auch in anderen Bereichen der Natur beobachten. Sie sind aber dann eher den Instinkten zuzuordnen. An Beispielen mangelt es nicht: Der Kugelfisch bläht sich auf, um größer zu erscheinen, verschiedene Tiere, wie zum Beispiel Kraken, nehmen die Farbe ihrer Umgebung an, um ihre Fressfeinde oder ihre Opfer zu irritieren.
Auf der bewussten Ebene sollen bei Männern Schulterstücke breite Schultern und damit Kraft und Stärke vortäuschen, durch Make-up wollen – nicht nur - Frauen in der Regel attraktiver wirken. Auch in anderen Bereichen unserer Kultur hat die Lüge ihren Platz: Werbung informiert nicht nur, sie hebt selbstredend allein die positiven Seiten eines Produkts hervor. Ideologien, Parteien und ihre Repräsentanten, Geschichtsschreiber verdrehen bisweilen Tatsachen und arbeiten oft mit Halbwahrheiten. Daran haben wir uns gewöhnt. Angesichts der vielen Schattierungen von „Lügen“ in Natur und Kultur erübrigt sich die Frage, warum es in einem zentralen Bereich menschlicher Kultur, der Religion, anders sein sollte.
…und ihr Gegenmittel
Weil wir mit der Lüge leben, haben wir aber auch gelernt, uns vor ihr zu schützen. Unser Gegenmittel sind gesundes Misstrauen und Offenlegung von Unwahrheiten mittels der Vernunft, der Grundlage des wissenschaftlichen Denkens. Dazu bedarf es nichts mehr als des Mutes, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen,27 was allerdings in manchen Gegenden der Erde und in der europäischen Vergangenheit lebensgefährlich ist und war und viele Menschen das Leben gekostet hat.
3.2 Wahrheit, Wahrhaftigkeit und Lüge in der jüdisch-christlichen Religion
Jeder Theologe weiß, dass manche biblischen Bücher unter dem Verfassernamen einer anderen Person geschrieben sind, anderen wiederum ist der falsche Verfassernamen nachträglich gegeben worden. Meist handelt es sich um biblische Gestalten. Man spricht in diesem Fall von Pseudepigraphen. Dadurch sollten die eigenen oder die von anderen geschätzten Schriften eine besondere Bedeutung erhalten.28 Pseudepigraph bedeutet übersetzt: Der Name ist gelogen.
Auch wenn man berücksichtigt, dass es in der Antike nicht selten war, den eigenen Schriften einen berühmten Verfassemamen zu geben, so war es jedoch kein übliches Verfahren. „Auch wenn die Antike kein Urheberrecht im modernen Sinne kannte, existierte ein ausgeprägtes Bewusstsein von geistigem Eigentum.“29
Die Motive für das Nennen eines anderen Verfassernamens gehen in mehrere Richtungen. Das Verleihen von Autorität und die Hoffnung auf eine nachhaltige Wirkung der verfassten Texte gehören dazu. Doch es ging nicht nur darum, die Leser hinsichtlich der Bedeutung des Textes zu täuschen, sondern es sollte auch die Autorität dessen, der mit seinem Namen für die Qualität des Textes einstehen musste, festigen.30
Die Unwahrheit wurde über Jahrhunderte geglaubt und die, die sie Weitergaben, haben natürlich – sofern auch sie guten Glaubens waren – nicht gelogen.
Ich habe mit diesem Beispiel begonnen, um an einem unbestrittenen Fall deutlich zu machen, dass die Bibel keineswegs außerhalb der Diskussion um Wahrheit, Wahrhaftigkeit und Lüge steht.
Gerade der für sie in Anspruch genommene Wahrheitsanspruch verlangt eine Auseinandersetzung mit diesen Begriffen, der sich auch die Vertreter der jüdisch-christlichen Religion stellen müssen.
Der Wahrheitsanspruch ist der Kern der jüdisch-christlichen Religion. Er wird im „Alten Testament“ unmissverständlich in den verschiedenen behaupteten Selbstoffenbarungen Jahwes erhoben. In den Zehn Geboten verbietet Jahwe die Verehrung anderer Götter (Exodus 20,1), im Buch des Propheten Jesaja sagt er klar und deutlich: „Ich bin der Erste und der Letzte; außer mir gibt es keinen Gott“ (Jes. 44,6).
Im „Neuen Testament“ lässt sich der Wahrheitsanspruch an dem Jesus unterstellten Ausspruch: „Ich bin der Weg die Wahrheit und das Leben“ (Joh. 14,6) festmachen. Jesus wird als der Sohn des Gottes Jahwe präsentiert. Am Verhalten der Menschen dem Sohn gegenüber entscheide sich, wer vom Vater angenommen wird.
Der Monotheismus jüdischer Herkunft lässt somit nur den einen, den eigenen Gott gelten, während allen anderen Göttern das Existenzrecht und ihren Worten jede Wahrheit abgesprochen wird. Die Festlegung auf Jesus als den Sohn Gottes, der den einzigen wahren Weg zu Gott zeigt, macht alle anderen Götter zu Götzen.
Der Wahrheitsanspruch beider Religionen ist bis heute nicht aufgegeben, trotz vielfacher Beispiele, diesen Wahrheitsanspruch zu relativieren.31
Mit dem exklusiven Wahrheitsanspruch ist der Gedanke, dass anderen Religionen auch Wahrheit zukommen könnte, folgerichtig ausgeschlossen. Denn der Wahrheitsanspruch der beiden monotheistischen Religionen sei nicht zu relativieren. Einzig die Interpretation ihrer Grundsätze sei für den Diskurs offen. Aus theologischer Perspektive ist der Wahrheitsanspruch der christlichen Religion Grundlage jeder theologischen Tätigkeit, der dann auch gegen alle anderen Religionen vehement verteidigt wird.
Diesem Wahrheitsanspruch ist aus mehreren Gründen zu widersprechen:
a) Zunächst ist die Bibel keine Offenbarung eines Gottes, die dadurch einen absoluten Wahrheitsanspruch theoretisch begründen könnte. Die sogenannte „Heilige Schrift“ ist, wie ich in den nächsten Kapiteln mit Blick auf allgemein bekannte Forschungsergebnisse zeigen werde, von theologischen Reflexionen zu historischen und politischen Ereignissen geleitet. Sie ist keine göttliche Wahrheit, die jede andere „Wahrheit" demaskiert, sondern schlicht ein Teil der religiösen Literatur dieser Welt. Die religiösen Bekenntnisse damals und heute halten einer wissenschaftlichen, theologischen und religionshistorischen Analyse in keiner Weise stand. Die im Tanach erzählte Geschichte Israels ist in vielen Teilen unwahr, ebenso zur Gänze die Lehre von dem einen Gott Jahwe und die Behauptung, Gott habe sich geoffenbart. Ähnliches gilt für die zentralen Glaubensaussagen des Neuen Testaments und der ihnen folgenden kirchlichen Tradition, wie sie zum Beispiel im Glaubensbekenntnis formuliert werden.
b) Aus der Perspektive der Religionswissenschaft macht der Wahrheitsanspruch der Religionen keinen Sinn, da es weder ein Kriterium dafür gibt, den Wahrheitsanspruch einer einzelnen Religion zu verifizieren oder zu falsifizieren, noch einen belastbaren Grund, einer Religion gegenüber einer anderen ein höheres Maß an Wahrheit zuzusprechen. Der Wahrheitsanspruch des jüdisch-christlichen Glaubens lässt sich somit allein schon aus der einsichtigen, logischen Überlegung bestreiten, dass er sich in der Gesellschaft vieler anderer Religionen befindet, die ebenfalls einen Wahrheitsanspruch stellen. Wenn alle Religionen den Wahrheitsanspruch erheben, lässt sich folglich die Frage der Wahrheit nicht lösen und der Exklusivitätsanspruch einer Religion nicht aufrechterhalten.
c) Zudem verbietet sich jeder Wahrheitsanspruch, da die einzelnen Religionen in ihren Lehren so voller Widersprüche und Bedingtheiten sind, dass ein Wahrheitsanspruch zurückgewiesen werden muss. Dies bedeutet nicht, dass in den Schriften aller Religionen nicht Wahrheiten anthropologischer Natur enthalten sind.
d) Aus der Perspektive der Philosophie ist jedweder Wahrheitsanspruch unhaltbar, da keine Religion über die letztgültige Wahrheit verfügen kann, da eine letztgültige Wahrheit in unserer Welt nicht auffindbar, geschweige denn zu formulieren ist.
An diesen Argumenten ändert es auch nichts, wenn der angesprochene Wahrheitsanspruch aus der Perspektive einer liberalen und relativierenden Geisteshaltung unter der Prämisse akzeptiert wird, dass jede Religion ihre eigene Wahrheit oder ein Kern an Wahrheit hat. Damit wird zugleich der absolute Wahrheitsanspruch nicht nur relativiert, sondern schlicht negiert, denn ein relativierter Wahrheitsanspruch wäre ein Widerspruch in sich.





























