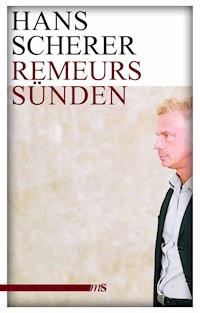
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Männerschwarm Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Paris, London, Amsterdam, aber auch Himmelgeist und Unter den Brücken lauten die Kapitel, in denen Hans Scherer das Leben seines Alter Ego Remeur erzählt. Remeur ist ein Reisender, und er erkundet die Welt der Klappen, Saunen oder Stricherkneipen mit derselben Neugier und Ernsthaftigkeit wie alles andere auch. Als kultivierter Einzelgänger genießt Remeur das Leben in allen seinen Facetten, und Scherer schreibt darüber mit Wahrhaftigkeit und Eleganz. "Dass ich die Jungs wirklich gern habe", so bekennt Remeur, "ist, genaugenommen, das einzige an mir, das zählt." Ein außergewöhnlicher Blick auf ein gelungenes Leben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 272
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
HANS SCHERER
REMEURS SÜNDEN
Roman
Männerschwarm Verlag Hamburg 2013
Oh, wie unschuldig und melancholisch-unverbindlich, dieses Spiel der Leiber. Wie angenehm und gottgefällig die starken Gerüche des Geschlechts. Niemals werde ich den Fluch des Christentums gegen die Fleischeslust verstehen. Niemals begreife ich, was Sünde bedeutet. Es gibt Sünden, freilich. Aber diese flüchtigen Glücksmomente – wenn ich mit jemandem im Bett liege und sehr zärtlich bin: eben diese ‹sündigen› Momente sind es, die mich am ehesten auf die Vergebung aller Sünden hoffen lassen.
Klaus Mann, Tagebuch
Für L. Für wen sonst
PARIS
In dem Krankenhaus gab es eben keine Einzelzimmer. An der Tatsache kam man nicht vorbei.
Als Sonderbehandlung, immerhin, hatte er das Bett am Fenster erhalten. Schön war vor allem der Blick aus der offenen Balkontür. Man sah vom Bett aus auf die Bepflanzung der Neubaudächer, die, als habe man ihre Pflege vergessen, eher einer Savanne als einem Rasen glichen. Vor allem aber interessierten ihn die vier ungeheuer hohen Pappeln am Horizont, an denen sein Blick durch die meist offenstehende Balkontür sich immer wieder festsaugte. Die Pappeln sehen aus wie die vier Türme der Pagode von Kanton, dachte er. Oder hatte die Pagode von Kanton nur zwei Türme? Wenn das Fieber stieg und er vor sich hindämmerte, fragte er sich zuweilen auch, ob die Pappeln am Ende nicht der weißen und der schwarzen Pagode von Konarak in Ostindien ähnelten. Nachts waren die Bäume jedenfalls ebenso eindrucksvolle Türme wie am Tage, und er sah sie immer, beleuchtet von der Sonne oder vom Mond.
In den ersten zwei Tagen hatte er das Zimmer für sich allein. Erst am Abend des dritten Tages wurde ein zweites Bett hereingerollt. Die Klarsichthülle wurde von dem Bett abgezogen. Es roch stark nach Desinfektionsmitteln. Gestützt von zwei Krankenschwestern erschien Herr Mellenthin im Zimmer. Er trug einen rotweiß gestreiften, etwas speckigen Bademantel, keinen Pyjama, sondern ein blassgrünes Krankenhaushemd, das hinten offen stand. Auffallend war die Fülle seiner schwarzen Haare, noch auffallender war, dass die Haare auf der linken Seite wesentlich länger herunterhingen als auf der rechten, was seinem grämlichen Gesicht einen Zug ins Verwegene gab. «Das ist Herr Mellenthin», stellte ihn Schwester Bettina vor. «Wir werden uns schon vertragen», brummelte Herr Mellenthin, indem er sich etwas mühsam ins Bett hangelte. Hoffentlich hat er keinen Fernsehapparat dabei, dachte er und sah angestrengt auf die vier Türme der Pagode von Kanton, die in der beginnenden Abenddämmerung ungewöhnlich schwarz geworden waren. Er erinnerte sich genau daran, weil er zwei, drei Stunden später, als er mit diesem merkwürdigen Schmerz in beiden Schultern wach geworden war, sich immer wieder vorsagte: Ich hätte es wissen müssen, weil die Türme so schwarz waren, – was keinerlei Sinn ergab und in seiner mystischen Rätselhaftigkeit überhaupt nicht zu ihm passte.
Er stand auf und suchte auf dem Gang die Nachtschwester, die zwar freundlich zu ihm war, aber alle Hände voll zu tun hatte. «Vielleicht haben Sie etwas Falsches gegessen», sagte sie und erkundigte sich nach der Zahl der Insulineinheiten, die er üblicherweise abends spritzte. «Ich koche Ihnen einen Kamillentee», sagte sie aufmunternd, nur um etwas zu tun und zu sagen. Er rannte zum Aufenthaltsraum der Patienten, wo um drei, vier Uhr in der Nacht niemand mehr war. Er suchte jemanden, mit dem er hätte sprechen können. Er hatte das Gefühl, auf die Toilette gehen zu müssen, obwohl er wusste, dass es vergeblich war. Er war wie abgeschlossen, eingeschlossen, zugeschlossen, zeitweise fiel ihm das Atmen schwer. Er hatte Angst davor, sich wieder ins Bett zu legen. Erst jetzt fiel ihm auf, dass er Angst davor hatte, mit sich allein zu sein. Dennoch, es blieb ihm nichts anderes übrig, ging er zurück in sein Zimmer, schlürfte den Kamillentee und setzte sich auf das Bett. «Fühlen Sie sich nicht wohl?», fragte Herr Mellenthin, der unbeweglich in seinem Bett lag. «Ich spüre in beiden Schultern eine Todesdrohung», sagte er und begriff im nächsten Moment, dass er unsinniges Zeug redete. Herr Mellenthin jedoch, dem Todesdrohungen in der Schulter offensichtlich eine alltägliche Erfahrung waren, sagte: «Legen Sie sich ohne Angst hin, atmen Sie ruhig durch. Sehen Sie in die Nacht hinaus» – er sah auf die schwarzen Türme der Pagode – «ich werde Ihnen eine Geschichte erzählen.» Er sprach mit einer schleppenden, fast leisen, doch erstaunlich deutlichen Stimme. Er begann das Geschichtenerzählen, einfach so.
In diesen Tagen ging Remeur mit federnden Schritten durch Paris. Die Sonne schien, und er war bester Laune. Fordere ich die Welt in die Schranken, dachte er und überlegte, woher das Zitat stamme. Er liebte es, durch die Straßen zu wandern, durch bekannte und unbekannte Stadtlandschaften, er beobachtete Fassaden, deren Farbe sich im Laufe der Jahre veränderte, abgerissene Plakate – noch nach zwanzig Jahren erinnerte er sich eines merkwürdigen Plakates mit dem Bild Rimbauds an der Außenwand der Medizinischen Fakultät, das ihn plötzlich an Georg Trakl erinnert hatte. Seitdem hatte er immer wieder neue Parallelen in ihrem Werk entdeckt. Beide gingen zum Leiden. Remeur fragte sich, ob es nicht ungehörig sei, Leiden und Lust und alle schmerzlichen und freudigen Erfahrungen der Menschen, die ihm in irgendeiner Weise jemals begegnet waren, solchermaßen zu genießen, wie er es tat. Aber mit diesen Skrupeln wollte er sich diesen Tag nicht verdüstern.
Die Klappen von Paris sind noch langweiliger als die Klappen von Rom. Das wird Henry Miller vermutlich anders gesehen und seine geliebten Vespasiennes vermutlich nach anderen Qualitäten beurteilt haben. Nach der frischen Luft zum Beispiel und nach dem klaren Blick auf die Goldtönung von Paris. Schwule haben gegen Henry Miller ihre Vorurteile. Merkwürdig seine Verehrung für Rimbaud, dem er immerhin ein ganzes Buch gewidmet hat. Er hat es tatsächlich fertig gebracht, ein ganzes Buch über Rimbaud zu schreiben, ohne den Namen Verlaines auch nur zu erwähnen. Am schönsten ist die Stelle, wo er seinen Geburtsort, New York, mit dem Geburtsort Rimbauds, Charleville in den Ardennen, vergleicht und feststellt, jeder Dichter müsse der Heimat, wo immer sie liegt, entfliehen. Erst im Exil vermag er es, sich selbst zu finden. «Wer Vater und Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert.» So ist Millers Rimbaud heilig und rein und geschlechtslos – aber nicht unschuldig. Denn wie könnte er unschuldig sein, wo er die Verführung zur Schuld nach Miller gar nicht kennengelernt hatte. Remeur war eher vom Gegenteil überzeugt. Nein, Miller mochte ein paar schöne Gedanken haben, aber indem er Rimbaud gleichsam kastrierte, nur damit ihm, Miller, das reine Engelsbild erhalten blieb, offenbarte er seinen in Wahrheit grausamen Puritanismus. Remeur hätte nicht gern mit ihm zu tun gehabt. Obwohl ausgerechnet Millers Philosophie das Lied seines Lebens geworden war. Die Lust ist der Sinn. An dieser Stelle bremste Remeur seine Gedanken und, wie es eine Angewohnheit von ihm war, auch seinen Schritt. Er versuchte sich zu erinnern, wie oft und mit wem er über diesen Satz schon gestritten hatte, nächtelang. Wo waren sie jetzt? Sind sie zurückgeblieben, oder waren sie ihm vorausgegangen? Haben sie den Sinn gefunden, nach dem er immer noch suchte? Mit sich und seinen Gedanken allein, er liebte diesen geistigen Dämmerzustand.
Vom Flore schlenderte er die Rue Bonaparte hinunter zur Seine und besah sich die Auslagen der Buchhandlungen und die kuriosen Stücke in den Schaufenstern der Kunsthandlungen. Geschmückte Kamine, bronzene Pferde in Lebensgröße, napoleonische Adler, afrikanische Möbel und Masken. Solange er nun schon Paris und speziell dieses Quartier kannte, standen die meisten Dinge unverändert in den Schaufenstern. Die Häuser müssen mit diesen Auslagen schon gebaut worden sein. Ob die Inhaber der Geschäfte jemals ein Stück verkauft haben? Vielleicht waren sie Mätressen reicher Männer, die mit dem Geschäft «abgefunden» wurden, wie man sagt, denen das Verkaufen ihrer Waren aber zu gewöhnlich ist.
Unten am Fluss kam ihm wieder Henry Miller in den Sinn. Wie kann einer von Pariser Pissoirs schwärmen, ohne die von Rio zu kennen in ihrer öffentlichen Spiegelpracht, oder die von Havanna in ihrer Heimlichkeit oder die vulgären von Moskau? Aus schwuler Gewohnheit sozusagen inspizierte Remeur die Pariser Klappen dennoch regelmäßig. Es war nichts los.
In den Katakomben um die Place de la Bastille hatte er einmal an einer Ecke eine merkwürdige Ansammlung von Männern beobachtet, wilde Gestalten, Remeur hatte es vorgezogen, rasch weiterzugehen, geschäftig, eilig, wie ein Tourist, ohne sich noch einmal umzusehen. Das wäre früher anders gewesen, dachte er, das ist das Alter. Über die Uferpromenade unterhalb der Tuilerien und des Louvre ging er allerdings immer, wenn sie auf seinem Weg lag. Nachts soll sich unter den Brücken einiges abspielen: Ein paar Jahre früher hätte ihn das gereizt. Heute schien es ihm, als empfinde er beim Anblick der dunklen, dumpfen, dampfenden Ecken eher ein Schaudern. Immer saßen zwei Männer auf der einen Bank, die nur noch ein Sitzbrett und keine Rückenlehne mehr hatte, immer ein Jüngerer, der seltsam tumb aussah, den Kopf nach allen Seiten reckte, motorisch regelmäßig wie ein Huhn, das nach nicht vorhandenem Futter pickt, und ein Alter mit einem Auge, das zweite Auge bestand aus einer Verdickung runzeliger Haut. Remeur kannte die beiden, solange er Paris kannte. Immer wenn er an ihnen vorüberging, bedachte er ironisch, dass man selbst in der größten Stadt schon nach kurzer Zeit «gute Bekannte» habe. Darin schloss Remeur auch die Bettler ein, den Demütigen von der Metro-Station an der Rue du Bac, den Stolzen vor dem Louvre, den Obdachlosen, der sich nachts auf dem Entlüftungsschacht am unteren Ende der Rue des Saints-Pères zum Schlafen legte, den Remeur und seine frivole Entourage in der Champagnerlaune einer Winternacht, angestiftet von Thilbeau selbstverständlich, von allen Seiten mit FrancStücken beworfen hatten, Sterntaler, der Arme wusste gar nicht, wie ihm geschah.
Der Gang unten an der Seine-Uferpromenade gegenüber dem Musée d’Orsay, eine Pflichtübung, wie Remeur es empfand, sommers wie winters, war ihm wie ein Gelübde auferlegt. Dort zu gehen war fast wie ein Bekenntnis, das täglich zu erneuern war.
Remeur erinnerte sich des starken Herzklopfens, das ihn als jungen Mann einst in Cannes befallen hatte, als er herausgefunden hatte, dass die Plage l’Ondine der Strand für die Homosexuellen war. Damals hatte er einen gehbehinderten, vornehmen alten Herrn beobachtet, der mit drei, vier dicken Zeitungen in der Hand wie selbstverständlich die steile Treppe zur Plage l’Ondine hinunterhinkte und dort mit Ehrerbietung begrüßt wurde. In diesem Moment, so hatte Remeur es immer empfunden, hatte er sein eigentliches Coming-out erlebt. «Ja», hatte er damals laut auf der Croisette gesagt, «ja», so laut, dass ein junges Mädchen sich nach ihm umsah, ob er für sich selbst redete, vor sich hin brabbelte. «Ja, ich gehör’ hierher», hatte er damals gesagt und war auch die steile Treppe hinuntergeschritten. Immer wenn er an der Seine entlangging, mit seinen feinen Schuhen durch den Dreck balancierte, musste er wieder an die Szene von Cannes denken, die nun schon so viele Jahre zurück lag. Es ist ein bisschen wie die Plage l’Ondine, sagte er sich, und ich gehör’ hierher, ob ich es will oder nicht.
Seitdem er den Weg und seine Geheimnisse entdeckt hatte, war die Strecke arg heruntergekommen. Die Bodenplatten waren fast alle zerbrochen. Mitten auf dem Weg gab es gefährliche Löcher. Das Wasser der Seine schwappte mit stinkendem Unrat an die Ufermauer. Ungewöhnlich große, wohlgenährte Ratten huschten über Müll, Schutt, Geröll. (In der Zeit, als das neue Hallenviertel aufgebaut wurde, hatte Remeur den Laden eines Kammerjägers entdeckt, in dessen Schaufenster die Ratten von Paris nach Art und Größe ausgestellt waren. Was sollte der arme Mann sonst ins Schaufenster stellen? Die Größen reichten von der gemeinen kleinen Hausratte bis zu hasenartigen Exemplaren. Die Pariser Rattenvielfalt konnte es spielend mit den Quantitäten und Qualitäten von New York oder São Paulo aufnehmen.)
Remeur und seine Freunde, die den Weg kannten, hassten die Passagierschiffe mit ihren grellen Scheinwerfern. Ihr strahlendes Licht erhellte zynisch eine Szene, deren Lebenselement die Dunkelheit ist. Die Höhlen unter den Brücken, die Schlupflöcher der Obdachlosen, die Bühnen der Exhibitionisten, die Matratzen der Liebenden; ihr Stöhnen, Flüstern, Schreien, Brüllen; die Promenade der unruhig Wandernden, der Fiebernden, der Hungernden, der Gierenden. Die Lust von unten. Die Lust an der Finsternis.
Remeur stellte sich immer vor, dass die Reiseführerin auf dem Schiff erklärte: «Wenn Sie Ihren Blick nun nach links richten wollen, so sehen Sie dort auf der Promenade unterhalb des Louvre die Pariser Homosexuellen», – die im Sommer immerhin ein attraktives und an dieser Stelle recht überraschendes Bild boten in ihren knappen Badeslips, die heute wohl allesamt Tanga heißen, früher jedoch, als Remeur das Seineufer kennenlernte, noch den poetischen Namen Pourquois-pas trugen. Ach, die Touristen. Paris-Touristen waren Remeur seit eh und je besonders dumm vorgekommen: Weil sie nicht begriffen, wie schnell und unkompliziert sie ihren Touristenstatus hätten ablegen können, indem sie einfach sagten: Ich bin kein Tourist mehr. Aber vermutlich fanden sie gerade unter dem Namen Tourist den Schutz, auf den sie nicht verzichten wollten. Remeur verstand sie nicht.
Die Pariser Homosexuellen – in Wirklichkeit gibt es, abgesehen von ein paar einschlägigen Straßen, die Rue Sainte-Anne etwa oder die Gegend um den Temple, kein richtiges Schwulenviertel, kein Village mit einer Christopher Street, kein Shinjuku oder sonst etwas in der Art. Sie wohnen vielmehr überall, verstreut in der ganzen Stadt, integriert, eingemeindet. Man wird lange suchen müssen, ehe man ein Restaurant, ein Café, eine Bar findet, wo man keine Schwulen trifft. Vielleicht fühle ich mich deshalb hier so wohl, dachte Remeur, der jede Art von Absonderung hasste.
An diesem Nachmittag, die Seine-Schiffe fuhren eilig vorüber, man hörte die erklärende Stimme und das tausendfache Klicken und Surren der Kameras bis ans Ufer, an diesem kühlen, sonnigen, wenngleich dunstigen Nachmittag beobachtete Remeur einen jungen Mann, der ihm schüchtern, unsicher folgte. Hatte er tatsächlich rote Haare? Remeur setzte sich zum ersten Mal in seinem Leben zu dem Einäugigen und dem Tumben auf die Bank, nickte den beiden zu, die sich vielsagend-ansahen: Siehst du, hab’ ich doch recht gehabt mit ihm, all die Jahre, in denen er nun schon hier vorbeikommt. Remeurs Verfolger hatte tatsächlich rote Haare, struppig, krullig, kurz geschnitten, Remeur dachte, die Haare sind vermutlich hart wie Draht. Mein Gott, der Junge ist sicher jünger, als das Gesetz erlaubt, dachte Remeur, aber nett und unbeholfen, mit einem lieben Lachen vor allem. Dass Remeur nun auf der ramponierten Bank saß, hatte seinen Verfolger aus dem Tritt gebracht. Er ging ein Stück weiter, bemüht, nicht allzu auffällig nach der Bank zu schielen, was ihm aber nur halbwegs gelang. Dann blieb er stehen, sah angestrengt hinüber zum Musée d’Orsay, ging festen Schritts wieder zurück, als habe er nun endlich sein endgültiges Ziel gefunden. Remeur stand auf und ging seinen Weg weiter wie vorhin. Der Balztanz hat eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Mühlespiel. Den Stein habe ich gewonnen, dachte Remeur, entweder kommt er mir jetzt nach, oder die Partie war sowieso von Anfang an verloren. Ohne sich umzusehen, ging er zu der kleinen Treppe, die zu dem Tunneldurchgang zu den Tuilerien führt. Auf der Treppe muss man sowieso die Richtung wechseln, eine natürliche Umdrehung sozusagen – wie wunderbar alles für das Spiel eingerichtet ist. Der Junge war ihm gefolgt. Von der Treppe aus lachte Remeur ihm zu. Aber der Junge war zu verlegen, nach Lachen war ihm überhaupt nicht. Er war gepackt von dem ernsten Geschäft, das ihn hierher getrieben hatte. Er war wirklich jung. Vielleicht hatte er so etwas noch nie gemacht. Gut, dachte Remeur, ich spiele mit.
Der Tanz fing damit erst an. Das gegenseitige Sich-Überholen, Sich-Hinsetzen, Gehen, Schreiten, Stehenbleiben, Gucken, Hingucken, Weggucken, In-die-Luft-Gucken, eine strenge, jahrhundertealte Choreographie. (Oscar Wilde soll in seinem Prozess ironisch auf die gesundheitlichen Vorzüge der Homosexualität hingewiesen haben: Man bleibe immer in Bewegung, und das meiste spiele sich in der frischen Luft ab.) Die große Manege des Spiels befindet sich in Paris im Park entlang der Orangerie. Der Kiesel knirscht, wenn man darüber geht, es sind knirschende Schritte wie in Resnais’ Film Letztes Jahr in Marienbad: «Immer wieder geh’ ich im Traum über die alten, knirschenden Parkwege. Haben wir uns dort getroffen? Warum erkennen wir uns heute nicht mehr?» Remeur und sein kleiner Verfolger trieben den Tanz bis zu der merkwürdigen Klappe rechts vom Eingang der Tuilerien zur Place de la Concorde. Das Pissoir, Urinoir, die Vespasienne erinnerte mit ihren an die Mauer gelehnten, rostenden Eisenplatten an eine Skulptur von Serra. «Kommst du mit mir? Oder gehen wir zu dir?», fragte Remeur, zuerst auf Deutsch, dann gleich noch einmal auf Französisch und auf Englisch, eine Art Fragetechnik, die er sich einst in London angewöhnt hatte. Der Junge hatte sofort auf Deutsch «ja» geantwortet, etwas atemlos und aufgeregt. Ein Deutscher also. Ein merkwürdiger Junge. Dem es nicht schnell genug geht.
Remeur winkte an der Place de la Concorde einem Taxi. «Du bist doch einverstanden?», fragte er den Jungen. Der nickte nur. Sprach fast gar nichts. Sah streng geradeaus in dem Auto, gab sich weltläufig und zitterte innerlich vor Nervosität. Remeur musterte ihn – möglichst unauffällig, aber mit Wohlgefallen. Nett, dachte er, sehr nett, hoffentlich ist er nicht wirklich zu jung. Der Junge trug lila Jeans. Remeur, Modekenner – ich habe nichts dazugetan, wie er zu sagen pflegte, die Wissenschaft ist mir zugeflogen – hatte sofort gesehen: Die lila Jeans gab es nur bei Armani. Das blassgrün gemusterte Hemd, die grüne Jacke dazu, was für eine kühne Kombination. Sogar die Socken waren lindgrün. Entweder hat der Junge Geschmack und Geld oder eine Mutter, die ein Faible für Mode hat, vielleicht hat er auch alles, Geld, Geschmack und Mutter, dachte Remeur, ich möchte wetten, er trägt auch eine lindgrüne Unterhose. Dazu das Lachsrot der Haare, Remeur fing an, sich auf den späteren Nachmittag zu freuen.
Der Junge trug eine weiße Unterhose. Schon im Taxi, während Remeur noch nach dem Zwanzig-Franc-Schein für den Fahrer in seiner Tasche suchte, hatte der Junge plötzlich Remeurs Hand berührt. Remeur sah ihn an, lachte, «wir sind gleich oben», sagte er. Er wohnte nun schon zwei Jahre in den beiden obersten Dachzimmern des Hotels Victoria de Saint-Germain. Den aristokratisch klingenden Namen hatte erst Remeur dem Hotel verliehen, weil die leicht versoffene Chefin des Etablissements selbst auch einen aristokratisch klingenden Namen hatte: Elvira de Maddelon, der Remeur an den nom de guerre einer Prostituierten erinnerte. Vielleicht war Elvira eine Nutte, die den Briefträger geheiratet hatte. Madame, eine französische Wirtin wie aus einem Gabin-Film, hatte vom vielen Gauloise-Rauchen eine Bassstimme. Sie gab Remeur den Zimmerschlüssel, warf einen musternden Blick auf den Jungen, zwinkerte mit einem Auge und drückte Remeur einen ganzen Packen Briefe, Zeitungen und Zeitschriften in die Hand.
In dem engen Aufzug, in diesem wahnsinnig engen, wahnsinnig langsam nach oben schwebenden Aufzug küsste er den Jungen zum ersten Mal. Remeur hatte für einen Moment die Vision, wen er schon in diesem Aufzug und in anderen Aufzügen geküsst hatte. Dieses sanfte Gleiten, durch leichtes Ruckeln zuweilen diskret an die Erde erinnernde Gefährt versetzte ihn in eine taumelig erotische Stimmung. Zum Teil war es wohl die Eingeschlossenheit auf engstem Raum. Aber das Erotische der Aufzugkäfige war dennoch nicht nur eine Eigenart ihrer Dimension. Remeur erinnerte sich an Tokio, wo Kiyoshi, der kleine Teufel, den Aufzug des Prince Hotels zwischen dem achten und dem neunten Stockwerk für einen letzten Abschiedskuss angehalten hatte, und dieser Aufzug war so groß, dass man eine japanische Party hätte darin feiern können. Nein, an der Größe lag es nicht.
Vielleicht liegt es an mir, dachte Remeur. Ich bin gut gelaunt. Der Junge mit den lila Hosen hat mich auf gute Gedanken gebracht, dachte er und küsste ihn noch einmal, stürmischer, drängender, und spürte in der Erwiderung des Kusses, dass der Junge sich ihm längst ergeben hatte.
Das Mittagessen vorhin mit Kessler, seinem Verleger, hatte keinen Anlass zu guter Laune gegeben. Das teure Essen im Louis XIII, zu dem Remeur auch noch eingeladen hatte, reute ihn jetzt. Für Kessler wäre auch eine Elsässer Platte gut genug gewesen; er hätte dann immer noch mit verdrehten Augen von der feinen französischen Küche geschwärmt – und wäre meinem Honorarvorschlag vielleicht eher entgegengekommen. Dass ich in solchen Restaurants wie dem Louis XIII esse, hat auf ihn vermutlich einen falschen Eindruck gemacht. Dabei wollte ich ihm klarmachen, dass ich das Geld brauche. War nicht gut, die Idee mit dem Louis XIII. Kessler war Remeur aus tiefer Seele unsympathisch. Er hasst mich ebenso wie ich ihn, dachte Remeur. Dieses Familiengetue. Dieser Kasinoton. Dass ich ausgerechnet von ihm abhängig bin. Remeur hatte jedoch in all den Jahren des Jonglierens mit seinem Leben die beneidenswerte Fähigkeit erworben, unangenehme Gedanken abzuschalten wie das Licht mit einem Schalter an der Wand. – Mein Gott, der Junge zittert ja, so geil ist der.
Im Zimmer, das Ausziehen, hastig zerrend. Remeur hätte laut darüber gelacht, wenn er nicht gewusst hätte, wie leicht man damit einen Jungen verschreckt. So mag es lustig sein, zum Lachen ist es nicht. Die Liebe ist überhaupt nicht zum Lachen. Wer sie nicht ernst nimmt, sollte es mit ihr gar nicht erst versuchen. Das blassgrüne Hemd, die lila Hose. Verdammt, dass die Jungen es immer so eilig haben mit dem Ausziehen. Remeur hätte das lieber selbst besorgt. Es machte ihn verrückt, einen Jungen langsam auszuziehen. Man muss wissen, wo man drücken und ziehen und streicheln muss, um sie wehrlos zu machen, hilflos, geil. Remeur glaubte zu Recht, ein diesbezüglicher Kenner zu sein. Die Wissenschaft ist mir auch zugeflogen, sagte er sich. Im vorliegenden Falle aber bedurfte es solcher Tricks nicht, er kam überhaupt nicht dazu. Der Junge überfiel ihn mit Zärtlichkeiten, sie überfielen sich gegenseitig. Die Haut des Jungen war heiß, seine Zunge und seine Lippen waren kalt, seine Küsse waren wie eine kühlende Erfrischung. Sie fielen auf das Bett, falsch herum, dass die Beine dort waren, wo die Kissen lagen, immer falsch herum, dachte Remeur schon atemlos. Sie fielen aus dem Bett heraus auf den kostbaren seidenen Gebetsteppich, den Remeur erst vorige Woche im Drouot ersteigert hatte. «Junge, Junge», sagte er, «was ist denn los mit dir?» Zu schnell, dachte er, das geht immer zu schnell. Er cremte den Jungen schon ein, seinen Bauch, seine Brust, seine Lippen, er salbte ihn, wollte sich erschöpft neben ihn legen auf den Gebetsteppich, ihre beiden Köpfe lagen fast unter dem Bett, als der Junge von neuem mit seinen fantasievollen Zärtlichkeiten begann.
Ein zauberhafter Liebesapparat, der ablief wie ein aufgezogenes Uhrwerk, sich in der Erschöpfung von neuem aufzuziehen schien und von neuem ablief, bis sie beide lachend unter dem Bett lagen, prustend darunter hervorkrochen. «Das glaubt uns kein Mensch», sagte Remeur, «Schwule erleben mehr, sag’ ich ja immer. Wie heißt du eigentlich?» – «Alexander», sagte der Junge, der gar nicht aussah wie ein Alexander, eher wie ein kleiner, genusssüchtiger Gabriel. «Ich werde dich Angelino nennen», sagte Remeur. Er liebte das Erzählen und das wohlige Beieinanderliegen.
Alexander war zum ersten Mal in Paris, wie er erzählte, mit seinen Eltern, nur drei Tage. Sie wohnten an der Place Vendôme im Hotel Intercontinental, dessen goldene Kandelaber vor dem Portal ihn besonders beeindruckt hatten. «Es gefällt dir in Paris?» Alexander war begeistert, dass er fast keine Worte fand. Lieber wäre er allerdings allein in Paris gewesen. Das Verhältnis zu den Eltern schien gespannt zu sein. Mit dem Vater vor allem gab es «ärgerliche Diskussionen», wie er sagte. Er verspottete ihn ein wenig, nannte ihn abschätzig einen «Bildungsbürger». Alexander stammte jedenfalls aus gutem Hause, wie man sagt. Er war reich, klug, hübsch, verwöhnt, frei, unbekümmert und jung. Er hat alles, dachte Remeur. Er hat alles, was ich in seinem Alter vermisst habe. Remeur betrachtete ihn mit leisem Neid. Er hat alles, dachte er, und er weiß nicht, dass das schon alles ist.
«Woran erkennt man einen Bildungsbürger?», fragte er scherzhaft. «Der Bildungsbürger hält den George-Kreis für zwei Schauspieler, einen alten und einen jungen, einen Postmeister und einen Schimanski. So schließt sich der Kreis der Georges.» Remeur hätte gern noch weitere Bonmots vorgetragen. «Gehen wir zusammen essen?» Nein, das sei nicht möglich. Alexander war mit seinen Eltern im Hotel verabredet, er hätte längst dort sein müssen. Am nächsten Morgen, ziemlich früh, würden sie nach Frankfurt zurückfliegen.
Alexander trug schon wieder seine makellos weiße Unterhose. Er zog gerade sein blassgrünes Hemd über den Kopf. Seine Haare waren hart wie Draht. «Was macht dein Vater?», fragte Remeur. «Er ist Verleger. Er hatte hier in Paris mit einem Autor zu sprechen.» – «Dein Vater heißt am Ende Kessler?», fragte Remeur, den ein Schrecken befiel. «Und wie alt bist du wirklich?» – «Ich bin gerade siebzehn geworden.» – O mein Gott, sagte Remeur still für sich und biss sich auf die Lippen. «Kennst du meinen Vater?», fragte Alexander. «Nicht direkt», stotterte Remeur, «ich habe ihn wohl einmal in einer Talk-Show gesehen.» – «Was machst du eigentlich in Paris?», wollte Alexander wissen. «Ich mache Werbung; für Mode und so; Design», sagte Remeur zögerlich und unbestimmt. «Toll», sagte Alexander, «find’ ich total toll.» So etwas würde er auch gern machen. Remeur überlegte, ob er sich in jungen Jahren auch mit so spärlichen Auskünften zufrieden gegeben habe. Oder ob dies eine Eigenart der heutigen Jugend sei. Vielleicht deutet es nur auf Desinteresse und Oberflächlichkeit. «Ich muss gehen», sagte Alexander. «Du weißt, wie du zu eurem Hotel kommst? Am schnellsten geht es mit der Metro. An der Place de la Concorde musst du aussteigen. Ich bring’ dich zur Metro-Station.»
So schnell, wie sie sich kennengelernt hatten, so schnell verabschiedeten sie sich. Alexander war wieder von dieser hastigen Nervosität gepackt, die wohl ein Zeichen seiner Jugend war. Remeur hätte gern gewusst, wie Alexander diesen späten Nachmittag in sein Leben einordnete. Als die Metro kam, umarmten und küssten sie sich. Niemand achtete im Gedränge darauf. Remeur sah dem Zug lange nach. Er kennt nicht einmal meinen Namen, dachte er. Alexander hatte vergessen, danach zu fragen, während Remeur ihm mit Absicht seine Adresse nicht gegeben hatte. Feige auch noch, dachte er. Der Sohn ist jedenfalls charmanter als der Vater. Kessler. Bestimmt hat der Vater keine Ahnung, dass sein Sohn Alexander juchzt und gluckst, wenn ihm ein anderer Mann den Bauchnabel küsst. Nur ich weiß es. Sein Vater würde mir einen Prozess machen, wenn er nur ahnte, dass ich es weiß. Das wäre noch das Harmloseste. Schlimmer wäre es, wenn er meinen Vertrag kündigte.
Wieder im Hotel, fragte Elvira de Maddelon ihn, ob er Lust habe, mit ihr einen Salat zu essen. Er bedankte sich und lehnte ab, leider müsse er schreiben. Oben im Zimmer setzte er sich an seinen teuren Computer und schrieb, wie es seine Art war, ohne aufzusehen, fast ohne nachzudenken – über eine genaugenommen recht überflüssige Modeshow, die schon vorige Woche stattgefunden hatte, die ihm aber nun Gelegenheit gab, Alexanders Kleidung mit der Farbkombination Lila-Grün zu feiern und gleichsam zu verewigen. Er ratterte den Text herunter, als sei er selbst ein Schreibautomat.
Erst jetzt, also ziemlich spät, kam der von der Nachtschwester herbeigerufene Arzt. «Um wen geht es?», fragte der Doktor. «Um ihn», sagte Herr Mellenthin und zeigte auf das Bett am Fenster, «aber Sie kommen zu spät mit Ihrer Morphiumspritze. Er schläft schon.» – «Gut», sagte der Doktor.
IMPRESSUM
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek Die Deutsche Bibliothek verzeichnet die Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.
Hans Scherer Remeurs Sünden Roman
© Männerschwarm Verlag, Hamburg 2013
Umschlaggestaltung: Carsten Kudlik, Bremen, unter Verwendung eines Fotos von Anja Müller 1. Auflage 2013 ISBN Buchausgabe: 978-3-86300-131-5 ISBN Ebook: 978-3-86300-139-1
Männerschwarm Verlag
Lange Reihe 102 – 20099 Hamburg
http://www.maennerschwarm.de/Verlag/
ÜBER DEN AUTOR
Hans Scherer (1938-1998) war seit 1973 Redakteur der FAZ, später ihr Kulturkorrespondent in Paris und in Berlin. Sein Titel «Stopover. Ein Jahr auf Reisen» in der «Anderen Bibliothek» wurde schnell ein Kultbuch.
INHALT
Paris
Olympia
Himmelgeist
Norderney
London
Amsterdam
Am Bodensee
Unter den Brücken
Impressum
Über den Autor





























