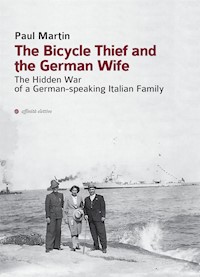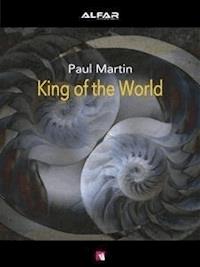5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der erste Teil dieser Reihe berichtet über Robert, dessen Weg nach seinem Outing von vielen extremen Schwierigkeiten begleitet ist. Er unternimmt am Schluss des Buches einen Selbstmordversuch und fällt nach der Reanimation für lange Zeit ins Koma. In diesem zweiten Teil erzählt Christoph, der Kellner aus dem Café Holzstrand in St. Peter-Ording, sowie Sänger der Band TheThreeGuys aus dem TwoFlowers und Freund von Robert, seine Geschichte. Er wird darüber berichten, wie sein eigener Lebensweg in der Zeit des Kennenlernens seines Eisbären ablief, welchen Versuchungen des Lebens er in dieser Zeit erlag und welche er bewältigt. In der Zeit, in dem Robert im Koma liegt, fängt Christoph an seine Erlebnisse mit Robert in seinem Tagebuch festzuhalten. Diese Tagebucheinträge zeichnen den Weg der beiden auf, bis zu dem Zeitpunkt in dem wieder eine kleine Familie, das Leben auf Renda gestaltet und sich der Kreis schließt, der 60 Jahre zuvor begann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2026
Ähnliche
Um existierende Personen nicht zu verletzen, wurde der Roman in einen fiktiven Rahmen mit einer fiktiven Handlung gesetzt. Trotzdem ist der überwiegende Teil ansatzweise erlebt. Dabei wurde die Funktion lebender Personen völlig verändert, mit anderen Namen versehen und im Wesentlichen in völlig andere Kontexte gesetzt. Sollte sich doch jemand angesprochen fühlen, sei ihm für seine Hilfe, wenn es denn eine war, gedankt. Der Autor bekennt sich mittlerweile offen zu seiner Homosexualität.
In dieser Neuauflage wurde versucht eine jugendfreiere Sprache zu verwenden, aber ist natürlich weiterhin ein Roman der homosexuelle Liebe beschreibt. Lektoriert wurde mit Chatgbt 5. Die enthaltenen Skizzen sind ebenfalls mit KI erstellt worden.
Triggerwarnung
Dieses Buch behandelt Themen, die für manche Leserinnen und Leser emotional belastend sein können.
Dazu gehören unter anderem Depression, Angstzustände, Suizidgedanken, Suizidversuch, Koma sowie familiäre Ablehnung nach einem Outing.
Bitte lies mit der nötigen Achtsamkeit. Wenn dich solche Themen persönlich betreffen oder belasten, zögere nicht, Unterstützung in Anspruch zu nehmen – bei vertrauten Menschen oder professionellen Hilfsstellen.
Inhalt
Prolog
Teil I – Erinnerungen
1. Kapitel – Der Eisbär
2. Kapitel – Careless Whisper
3. Kapitel – Gefangen
4. Kapitel – Heimkehr
5. Kapitel – Wiedersehen
6. Kapitel – Ein schlimmer Tag
7.Kapitel – Christmette
8. Kapitel – Momente
9. Kapitel – Fehler
10. Kapitel – Silvester
11. Kapitel – Kissing a Fool
12. Kapitel – Das Schicksal stellt Weichen
Teil II – Hoffen
1. Kapitel – Im Koma
2. Kapitel – Tagebuch
3. Kapitel – Zufälle
4. Kapitel – Mit allen Sinnen
5. Kapitel – Kälte
6. Kapitel – Fortschritte
7. Kapitel – ELLA
8. Kapitel – Ein Blick
9. Kapitel – Das Porträt
10. Kapitel – Notar Billerbeck
11. Kapitel – Eine Beichte
12. Kapitel – Aufzeichnungen
Teil III – Ein zweites Leben
1. Kapitel – Urlaub aus der Klinik
2. Kapitel – Leben lernen
3. Kapitel – Eine unerwartete Nachricht
4. Kapitel – Auszeit
5. Kapitel – Ausnahmezustand
6. Kapitel – Stürmisches Wetter
7. Kapitel – Ruhe im Karton
8. Kapitel – Begehrlichkeiten
9. Kapitel – Drei sind keiner zu viel
10. Kapitel – Betrachtungen
11. Kapitel – Spuren im Nebel
12. Kapitel – Das Vermächtnis
Teil IV – Die Reise
1. Kapitel – Erinnerungen
2. Kapitel – Nachrichten
3. Kapitel – Madrid
4. Kapitel – Puppen
5. Kapitel – Eine Hand
6. Kapitel – Der gefallene Engel
7. Kapitel – Entscheidungen
8. Kapitel – Bilder
9. Kapitel – Der Abend im Atelier
10. Kapitel – Die Reise zurück
11. Kapitel – Angst vor der Angst
12. Kapitel – Der Antrag
Epilog
Der Autor
Auswahl seiner Bücher
Manchmal beginnt Versuchung nicht mit einer Berührung, sondern mit dem Gefühl, dass jemand genau weiß, wie still es in einem ist.
PROLOG
Mein Name ist Christoph Krüger. Ich wurde 1978 geboren, bin 37 Jahre alt und komme aus einer kleinen Stadt nördlich von Berlin.
Das Abitur habe ich zwar gemacht, aber nie etwas daraus werden lassen. Musik war mir wichtiger als alles andere. Während meine Eltern hofften, ich würde „etwas Vernünftiges“ anfangen, wollte ich einfach nur mein eigenes Leben führen. Irgendwann begriffen sie, dass Kinder nicht Eigentum ihrer Eltern sind – sie sind nur geliehen. Es hat lange gedauert, bis sie das akzeptierten.
Ich konnte Gitarre spielen, bevor ich das Einmaleins konnte. Das Instrument bekam ich von meiner Tante Anke. Ich brachte mir selbst ein paar Akkorde bei, krächzte dazu und strapazierte damit die Nerven aller Nachbarn. Trotzdem war es für mich das Größte. Ich fühlte mich frei, wenn ich spielte.
In der Schule saß ich neben Falk, der zu Weihnachten eine Trommel geschenkt bekam. Wir waren unzertrennlich, spielten zusammen, ohne zu wissen, was wir taten, und hatten einfach Spaß. Unsere Klassenlehrerin förderte das und gründete extra für uns eine kleine Musikgruppe.
Damals, in der DDR, hieß das offiziell „Hebung des Niveaus der musikalischen Bildung und Erziehung sozialistischer Schülerpersönlichkeiten“. Für uns war es einfach Musikstunde mit Herz.
Zu Weihnachten wünschte ich mir natürlich auch eine Trommel. Bekommen habe ich eine Stimmgabel und ein Notenheft. Enttäuschend – aber vielleicht war das der Anfang meines Verständnisses für Musik.
In der vierten Klasse bekam die Schule ein richtiges Schlagzeug – zwei Tomtoms, Becken, große Trommel. Ich durfte darauf spielen. Das war ein Gefühl, als hätte mir jemand Flügel geschenkt.
Ein Jahr später gründeten wir die erste Jugendband an einer Grundschule im ganzen Bezirk – kurz vor der Wende.
Dann war plötzlich alles anders. Falk kam nicht mehr zur Schule. Man sagte, seine Eltern seien in den Westen geflohen. Ich habe ihn nie wiedergesehen.
Nach der Wende war Musik überall. Endlich konnte man Noten kaufen, die es vorher nur unter der Hand gab. Ich erinnere mich gut an Careless Whisper von George Michael. Ich lernte das Lied für den Englischunterricht auswendig und sang es als Schulprojekt. Das Ergebnis war wohl eher Hauchen als Singen, aber es reichte, um mich zur Stimme der Schulband zu machen. Unsere Musiklehrerin, Frau Kleinschmidt, gab mir danach Gesangsunterricht. Von da an war Musik mein Zuhause.
Heute spiele ich immer noch in einer Band. Wir heißen The Three Guys – kein besonders kreativer Name, aber man kennt uns. Wir treten auf Stadtfesten auf, manchmal auf Hochzeiten oder Sommerfesten.
Tom, unser Gitarrist, ist verheiratet, hat zwei Kinder und arbeitet als KfzMeister. Frank, unser Schlagzeuger, lebt in Berlin, ist Hotelfachmann, charmant, gutaussehend und der Schwarm vieler. Ich mochte ihn mehr, als ich zugeben wollte, habe ihn aber nie wissen lassen, wie sehr.
Ich bin schwul. Es ist nichts, wofür ich mich schäme, aber auch nichts, das ich überall herumerzähle. Nur meine engsten Freunde und meine Tante Anke wissen es. Für meine Eltern wäre das schwer zu akzeptieren.
Ich war oft in Berlin unterwegs – in Bars rund um die Schönhauser Allee oder die Motzstraße. Später eröffnete in meiner Heimatstadt eine kleine Bar namens TwoFlowers. Ein Zufluchtsort für viele, die nicht extra nach Berlin fahren wollten, um einfach sie selbst zu sein.
Von der Musik allein kann ich nicht leben. Im Sommer nehme ich Gelegenheitsjobs an. Nicht, weil ich das will, sondern weil es nötig ist. Da kam mir Tante Anke zu Hilfe. Sie lebt in Sankt PeterOrding und führt dort das Café Holzstrand – eine gemütliche Kaffeestube in Strandnähe, immer voller Leben, Touristen, Stimmen und Möwenschreie.
Manchmal helfe ich dort aus. Das Meer, der Wind, der weite Himmel – all das hat etwas Beruhigendes. Ich mag diesen Ort, auch wenn die Arbeit anstrengend ist.
Und dort begann alles.
An einem Nachmittag, als das Café voll war und draußen ein leichter Wind über die Dünen zog, kam ein Mann herein. Er setzte sich in einen Strandkorb, bestellte nichts und sah einfach nur hinaus aufs Meer. Irgendetwas an ihm war anders – eine Art stiller Schmerz, den man nicht übersehen konnte.
Als ich ihn fragte, ob er etwas trinken möchte, schaute er mich kurz an, stand auf und ging. Kein Wort. Nur dieser Blick.
Ich dachte erst, das sei eine von diesen flüchtigen Begegnungen, die man vergisst. Aber das stimmte nicht. Er blieb mir im Kopf.
Ein paar Wochen später sah ich ihn wieder. Von da an begann etwas, das ich selbst kaum in Worte fassen kann.
Jetzt sitze ich an seinem Krankenbett. Der Mann, den ich dort kennengelernt habe, hat versucht, sich das Leben zu nehmen. Zu viele Schicksalsschläge, zu wenig Hoffnung. Er wurde reanimiert und liegt seitdem im künstlichen Koma.
Ich halte seine Hand und rede mit ihm, als könnte er mich hören. Vielleicht kann er es ja wirklich. Ich erzähle ihm, wie wir uns kennengelernt haben, was wir erlebt haben – und ich schreibe es auf. Nach jedem Kapitel lese ich es ihm vor.
Ich hoffe, dass meine Stimme ihn zurückholt.
Dass er wieder die Augen öffnet und lacht, so wie damals im Café.
Wenn irgendwann jemand anderes das hier liest, soll er wissen:
Es lohnt sich, zu leben. Auch dann, wenn das Leben einem den Boden unter den Füßen wegzieht. Und es lohnt sich, zu sich selbst zu stehen – egal, was andere denken.
Ich werde nicht aufgeben.
Nicht bei ihm.
Nicht bei uns.
TEIL I – ERINNERUNGEN
1. Kapitel – Der Eisbär
Meine Tante wohnt in Ording, am Norddeich, in der Nähe der Fischerkate. Ein kleines Häuschen mit großem Garten – und einem Parkplatz für mein Wohnmobil, auf das ich ziemlich stolz bin. Es ist kein neues Modell, eher ein älteres Semester, gut, eigentlich ein ziemlich altes. Der Vorbesitzer wollte es schon verschrotten lassen, doch Tom, unser KfzMechaniker, hat es mir wieder flottgemacht. Seitdem touren wir mit der Band, wenn wir außerhalb Auftritte haben, mit diesem Bus durchs Land.
Das Ding hat alles, was man braucht: hinten ein schmaleres Doppelbett, daneben eine winzige Dusche, ein drehbares WC mit einem kleinen Waschbecken. Ein Kleiderschrank, kaum breiter als eine Gitarre, daneben ein Kühlschrank mit Gefrierfach und eine Mikrowelle. Gerade gegenüber ein Zweiplattenherd, darunter Schubladen mit Halterungen für Geschirr und Besteck, damit unterwegs nichts klappert. Eine kleine Sitzgruppe mit umklappbarer Bank, über Fahrer und Beifahrersitz ein Alkoven mit Matratze – und in allen Ecken Stauraum. Für uns Musiker war es ein praktisches, vor allem aber kostensparendes Zuhause auf Rädern. Und für mich im Sommer die perfekte Unterkunft, um bei Tante Anke im Garten zu stehen, von ihr bekocht zu werden und trotzdem mein eigenes kleines Reich zu haben.
Es war der erste richtige Frühlingstag im Jahr 2014. Die Sonne schien hell über die Salzwiesen, der Wind wehte vom Meer herüber und brachte diesen salzigen, klaren Duft mit. Ich fuhr mit Tantchens Fahrrad Richtung Bad, der Wind im Gesicht, die Sonne auf der Haut. Die Schilfdolden glänzten im Gegenlicht, und ich hatte das Gefühl, als würde der Winter endlich loslassen.
Ich freute mich auf nette Gäste, freundliche Gesichter und gutes Trinkgeld. Tante Anke hatte das Café nach dem Winter gründlich herausgeputzt. Eine neue Terrasse zur Straße hin, mit dunkel gebeizten, geriffelten Holzdielen, Strandkörben und kleinen Glastischen. Die Gäste konnten dort frühstücken, Kuchen essen oder einfach in der Sonne sitzen. Wegen dieser markanten Holzdielen nannte man das Café bald nur noch den Holzstrand – und der Name blieb.
Es war Montag, Mitte April. Ich erinnere mich genau, weil an diesem Tag zum ersten Mal die Sonne so richtig wärmte. Der Wind kam vom Westen, und der Geruch von Salz lag in der Luft. St. PeterOrding – oder kurz SPO – besteht eigentlich aus vier Ortsteilen: Böhl, St. PeterDorf, St. PeterBad und Ording. Früher hatten sie sogar eigene Autokennzeichen. Heute läuft alles unter „NF“, und irgendwie klingt das nach nichts.
Aber das soll keine Geschichtsstunde werden. Ich will von einer Begegnung erzählen, die alles veränderte.
Es war der 14. April 2014, gegen elf Uhr vormittags. Ich begann meinen Dienst im Holzstrand. Ich bin etwa einsachtzig groß, habe grüne Augen und kurze dunkle Haare. Ich gehe ab und zu ins Fitnessstudio – kein Muskelpaket, aber in Form. Beim Kellnern trage ich schwarze Jeans, ein weißes Hemd ohne Krawatte und weiße Sneaker. Dazu die typische lange, bordeauxrote Schürze.
Ich band sie mir um, nahm den Notizblock und ging hinaus auf die Terrasse, wo die Strandkörbe schon voll besetzt waren. Ganz hinten, allein, saß ein Mann. Älter als ich, graues kurzes Haar, dichter Bart, kräftige Statur – ein richtiger Bär eines Kerls. Etwas an ihm zog mich sofort an. Er wirkte traurig, verletzt vielleicht, und doch hatte sein Blick etwas Warmes, Ruhiges.
Ich weiß nicht warum, aber ich dachte sofort: Ein Eisbär. Groß, stark, und doch irgendwie schutzlos. Und diese Augen – so blau, dass man darin versinken konnte. Ich hatte noch nie so jemanden gesehen.
„Moin“, begrüßte ich ihn. „Hunger?“
„Frühstück, bitte“, antwortete er knapp.
Ich zählte die Varianten auf – und er bestellte schließlich: „Zwei Brötchen, Marmelade, Honig, kein Aufschnitt, ein Stück Camembert und einen Pott Kaffee, wenn ich bitten darf.“
Ich grinste. „Uiii, da ist aber einer schlecht drauf. Stress gehabt? Kann ich außer mit einem Frühstück sonst noch helfen?“
Er schaute mich an – und plötzlich stand er auf, drehte sich um und ging. Einfach so. Ich sah ihm hinterher, wie er sich ein Fischbrötchen am Eckimbiss kaufte, es achtlos in die Jackentasche steckte und Richtung Seebrücke davonlief.
Das war mir noch nie passiert. Ein Gast, der einfach ging. Ich stand da, unschlüssig, zwischen Verblüffung und einem merkwürdigen Gefühl von Verlust, als hätte mir jemand etwas weggenommen, das mir gar nicht gehörte.
Ich überlegte kurz, ob ich ihm hinterherlaufen sollte, ließ es aber bleiben. Meine Schicht hatte gerade erst begonnen, und Tante Anke hätte mich gelyncht.
Als ich mich endlich wieder umdrehte, bediente meine Tante bereits die restlichen Gäste. Sie hob nur kurz eine Augenbraue, und ich wusste, dass ich gleich eine Ansage bekommen würde.
„Kannst du mir mal erklären, was das eben war?“ fragte sie, als ich an den Tresen kam.
Ich stotterte etwas von „Blackout“ und versprach, dass es nicht wieder vorkomme.
„Das meinte ich gar nicht“, sagte sie und grinste. „Ich habe genau gesehen, wie du diesen Mann angeschaut hast.“
„Er sah einfach so traurig aus“, murmelte ich.
„Aha“, machte sie gedehnt. „Und du verteidigst ihn schon. Ich kenne dich, mein Junge. Das hat geknistert da draußen – ich hab’s bis hier gespürt.“
Ich wurde rot. „Ich hab ihn noch nie gesehen.“
„Dann wird’s Zeit, dass du ihn wieder siehst“, meinte sie trocken. „Geh, such ihn. Ich halte hier die Stellung.“
„Ist das nicht aufdringlich?“
„Magst du ihn oder nicht?“
Ich zögerte. „Ja. Irgendwie schon. Ich weiß selbst nicht, was los ist.“
„Dann los. Du wirst schon wissen, was du sagen musst.“
Ich band die Schürze ab, legte sie auf den Tresen, steckte mein Portemonnaie in die Kasse und rannte los. Natürlich war er längst verschwunden. Aber ich erinnerte mich, dass er Richtung Seebrücke gegangen war.
Der Platz dort war neu gestaltet – Pflaster, Gaslaternen, kleine Geschäfte, Bänke. Ich suchte alles ab. Kein Eisbär. Erst als ich zum Deichweg kam, sah ich ihn. Etwa hundert Meter entfernt, auf einer Bank, den Blick über die Salzwiesen gerichtet.
Ich wollte gerade zu ihm gehen, als er sein Handy nahm und halblaut sagte: „Was hat der Kerl gemacht… war er etwa bei mir zu Hause?“
Ich trat näher. „Also doch Stress mit einem Kerl“, sagte ich – etwas frech vielleicht.
Er drehte sich um, sah mich an, musterte mich kurz. Dann: „Habe ich so laut gedacht, dass man das bis zum Holzstrand hört?“
Und dann – lächelte er. Ein Lächeln, das mir den Boden unter den Füßen wegnahm.
„Hab Pause“, log ich und setzte mich einfach neben ihn. „Lauf dir nicht hinterher, keine Sorge. Ich mach nur meine Runde. Ich bin Christoph, übrigens. Kann gut zuhören – gehört zum Job.“
Er sah wieder aufs Meer. „Robert“, sagte er knapp. „Und es geht dich nichts an.“
Ich musste schlucken. „Na ja, so ganz fremd sind wir uns ja nicht mehr. Wir haben uns heute schon zweimal gesehen.“
Keine Antwort. Nur Wind und Wellen. Nach einer Weile wurde mir das Schweigen zu lang. Ich stand auf, beugte mich kurz zu ihm hinunter und flüsterte: „Man sieht sich, Süßer.“
Er schaute hoch – überrascht, vielleicht verwirrt – und ich ging. Doch kaum war ich ein paar Schritte weit, drehte ich mich um und sah, wie er aufstand und in die entgegengesetzte Richtung ging.
„Schnorpicon! Heute Abend!“, rief ich ihm hinterher und grinste. „Da will ich alles wissen von dir!“
Aber er drehte sich nicht mehr um.
Am Abend erzählte ich Tante Anke, dass ich ihn nicht wiedergesehen hatte. Sie neckte mich ein bisschen, dann ließ sie mich in Ruhe. Um sechs war Feierabend. Ich fuhr mit dem Rad zurück nach Ording, duschte, zog ein frisches Hemd an und hoffte – gegen jede Vernunft –, dass er doch noch auftauchte.
Er kam nicht.
Auch die nächsten Tage nicht.
Ich sah ihn weder im Café noch irgendwo im Ort. Abends saß ich oft allein in meinem Wohnmobil, starrte an die Decke und dachte an ihn. Ich roch noch immer sein Aftershave – Zedernholz, warm, würzig, männlich.
Ich konnte ihn nicht vergessen.
Tante Anke merkte, dass ich völlig neben mir stand. Ich vertauschte Bestellungen, vergaß Rechnungen, verschüttete Kaffee. Irgendwann schickte sie mich nach Hause.
„Mach den Kopf frei, Junge“, sagte sie. „Der Sommer kommt noch früh genug.“
2. Kapitel – Careless Whisper
Nach einigen Tagen des Wartens war mir klar, dass die Hoffnung auf ein Wiedersehen mit meinem Eisbären vielleicht aussichtslos war. Also beschloss ich, meine Abende nicht mehr im Schnorpicon zu verbringen und nicht weiter auf etwas zu warten, das vermutlich nicht eintreten würde. Nur noch einmal, dachte ich. Ein letztes Mal.
Das Schnorpicon war in diesen Tagen fast zu meiner zweiten Heimat geworden – zumindest abends. Kalle und Conny, die Inhaber, hatten längst gemerkt, wie es um mich stand; vor den beiden kann man nicht viel verbergen. Und wenn nicht die beiden, dann Heike: die neue, etwas üppige Barfrau, inzwischen die Seele der Kneipe. Sie spürt sofort, wenn mit jemandem etwas nicht stimmt, und holt einen wieder auf die Füße.
Die Kneipe selbst ist gemütlich. Ein rechteckiger Raum mit einem ebenso rechteckigen Tresen in der Mitte, der nur eine schmale Öffnung für das Personal hat. Rundherum stehen Barhocker dicht an dicht. Über dem Tresen hängen Gläser, daneben stehen Flaschen fürs Mixen. An den Wänden Filmplakate aus alten Zeiten. Hier lernt man Einheimische, wie Touristen kennen, und man wird beim zweiten Besuch schon mit Namen begrüßt. Grüppchen sitzen im Rund, reden durcheinander, lachen.
Ich setzte mich an die Stirnseite, den Rücken zum Eingang, und bestellte bei Kalle ein frisches, kühles Helles. Eigentlich war ich kurz davor, gleich wieder zu gehen. Die Enttäuschung stand mir ins Gesicht geschrieben; ich starrte die meiste Zeit mit gesenktem Kopf ins Leere. Kalle sah es und fragte in seiner unverblümten friesischen Art: „So schlimm?“
„Schlimmer“, murmelte ich.
Kalle lachte, ging zum Zapfhahn – und als ich den Kopf hob, blieb mir für einen Moment das Herz stehen. Links von mir, an der langen Seite des Tresens, saß plötzlich mein Eisbär und bestellte bei Kalle sein Bier. Er musste gerade erst gekommen sein. Ich stand auf, trat leise hinter ihn; er schaute nach links, weg von mir.
„So allein, schöner Mann?“, flüsterte ich ihm ins rechte Ohr. Die Gänsehaut kam sofort, ein Kribbeln lief mir den Rücken hinunter. „Keine Sorge, ich habe dich nicht verfolgt. Du bist ganz allein hierhergekommen“, setzte ich schnell hinterher.
„Kannst du bitte aufhören, mich Süßer zu nennen? Das ist mir peinlich“, sagte er ruhig. „Ich wollte hier nur gepflegt und allein ein Bier trinken.“
„Will ich auch“, antwortete ich und setzte mich neben ihn. „Was dagegen?“
„Kann ich das verhindern?“, erwiderte Robert knapp.
„Nö.“ Ich atmete durch. „Ich habe mir fest vorgenommen, dich heute aufzumuntern. Also – was ist passiert, seit wir uns am Deich getroffen haben?“
„Gibst du nie Ruhe? Ich will darüber nicht reden.“
Etwas in seinen Augen verriet mir, dass er mich mochte. Manchmal sah er mich an, als stünde da jemand, den er bewunderte, und ich hätte viel darum gegeben, ihn in diesem Moment für mich zu gewinnen. Aber es sollte wohl nicht sein. Nicht an diesem Abend.
Wir schwiegen bestimmt zwanzig Minuten, bis Conny scherzhaft rief: „Na, Jungs, noch ein Bier – damit der Mund nicht trocken wird vom vielen Reden?“
Robert drehte sich zu mir. „Was willst du wissen?“
„Alles, was dich bedrückt“, sagte ich leise. Offenbar öffnete sich in ihm ein Ventil.
Er erzählte von kleinen Gemeinheiten, Geheimnissen und Lügen in seiner Familie, die ihn herunterzogen. Von seinen Eltern. Vom Gefühl, schwul zu sein und es verstecken zu müssen, bis es ihn fast zerriss. Von einem Harald, wie sie sich wiedergetroffen hatten. Und davon, dass vor einer Woche plötzlich ein Sohn aufgetaucht war, den Harald ihm verschwiegen hatte.
In diesem Moment lief über die Lautsprecher Careless Whisper von George Michael. Robert verstummte. „Das ist mein Lieblingssong“, sagte er leise.
„Jetzt bist du fort... Was hab ich bloß falsch gemacht – so falsch, dass du mich gleich verlassen musstest...“, rezitierte ich gespielt übertrieben und musste dann doch grinsen. Es war das Lied, das ich früher in Englisch und später in Deutsch gesungen hatte, und ich dachte im Stillen, dass es gut ins Repertoire unserer Band passen würde.
Ich nahm Roberts Hand, zog ihn hoch, legte seine Hände um mich, meine Hand an seine Hüfte – und wir bewegten uns langsam im Takt. Ganz ruhig. Es fühlte sich richtig an. Er zitterte ein wenig. Ich sah ihm in die Augen, wollte ihn gerade küssen, da stieß er mich weg.
„Spinnst du jetzt total?“ Seine Augen zeigten mehr Angst vor sich selbst als Zorn. Ich ließ ihn los, wir setzten uns, taten so, als wäre nichts gewesen.
„Und?“, fragte ich schließlich. „Was wirst du morgen tun, wenn du nach Hause kommst – zu deiner Frau? Was wirst du ihr sagen?“
„Was soll ich denn sagen?“ Er sah mich verzweifelt an. „Sag du es mir. Was würdest du an meiner Stelle tun?“
Fiete, ein Handwerker aus dem Ort, hatte uns die ganze Zeit über vom gegenüberliegenden Hocker beobachtet. Er schüttelte den Kopf, als ich mich vorbeugte, um Robert erneut zu berühren. Also sagte ich nur leise: „Es ist nicht entscheidend, was ich tun würde. Du musst es für dich herausfinden. Du hast, so wie ich dich verstanden habe, die letzten dreißig Jahre das Leben deiner Frau und deiner Eltern gelebt. Denk darüber nach, was du willst.“
Fiete nickte mir zu. Robert sah ihn an, als wäre er Luft, legte einen Schein auf den Tresen, sprang auf und hastete hinaus.
„Holla“, rief ich hinterher. „Warum so stürmisch?“
Kalle zuckte die Achseln. „Sturm ist hier erst, wenn die Schafe keine Locken mehr haben.“
Ich lief zur Tür, doch draußen war Robert nirgends zu sehen. Die Nacht war dunkel, die Straßen leer – sinnlos, ihn zu suchen. Zurück in der Kneipe setzte sich Fiete zu mir. „Er mag dich, glaub mir. Er kann’s bloß nicht zugeben. Noch nicht.“
„Was soll ich machen?“, fragte ich, und es klang verzweifelter, als ich wollte.
„Du magst ihn doch auch, oder?“
„Ja. Natürlich.“
„Dann kommt der Tag, an dem ihr euch wiederseht. Und ich glaube, der ist gar nicht mehr so fern.“
„Kannst du jetzt spökenkieken, oder was?“
„Meine Mutter konnte es“, sagte Fiete und nickte ernst. „Vielleicht ist was hängen geblieben. Aber ich weiß, dass ihr euch wiederseht. So wahr ich hier sitze.“
„Wenn ich dir doch bloß glauben könnte“, sagte ich mit einem Kloß im Hals. „Ich habe nicht einmal seine Telefonnummer.“
3. Kapitel – Gefangen
Die nächsten Tage waren geprägt von Wut – auf mich selbst, auf Robert, dann wieder auf mich. Ich konnte nicht mehr schlafen, und irgendwann blieb nur noch diese Müdigkeit, die alles dämpft. Ich hatte meinen Eisbären verloren, ohne auch nur versucht zu haben, ihm zu folgen.
Nach einiger Zeit fand ich wieder ein Stück Gleichgewicht und kehrte ins Café zurück. Tantchen schickte mich gleich wieder heim. „Komm erst wieder, wenn du wieder du bist“, sagte sie, und sie hatte recht. Ich war fahrig, zerstreut, und in jedem Gast suchte ich Roberts Gesicht.
Ich ging viel hinaus, durch den Dünenwald, hinauf auf den Maleens Knoll. Dazu wird folgendes berichtet:
„Ein junges Mädchen namens Maleen wartete auf ihren Seemannsverlobten, der zur See fuhr. Sie saß jeden Tag auf der höchsten Düne, spinnte mit ihrem Spinnrad und zündete jeden Abend eine Laterne an, damit er den Weg zu ihr finden konnte. Eines Tages blieb das Licht aus; sie wurde tot aufgefunden. Wenige Wochen später wurde ihr Verlobter, der zurückkam, aber zu spät, tot an den Strand gespült.
Ich mochte die Geschichte von Maleen, die auf ihren Verlobten wartete, bis sie an ihrem Spinnrad starb. Vielleicht, dachte ich, bin ich wie sie – wartend, hoffend, unfähig loszulassen.
Abends saß ich im Schnorpicon, dieser kleinen Kneipe voller Stimmen, Rauch und Meergeruch. Fiete kam oft vorbei, wir redeten über das Leben und über das, was uns entglitt.
Eines Abends kam ein Jürgen Wiesner herein. Groß, gepflegt, selbstsicher – einer, der wusste, dass man ihn bemerkte. Seine ruhige, freundliche Art zog mich an. Vielleicht war es nur die Sehnsucht, wieder gesehen zu werden. Nach so vielen Wochen des Schweigens fühlte sich das wie Rettung an.
Er bestellte mir ein Getränk, wir redeten über Musik, das Meer, über Belangloses. Es war nichts Besonderes – und doch zu viel. Später lud er mich ein, den Abend noch mit ihm ausklingen zu lassen. Ich sagte ja, ohne nachzudenken.
Seine Wohnung lag im obersten Stockwerk des Hotel Atlantic, fast direkt an der Strandpromenade. Als sich die Aufzugstüren öffneten, schlug mir der Duft von warmem Holz, Parfüm und Meerluft entgegen. Das Apartment war großzügig, elegant, beinahe steril: dunkles Parkett, helle Möbel, ein tiefer Ledersessel am Fenster. An den Wänden hingen Gemälde von Erhard Schiel – kräftige Farben, voller Wind und Bewegung. Nichts daran wirkte zufällig. Jürgen war ein Mann, der Kontrolle liebte.
Ich stand am Fenster und sah auf das Meer hinunter, das im Licht der Sterne schimmerte. Alles wirkte unwirklich, fast schön. Vielleicht war es diese Stille, die mich glauben ließ, ich wäre in Sicherheit. Er trat neben mich, legte eine Hand auf meine Schulter, und ich ließ es zu. In diesem Moment wollte ich einfach nur gehalten werden – wenigstens für eine Nacht.
Später brachte er mich mit seinem Jaguar nach Ording zurück. Der Wagen roch nach Leder und Menthol, die Scheinwerfer schnitten lautlos durch den Nebel. Ich bat ihn, mich an der letzten Kurve aussteigen zu lassen – ich wollte nicht, dass er meinen alten Wohnwagen sah. Er nahm mich in den Arm, küsste mich auf die Stirn und sagte leise: „Morgen ist mein Geburtstag. Komm doch vorbei.“ Ich nickte. Es war, als hätte ich endlich wieder eine Richtung.
Am nächsten Abend stand ich mit einer Flasche Rotwein vor seiner Tür. Er öffnete sofort, nannte mich „mein Goldstück“ und stellte mich seinen Freunden vor – fünf Männer, die mich musterten, als wäre ich Teil des Abends.
Ich erinnere mich an ihr Lachen, an Gläser, die klirrten. Nur einer blieb mir im Gedächtnis: HansGeorg, von allen Schorschi genannt. Ein älterer Mann mit ruhiger, aber unheimlicher Art. Er sprach kaum, beobachtete nur – und jedes Mal, wenn sich unsere Blicke trafen, fror mir das Blut. Wir tranken. Ich wurde müde. Jürgen legte mir eine Hand auf die Schulter. „Leg dich kurz hin, du siehst erschöpft aus.“ Ich nickte. Ich ahnte nicht, dass dies der Moment war, in dem alles kippte.
Als ich wieder zu mir kam, war alles still. Mein Kopf dröhnte, mein Körper fühlte sich fremd an. Stimmen flüsterten irgendwo, dann Schritte, ein kurzes Lachen. Ich wollte mich bewegen, doch ich konnte nicht. Etwas in mir begriff, dass aus Nähe Gewalt geworden war.
Ich weiß nicht, wie lange das dauerte – vielleicht Stunden, vielleicht nur Minuten. Irgendwann war ich allein. Der Raum roch nach kaltem Rauch und Parfüm. Jürgen saß am Tisch, rauchte, als wäre nichts geschehen. „Nimm das Geld, zieh dich an und geh“, sagte er leise, mit einer Kälte, die mir durch die Knochen fuhr.
Ich tat, was er sagte. Ich wollte nur weg.
Draußen brannte der Wind auf meiner Haut. Ich schob mein Fahrrad am Deich entlang, Schritt für Schritt, bis mir die Knie versagten. Ich fühlte mich leer, ausgeweidet, als hätte man mich aus mir selbst herausgenommen.
Zwei Stunden später saß ich in meinem alten Bus. Ich startete den Motor, fuhr los – ohne Ziel. Der Morgen kam, aber ich spürte nichts. Ich wollte nur vergessen.
Es hat lange gedauert, bis ich begriffen habe, was das wirklich war. Ich hatte mir eingeredet, ich hätte es zugelassen, weil ich das Geld nahm, weil ich schwieg. Aber das stimmt nicht. Kein Mensch stimmt zu, erniedrigt zu werden. Kein Mensch bittet darum, gebrochen zu werden.
Ich erinnere mich an den Moment, als ich die Tür hinter mir schloss. Der Flur war leer, nur das Summen der Neonröhren begleitete mich. Ich lief den langen Gang hinunter, Schritt für Schritt, tastend, wie jemand, der nicht weiß, ob der Boden unter ihm trägt. Draußen atmete ich die kalte Luft ein – sie stach in der Lunge, aber sie roch nach Freiheit. Ich ging, weil ich nicht wusste, wohin sonst. Der Deich lag still, das Meer rauschte dumpf in der Ferne. Jeder Schritt tat weh. Meine Hände zitterten, und ich zwang mich, weiterzugehen – nicht stehen bleiben, nicht nachdenken, nicht fühlen.
Der Wind kam vom Meer, biss mir ins Gesicht. Irgendwann begann es leicht zu schneien – winzige Flocken, die sofort wieder schmolzen. Ich sah sie auf meinen Handrücken vergehen und dachte, dass sie wenigstens verschwinden durften. Ich nicht.
Als ich den Ortsrand erreichte, begann der Himmel sich aufzuhellen. Der Morgen kam – gleichgültig, als ginge die Welt einfach weiter. Ich tankte an der kleinen Station, zahlte bar, stieg ein und fuhr los. Der Motor klang fremd, als gehörte er zu jemand anderem.
Auf der Autobahn zwischen Heide und Hamburg wehte der Wind quer über die Fahrbahn, der Scheibenwischer arbeitete stoisch gegen den feinen Regen. Ich hielt mich an der Straße fest, an der Bewegung, an dem Geräusch der Reifen. Alles war besser als Stille.
Zweimal hielt ich an Raststätten, nur um Luft zu holen. Ich sah mein Gesicht im Spiegel – blass, mit geröteten Augen, fast fremd. Ich wusch mir die Hände, das Gesicht, die Arme, immer wieder. Das Wasser lief klar davon, aber in mir blieb der Schmutz.
Erst am zweiten Tag kam ich bei Tom an. Er fragte nichts, und ich war dankbar dafür. Ich war müde, aber Schlaf brachte keine Ruhe. Ich hatte das Gefühl, das Meer rausche noch immer in meinen Ohren – wie ein dunkles Echo jener Nacht. Ich schämte mich, obwohl ich das Opfer war. Ich wusch mich, bis meine Haut brannte, als könnte ich etwas abspülen, das gar nicht sichtbar war. Doch der Geruch blieb – nicht auf der Haut, sondern irgendwo tiefer.
Von all den Männern jener Nacht blieb nur einer in meinem Kopf: Schorschi. Sein Name tauchte immer wieder auf – in Träumen, in Gesprächen, im Rauschen des Meeres. Ich wusste, dass er noch einmal eine Rolle in meinem Leben spielen würde. Und dass ich ihm beim nächsten Mal nicht mehr als Opfer begegnen würde.
4. Kapitel – Heimkehr
Als ich meinen Bus bei Tom vor dem Haus abstellte und die letzten Meter zu Fuß zu meinen Eltern schlich, warteten sie bereits. Meine Mutter öffnete die Tür, noch ehe ich klingeln konnte. Ihr Blick war sorgenvoll, und mein Vater stand wie immer etwas abseits, mit verschränkten Armen. Sie wollten natürlich wissen, was vorgefallen war – Tante Anke hatte Alarm geschlagen, als sie mich am Morgen nicht mehr gefunden und mein Wohnmobil verschwunden war.
Ich erzählte ihnen nicht die Wahrheit. Ich tischte irgendeine Geschichte auf, an die ich mich später kaum erinnern konnte. Offenbar war sie glaubwürdig genug, denn niemand hakte nach. Ich war erschöpft, leer und wollte nichts erklären. Tom ließ mich mein Wohnmobil auf seinem Hof abstellen und versprach, es kostenlos durchzusehen. Ich nickte dankbar, mehr brachte ich nicht hervor.
In den nächsten Wochen nahm das Leben wieder eine Art Form an. Wir begannen zu proben, aber ich war unkonzentriert und zog mich oft zurück. Meist lag ich auf dem Bett, starrte an die Decke und wartete, dass die Tage einfach vorbeigingen. Frank hatte für uns einige Auftritte im TwoFlowers gebucht – zur Adventszeit und über Silvester. Meine Mutter war glücklich, mich wieder um sich zu haben, kochte, redete, umsorgte mich. Mein Vater brummte manchmal: „Wie lange willst du uns noch auf der Tasche liegen?“ Doch es klang mehr nach Gewohnheit als nach Ärger.
Ich lebte sparsam, hatte vom Trinkgeld bei Tantchen ein wenig beiseitegelegt, sodass ich nur Frühstück und Mittag bei den Eltern bunkerte. Abends saßen Tom, Frank und ich oft beisammen, probten im Schuppen hinter dem Haus und arbeiteten an neuen Songs. Frank entpuppte sich als guter Übersetzer, und bald bestand unser Programm fast ausschließlich aus englischen Stücken, die ich auf Deutsch sang.
Eines Nachmittags stöberten Frank, seine Frau Birgit und ich in einem SecondHandLaden. Ich fand dort einen cremefarbenen Anzug mit Glitzersteinchen und ein flaschengrünes Hemd. Frank meinte lachend, die Farbe würde wunderbar zu meinen Augen passen. Sein Blick blieb einen Moment zu lange an mir hängen, und ich wusste nicht, ob es ein Scherz war oder mehr. Ich lächelte unsicher. Birgit zwinkerte mir zu – auf eine Art, die alles entschärfte und doch etwas unausgesprochen ließ.