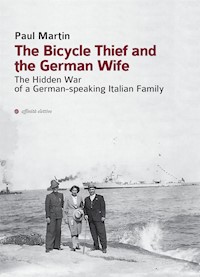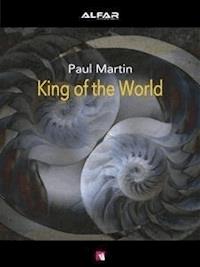Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Renda
- Sprache: Deutsch
Dieser Band fuehrt zwei Wege zusammen: die offenen Schatten aus "Tanz auf dem Vulkan" und die nur angedeuteten Brueche aus "Des Lebens Versuchungen". Was damals ungesagt blieb, findet hier seine Fortsetzung. Es ist kein leichtes Buch. Es ist aus Verlust entstanden - aus dem Versuch, nach dem Tod meines Mannes Worte zu finden, die tragen, statt zu zerbrechen. Die Figuren stehen an einem Punkt des Rueckblicks, bevor sie weitergehen koennen. Wer die frueheren Baende kennt, wird Vertrautes wiederfinden. Wer neu einsteigt, spuert die Vergangenheit, die in jeder Zeile mitschwingt. Der Vorhang hebt sich erneut - leise, aber entschlossen. Die Geschichte geht weiter. Auch meine.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 246
Veröffentlichungsjahr: 2026
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Prolog – Der Weiße Schal
I. Teil – Schicksalsschläge
1. Kapitel – Der Morgen,
2. Kapitel – Der nächste Tag
3. Kapitel – Der Geburtstag
4. Kapitel – Zwischen den Zeiten
5. Kapitel – Gespräche am Abend
6. Kapitel – Auf dem Friedhof
7. Kapitel – Schwierige Tage
8. Kapitel – Sind Träume Schäume?
9. Kapitel – Maikäfer flieg
10. Kapitel – Auf hoher See
11. Kapitel – Begleitung
12. Kapitel – Am Mövenbruch
II. Das Tagebuch
1. Kapitel – Ordinger Leben
2. Kapitel – Ludwig von Schöneck
3. Kapitel – Der einsame Reiter
4. Kapitel – Maleens Knoll
5. Kapitel – Die alte Gyde
6. Kapitel – Unruhe
7. Kapitel – Überraschungen
8. Kapitel – Erinnerungen
9. Kapitel – Letzte Tage
10. Kapitel – Vater und Sohn
11. Kapitel – Wahrheiten
12. Kapitel – Neuigkeiten
III. Spurensuche
1. Kapitel – Herz aus Feuer
2. Kapitel – Brookholts Geschichte
3. Kapitel – Urtas Gabe
4. Kapitel – Stille Zeit
5. Kapitel – Nochmals Gyde
6. Kapitel – Wiener Lieder
7. Kapitel – Entscheidungen
8. Kapitel – Raues Wetter
9. Kapitel – Außer Kontrolle
10. Kapitel – Merci mon ami
11. Kapitel – Die Rückkehr
12. Kapitel – Am See von Renda
Epilog
Danksagung
Was Bleibt
Der Autor
AUSWAHL SEINER BÜCHER
Manchmal tanzen wir, ohne zu wissen, wer die Musik spielt.
VORWORT
Dieser Band knüpft an zwei frühere Wege an, die sich nun miteinander verweben.
Zum einen führt er die Geschichte aus Band 3 – Tanz auf dem Vulkan – fort, dort, wo die Schatten der Stadt und die leisen Spannungen zwischen den Figuren zuletzt offenblieben.
Zum anderen nimmt er Fäden aus Band 2 – Des Lebens Versuchungen – wieder auf und erzählt weiter, was damals nur angedeutet wurde: die Begegnungen, Entscheidungen und Brüche, die noch nachwirkten, als die letzte Seite umgeblättert war.
Doch eines soll gleich zu Beginn gesagt sein: Dies ist kein leichtes Buch. Kein Werk für heitere Stunden. Keine Geschichte, die versucht, das Leben weich zu zeichnen oder leichter erscheinen zu lassen, als es ist.
Es ist ein Buch, das aus echtem Schmerz entstanden ist – und aus dem Bedürfnis, diesen Schmerz zu tragen, anstatt vor ihm davonzulaufen.
Ich schreibe diesen Band, weil ich den Tod meines Mannes begreifen muss.
Weil Worte manchmal der einzige Ort sind, an dem man seinen Verlust abstellen kann, ohne daran zu zerbrechen.
Jede Seite ist ein Versuch, weiter zu atmen.
Hier beginnt also kein neuer Abschnitt, sondern ein Weitergehen. Ein Übergang. Ein Atemzug zwischen Vergangenem und dem, was noch kommt. Die Figuren stehen nicht am Anfang, sondern an einem Punkt, an dem sie zurückblicken müssen, bevor sie vorankommen können.
Wer die vorherigen Bände kennt, wird vertraute Stimmen hören.
Wer neu einsteigt, wird spüren, dass es eine Vergangenheit gibt, die in allem mitschwingt.
Und so hebt sich der Vorhang erneut – leise, aber entschlossen.
Die Geschichte geht weiter.
Auch meine.
PROLOG – DERWEIßE SCHAL
Es war nur ein Tango. Ein Augenblick im Schein der Lampen, ein Flügelschlag der Musik – und doch blieb er. Zwei Tänzer, verbunden durch einen weißen Schal, der sich wie Atem zwischen ihnen spannte. So endete alles – und so begann es wieder.
Achtzig Jahre sind vergangen. Die Welt hat sich verändert, die Städte, die Menschen. Doch manche Erinnerungen überdauern die Zeit – nicht im Kopf,
sondern in der Seele.
Jons ist zurück – diesmal als Robert. Er hatte es sich geschworen, dort, wo kein Name mehr gilt, im weißen Nebel zwischen den Leben: Ich will gutmachen, was ich einst nicht konnte. Er wählte seine Eltern mit Bedacht: Martha, die bei den Heilemanns ins Leben fand, nachdem ihre Eltern im Bombenhagel starben, und Hermann, den Freund aus Forte dei Marmi, der ihn einst gerettet hatte. Sie gaben ihm Boden und Licht – damit er diesmal nicht fällt.
Doch manche Schatten sind geduldiger als die Zeit. In Träumen, in Blicken, in der Musik tauchen sie wieder auf – die Augen, stahlblau und unbegreiflich. Nur eine Erinnerung, sagt er sich. Und doch weiß etwas in ihm: Der Tanz ist noch nicht zu Ende.
In manchen Nächten sieht er ihn wieder – den Saal, das Licht, die Drehung. Zwei Gestalten, die sich halten, eng, fast zu eng. Dann: ein Riss, ein Sturz, Stille. Die Musik bricht ab. Der andere liegt am Boden, reglos, und der weiße Schal sinkt langsam über ihn.
Robert schreckt hoch, der Schweiß brennt auf der Haut. Nur ein Traum, sagt er sich – und spürt doch, dass etwas wahr ist daran. Ein dumpfer Schmerz zieht durch ihn, wie ein fernes Echo aus einer Zeit, die sich wiederholt.
Er ahnt nicht, dass der Traum längst begonnen hat.
I. TEIL – SCHIC KSALSSCHLÄGE1. Kapitel – Der Morgen,
an dem alles anders wurde
Gegen fünf Uhr, an einem viel zu frühen Morgen, klingelte mein Telefon. Draußen war es noch dunkel, dieses tiefe Schwarz, in dem die Zeit stillzustehen scheint. Ich erkannte die Nummer sofort: das Krankenhaus, in dem Christoph seit einigen Tagen lag, wegen dieser rätselhaften Entzündung im Bein, die keiner erklären konnte.
Ich nahm ab, noch bevor ich richtig saß. Die Stimme am anderen Ende klang ruhig, geübt, beinahe vorsichtig. „Herr Krüger?“ fragte sie und für einen kurzen Moment brauchte ich, um zu begreifen, dass sie mich meinte, seit ich bei unserer Hochzeit Christophs Namen angenommen hatte. „Ihr Mann ist heute früh verstorben.“ Mehr nicht. Dann die Erklärung: Lungenembolie, Reanimation erfolglos. Gestern hatte Christoph noch gelächelt, hatte Louis die Hand gedrückt. Jetzt war er tot.
Ich legte das Telefon vorsichtig auf den Tisch, als wäre es etwas Zerbrechliches. Mein Körper fühlte sich fremd an, weich und schwer zugleich. Erst nach einer Weile kehrte ein Gedanke zurück, der mich wieder in Bewegung brachte: Louis.
Ich rief Schorschi an. Er war bereits wach, irgendwo unten im Schuppen. Wenige Minuten später stand er in der Tür, barfuß, verschlafen, im Schlafanzug. Für einen Moment musste ich lächeln, ein leises, erschöpftes Lächeln, das gleich wieder verschwand. Er setzte sich zu mir, sagte nichts. Es war genug, dass er da war.
Als der Wecker klingelte, begann der Teil des Tages, der weitergehen musste. Louis würde aufstehen, frühstücken, zur Schule fahren. Egal, was bei mir zusammenfiel. Schorschi schmierte Brote, stellte Tassen hin, räumte in seiner stillen Art auf. Dann ging er, so leise, als wolle er die Stille nicht verletzen.
Auf der Fahrt zur Schule brachte ich kein Wort heraus. Louis ist sieben, hellwach, mit einer Empfindsamkeit, die manchmal größer wirkt als die Welt um ihn. Beim Frühstück hatte ich gelacht, gespielt, als sei alles wie immer. Er hatte es geglaubt. Vor der Schule sprang er aus dem Auto, winkte, rannte davon. Ich lächelte, und in mir war nur Leere.
Danach schrieb ich Nachrichten: Familie, Freunde, Christophs Eltern. Jeder reagierte anders. Manche weinten, andere schrieben nur ein „Nein“ zurück. In diesem Moment hatte ich mehr Angst um sie als um mich.
Gegen elf fuhr ich ins Krankenhaus, um Christophs Sachen abzuholen. Die Gänge waren gedämpft, als säßen die Wände selbst in Trauer. Eine Schwester übergab mir drei Taschen: Pullover, Jogginghose, Poloshirts. Alles roch noch nach ihm. Obenauf lag das Bounty, unberührt. Ich nahm es an mich, wie einen Rest von gestern.
Dann rief ich Norbert vom Bestattungsinstitut an. Die Stimme des Alltags, der auch durch solche Tage hindurchgeht. „Um dreizehn Uhr wäre gut“, sagte er. Dafür brauchte er Unterlagen, die natürlich irgendwo lagen und nicht dort, wo sie sollten. Ich suchte Schubladen durch, fand nichts, bis plötzlich – unter einem einzigen Blatt – alles da war. Als hätte jemand es für mich hingelegt.
Da klingelte mein Handy. Christophs Name stand auf dem Display. Sein eigenes Telefon lag still auf dem Tisch, ohne verpasste Anrufe. Ich nahm ab. Nichts. Nur die Stille einer toten Leitung. Wenige Minuten später riefen Christophs Eltern an. Auch sie hatten einen Anruf bekommen. Vielleicht Zufall. Vielleicht etwas anderes. Es spielte keine Rolle. Man hält sich fest an allem, was nicht schmerzt.
Am Nachmittag saß ich Norbert gegenüber. Er sah aus wie immer, gepflegt, ruhig, mit seinem perfekten Bestatterlächeln. Ich wusste, was ich wollte: eine dunkelblaue Urne mit der Aufschrift Glaube – Liebe – Hoffnung. Ich brachte einen Lieblingspullover und eine Hose von Christoph mit. Sie sollten bei ihm sein. Die Trauerfeier schlicht, nur zwei Lieder: Careless Whisper und Jesus to a Child.
Als ich das Institut verließ, fühlte ich mich leer, aber merkwürdig geordnet. Man funktioniert an solchen Tagen wie jemand, der Schritte zählt, weil er nicht denken kann.
Am Abend sprach ich mit Christoph, als säße er neben mir. Goldi lag auf dem Bett, den Kopf schief, als verstünde sie, dass ihr zweiter Mensch nicht zurückkehren würde. Sie atmete flach, fast angespannt. Ich erzählte Christoph von der Urne, den Liedern, den Entscheidungen, die man trifft, wenn man keine Entscheidungen treffen will.
Später schaltete ich das Licht ein und packte seine Taschen aus. Alles sauber gefaltet. Doch etwas fehlte: das Kopfkissen. Der goldene Ohrring, den ich ihm zur Hochzeit geschenkt hatte. Auch sein Portemonnaie war leerer, als es hätte sein dürfen. Ich dachte kurz daran, etwas zu sagen, aber die Kraft dazu war nicht da.
Ich trat ans Fenster. Der Garten lag dunkel vor mir. Der Apfelbaum bewegte sich leicht im Wind. Ich sagte leise: „Wer diesen Ohrring genommen hat, wird ihn tragen müssen – nicht an der Hand, sondern im Gewissen.“ Es war kein Fluch. Nur ein Satz, der in die Dunkelheit fiel.
Ich blieb lange stehen. Der Wind ließ nach. Der Himmel wurde klarer. Und aus der Ferne klang Musik, ein paar Takte eines Tangos, kaum hörbar, wie aus einer Erinnerung. Ich schloss die Augen. Und zum ersten Mal seit diesem Morgen verstand ich, dass nichts wirklich endet.
Es verändert nur die Form, in der es bleibt.
2. Kapitel – Der nächste Tag
Die Nacht war schwierig. Die Tabletten halfen kaum. Ich schlief nicht richtig, fiel nur in kurze, flache Abschnitte, die eher wie Aussetzer wirkten als wie Ruhe. Immer wieder wachte ich auf, mit dem Gefühl, keine einzige Minute wirklich gelegen zu haben.
Am späten Vormittag rief ich schließlich Dr. Eichinger an. Ich wollte ihm nur sagen, dass ich vor Erschöpfung kaum stehen konnte, doch schon im ersten Satz brach mir die Stimme weg. Er hörte zu, ganz still, so wie er es immer tat, wenn etwas nicht einfach war. Dann fragte er vorsichtig: „Robert… was ist passiert? Sie klingen anders.“
Ich sagte ihm, dass Christoph gestorben war.
Am anderen Ende wurde es vollkommen still. Kein rasches Atmen, kein hektisches Räuspern. Nur Stille, wie ein Raum, der erst begreifen muss, was er gerade gehört hat.
Er holte leise Luft.
„Mein Gott“, sagte er. „Nein… das kann nicht sein.“ Seine Stimme schwankte, fing sich wieder, aber nicht aus professioneller Distanz – eher, weil er versuchte, selbst standzuhalten. „Eine Embolie? Robert… wie geht es Ihnen?“
Ich konnte nichts sagen. Ich glaube, er hörte es.
„Hören Sie mir zu“, sagte er schließlich. „Heute entscheiden Sie gar nichts. Wirklich nichts. Heute Abend nehmen Sie die doppelte Dosis, sonst bricht Ihr Körper weg. Und wenn irgendetwas ist – egal was –, rufen Sie mich sofort an. Versprechen Sie mir das.“
Es war nicht der Arzt, der sprach.
Es war ein Mensch, der entsetzt innehielt, weil das Leben sich nicht an Gerechtigkeit hält.
Am frühen Nachmittag sitze ich jetzt nach einem kargen Frühstück am Schreibtisch und versuche, Christophs Post zu sortieren. Einige Rechnungen, ein Terminbrief, ein ungeöffneter Umschlag. Seine Hausschuhe stehen unter dem Tisch. Ich schlüpfe hinein. Ein lächerlich kleiner Trost, aber er tut gut.
Ich brauche Kaffee. Mit zitternden Händen befülle ich den Filter, gieße Wasser ein. Zum Glück ist Louis noch nicht hier. Die Eltern seines Freundes bringen ihn erst später. Ich bin dankbar, dass ich den Vormittag allein überstehen darf.
Am Nachmittag kommt Schorschi vorbei. Wir sitzen in der Küche, reden wenig. Seine Anwesenheit reicht. Er hilft mir, Christophs Sachen aus dem Krankenhaus zu sortieren. Ich öffne das Brillenetui – und sehe einen Fünfziger und den goldenen Ohrring darin. Mir fällt ein Stein vom Herzen. Ich hätte sonst jemanden beschuldigt, der unschuldig ist. In letzter Zeit passieren mir solche Fehlgedanken zu schnell.
Als Louis später heimkommt, merke ich, dass ich keine Kraft habe, ihm alles zu erzählen. Schorschi legt mir kurz die Hand auf die Schulter. „Nicht heute“, sagt er. „Morgen ist Sonntag. Dann hast du Ruhe.“ Ich nicke.
Wir essen Spaghetti mit Tomatensoße und schauen Fußball. Louis schmiegt sich an mich, als wolle er mich bewachen. Ich dachte nie, dass Trost so klein und so warm sein kann.
Später bringe ich ihn ins Bett. Er schläft sofort ein. Vielleicht war der Tag zu lang. Oder ich bin zu still.
*****
Ich schlafe unruhig. Irgendwann muss ich geschrien haben, denn Louis steht plötzlich neben mir. Er kriecht unter die Decke, Goldi rückt beiseite, und wir liegen zu dritt da. Es wird langsam ruhig.
Als der Morgen graut, wird es heller im Zimmer. Es ist kurz nach sechs. Ich stehe auf, wie jemand, der durch Nebel geht. Eine Katzenwäsche – mehr schaffe ich nicht. Duschen würde bedeuten, sich zu spüren, und dafür ist es zu früh.
Ich greife nach Christophs Tasse, schenke Kaffee ein. Am Terrassenfenster bleibe ich stehen. Der See liegt still, als hätte er beschlossen, keine Wellen zu schlagen, um mich nicht zu stören.
Ich denke an all die Menschen, die ich verloren habe. Harald, der einfach zu früh starb. Dieter, mein Zwillingsbruder, der verschwunden ist, ohne auch nur einmal zurückzuschauen.
Ein Gedanke schleicht sich ein: Nehme ich den Menschen, die ich liebe, das Glück? Oder nimmt das Leben mir die Menschen?
Selbst meine Kinder sind tot. Nur Louis ist mir geblieben.
Einen Moment später bin ich wütend. Auf Christoph. Weil er einfach geht. Weil ich nun allein bin. Ich weiß, es ist ungerecht, aber die Wut ist da und brennt.
Louis kommt schlaftrunken ins Zimmer, sein Kuschelkissen im Arm. „Wo ist Chrissipapa?“, fragt er. „Noch im Krankenhaus?“
Ich spüre ein Schmerz in der linken Brusthälfte.
Ich setze mich, nehme ihn auf den Schoß.
„Komm her, mein Junge. Wir müssen heute stark sein.“
Er kuschelt sich an mich. Ich ringe um Worte. Dann sage ich leise: „Chrissipapa ist gestern gestorben. Sein Herz hat aufgehört zu schlagen. Aber er passt jetzt auf uns auf.“
Louis nickt, ernst, viel zu ernst für seine sieben Jahre. „Das ist schlimm, Papa“, sagt er. Zum ersten Mal ohne „Opi“. „Aber wenn er uns jetzt von oben hilft, ist das gut.“
Ich kann nicht sprechen, ohne zu weinen. Er legt seine kleine Hand auf meine Wange.
„Kann er uns besuchen?“, fragt er.
„Ja“, sage ich. „Nur wir werden ihn nicht sehen. Aber wenn du an ihn denkst, merkt er das.“
„Ich denke jeden Tag an ihn“, sagt er. „Damit er uns nicht vergisst.“
*****
Später, als Louis spielt und ich allein bin, sehe ich ihn wieder: den Mann mit den stahlblauen Augen. Er sitzt hinter dem Tisch, ein wenig durchsichtig, aber deutlich zu erkennen.
„Ich bleibe, solange du mich brauchst“, höre ich flüstern – oder denke es. Ich weiß es nicht.
Der Sonntag vergeht leise. Louis spielt im Garten. Freunde schreiben Beileidsnachrichten über WhatsApp und Facebook. Keine Anrufe. Keine Karten. Vielleicht sind die Menschen überfordert. Vielleicht haben sie Angst, etwas Falsches zu sagen.
Schorschi hält Abstand. Er trauert auf seine Weise. Christoph war ihm näher, als ich wusste. Wir sagen kaum etwas. Manchmal ist Schweigen die ehrlichste Form der Nähe.
Louis stochert in den Pommes herum. „Bekomme ich einen neuen Papi?“, fragt er plötzlich.
Ich zucke zusammen. „Nein. Chrissi kann niemand ersetzen.“
„Ich will nur, dass du nicht so traurig bist. Vielleicht ein Freund?“
Ich ziehe ihn an mich. „Ich werde lange traurig sein. Aber wir schaffen das.“
Er nickt. „Chrissipapa und der Mann mit den blauen Augen helfen dir.“
Ich sehe ihn an. „Welcher Mann?“
„Er saß da.“ Louis zeigt auf den Stuhl. „Er heißt Ludwig. Er kennt dich. Früher hießt du Johannes.“
Ich fühle, wie mir kalt wird.
„Ich war immer Robert“, sage ich.
„Nein“, sagt er sanft. „Vor deiner Geburt warst du Johannes.“
Er geht in sein Zimmer. Ich bleibe zurück. Der Name Ludwig klingt wie ein alter Ton, den ich nicht mehr zuordnen kann, aber trotzdem kenne.
*****
Am späten Nachmittag sehen wir einen Film: Schneewittchen. Louis lehnt an mir. Während die Zwerge singen, denke ich:
Wenn es doch einen Kuss gäbe, der die Toten zurückholt.
Als ich ihn später in sein Zimmer bringe, schläft er schnell ein. In der Schule fragen manche Kinder, ob ich sein Opa bin. Es ist richtig – und doch tut es weh.
Später sitze ich vor dem Fernseher. Oli P. singt Kleine Taschenlampe brenn’. Die Worte treffen mich unerwartet tief.
Ich bastle eine kleine Papierlaterne, stecke ein Teelicht hinein und gehe zum Steg. Es ist dunkel, der Mond hinter Wolken. Der Wind bewegt das Wasser. Ich knie mich hin, lasse die Laterne los. Sie treibt langsam hinaus.
Der Wind streicht mir durchs Haar – genau so, wie Christoph es tat.
Ich drehe mich um. Niemand da.
Als ich wieder hinausblicke, ist die Laterne verschwunden.
Ich denke an Christoph. Und daran, dass vielleicht etwas von ihm hiergeblieben ist, im Wasser, im Wind, im Licht.
Morgen bringe ich eine kleine Lampe am Steg an. Nur, damit das Licht bleibt.
3. Kapitel – Der Geburtstag
Heute wäre Chrissis vierundvierzigster Geburtstag.
Ich liege noch im Bett, als die Rollläden hochfahren, und zucke zusammen. Für einen Herzschlag glaube ich, seine Hand an meiner zu spüren – warm, vertraut. Dann merke ich, dass es Goldi ist, die meine Finger ableckt. Ich lasse sie gewähren.
Die Träume hängen noch wie Nebel in mir: eine dunkle Straße, ein fernes Licht, schwerer Schnee unter meinen Füßen. Ich hasse Schnee. Neben mir schnaubt ein Pferd, irgendwo fallen Schüsse, jeder Knall fährt mir in die Glieder. Ich will mich aufrichten, doch meine Beine fühlen sich an wie aus Blei.
Aus dem Bad höre ich Louis. Offenbar ist er allein aufgestanden. Ich zwinge mich hoch, richte mich mühsam auf. Schulbrote schmieren, Frühstück richten – Mechanik statt Bewusstsein. Auch die Fahrt zur Schule vergeht wie durch Watte. Ich nehme mir vor, wachsam zu sein. Ich möchte nicht, dass meine Erschöpfung zu einem Unfall führt.
Am Nachmittag fahren wir zu meinen Schwiegereltern zum Kaffee. Gemeinsam an Christoph denken – ich weiß nicht, ob ich das verkrafte. Sie sind eigen, beide, aber sie lieben Louis innig, und Louis liebt sie.
Christophs Mutter hat den Tisch liebevoll gedeckt. Ein Platz ist für ihn bereitet: sein Foto im silbernen Rahmen, eine brennende Kerze auf dem Teller, davor eine gelbe Rose – seine Lieblingsblume. Die Tränen kommen sofort. Sie zieht mich in die Arme, und ich versuche, ruhig zu bleiben, damit Louis nicht erschrickt.
Christophs Vater bemerkt die Situation und lockt Louis zu seiner Modelleisenbahn. Spur N, liebevoll aufgebaut. Ich staune, wie wenig ich eigentlich über diese Familie weiß, die doch meine geworden war.
Zuhause sinke ich in den Sessel.
Louis wollte bei Grandpa bleiben – die Eisenbahn hat ihn völlig vereinnahmt, und Christophs Eltern wirken ein wenig erleichtert, wieder etwas Leben im Haus zu haben.
Ich gehe mit Goldi eine Runde. Sie liest die Bäume wie andere Menschen Zeitungen.
Dann öffne ich die E-Mails.
Der vorläufige Krankenhausbericht ist eingetroffen: eine unerkannte Infektion, daraus ein Blutgerinnsel. Christoph hatte noch geklingelt, doch als die Schwester kam, war er bereits bewusstlos.
Wiederbelebung erfolglos. Man werde alles prüfen und sich melden.
Ein paar nüchterne Sätze – und in mir brennt es.
Ich greife nach dem Rotweinglas und schleudere es gegen das Büfett. Das Klirren zerschneidet die Stille, fällt dann in sie zurück.
Ich atme hart. Die Wut ist neu, ungewohnt, fast erschreckend.
Ein Gedanke steigt auf: Dieter. Wie oft hat er mich beruhigt. Aber Dieter ist seit vier Jahren tot – erfroren vor der Rehaklinik, die ihm einen Neuanfang geben sollte.
Ich brauche Luft. Bewegung. Menschen.
Nicht, um zu reden – nur, um nicht allein zu sein. Goldi steht im Türrahmen, Ohren angelegt. Ich gehe zu ihr, streiche ihr sanft über den Kopf. „Alles gut, Lady. Ich bin gleich zurück. Pass auf das Haus auf.“
Eine halbe Stunde später stehe ich vor dem TwoFlowers.
Noch bevor ich die Tür öffne, höre ich den dumpfen Bass. Drinnen ist es warm, farbig, voller Stimmen. Der Geruch nach Parfum, Lederjacken und verschütteten Drinks hängt in der Luft. Die Welt dreht sich weiter, auch wenn meine stillsteht – ein Gedanke, der sticht.
Torsten sieht mich sofort.
Er poliert gerade Gläser, hebt den Kopf – und strahlt, wie er es immer tut, wenn er jemanden mag.
„Heeeeey, Großer!“, ruft er, viel zu laut, viel zu fröhlich. „Na, wo ist dein Kerl? Kommt er später? Oder raucht er draußen heimlich, der Schlingel?“
Er kommt um die Theke, hebt die Arme für eine Umarmung – und bleibt stehen.
Er sieht mein Gesicht.
Seine Miene zerbricht in einer Sekunde.
Das Lächeln fällt wie eine Maske.
„Robert…?“, fragt er, plötzlich ganz leise. „Was ist passiert?“
Ich brauche einen Atemzug, dann sage ich:
„Chrissi ist tot. Vor drei Tagen. Im Krankenhaus.“
Torsten stolpert einen Schritt zurück.
„Was? Nein… nein. Nicht Chrissi. Nicht unser Chrissi.“
Er schüttelt den Kopf, verzweifelt, versucht, die Worte nicht in sich hineinlassen zu müssen.
„Sag bitte, dass das ein schlechter Witz ist“, flüstert er. „Bitte sag’s.“
Ich schüttle den Kopf.
Er presst die Lippen zusammen, ringt um Haltung, findet sie nicht.
„Aber… ihr wart doch… er hat doch… er hat doch hier vor ein paar Wochen noch… er war glücklich.“
Er bricht ab, atmet tief durch.
Dann richtet er sich auf, die Stimme nun klar, aber brüchig:
„Musik aus!“, ruft er. „Sofort!“
Der Bass verstummt.
Gespräche verebben.
Alle drehen sich um.
Torsten stellt sich neben mich, legt mir eine Hand auf den Rücken.
„Leute… hört mal zu.“
Er schluckt.
„Unser Chrissi… der Chrissi, den wir hier alle kannten… er ist tot. Vor drei Tagen. Robert hat’s eben gesagt.“
Ein Aufraunen geht durch den Raum. Jemand setzt sich hart auf einen Hocker. Eine Frau hält sich die Hand vor den Mund. Torsten atmet durch und spricht weiter: „Chrissi war einer von uns. Einer, der zuhören konnte. Einer, der gelacht hat, wenn keiner wusste, wie’s weitergeht. Einer, der Robert geliebt hat wie nichts auf der Welt. Und er war der Bandleader der ThreeGuys – die hier so oft für uns ’ne Mucke hingelegt haben, dass die Wände gewackelt haben.“
Er hebt sein Glas. „Wer ihn kannte – hebt euer Glas. Für Chrissi.“ Nach einem Moment heben die ersten ihre Gläser.
Dann der ganze Raum.
Ein stilles, gemeinsames Innehalten.
Torsten sieht mich an, seine Augen brennen.
„Robert… du bist hier nicht allein. Wirklich nicht. Wenn du irgendwas brauchst – sag’s. Wir kriegen das hin. Zusammen.“
Er stellt mir ein Glas hin.
Kein Alkohol.
„Du sollst heute bei dir bleiben. Das hätte Chrissi gut gefunden.“
Ich nicke, schlucke, ringe um Fassung.
In diesem Moment, als alle Gläser noch erhoben sind, drehe ich den Kopf – und sehe ihn.
Den Mann mit den stahlblauen Augen.
Er sitzt in einer Nische, regt sich nicht, sieht mich einfach an – aufmerksam, fast vertraut.
Seine Kleidung wirkt wie aus einem alten Foto: anthrazitfarbene, hellgrau gestreifte Hose, schwarzer Cutaway, silbergraue Weste mit Taschenuhr, ein Spazierstock mit silbernem Schlangenkopf, das blonde Haar zu einem Mozartzopf gebunden.
Ich blinzle.
Torsten bemerkt meinen Blick.
„Wen suchst du?“, fragt er.
„Den da hinten“, sage ich. „Den Mann mit dem altmodischen Anzug.“
Torsten dreht sich um, schaut lange, schüttelt dann den Kopf.
„Da sitzt keiner.“
„Doch“, flüstere ich. „Ich sehe ihn.“
Ich gehe durch die Menge, langsam, fast wie im Traum.
Das Kribbeln auf meiner Haut ist wieder da – dieses leise, unerklärliche Stromgefühl, das ich seit dem Koma kenne.
Ich komme näher.
Die Luft scheint dünner zu werden.
Sein Blick trifft mich, klar und ruhig.
Dann höre ich seine Stimme, nah wie ein Gedanke:
„Ihr werdet mich an meinen stahlblauen Augen erkennen. Ihr werdet mich sehen, aber euch nicht erinnern – euer Leben soll sich so entfalten, wie ihr es begonnen habt.“
„Wer bist du?“, flüstere ich. „Und was habe ich begonnen?“
Ich blinzle und der Stuhl ist leer.
Ein Ziehen geht durch meinen Brustkorb. Nicht Angst.
Erinnerung, die ich nicht greifen kann.
Tom und Frank treten hinter mir auf. Sie legen mir die Hände auf die Schultern.
„Drei Tage, Robert“, sagt Frank. „Wir hätten da sein können.“
„Ich… konnte nicht reden“, sage ich.
Tom nickt. „Dann reden wir jetzt. Oder auch nicht. Aber wir sind da.“
Sie fragen, wie sie bei der Beisetzung helfen können.
Ich sage: „Careless Whisper. Dann Jesus to a Child. Ich lese einen Text. Vielleicht könnt ihr ein paar Worte sagen.“
Sie nicken sofort.
Der Abend bleibt schwer.
Kein Lächeln, kein Trost reicht.
Schließlich verabschiede ich mich. Sie lassen mich ziehen.
Zuhause stelle ich eine Kerze ins Fenster – für Chrissi.
Goldi läuft ins Schlafzimmer und rollt sich auf seiner Seite ein.
Ich bleibe in der Tür stehen und lausche.
Das Haus ist still.
Dann höre ich es – ein leises Ticken, regelmäßig, fein, wie das einer Taschenuhr.
Ein Geräusch aus einer anderen Zeit.
Dann verstummt es wieder.
4. Kapitel – Zwischen den Zeiten
Die Tage vergehen, und ich funktioniere.
Morgens bringe ich Louis zur Schule, mittags hole ich ihn ab. Dazwischen die Runde mit Goldi, ein paar Telefonate, ein Teller Suppe, irgendwie. Christophs Eltern nehmen mir viel ab, kümmern sich rührend um den Jungen. Ich aber ziehe mich zurück. Meine Trauer erklärt sich nicht, und sie fällt auch auf Louis. Ich lasse ihn in diesen Tagen nicht richtig an mich heran. Ein Fehler, den ich später bereuen werde; jetzt geht es nicht anders.
Ich habe zu viel verloren.
Zuerst mich selbst. Als ich mich wiederfand, starb Harald. Dann sein Sohn. Die Tante. Später Dieter, mein Zwillingsbruder – erfroren, hundert Meter vor der Klinik, in die er wollte, um endlich trocken zu werden. Schließlich meine eigenen Kinder. Und meine Enkeltochter Isabella, die ich nur ein paar Stunden kannte. Das Flugzeugunglück in Madrid. Danach hoffte ich auf Ruhe, nach fast vier Jahren Ehe. Stattdessen der nächste Schlag.
Ich frage mich, was davon meine Schuld ist – und wie viel noch kommen soll.
Die Albträume bleiben.
Chrissi konnte damit umgehen. Louis nicht. Auch er träumt schlimm, und ich kann ihm nicht helfen. Chrissi konnte es – mit seinen Geschichten, die er später aufschrieb, weil Louis sie „noch mal“ hören wollte. Irgendwann werde ich sie zusammensuchen.
Ich denke viel an Madrid, an die chilenische Familie, die mir damals zu verstehen gab, dass ihnen an dem Jungen wenig lag. War der Vater je erwähnt worden? „Ein One-Night-Stand“, hieß es. Aber irgendwer ist Vater.
Ich werde ihn finden müssen – ihm sagen, dass er Verantwortung trägt, vor allem, wenn ich einmal nicht mehr bin. Ich bin fast siebzig. Wie lange kann ich Louis noch das Zuhause sein, das er braucht?
Die nächsten Tage fülle ich mit Terminen. Bestattungsinstitut. Gespräche. Caterer. Fingerfood für den Tag der Beisetzung.
Fünfundzwanzig Trauerkarten – und ich weiß nicht einmal sicher, an wen.
Ich taste mich durch alte Unterlagen, finde Chrissis Notizbuch. Unter A: Tante Anke. Da fällt mir siedend heiß ein, dass ich sie noch gar nicht angerufen habe. Ich will zum Telefon greifen – da klingelt es an der Haustür, Goldi bellt, und Anke steht da, als hätte Chrissi sie selbst gerufen.
„Was machst du denn hier?“ frage ich, und weiß selbst, wie unnötig die Frage ist.
Sie tritt ein, nimmt mich fest in den Arm, und plötzlich wird es etwas leichter. Sie ist sechs Jahre älter als ich, war Christophs Halt – und ist es jetzt meiner.
„Ach, mein Junge“, sagt sie. „Der liebe Christoph … so jung. Gesche hat mir schon alles erzählt, aber ich wollte es auch von dir hören. Verzeih, ich rede zu viel.“
Goldi springt an ihr hoch, wedelt, als wäre endlich Ordnung im Haus.
Ich atme durch.
Gesche. Ich hatte den Vornamen seiner Mutter fast vergessen. Für uns waren sie Mutter und Vater.
Anke und Gesche stammen von der Nordseeküste, sind nach dem frühen Tod der Eltern nach Berlin-Pankow zu Pflegeeltern. 1944 war die Großmutter geflohen; die Mutter war damals hochschwanger. Viel mehr weiß ich nicht. Keine Fotos.
Ein paar Erzählungen. Die Familienbücher gingen im Krieg verloren.
Chrissi erzählte manchmal, seine Urgroßmutter sei eine Baronin gewesen – Besitz gab es keinen mehr. Alles im Krieg zerstört. Sie sei kurz nach dem Krieg im Schnee gestürzt und erfroren.
Wie sich Geschichten wiederholen.
Dieses Ostpreußen verfolgt mich.
Ein verlorenes Land, dessen Schatten mir in den Nächten nachgehen. Vielleicht bekomme ich jetzt Antworten – über Chrissis Familie, über unsere.
Ich sehe auf die Uhr.
Gleich kommt Louis aus dem Hort. Wird er sich über den Besuch freuen?
Ein paar Tage nach Chrissis Tod hat er aufgehört zu sprechen.
Seine Lehrerin rief vorgestern an: Louis bräuchte psychologische Betreuung. Er nehme aufmerksam am Unterricht teil, beantworte aber nur mit Nicken oder Kopfschütteln. Stattdessen reiche er ihr Zettel mit kurzen Sätzen. Hausaufgaben: tadellos. Die fehlende Sprache: ein Hindernis.
Ich biss mir auf die Zunge.
Chrissi ist noch nicht einmal beigesetzt, und alle sind im Schock – warum sofort ein Psychologe? Wenn Louis sich andere Wege sucht, dann ist das immerhin ein Weg. Das sagte ich ihr.
Ich fragte, wie sie mit einem Kind umgehen würde, das von Geburt an stumm ist.
„Dann wäre es in einer Integrationsklasse“, meinte sie knapp. „Haben wir hier nicht.“
Ich bin diese Sätze leid.
Ich bat um Geduld.