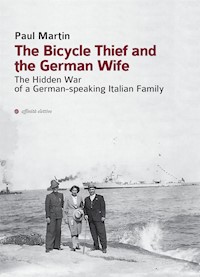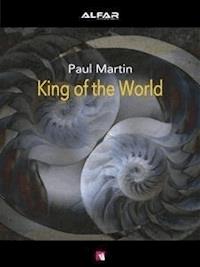Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Renda
- Sprache: Deutsch
Eine Geschichte wird erzählt und doch ist es Geschichte, an Hand derer sich die Handlung entwickelt. Berichtet wird in einer braunen Zeit über den Niedergang einer noch aufrechten ostpreußischen Familie auf der kurischen Nehrung. Der jüngste Sohn Johannes hat homosexuelle Neigungen, welche die Familie toleriert aber trotzdem besorgt ist. Drei Männern wird Jons, der nicht weiß, was er will, in der Zeit bis 1944 begegnen. Einem Fischerjungen, der nicht weiß, wer er ist. Einem Grafen, der nicht weiß was er machen soll und Einem Chauffeur, der trotz des Wissens, was er machte, noch lebt. Die Versuche von Johannes sich einem von den dreien zu nähern sind halbherzig und wankelmütig. Es entwickelt sich ein gefährliches Spiel für alle vier und nach und nach müssen sie den Preis dafür bezahlen, denn es ist Krieg und Krieg nimmt nun mal keine Rücksicht auf Gefühle. Voellig neu bearbeitet mit zusaetzlichen Kapiteln und Illustrationen
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 379
Veröffentlichungsjahr: 2026
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hinweis:
Dieses Buch behandelt Themen wie politische Verfolgung, seelische Belastung, gesellschaftliche Ausgrenzung und Gewalt im historischen Kontext der 1930er- und 1940er-Jahre.
Die Darstellung erfolgt in literarisch zurückhaltender Form, ohne explizite Szenen.
Empfohlen für Leserinnen und Leser ab 16 Jahren.
Inhaltsverzeichnis
Prolog
I. Teil – Unruhige Zeiten
1. Kapitel – Nach Hause
2. Kapitel – Zugestiegen
3. Kapitel – Kerzenschein
4. Kapitel – Ausritt am Morgen
5. Kapitel – Vorbereitungen
6. Kapitel – Am Pregel
7. Kapitel – Graf von Schöneck
8. Kapitel – In der Bibliothek
9. Kapitel – Studentische Zeiten
10. Kapitel – Weihnachten ’36
11. Kapitel – Pillkoppen
12. Kapitel – Georg
II. Teil – Sommerträume
1. Kapitel – Auf dem Petschberg
2. Kapitel – Toni
3. Kapitel – Liebe und Wehe
4. Kapitel – In der Rendantur
5. Kapitel – Erkenntnisse
6. Kapitel – Warten
7. Kapitel – Enttäuschungen
8. Kapitel – Erbarmung
9. Kapitel – Der 50. Geburtstag
10. Kapitel – Noch einmal Pillkoppen
11. Kapitel – Sturm über der See
12. Kapitel – Verlust und neue Zuversicht
III. Teil – Kriegszeiten
1. Kapitel – Ludwig
2. Kapitel – Ein Brief
3. Kapitel – Südwärts
4. Kapitel – Berliner Bilder
5. Kapitel - Auf der Nehrung
6. Kapitel – Nachrichten
7. Kapitel – Luftangriffe
8. Kapitel – Wiedersehen
9. Kapitel – Aufbruch
10. Kapitel – Renda
11. Kapitel – Königsberg
12. Kapitel – Die Hand
Teil IV – Ende und Anfang
1. Kapitel – Geschichten
2. Kapitel – Nach Westen
3. Kapitel – Winterwelt
4. Kapitel – Brookholt
5. Kapitel – Der Bericht
6. Kapitel – Das Schiff
7. Kapitel – Heimkehr
Epilog
Der Autor
Auswahl seiner Bücher
PROLOG
Seit dem Jahr 1933 hatte sich der Ton der Welt verändert.
Er war nicht lauter geworden – nur eindringlicher. Wie ein Marsch, der nie endete, und dessen Rhythmus selbst im Schlaf noch weiterklang.
Auf den Bahnhöfen wehten Fahnen, in den Schulen hingen Porträts, und auf den Dörfern Ostpreußens wurden die Glocken nicht mehr allein zu Gottesdienst und Ernte geläutet, sondern auch, wenn irgendwo ein „Führerwort“ verkündet wurde.
Die Menschen taten, was sie immer getan hatten: sie pflügten, sie nähten, sie hielten Hof.
Doch über den Feldern lag eine Schwere, die nicht von der Witterung kam. Selbst das Licht über den Weiten des Samlands, sonst klar und kühl, schien nun anders zu fallen – als hätte jemand die Sonne diszipliniert.
In Berlin bereitete man sich auf die Olympischen Spiele vor.
Ein Weltfest des Friedens, so hieß es in den Zeitungen, und überall wurden Fahnen gehisst, Tribünen errichtet, Reden geschrieben. Man sprach von Größe, von Ordnung, von Zukunft.
Aber wer einmal in den Augen jener gesehen hatte, die heimlich die Straßenseite wechselten, wenn sie Uniformen sahen, wusste, dass etwas nicht stimmte.
Manche erkannten es sofort, andere erst, als es zu spät war.
Und doch tanzte das Land.
Im Sommer wehten Walzerklänge aus den offenen Fenstern der Villen am Wannsee, in den Kurorten spielte man Tango, in Königsberg veranstaltete man Matineen im Stadtgarten. Die Menschen wollten glauben, dass man der Angst davon tanzen könne.
Auch auf den Gütern an der Küste Ostpreußens, dort, wo der Wind vom Haff her die Scheunen durchwehte, hielt das Leben den Atem an. Zwischen Moor und Meer, zwischen Rossitten und Kunzen, wuchs eine Generation heran, die nicht ahnte, wie rasch aus Begeisterung Pflicht, aus Pflicht Gehorsam und aus Gehorsam Schuld werden konnte.
In den Nächten über den Dünen flackerten manchmal Lichtsignale von Schiffen auf dem Haff.
Dann schwiegen selbst die Tiere, und nur der Wind erzählte – leise, wie einer, der zu viel gesehen hat.
Noch glaubten sie an den Sommer, an die Spiele, an die Zukunft.
Noch glaubten sie, dass der Tanz ewig dauern würde.
Aber unter den Wiesen begann es längst zu beben.
Und keiner wusste, wann der Vulkan ausbrechen würde.
I. TEIL – UNRUHIGE ZEITEN
1. Kapitel – Nach Hause
Die Dampflokomotive der Baureihe 01 fuhr schnaubend und dampfend in den Schlesischen Bahnhof ein. Diese Lokomotive wurde erst seit Beginn der Olympiade 36 für den D 1 durch den Korridor nach Ostpreußen eingesetzt und erzeugte Begeisterungsstürme bei den Reisenden auf dem Perron. Mit dem Einsatz dieser leistungsstarken Maschine wollte die Regierung dem Vorwurf begegnen, der Führer vernachlässige den Transitverkehr nach Königsberg.
Der Bahnsteig war inzwischen voll mit Reisenden sowie mit Besuchern, die Bahnsteigkarten erworben hatten, um ihre Gäste zu verabschieden. Großes Stimmengewirr erfüllte die Halle mit den gläsernen Tonnengewölben. Am Bahnsteig standen der neunzehnjährige Johannes von Ammen zusammen mit seiner Tante Mathilde von Gerstäcker, geborene zu Kunzen und Schwester seiner Mutter Gerlinde, sowie ein etwas heruntergekommener älterer Gepäckträger, der bereitwillig darauf wartete, die Gepäckstücke in die Erste Klasse zu verfrachten. Natürlich fuhren die von Ammens immer Erster Klasse – etwas anderes wäre unter ihrem Niveau und nicht schicklich gewesen.
Der Dampf der bremsenden, einfahrenden Lokomotive kroch über den Bahnsteig, und Tante Mathilde wich etwas zurück, damit ihr Rocksaum nicht beschmutzt würde. Johannes von Ammen, genannt Jons, liebte jedoch die Einfahrten der Lokomotiven und sog den Dampf in seine Lungen ein, als wären es die schönsten Düfte, die er je gerochen hatte. Er erkannte sofort die 2’C1-Achsfolge dieses riesigen Dampfrosses. Dampflokomotiven waren für ihn das Sinnbild der Freiheit, die Möglichkeit, überallhin zu gelangen – nicht nur mit dem Kurenkahn über das Haff oder mit der Kutsche von Rossitten, seiner Heimat, nach Königsberg.
Diese einfahrende Lokomotive und die dahinter gekuppelten Waggons des D 1-Schnellzuges waren der perfekte Abschluss bewegender Tage, in denen er im Olympiastadion auf dem Reichssportfeld ausgerechnet an dem Tag sitzen durfte, an dem Jesse Owens seine vierte Goldmedaille im 100-Meter-Lauf in fantastischen 10,2 Sekunden gewann. Für Jons war insgeheim klar: Hier zählte nicht schwarz oder weiß, sondern nur langsam oder schnell – und dieser schwarze Kerl aus Amerika war schnell, sehr schnell. Doch mit solchen Gedanken musste man in diesen Jahren vorsichtig sein, durfte sie nicht aussprechen und sollte sie tunlichst für sich behalten.
Jons war hochgewachsen und reichte fast an die 1,80 m heran. Er hoffte inständig noch auf einige Millimeter mehr, um seinen Vater zu überragen. Sein vier Jahre älterer Bruder Heribert war nur 1,78 m groß, was oft zu verbalen Rangeleien zwischen den beiden führte. Jons’ blondes Haar und die strahlend blauen Augen, die er als Einziger von seiner Mutter geerbt hatte, waren in jener Zeit ein großes Pfund und verhalfen ihm zu manchem Vorteil in einer von arischen und rassischen Vorurteilen geprägten Gesellschaft. Zwar war er nicht breitschultrig, eher schmal, aber durch seine Ausritte auf der Lieblingsstute Blinka vom heimischen Gehöft hatte er sich eine ansehnliche Muskulatur erarbeitet.
Leider hatten Jons und seine Tante als Anstandsdame nur für einen Tag Eintrittskarten für das neue Olympiastadion erhalten. Ansonsten verbrachte Jons viele Stunden in den eigens eingerichteten Fernsehstuben, um die Wettkämpfe dort verfolgen zu können. Das war etwas Neues, etwas Revolutionäres: Im Stadion kämpften die Athleten, und man sah es gleichzeitig in einem Zimmer.
Jons fieberte dem Tag entgegen, selbst solch einen Apparat besitzen zu dürfen, um am Leben in der Welt teilzunehmen. Er hatte sich erklären lassen, dass das Bild elektronisch zerlegt und mittels einer sogenannten Braun’schen Röhre wieder zusammengesetzt werde – und zwar mit sage und schreibe 375 Zeilen pro Bild, während es vor einem Jahr noch weniger als halb so viele gewesen waren.
Ein gewaltiger Fortschritt, für den natürlich das Deutsche Reich mit seinen Übertragungen dieser Spiele führend in der Welt war. Ohne den Führer wäre das nicht möglich gewesen, dachte Jons – und doch war ihm nicht wohl bei diesem Gedanken. Er wusste aber nicht, warum.
Nachdem der Gepäckträger die Koffer im Erste-Klasse-Abteil verstaut hatte, machten Tante Mathilde und Jons es sich bequem. Zuvor hatte Tantchen den armen Mann angemessen belohnt und ihm ein üppiges Trinkgeld gegeben.
„Nicht alle Menschen haben es so gut wie wir“, meinte sie mit einem entschuldigenden Achselzucken zu Jons. „Merke dir das, mein Junge – es kann von Nutzen sein.“
„Jawohl, Tante Mathilde“, antwortete Jons gehorsam und blickte hinaus auf den Bahnsteig, den man aus dem Waggonfenster in völlig anderer Perspektive wahrnahm.
Es war die erste längere Reise für Jons – ein Geschenk seiner Eltern zum erfolgreichen Abschluss der Oberprima und nach Beendigung der einjährigen Wehrpflicht. Er hatte Glück; erst ab dem 24. August 1936 sollte die Wehrpflicht auf zwei Jahre verlängert werden.
Sicher hatte er auf der Hinfahrt nach Berlin schon vieles gesehen, doch bei der Ankunft war er überwältigt gewesen von der Größe der Stadt und der Menschenmenge. Nun aber nahm er alles wacher und genauer wahr.
Seine Tante, Mathilde von Gerstäcker, war vierzig Jahre alt und doch schon Witwe – dem großen Krieg geschuldet. Es hielt sie jedoch nicht davon ab, weder einsam noch klagend zu leben. Die wilden Zwanzigerjahre waren zwar mit dem Fackelzug von 1933 jäh beendet worden, doch Tantchen benahm sich keineswegs wie eine graue Maus.
Schließlich stellte sie jemanden dar: arisch rein, von adligem Geblüt, fühlte sie sich einer Gesellschaftsschicht zugehörig, in der man etwas darzustellen hatte. Heute trug sie ein gewagtes Hosenkleid mit Kragen und vorwitziger Brusttasche aus orangefarbenem, feingewebtem Baumwollstoff, dazu einen passenden Gürtel mit großer Schnalle, der ihre tadellose Figur betonte. Ein kurzes gestricktes Sport Jäckchen in Weiß, mit eingewebten Karos, lag über ihren Schultern. Ihre Schneiderin hatte betont, es handle sich um ein Modell nach Elsa Schiaparelli, der angesagtesten Modezeichnerin aus Paris. Sie rauchte selbstverständlich Zigaretten mit Spitze; weiße Handschuhe schützten sie vor Staub, und ein modischer Hut, ebenfalls orange mit heller Schleife, hielt ihr blondes Haar in Form und vollendete ihre auffallende Erscheinung.
Jons durfte nach seinem Wehrdienst endlich die Uniform ablegen und trug nun seinen neuen Freizeitanzug.
So saßen die beiden in dem Abteil, das Tante Mathilde eigens für die Rückfahrt reserviert hatte. Es gab nur drei solcher Abteile im Zug. Alle anderen Wagen waren Sitzwagen, zwar gepolstert und mit Tischchen, doch Tantchen bevorzugte es, nicht mit Fremden über Wetter oder Zeitungsschlagzeilen plaudern zu müssen. Dem Zug angegliedert waren an diesem Tag Kurswagen nach Danzig, Insterburg und Riga.
Jons war aufgeregt. Die Erlebnisse während der Olympiade hallten nach, und nun stand die Rückfahrt nach Hause bevor. Was hatte er nicht alles zu berichten! Zudem würde er Anfang Oktober das erste Semester seines Landwirtschaftsstudiums beginnen – ein aufregendes Jahr lag vor ihm. Sein Vater hatte ihm nach langen Diskussionen erlaubt, sich zum Wintersemester 36/37 zu immatrikulieren. Aufgrund guter Beziehungen zum Kurator der Universität, Herrn Friedrich Hoffmann, war dies kein Problem gewesen. Hoffmann konnte die Familie auch dahingehend beruhigen, dass die von ihm sogenannte radikale NS-Clique sich noch einer erdrückenden Mehrheit wissenschaftlich orientierter Akademiker gegenübersehe.
Friedrich Hoffmann wusste, dass er sich gegenüber seinem Freund Heinrich von Ammen dieser Worte bedienen durfte. Von Ammen hatte es stets verstanden, trotz aller „Ermutigungen“ nicht in die NSDAP eintreten zu müssen. Früher war er Sympathisant der Sozialdemokraten gewesen, im Stillen blieb er es wohl bis heute.
So wurde den Kindern der Familie – Heribert, dem vierundzwanzigjährigen ältesten Sohn und Leutnant bei der 10. Panzerdivision in Regensburg, Gerda, der zweiundzwanzigjährigen Schwester, und Jons – stets klargemacht, dass es eine Wahrheit für die Familie gab und eine andere für die Welt draußen. Heribert war dem Regime zugetan, Mitglied der Partei und selten auf Heimaturlaub. Der Mutter Gerlinde war er fremd geworden, und für ihn blieb Jons der kleine Bruder, der auf der Nehrung Sandburgen baute. Gerda hatte im Vorjahr geheiratet – warum es ausgerechnet der fast einen Kopf kleinere Erwin von Knöppelsdorf sein musste, verstand keiner auf Gut Kunzen.
Während Johannes auf den Bahnsteig schaute und versuchte, nicht an seinen Bruder zu denken, ertönte endlich das Abfahrtsignal des Schaffners.
„Zurückbleiben von der Bahnsteigkante!“, rief dieser laut und deutlich.
Es schien, als würde die Lokomotive mit ihrer Pfeife antworten. Jons beugte sich aus dem Fenster und blickte mit großen Augen nach vorn auf die Maschine, fünf Waggons voraus.
Es war 9.04 Uhr. Die letzten Türen wurden geschlossen, und dampfend, stoßend setzte sich die schwere Lokomotive in Bewegung. Zunächst quoll Dampf unter den Rädern hervor, dann stieß die Lok dunkle Wolken aus ihrem Schornstein. Immer schneller folgten die Schläge, immer rascher wurde das Tuckern der Räder.
Viele Zurückgebliebene, die im Besitz einer Bahnsteigkarte waren, winkten mit Taschentüchern, und in manchem Gesicht glaubte Jons Tränen zu sehen. Für einen Augenblick schien es ihm, als stünden die Menschen auf einem dieser neuen Fahrbänder, wie er sie in Berlin gesehen hatte. Doch als das Bahnhofsgebäude verschwand, begriff er: nicht der Bahnsteig bewegte sich – der Zug tat es.
„Mach das Fenster zu, Jons, es zieht doch entsetzlich“, sagte Tante Mathilde.
„Jawohl, Tante“, entgegnete Jons und schloss das Fenster. Dann lehnte er sich in das weiche Polster der Ersten Klasse.
Um 11.57 Uhr würde man in Schneidemühl halten, hatte der Schaffner erklärt; danach übernähmen polnische Kollegen die Fahrt im Korridor. Konitz sei der einzige Ort, an dem polnische Staatsbürger zusteigen dürften.
Jons hatte in der Berliner Zeitung gelesen, dass ausstehende deutsche Zahlungen für den Transitverkehr dazu geführt hatten, dass Polen seit Februar fast alle Transitleistungen eingestellt hatte. Nur der D 1 und D 2 sowie zwei weitere Zugpaare waren davon ausgenommen, da sie internationale Kurswagen führten und Polen diplomatische Verwicklungen vermeiden wollte. Erst in Elbing erreichte man wieder deutsches Reichsgebiet. Die Waggons wurden verplombt, um Deutsche und Polen zu trennen. Konitz um 13.01 Uhr, Elbing um 14.08 Uhr – so stand es im Fahrplan.
Tante Mathilde seufzte tief, als sie den Namen Konitz hörte. Die Mutter ihres Patenkindes war der Liebe wegen dorthin gezogen, und der junge Antas, der seinen Vater im Krieg früh verloren hatte, musste seine geliebte Großmutter in Nidden verlassen und ihr folgen.
„Er sehnt sich gewiss nach Hause zurück“, sagte sie leise, mehr zu sich selbst als zu jemandem. „Die Großmutter wohnt nun bei ihrem Sohn in Rossitten – einem Maler, weißt du“, wandte sie sich zu Jons und sah ihn ernst an.
„Es ist kein Zufall, Jons, dass ich heute mitkomme“, fuhr sie langsam fort. „In Konitz wird jemand zusteigen. Falls dich jemand fragt, so ist das dein Cousin aus Schneidemühl, der dich nach Rossitten begleitet. Und bitte – stelle keine weiteren Fragen. Und kein Wort darüber gegenüber irgendwem. Kann ich mich auf dich verlassen?“
„Selbstverständlich, Tante. Du kannst dich auf mich verlassen“, sagte Jons fest.
2. Kapitel – Zugestiegen
Einige Minuten später begann der Zug langsamer zu werden. Das Rattern der Räder verlor seinen Rhythmus, wurde stoßweise, unruhig. Draußen flogen Telegraphenmasten vorbei, einzelne Dächer, dann die ersten Signaltafeln. Der Wind trug den beißenden Geruch von Kohle und Schmieröl herein. Jons richtete sich auf. Durch das beschlagene Fenster sah er den Bahnsteig von Konitz näherkommen – graue Gebäude, ein paar Männer in Uniform, ein bellender Hund. Er wusste, dass nun der Wechsel bevorstand: deutsches Personal hinaus, polnisches hinein. Gleich würden die Kontrolleure durch die Gänge gehen, um die Abteile zu prüfen und die Türen zu verriegeln.
Tante Mathilde hatte die Lippen fest aufeinandergepresst und hielt die Handtasche auf dem Schoß. In der plötzlichen Stille zwischen zwei Bremsstößen hörte Jons ihr leises Flüstern:
„Bleib ruhig, Jons. Jetzt kommt’s darauf an.“
Jons fragte sich, wie ein Zustieg hier überhaupt möglich sein sollte. Er war nervös, denn gleich würde er jemanden kennenlernen, von dem er niemandem erzählen durfte. Er war unsicher, was er davon halten sollte – aber das Wort seiner Tante galt.
Der Zug hielt. Leider lagen die Fenster ihres Abteils auf der falschen Seite, sodass Jons den Bahnsteig nicht sehen konnte.
„Öffne das Fenster, Jons, und sieh hinaus. Was erkennst du?“ befahl Tante Mathilde mit fester Stimme.
Jons gehorchte, stellte sich auf die Zehenspitzen, zog das Schiebefenster hinunter und blickte hinaus. Zwischen den Gleisen standen Güterwagen – und dazwischen bewegte sich etwas.
„Dort hinten steht ein junger Mann“, sagte er leise. „Zwischen den Eisenbahnwagen.“
„Winke ihm“, erwiderte Tante Mathilde rasch. „Wenn er herankommt, hilf ihm hinein, bevor der Schaffner etwas bemerkt.“
In diesem Moment dachte Jons nicht mehr nach. Der junge Mann hatte sein Winken erkannt, rannte auf das Abteil zu und zog sich mit Jons’ Hilfe hinauf. Kaum war er im Innern, da lächelte er Tante Mathilde an.
„Gott zum Gruß, Tante Mathilde. Habt Dank für alles. Ich hab Ihnen einen Bund Sandstrohblumen mitgebracht.“
Jons atmete tief ein. Der Fremde roch nach Kiefern, nach Sommer, nach Sandstrohblumen. Etwas an ihm ließ Jons’ Haut prickeln. Der dunkle, ungezähmte Haarschopf, die offene Art – dieser Junge hatte eine Ausstrahlung, die Jons reglos machte.
„Mein Junge“, sagte Mathilde gerührt, „ich bin froh, dich heil hier zu sehen. Und danke für die Blumen – sie werden mir guttun. Ich werde mir morgen gleich einen Tee daraus bereiten lassen. Doch nun, beeile dich. Zieh diese Sachen an, bevor der Schaffner kommt.“
Sie griff in ihre Reisetasche und holte eine Uniform der Hitlerjugend hervor.
„Das ist mein Patenkind Antas – wir nennen ihn Toni“, erklärte sie rasch. „Und das, Toni, ist Johannes, genannt Jons, der Sohn meiner Schwester Gerlinde. Wir haben gemeinsam der Olympiade beigewohnt. Er ist ein halbes Jahr jünger als du.“
Dann fügte sie, halb spöttisch, hinzu: „Und Jons – schließ den Mund, mein Lieber, sonst fliegen dir noch die Mücken hinein.“
Doch die beiden Jungen schauten sich nur an. Ihre Blicke trafen sich, als wären sie längst vertraut. Tante Mathilde seufzte.
„Nun gebt euch wenigstens die Hand“, mahnte sie.
Zögernd reichte Jons dem anderen die Hand. Eine Sekunde lang spürte er dessen Zittern – und das eigene. Etwas flackerte zwischen ihnen auf, so flüchtig wie gefährlich. Für einen Moment schien das Abteil im weißen Dampf zu verschwimmen, und Jons wusste: Diesem Gefühl würde er nicht entkommen.
Dann klangen Schritte im Gang. Der polnische Schaffner näherte sich. Hastig zog Toni die Uniform über seine Kleidung und setzte sich neben Tante Mathilde. Der Mann öffnete die Abteiltür, runzelte die Stirn – drei Personen statt zwei. Doch der Anblick der Uniform und das herrische Auftreten der Dame genügten, um ihn schweigend weitergehen zu lassen.
Von Konitz bis Dirschau schwieg man. Die Spannung lag spürbar in der Luft, denn die Polen achteten streng darauf, dass niemand das Transitabkommen unterlief. Erst nach Elbing, nach dem erneuten Lokwechsel, entspannte sich die Atmosphäre. Der neue Schaffner grüßte Antas mit erhobenem Arm. Der Hitlergruß blieb den dreien wie ein Kloß im Hals.
Kaum erreichten sie den Königsberger Hauptbahnhof, verschwand Antas auf der Toilette und riss die Uniform vom Leib. Er übergab sie wortlos samt Reisetasche Tante Mathilde. „Die hat ausgedient“, murmelte er, und diesmal nickte auch sie.
Als sie vom Chauffeur des Gutes Kunzen abgeholt wurden, begann Antas von seiner Mutter und dem ungeliebten Stiefvater zu sprechen, doch Tante Mathilde bedeutete ihm zu schweigen. Die Fahrt mit dem gutseigenen Benz war allemal angenehmer als die mit der Cranzer Bahn oder dem Dampfer.
Der Wagen, üppig dimensioniert, war im Innern mit blauem Flockvelours ausgeschlagen; die Sitzbänke standen sich gegenüber, getrennt vom Fahrer durch eine Scheibe. Auf der hinteren Chromstoßstange war das Gepäck verzurrt – ein Anblick von stiller Noblesse.
Chauffeur Georg, 41 Jahre, nicht ganz 1,90 m groß, kräftig gebaut, mit kurzgeschorenem Schädel, trug die Uniform der Partei. Das Abzeichen am Revers ließ Jons jedes Mal frösteln. Es erinnerte ihn an jenen kleinen Mann aus Österreich, der mit seiner keifenden Stimme die Massen in Trance schrie.
Dabei mochte Jons Georg. Er kannte ihn seit seiner Kindheit. Georg hatte ihn das Reiten gelehrt, ihn aufgefangen, wenn er stürzte, und ihn oft getröstet, wenn der Vater zu streng gewesen war. Als Jons ihn einst nach dem Abzeichen fragte und meinte, der Vater würde das gewiss missbilligen, hatte Georg nur gelacht:
„Mach dir mal keenen Kopp, Jung. Der gnädije Herr weeß Bescheid.“
Dann, mit ernster Miene: „Es werden Zeiten kommen, da wirst du froh sein, dass ick dat Ding trag. Glaub mir.“
Jons ahnte damals nicht, wie recht er behalten sollte.
Vom Bahnhof fuhren sie durch die Langgasse, über den Pregel, vorbei am Schloss, Richtung Cranz. Hinter dem Meer, auf der Nehrung, führte die schmale Straße durch Kiefern- und Erlenwälder, die den Dünen Schutz boten. Kurz vor Rossitten, noch vor dem Mövenbruch, einem kleinen See, bogen sie an der Gabelung Richtung Kunzen ab. Buchen säumten den Weg, und manchmal huschte ein Elch durch das Unterholz.
Links führte die unbefestigte Straße weiter nach Rossitten. Dort hielt Georg auf Mathildes Zeichen. Die drei stiegen aus. Jons hatte die ganze Zeit schweigend neben seiner Tante gesessen und versuchte, seinen Blick von dem jungen Mann gegenüber abzuwenden. Auch Antas schwieg, sah hinaus auf die vorbeihuschenden Bäume, das aufblitzende Meer, das ihm sichtlich fehlte.
Mathilde beobachtete die beiden verstohlen. Sie hatte es geahnt – und gerade deshalb machte ihr dieses Schweigen Angst.
Sie hatte das Risiko eingehen müssen, dass die beiden sich sympathisch fanden – mehr noch, dass zwischen ihnen etwas entstehen könnte, das sie nicht mehr würde lenken können.
Dann kam der Abschied. Eine kurze, wehmütige Umarmung, ein fester Händedruck. Antas wusste, dass der Sohn aus gutem Hause für ihn unerreichbar war. Seine Herkunft durfte er nicht zeigen – es war sicherer so. Er wandte sich ab, verschwand hinter den Heckenrosen, die den Zufahrtsweg säumten, und ging allein weiter nach Rossitten.
„Gnädije Frau, Se wissen schon, det der Junge ‚nen bissken jüdisch aussieht, wa?“ meinte Georg leise, fast spöttisch.
„Ein mitreisender Zuggast, den wir freundlich mitgenommen haben – oder ist das neuerdings verboten?“ erwiderte Tante Mathilde kühl.
„Ick mein ja nur. Nich, dat ihm wat passiert. Ick kenn ihn. Is aus der Gegend“, gab Georg zurück.
„Mein lieber Georg, ich danke Ihnen für Ihre Sorge. Behalten Sie ihn einfach als Mitreisenden in Erinnerung – das genügt.“
„Georg meint’s nur gut“, sagte Jons leise.
„Wenn Se meinen, gnädige Frau – allet im Lot. Ick dacht nur, det Färdchen hat Stallluft jäwittärt. Das Jesichte kam mir bekannt vor“, brummte der Chauffeur und startete den Wagen.
Vor dem Gutshaus duftete eine weite Blumenwiese. Der Park mit seinen alten Buchen öffnete sich bis hinunter zum Haff. Die Auffahrt war breit und führte fast einen Kilometer bis zum Haus.
Jons war wieder zu Hause. Der Aufenthalt in Berlin war aufregend gewesen – doch die Stadt war ihm zu laut, zu braun, zu unruhig. Und gefährlich.
Auf der Freitreppe warteten seine Eltern. Heinrich von Ammen trat vor, schüttelte Mathilde die Hand und fragte:
„Alles gut gegangen?“
Sie nickte nur. Gerlinde umarmte ihre Schwester unter Tränen des Wiedersehens. Dann gingen sie gemeinsam ins Haus. Das Gepäck stand noch vor der Tür; Hannchen, die Magd, würde es später hinaufbringen. Nur die Reisetasche mit der Uniform behielt Tante Mathilde fest in der Hand. Ohne ein Wort nahm sie sie mit hinein.
3. Kapitel – Kerzenschein
Das Abendessen war beendet. Der Duft nach gebratenem Wild und frischem Brot lag noch in der Luft, vermischt mit dem leisen Rauch der Kerzen, die auf dem langen Tisch herabgebrannt waren. Aus der Küche drang das gedämpfte Klirren von Tellern, das Rascheln von Schürzen, die Stimmen der Dienstboten, die leise miteinander sprachen.
Heinrich von Ammen hatte sich mit Mathilde ins Rauchzimmer zurückgezogen. Ein schwacher Geruch von Zigarren und Cognac hing in der Luft, und von fern war das dumpfe Ticken der Standuhr zu hören. Heribert, der ältere Bruder, war in Regensburg stationiert, die Schwester Gerda mit ihrem Mann in Breslau. Nur Jons war geblieben – und seine Mutter.
Bei Tisch hatte er bereitwillig von Berlin erzählt, von den Spielen, den Tribünen, der Begeisterung der Menschen. Über die Rückfahrt aber hatte er nur wenige Worte verloren. Tante Mathilde hatte das übernommen, ruhig und bedacht, ohne Antas zu erwähnen.
Seine Mutter saß nun im Salon. Das Kerzenlicht spiegelte sich im Glas der Schrankvitrine, ließ die vergoldeten Tassen darin schimmern. Sie hatte ein Buch aus einem verborgenen Fach im Regal genommen – Der Zauberberg von Thomas Mann, einem mittlerweile verbotenen Schriftsteller. Vorsichtig blätterte sie die Seiten auf, so, als könnte jemand plötzlich hereinkommen und sie ertappen. Der Einband war abgegriffen, das Papier roch leicht nach Staub.
Die Familie von Ammen galt seit jeher als aufgeschlossen und frei in ihrem Denken. Doch gerade diese Haltung machte sie in den Augen der neuen Machthaber verdächtig. Ihr Liberalismus – von manchen gar als sozialistisch verschrien – passte nicht in das Weltbild derer, die nun über Deutschland herrschten. So sah sich die Familie gezwungen, ihre Gesinnung mehr und mehr zu verbergen.
Immer häufiger wurde das eigene Haus zum unsicheren Terrain. Zu viele Lauscher, zu viele neugierige Augen. Viele Dienstboten mussten gehen, denen man nicht mehr traute. Man begründete die Entlassungen mit der „verkleinerten Haushaltsführung“, da die Kinder meist außer Haus lebten. Nur einige Vertraute blieben: Wanda, Gerlindes Zofe, und Minna, die Köchin, unterstützt von Welda und Greta beim Aufwarten. Auch die Stubenmädchen Anna und Gertruda waren noch da, doch wohl nicht mehr lange.
Das frühere Kindermädchen Berta, längst Mamsell, gehörte beinahe zur Familie; sie aß am Abend mit am Tisch – ungewöhnlich für ein Haus dieser Stellung. Und dann war da Georg, der treue Chauffeur und Stallmeister. Trotz – oder vielleicht gerade wegen – seiner Mitgliedschaft in der Partei blieb er. Denn er stand in der Schuld des Hauses: Heinrichs Vater, General Johannes von Ammen, hoch dekoriert im großen Krieg von 1914 bis 1918, hatte den damals zwanzigjährigen Georg vor einer Verurteilung wegen „Unzucht“ bewahrt und ihm nach der eigenen Hochzeit eine sichere Anstellung verschafft.
Seitdem schwor Georg unerschütterliche Treue – „bis in den Tod“, wie er stets betonte. Ihm zur Seite stand der Stalljunge Felix, ein etwas einfältiger, doch gutmütiger Bursche, der seine Arbeit gewissenhaft verrichtete.
Die von Ammens lebten damit einen Lebensstil, der im faschistischen Deutschland zunehmend anstößig wirkte. Wenn der älteste Sohn Heribert seinen Heimaturlaub ankündigte, eilte Gerlinde stundenlang durchs Haus, um Bücher, Zeitungen oder Briefe zu verstecken, die dem Eifer ihres Sohnes Anlass zum Argwohn geben könnten. Heribert war seit der Machtergreifung Hitlers ein glühender Verehrer des „Führers“ geworden – und jedes Wiedersehen mit ihm ein Gang über dünnes Eis.
Jons hatte sich nach dem Essen ins Musikzimmer begeben. Der Raum lag still, nur das Rascheln der Bäume vor dem Fenster war zu hören. Er zündete die Kerzen auf dem Flügel an, setzte sich und schlug die Noten auf. Tschaikowskys Album für die Jugend, Stück 1: Morgengebet. Langsam legte er die Finger auf die Tasten. Die Musik klang weich und getragen, wie eine Erinnerung an etwas, das er nicht festhalten konnte. Er spielte so, wie es ihm sein Lehrer Grünbaum einst beigebracht hatte – dieser freundliche alte Mann mit den weißen Haaren, den man eines Tages fortgebracht hatte, ohne dass jemand wusste, wohin. Niemand sprach laut darüber, doch jeder ahnte das Schlimmste.
Ein Luftzug ließ die Flammen flackern. Die Tür öffnete sich leise, und der vertraute Duft seiner Mutter erfüllte den Raum.
„Guten Abend, Jons“, sagte sie und trat hinter ihn.
„Guten Abend, Mama. Ich bin froh, wieder daheim zu sein. Berlin war laut und… irgendwie anders.“
„Das Morgengebet am Abend?“ fragte sie mit einem schwachen Lächeln. „Geht es dir gut, mein Junge?“
„Natürlich, Mama. Nur müde.“
„Du spielst anders als sonst“, sagte sie und legte ihm die Hand auf die Schulter. „Etwas beschäftigt dich.“
„Vielleicht die Stadt“, antwortete Jons zögernd. „Überall diese Fahnen, diese Reden. Es war, als hätte jemand den Himmel kleiner gemacht.“
„Das ist alles?“ fragte sie leise. „Ich hörte, Ihr hattet einen zusätzlichen Passagier im Abteil.“
Er hielt inne. „Was hat dir Tante Mathilde erzählt?“
„Genug, um zu wissen, dass du ihn sehr nett findest. Ich kenne ihn – es ist Antas, der Neffe des Kunstmalers aus dem Dorf. Er war schon einmal hier, um beim Verladen der Bilder zur Reinigung zu helfen.“
Jons’ Hände erstarrten auf der Klaviatur. Langsam drehte er sich zu seiner Mutter um.
„Also stimmt es“, flüsterte er. „Ich hatte es mir gedacht.“
Gerlinde von Ammen, geborene zu Kunzen, sah ihn prüfend an. In ihrem Blick lag weniger Strenge als Sorge.
„Ich weiß um deine Gefühle, mein Junge. Du musst mir nichts erklären. Aber – bitte – sprich es nicht laut aus. Die Wände und Türen haben Ohren, das weißt du. Es ist gefährlich geworden, jemandem zu vertrauen, selbst unter dem eigenen Dach. Die Menschen denunzieren einander, um sich selbst zu retten.“
Sie hielt inne, sah zur Tür, dann leiser:
„Ich verurteile dich nicht. Deine Empfindungen sind nichts Unreines. Aber es ist nicht die Zeit dafür, sie zu zeigen. Versprich mir, nach außen hin wenigstens einer jungen Dame den Hof zu machen. Nur zum Schein, wenn es sein muss. Es ist besser so, glaub mir.“
Sie seufzte, fast unhörbar.
„Vielleicht kommt wieder eine Zeit, in der man frei lieben darf. Doch jetzt – jetzt ist alles anders als vor zehn Jahren. Versuch dich zu beherrschen, mein Sohn. Ich bitte dich.“
„Ich verspreche es, Mama.“
„Das genügt mir.“ Sie lächelte matt. „Dein Vater wird davon nichts erfahren. Ich bewahre dein Vertrauen.“
„Danke“, sagte er schlicht. Sie nickte, drehte sich um und verließ das Zimmer. Als sie über den Flur ging, hörte sie hinter sich wieder Musik. Jons spielte weiter – das Stück In der Kirche. Die Töne waren weich und traurig, und sie wusste, dass er ihre Worte wohl gehört, aber nicht verinnerlicht hatte.
Im Kerzenschein saß er noch lange am Flügel, die Schultern leicht nach vorne geneigt, den Blick auf die Tasten gerichtet. In seiner Vorstellung sah er nur ein Gesicht – freundlich, offen, mit dunklen Augen – und wusste nicht, weshalb ihn der Gedanke so sehr bewegte.
*****
Inzwischen war Antas in Rossitten angekommen. Er war nicht die Straße entlanggewandert, sondern kurz vor den Teichen, die dem Mövenbruch vorgelagert waren, nach Osten abgebogen. Den schmalen Sandweg über das Moor nahm er, den Rucksack mit seinen wenigen Habseligkeiten über die Schulter gehängt.
Seine Großmutter war einst aus ihrer Heimat Nidden geflohen, hinüber nach Rossitten, weiter südlich. Das war im Jahre 1923, als die Franzosen das besetzte Memelland an Litauen übergaben. Sie konnte fließend Litauisch, auch Russisch, doch ihre Muttersprache war Deutsch, und sie wollte im Deutschen Reich bleiben. So verließ sie mit ihrem zweitgeborenen Sohn Carl das heimatliche Dorf und zog zwei Dörfer weiter. Der Erstgeborene, Joris, war im großen Krieg geblieben, und Jahre später hatte die Schwiegertochter einen neuen Mann geheiratet und war mit ihrem einzigen Kind, Antas, in den polnischen Korridor gezogen.
Meta Josuweit, geborene Prusseit, liebte ihren Enkel von Herzen. Sie erhielt Briefe von ihm, regelmäßig sogar, doch sie konnte sie nicht beantworten. Sie war einfache Bäuerin, konnte weder lesen noch schreiben. Carl las ihr die Briefe vor – und manchmal meinte sie zu spüren, dass er beim Vorlesen etwas ausließ, um sie nicht zu beunruhigen.
Carl war Landschaftsmaler, ein stiller, freundlicher Mann mit wenig Glück im Geschäft. Seine Farben stellte er selbst her, aus Kreide, Erden, Pigmenten und Leinöl. Doch das Einkommen reichte nie ganz. Früh am Morgen half er oft beim Fischer, den Fang auf den Markt zu bringen, oder er reinigte alte Gemälde für die Sommergäste. Eine Frau hatte er nie genommen. „Mir reicht meine Mutter“, sagte er mit einem Lächeln, und Meta antwortete jedes Mal: „Ach Carl, du bist nur feig, mein Sohn.“
Sie wohnten in einem alten Holzhaus mit Strohdach, das immer wieder mit neuem Schilf vom Haff ausgebessert werden musste. Die Fensterläden waren rot gestrichen, die Farbe blätterte schon in kleinen Schuppen ab. Am Dachfirst flatterten bunt bemalte Windbretter, und aus dem Schornstein kringelte sich dünner Rauch von der Kochstelle.
Als Antas aus der Ferne den Rauch sah, wie er leicht über das Dach wehte, wusste er: Ich bin daheim. Das war sein Ort, der Ort, an den er gehörte. An das Haus in Nidden, in dem er geboren wurde, erinnerte er sich kaum noch. Er war sieben Jahre alt gewesen, als die Familie fortmusste. Rossitten war zur Heimat geworden – bis zu jenem Jahr 1934, als seine Mutter, von vielen hinter vorgehaltener Hand ein Polenflittchen genannt, ihn von hier fortriss.
In Polen wurde alles schlimmer. Der neue Stiefvater schlug ihn, wenn er nicht folgte, und nichts, was Antas tat, war gut genug. Seine Mutter betäubte ihre Sorgen im schwarzgebrannten Schnaps. Zwei Jahre hielt er es aus. Dann kam ein Brief von seiner Patentante, Mathilde zu Kunzen, die lange nach seinem Verbleib gesucht hatte. Schnell wurde beschlossen, ihn zurückzuholen.
Baroness Mathilde zu Kunzen hatte schon im Frühsommer 1915 die hochschwangere Käthe, eine Tagelöhnerin auf dem Gut, in den Wehen gefunden und sie mit der eigenen Kutsche nach Cranz gebracht. Dort kam Antas zur Welt. Mathilde übernahm die Patenschaft für das vaterlose Kind – wohl wissend, wer sein Vater war – und sorgte in den ersten Jahren für Kleidung, Schulbesuch und ärztliche Betreuung. Sie hatte keine eigenen Kinder; ihr Gatte, der Offizier von Gerstäcker, war wie Antas’ Vater im Krieg geblieben.
Als Antas nun das kleine Haus am Dorfrand erreichte, blieb er stehen. Alles sah aus wie früher. Vor dem Haus saß seine Großmutter auf der Bank und schälte Kartoffeln für das Abendbrot.
„Mein Jungchen!“ rief sie, als sie aufsah und ihn erkannte. „Ach Jotte nee, mein Jungchen, wo warst du nur so lang?“ Tränen liefen über ihre Falten, und Antas, tief bewegt, kniete sich neben sie, umarmte sie fest, als wollte er sie nie mehr loslassen.
Einige Zeit später kam auch Onkel Carl aus dem Schuppen, noch mit Malspuren an den Händen. Es wurde spät, sie redeten lange, lachten, weinten ein wenig, und schließlich lag Antas auf dem Dachboden in seinem alten Zimmer, auf einem Sack voll Stroh, mit einer von Mäusen angefressenen Decke über sich – und empfand doch, als läge er im besten Hotel von Königsberg.
Gläubig wie er war, kniete er zuvor noch vor dem kleinen Kreuz, das neben dem Fenster hing, und dankte leise für seine glückliche Heimkehr. Bevor er die Augen schloss, dachte er an den Jungen aus dem Zugabteil, an den Blick, den er nicht vergessen konnte. Nie hatte er jemanden getroffen, der ihn so berührt hatte, nie einen solchen Schmerz gespürt, als sie sich verabschiedeten. Er stellte eine kleine Kerze ins Fenster – nur eine aus Wachs, fast ganz heruntergebrannt – in der Hoffnung, dass jener andere, wo immer er war, ihr Licht vielleicht sehen würde.
Und während draußen das Meer rauschte und ein ferner Wind durch die Kiefern strich, schlief Antas endlich ein.
4. Kapitel – Ausritt am Morgen
Am nächsten Morgen, nach einem ausgiebigen Frühstück, war Jons’ erster Weg zu seiner Stute Blinka – ein Geschenk seines Vaters zur Konfirmation. Er trat aus dem schlichten Eingangsportal hinaus und hob den Blick in den blauen, nur leicht bewölkten Himmel. Es war ein wunderbarer Tag zum Ausreiten – noch früh, etwa um die achte Stunde –, und das Haus lag in friedlicher Ruhe.
Über dem Eingangsportal befand sich das Zimmer von Tante Mathilde. Von ihrem Balkon aus reichte der Blick weit über den Park und die halbrunde Vorfahrt für Kutschen und Automobile. Jons hatte bereits den rechten Seitenflügel erreicht, als ihn Tante Mathilde lautstark vom Balkon herabrief, er möge doch warten – sie wolle so gern mit ausreiten.
Jons seufzte. Warum konnte er nichts allein tun? Manchmal hatte er das Gefühl, stets unter Beobachtung zu stehen. Doch drehte er sich artig um und ging zum Eingang zurück.
Tante Mathilde stand schon bereit – in engen Reithosen, Stiefeln, gestricktem Pullover und Kappe. Das Haar unter der Kappe verborgen, wirkte sie beinahe wie ein Mann.
„Ich weiß, dass ich nicht gerade damenhaft aussehe“, sagte sie lächelnd, als sie den verdutzten Neffen ansah. „Aber ich finde Kleider und den Damensattel einfach scheußlich. Oder bin ich dir zu despektierlich? Lässt du mich noch rasch eine Zigarette rauchen? Dein Vater schaut mich immer so erschüttert an, wenn ich im Haus rauche. Ich bin eben nicht so etepetete wie deine Mutter – war ich noch nie.“
„Alles gut, Tante“, erwiderte Jons schmunzelnd. „Nur, ich habe eine Bitte: darf ich nach der Anstandsrunde noch allein weiterreiten? Ich muss den Kopf freibekommen.“
„Dir spukt noch Antas im Kopf herum, mein Junge, nicht wahr?“ – Sie hatte die Stimme gesenkt; ihre Offenheit war berühmt. – „Ich habe doch gestern gesehen, dass ihr beide nicht voneinander loskommt. Darf ich dir einen Rat geben?“
„Ja, natürlich, Tante Mathilde.“
„Lasst euch nicht erwischen – von den Leuten, die glauben, alles kontrollieren zu dürfen. Das ginge nicht gut aus.“
„Mama sagte etwas Ähnliches.“
„Was habe ich doch für eine kluge Schwester“, nickte sie. „Ihr habt noch euer Leben vor euch. Werft es nicht weg, denn das wäre die Folge. Hofft auf bessere Zeiten – sie werden kommen. Ich hoffe bald.“
„Danke für den Rat, Tante.“
„Na, dann reite los, mein Junge. Lass dir vom Wind den Kopf freiblasen. Ich denke, zum Reiten ist es mir heute zu warm, wie ich gerade feststelle.“ – Sie lachte, warf den Zigarettenstummel in den Kies und zog die Handschuhe wieder an. – „Ich sehe mir lieber den Garten an, was sich dort verändert hat. Vielleicht treffe ich deinen Vater – mit ihm habe ich ohnehin einiges zu besprechen.“
Damit drehte sie sich um und ging wieder ins Haus.
Jons sah ihr nach und dachte über ihre Worte nach. Sicherlich hätte er Antas gern wiedergetroffen, vielleicht ihm näherkommen wollen – doch wie, und wo?Außerdem würde er Ende September nach Königsberg zur Großmutter mütterlicherseits ziehen, die nur in den Monaten Mai bis September auf Kunzen weilte und im Winter stets in das Stadthaus der Familie zurückkehrte.
Zurzeit kurte die Großmutter in Rauschen und würde erst in einer Woche zurückkehren. Gewiss, Rauschen war nicht so mondän wie Cranz, doch das störte sie nicht. Wichtig war ihr, dass sie den Strand leicht erreichen konnte. Die Drahtseilbahn, die von der Kurpromenade hinunterführte, war ihr liebster Weg. Dort saß sie in einem der Strandkörbe, atmete die frische Seebrise und sagte stets, das befreie die Lungen. Dazu kam der würzige Duft des Waldes, der den Ort umgab.
Als Jons den Stall erreichte, hatte Georg bereits Blinka gesattelt und führte sie heraus, als er den jungen Herrn sah.
„Dachte mir schon, dass der junge Herr heute gleich ausreiten will. Wohin soll's gehen? Nach Rossitten?“ – Georg schleckte sich mit der Zunge auffällig über die Lippen.
Jons bemerkte es nicht. In seiner Unbekümmertheit verstand er die Geste nicht, doch Georg wusste genau, was in dem Jungen vorging. Er hatte gespürt, dass zwischen Jons und Antas mehr gewesen war als bloße Freundschaft. Auch er selbst hatte die Augen nicht von diesem dunklen, wuscheligen Haar abwenden können.
Im Gegensatz zu Jons hatte Georg in seinen Jugendjahren seine Neigungen in den Hinterzimmern Berlins ausleben können – heimlich, aber damals noch geduldet. Auch in Königsberg hatte es Orte gegeben, an denen man sich traf, unauffällig, geschützt. Er hatte vieles erlebt, was er sich erträumt hatte, und konnte heute davon zehren.
Der junge Herr aber lebte in einer anderen Zeit – einer Zeit, die gefährlich geworden war für alles, was anders war. Georg nahm sich vor, ihn zu schützen. Zu groß war die Zuneigung, die er für diesen schmalen Jungen empfand, den jüngsten Spross der von Ammens. Zu groß war auch die Verehrung für Vater und Großvater gewesen. Ohne die beiden, das wusste er, hätte er selbst nicht mehr gelebt, nachdem man ihn einst bei einer unbedachten Albernheit mit einem Jungen erwischt hatte.
Der Kleine, wie er Jons im Stillen nannte, war für ihn tabu. Doch manchmal wünschte er sich nichts sehnlicher, als ihn einfach einmal in den Arm nehmen zu dürfen.
Zuerst begrüßte Jons seine Stute, gab ihr einen Apfel, den sie gierig aufknabberte. Mit den Nüstern rieb sie sich an seiner Joppe und scharrte mit dem linken Vorderhuf, als wolle sie sagen: Nun los doch – ich habe lange genug auf der Koppel gestanden.
Neben Blinka, der braunen Trakehnerstute, gab es noch vier weitere Pferde – zwei Hengste und zwei Fuchsstuten. Früher waren es mehr gewesen. Doch nach dem Versailler Vertrag kam die Truppenreduzierung, und mit dem Aufkommen der Automobile begann der Niedergang der Pferdezucht.
Heribert, Jons’ älterer Bruder, hatte den Vater mehrmals gebeten, die Zucht zu überdenken. Doch Heinrich von Ammen lehnte ab. Wie viele junge Gutsbesitzer seiner Zeit wollte Heribert den neuen Weg gehen – sportliche Reitpferde züchten, für Turniere und den Staat, für jene, die vom „neuen Deutschland“ sprachen. Der Vater aber blieb seiner Überzeugung treu. Für ihn war das Pferd ein Arbeitstier, Teil der gewachsenen Ordnung des Landes, nicht Werkzeug einer Ideologie. Er verabscheute den Gedanken, Zucht und Tradition den politischen Strömungen zu unterwerfen. In seinen Augen bedeutete wahre Zukunft Beständigkeit – nicht Eroberung. Heinrich wollte keine fremden Leute auf dem Hof und verurteilte die Haltung des Sohnes, der sich nach der Machtergreifung Hitlers, vor über drei Jahren, offen den neuen Herren angeschlossen hatte.
Johannes ahnte nichts davon. Heute dachte er nur an seinen Ausritt.
Blinka hatte ein kupferfarbenes Fell mit gleichfarbigem Langhaar. Ihre Hufe waren dunkel, die Augen schimmerten wie bittere Schokolade. Jons beschloss, über die Bruchberge hinunter zum Strand zu reiten – durch die Gischt zu jagen, das Wasser aufpeitschen zu lassen. Er wollte sich den Kopf freiblasen.
Er wollte die quälenden Gedanken vertreiben, das unruhige Gefühl, das ihn ergriff, sobald er an Antas dachte. Doch er wusste – es gelang ihm nicht. Alles in ihm sehnte sich danach.
Der Erdboden war trocken, der Duft der Felder mischte sich mit der Wärme des Pferdeschweißes. Mehrmals hielt Jons an, um den Sommer zu atmen – den Geruch von Gras, Sonne und Salz.
Am Strand trieb er Blinka in den Galopp, hinein in die flachen Wellen, die gegen die Hufe schlugen. Gischt spritzte auf, der Wind griff nach seinem Hemd, trug den salzigen Geschmack des Meeres heran. Einen Moment lang schien alles leicht – als könnte der Sturm ihn davontragen.
Dann zügelte er das Pferd. Blinka schnaubte ungeduldig, doch Jons ließ die Zügel locker, stieg ab und blieb eine Weile im Sand stehen. Das Meer rauschte, der Himmel war weit und leer.
Er hatte geglaubt, Abstand gewinnen zu können, doch das Herz blieb unruhig. Das Bild des anderen ließ ihn nicht los – jener erste Blick, so schlicht und doch von etwas erfüllt, das sich nicht benennen ließ.
*****
Währenddessen half Antas seiner Großmutter im Garten. Es war Erntezeit. Gemüse wurde eingemacht, Kartoffeln ausgegraben und in die Kellermiete gebracht. Meta Josuweit war glücklich, ihren Enkel wieder bei sich zu haben. Alles fiel ihr schwer inzwischen, und Sohn Carl war keine große Hilfe.
Abends saß sie in ihrem alten Sessel und nähte für das Gut Kunzen. Die Zeiten waren schwer. Das Gut kämpfte um seinen Erhalt. Die Einnahmen aus dem Verkauf von Pferden an die Wehrmacht stagnierten – nicht zuletzt wegen der ablehnenden Haltung der Familie. Man sparte, wo man konnte. Die Flickarbeiten vergab man an alte Leute aus Rossitten, die sich freuten, ein paar Groschen zu verdienen.
Das Reich lag weit entfernt. Alles, was man nicht selbst herstellen konnte, musste teuer über den polnischen Korridor bezogen werden. Für die wenigen Gesellschaften, die noch stattfanden, wurden kaum neue Kleider genäht; man wendete alte, flickte, besserte aus. Noch gab es nicht genug Arbeit – schon gar nicht hier, auf der schmalen Insel, wie manche sie nannten.
Meta war dankbar für jeden Auftrag. Sie hoffte, dass ihr Enkel im kommenden Jahr Arbeit finden würde – als Schnitter, vielleicht als Schweizer, oder, wenn das Glück es wollte, in einer Bibliothek. Er liebte Bücher, seit er denken konnte. Was er auch tun würde, sie war stolz auf ihn. Und glücklich, dass er heimgekehrt war. Zu lange war er bei ihrer Tochter gewesen, die sich, wie Meta sagte, „diesem Polen an den Hals geworfen“ hatte.
Meta trug denselben Geburtsnamen wie Baronin Herta. Vielleicht waren sie sogar verwandt, behauptete sie manchmal kühn.
Als Jons von seinem Ausritt zurückkehrte, zog es ihn über die Vogelwiese hin zur Schwarzen-Berg-Bucht, auf der anderen Seite der Nehrung am Haff. Blinka setzte die Hufe von selbst dorthin, als wüsste sie, was ihr Herr suchte – den Jungen mit dem dunklen, wuscheligen Haar: Antas.
In Rossitten machten die Dorfbewohner ehrerbietig Platz für den hohen Herrn, und einige Kinder in abgerissenen Kleidern kamen bettelnd heran. Doch Jons lenkte seine Stute nur rasch durch die Gasse, bog auf der Nordseite des Mövenbruchs ab und ritt heimwärts.
Die letzten Störche klapperten auf den Dächern, besonders laut, wenn einer einen Frosch im Schnabel hatte.
Jons liebte den Sommer hier auf der Nehrung.
Sein Suchen blieb vergeblich. In eben jenem Moment, als er Rossitten durchquerte, trug Antas zwei Kiepen voller Kartoffeln in den Keller. So sah Jons nur die alte Frau und ihren Sohn Carl, der vor einer Staffelei saß und malte.
Meta blickte dem Reiter lange nach. Sie wusste, wer er war – Johannes von Ammen, der junge Herr, der ihrem Enkel einst geholfen hatte, den Zug zu erreichen. Antas hatte von ihm erzählt. Sie hatte gespürt, wie sehr er für ihn schwärmte – und sie bekam Angst. Angst um die Zukunft der beiden Jungen.
5. Kapitel – Vorbereitungen
Großmutter Herta, Baronin zu Kunzen, geborene von Prusseit, war aus der Kur zurückgekehrt. Georg hatte sie mit dem Automobil aus Rauschen abgeholt, und nun stand sie, von ihren Töchtern Gerlinde und Mathilde umringt, im Foyer des Gutshauses. Man herzte und küsste sich, wie es nach einer langen Trennung üblich war.
Vater Heinrichs Familie lebte in Südschleswig, und so war die Schwiegermutter auch für ihn von Bedeutung. Als Zweitgeborener hatte er das Gut seiner Eltern nicht erben können und musste – um weiterhin in herrschaftlichen Kreisen verkehren zu dürfen – eine Gutstochter heiraten.
Mamsell Berta hatte in der Küche den Auftrag gegeben, Großmutters Leibgericht zuzubereiten: Brathähnchen mit Kartoffeln und Blumenkohl, dazu die unvergleichliche Soße der Köchin Minna.
Als der Gong zum Essen ertönte, hatte sich Großmutter umgekleidet, und man versammelte sich zu Tisch. Greta servierte die Blumenkohlsuppe, die Minna aus den Strünken und Resten bereitet hatte. Herta, Baronin zu Kunzen, erhob das Wort, als die Teller abgeräumt wurden.
„Liebe Familie“, begann sie mit fester Stimme, „wie schön, euch alle hier am Tisch zu sehen. Die letzten Wochen meines Aufenthaltes auf dem Gut brechen an, danach werde ich nach Königsberg zurückkehren – und sehen, was mein Personal vom Besteck noch übriggelassen hat.“