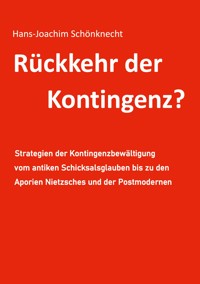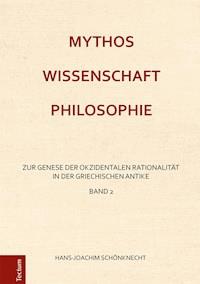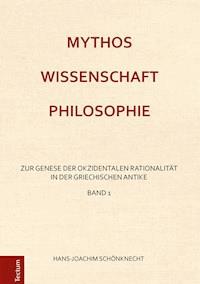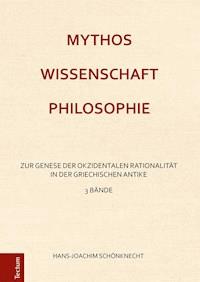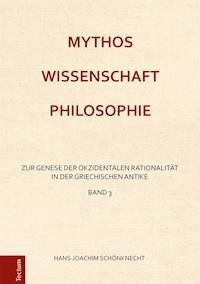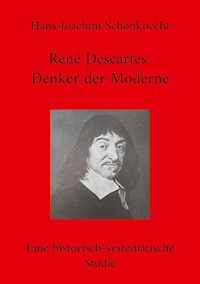
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Schrift bietet eine umfassende Einführung in Descartes' Philosophie. Sie entwickelt unter Bezugnahme auf den historischen Kontext deren singuläre denkgeschichtliche Rolle und analysiert gleichgewichtig ihre erkenntnistheoretisch-methodologischen, naturphilosophischen, metaphysischen und ethisch-praktischen Aspekte. Sie zeigt die Unüberholbarkeit von Descartes' Ansatz beim seiner selbst bewussten Subjekt auf und schließt mit einer Metakritik sowohl der naturwissenschaftlich-naturalistischen wie der fundamentalphilosophischen Kritik an Descartes.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1110
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Vorbemerkung
I.
Einleitung: René Descartes – Denker von epochalem Rang
II.
Historischer Hintergrund
Die Ursprünge wissenschaftlichen Denkens
Emblematische Ereignisse der geschichtlichen Krisis
2.1 Überblick
2.2 26. April 1336: Besteigung des Mont Ventoux durch den Dichter und Humanisten Francesco Petrarca
2.3 7. Dezember 1486: Der Thesenanschlag des Pico della Mirandola
III.
Biographisches: Descartes‘ Weg zu einem neuen Denken
Kindheit und Adoleszenz
Eine Sinn- und Orientierungskrise – und ihre hermeneutische Funktion
Exkurs: Das Masken-Gleichnis
Physico-mathematici paucissimi
– Descartes‘ Begegnung mit Isaac Beeckman
Entscheidung in Deutschland?
5.1 Die wohlgeheizte Stube – Neuburg 1619/20
5.2 Aufenthalt in Ulm 1620 und Rückkehr nach Frankreich
IV.
Descartes – Philosoph der Naturwissenschaften und Metaphysiker
Theoretische Grundorientierung
Descartes‘ Schriften im Überblick
2.1 Frühe Versuche
2.2 Erste Publikationen: Realwissenschaftliche
Essais
, Methodenschrift und
Meditationen über Erste Philosophie
2.3 Spätschriften:
Principia
,
Passions de l’âme
,
Recherche de la Vérité
Der Baum der Philosophie
– Descartes‘ weiter Philosophiebegriff
V.
Idee und Bedeutung der Methode bei Descartes
Vorüberlegungen und Annäherung an das Thema
Die elementaren logischen Operationen: Intuition und Deduktion
2.1 Intuition
2.2 Deduktion
Weitere Aspekte der Methode
3.1 Vorbereitende Überlegungen
3.2 Exkurs: Reduktion und Rekonstruktion
3.3 Das Postulat der Ordnung
3.4 Absolutheit vs. Respektivität
3.5 Vervollständigung der Methode: Aufsuchen des Bekannten – Induktion – Schärfung des Blicks – Grenzen der Erkenntnis
VI.
Transzendentallogische Fundierung der Methode
Ein dualistischer Ansatz
Apparativer Charakter der Sinne
Wahrnehmungsverarbeitung
Theorie des
Ingenium
oder
reinen Verstandes
Der reine Verstand:
Index sui et contrarii
Wirklichkeit als Ensemble von Komplexen
einfacher Naturen
Wissenschaft als
Rekonstruktion
komplexer Zusammenhänge
Theorie des Irrtums
Weitere Einschränkungen objektiver Erkenntnis
Bedeutung der
Regulae
für die späteren Schriften
VII.
Zwischen Ontologie und Physik: Descartes‘ Naturtheorie, dargestellt am Beispiel seiner Kosmologie im frühen Fragment
Le Monde
Vorüberlegungen
Exkurs: Die vor-cartesianische Tradition der Kosmologie
2.1 Kosmologische Entwürfe der griechischen Antike
2.2 Kosmologische Theorien des Mittelalters
2.3 Die
Copernikanische Wende
2.4 Copernicus-Rezeption vor Descartes
Descartes‘ kosmologischer Neuansatz in
Le Monde
3.1 Einführung
3.2 Zur Textgestalt von
Le Monde
3.3 Die
Abhandlung über das Licht
– Descartes‘ erkenntniskritischer Vorbehalt
3.4 Theorie des Lichts und der Materie
3.5 Descartes‘ Hypothese kosmischer Genese
3.5.1 Auf dem Weg zur Autonomisierung der Natur
3.5.2 Drei fundamentale
Naturgesetze
VIII.
Übertragung des mechanistischen Ansatzes auf die Physiologie: die Abhandlung
L’Homme – Der Mensch
Hinführung
Descartes‘ Affinität zum Prinzip des Mechanischen
Grundfunktionen der ‚Körpermaschine‘
Die Theorie der
Lebensgeister
Descartes‘ Idee einer Neurophysiologie
Exkurs: Eine Konsequenz der Leib-Seele-Dichotomie
IX.
Wende zum Subjekt – Descartes‘ egologische Neuausrichtung der Metaphysik in den
Meditationes de prima philosophia
Hinführung
Descartes und die metaphysische Tradition
Entstehung und äußerer Aufbau der
Meditationes
Beobachtungen zum Titel der
Meditationen
Das konstitutive Formelement: der narrative Rahmen
Der Ansatz beim radikalen Zweifel
Ich bin ein denkendes Ding
– Descartes‘
Cogito
Exkurs: Zwei von Descartes angestoßene begriffliche Umprägungen
8.1 Revision des Seelenbegriffs
8.2 Einführung des Begriffs
Bewusstsein
Die Einheit des Bewusstseins – Der cartesianische
Apriorismus
X.
Konsequenzen aus der Selbstgewissheit des
Cogito
Neufassung des Wahrheitsbegriffs
Realitätsprüfung unter der Maßgabe der Evidenz
Ich-Bewusstsein und Gott – Der
Gottesbeweis
der 3.
Meditation
3.1 Rekonstruktion des Beweisgangs
3.2 Interpretation und Diskussion des Gottesbeweises
Der kleine Gott der Welt
– Theorie der Willensfreiheit und der Irrtumsvermeidung
4.1 Anthropologie des Irrtums: Der Mensch als Wesen der Mitte
4.2 Irrtum als Willensphänomen
4.3 Exkurs zur Theoriegeschichte der Willensfreiheit
4.4 Theodizee I
XI.
Die wiedergefundene Wirklichkeit
Hinführung
Descartes‘ Idee der
Idee
Anschauung
vs.
reine Einsicht
Realität
der körperlichen Substanz
Von der Metaphysik zur Anthropologie: Der Mensch als unvollkommene Natur
Theodizee II
XII.
Leben
als subjektiver Vollzug – Descartes‘ praktische Philosophie
Der Autor schreibt nicht gern Ethisches
– Descartes‘ Vorbehalte gegen philosophische Ethik
Eine Minimalethik: die
Morale par provision
Begegnung mit Elisabeth von der Pfalz: Weg zur
Morale définitive
Elemente von Descartes‘
Morale définitive
Die
Passions de l’âme
und die ethische Auszeichnung der
Générosité
Technik statt Ethik
– Descartes‘ intellektuelles Vermächtnis
XIII.
Kritik und Metakritik – Descartes in der Diskussion
Philosophiegeschichtliche Verortung Descartes‘
1.1 Vorbemerkung
1.2 Descartes‘ Position vor dem Hintergrund der scholastischen Tradition
1.3 Aspekte des gesamtphilosophischen Kontextes
Der Dualismus der Substanzen – ein essentielles Lehrstück
2.1 Unhintergehbarkeit des Dualismus
2.2 Popularphilosophische Bestreitungen des Dualismus und deren blinder Fleck
XIV.
Programmatische Descartes-Kritik der Gegenwart
Kritik aus phänomenologischer Perspektive: Edmund Husserl
1.1 Husserls Verortung Descartes‘ zwischen
Rationalismus
,
Transzendentalismus
und
Objektivismus
. Husserls ambivalentes Verhältnis zu Descartes
1.2 Der rationalistische Aspekt bei Descartes
1.3 Das transzendentale Motiv
1.4 Husserls Descartes-Interpretation – kritisch hinterfragt
1.5 Scheitern von Husserls Descartes-Kritik am eigenen Idealismus
Die Descartes-Kritik Martin Heideggers
2.1 Husserls und Heideggers Verfehlen der geschichtlichen Wirklichkeit – Ein geschichtsphilosophischer Exkurs
2.2 Descartes-Kritik – fundamentalontologisch verfehlt
Anti-Realist Descartes? – Die Descartes-Kritik in Dreyfus/Taylors
Die Wiedergewinnung des Realismus
3.1 Descartes als philosophischer ‚Stein des Anstoßes‘
3.2 Dreyfus/Taylors ‚anti-cartesianischer‘ Ansatz
3.3 Dreyfus/Taylors ‚holistisches‘ Konzept
3.4 Fehlinterpretation von Descartes‘ Ideen-Konzeption
3.5 Scheitern des Anti-Realismus-Vorwurfs gegen Descartes
Epilog
Siglen
Literaturverzeichnis
Personenregister
Vorbemerkung
Die vorliegende Untersuchung verfolgt die Absicht – der Titel deutet es an –, die ungebrochene und aufgrund ihres fundamentalen Charakters ungefährdete Aktualität von Descartes‘ Denken herauszustellen und in eins damit die heute unter Philosophen ebenso wie in der gebildeten Öffentlichkeit vorherrschende Auffassung zu korrigieren, Descartes sei ein historisch längst erledigter oder – schlimmer – in seinen Wirkungen sogar schädlicher Philosoph.
Die Darstellung ist historisch-systematisch angelegt. Sie entwickelt einerseits Elemente des historischen Kontextes, gegen den Descartes sich bewusst absetzt und präsentiert den Philosophen andererseits in der bemerkenswerten Fülle seiner denkerischen Ansätze, die erkenntnistheoretisch-methodologische, naturforscherische, metaphysische und philosophisch-praktische Konzeptionen umfassen – und zwar durchweg in origineller, eine historisch neue Perspektive eröffnender Form. Ausgenommen ist lediglich der von Descartes im Alleingang begründete Zweig der Mathematik, die Analytische Geometrie, auch dies eine intellektuelle Großtat, deren Behandlung aber den Rahmen einer philosophischen Interpretation sprengen würde.
Thematisches Zentrum der Untersuchung ist die von Descartes für die Neuzeit geleistete philosophische Grundlegung der Wissenschaftsidee, und damit schließt die vorliegende Schrift an mein im Jahr 2017 erschienenes dreibändiges Werk Mythos – Wissenschaft – Philosophie. Zur Genese der okzidentalen Rationalität in der griechischen Antike an.
Auch diesmal gilt mein Dank meiner Frau Ursel für ihre Geduld angesichts meiner zeitaufwendigen Forschungstätigkeit und für ihre vielfältigen hilfreichen Ratschläge zu formalen Fragen der Textgestaltung.
Köln, Juni 2022
Hans-Joachim Schönknecht
I. Einleitung: René Descartes – Denker von epochalem Rang
Die folgende Darstellung der Philosophie des René Descartes (1596-1650) schließt, wie in der Vorbemerkung erwähnt, thematisch an meine frühere Schrift Mythos – Wissenschaft – Philosophie. Zur Genese der okzidentalen Rationalität in der griechischen Antike1 an. Darin hatte ich umfassend die Entstehung der okzidentalen Wissenschaftsidee rekonstruiert, beginnend mit dem berühmten, durch die vorsokratischen Denker geleisteten Übergang vom Mythos zum Logos (W. Nestle), über ihre Entfaltung durch Platon und Aristoteles, bis zu ihrer Schwächung im Skeptizismus und ihrer Unterdrückung bzw. Reduzierung auf Theologie durch das aufsteigende Christentum. Es handelt sich um jenen denkgeschichtlichen Umbruch, der Europa erst zu Europa und das Abendland zu einem solchen werden ließ. Es ist jene Form von Kultur, in der sich, auf den einfachsten Nenner gebracht, erstmals die Idee einer durch Beobachten und Nachdenken zu ermittelnden sachhaltigen, nicht mehr anthropomorphen Wahrheit kristallisierte und in der erstmals die Wahrheit als Wahrheit, das heißt auch: der Gegensatz von Wahrheit und Irrtum, zum Thema von Reflexion wurde.
Das hier vorgelegte Buch versucht, in Analogie zu dem vorhergehenden, die Erneuerung des wissenschaftlich-rationalen Weltzugangs am Beginn der Neuzeit zu rekonstruieren. Im Unterschied zu der früheren Publikation ist es jedoch nicht als historischer Längsschnitt angelegt, sondern exponiert mit Descartes den Denker, der wie kein anderer den geistigen Umschwung verkörpert. Vielleicht nur noch dem Aristoteles vergleichbar, verbinden sich in Descartes‘ Denken breite wissenschaftliche Forschung mit deren philosophischer, d.h. methodologischer und metaphysischer Grundlegung. Sehr im Unterschied zu Aristoteles jedoch enden Descartes‘ denkerische Bemühungen nicht in dem generellen Erkenntniszweifel der Skeptiker, der seinerseits in unbändige religiöse Empfänglichkeit umschlägt, sondern fundieren einen Jahrhunderte dauernden, sich bis in unsere Gegenwart intensivierenden und ausweitenden, dank seiner realen Ergebnisse die menschliche Welt und alle Lebensverhältnisse transformierenden Wissenschaftsprozess, dessen Ende nicht abzusehen ist.
Dass Descartes für die Wissenschaftskultur der Neuzeit von überragender Bedeutung ist, ist zwar kein neuer Gedanke, er wurde jedoch, zumindest im deutschen Sprachraum, selten zur Grundlage einer Darstellung. Meist beschränkte sich die Interpretation auf die Metaphysik Descartes‘, ohne deren erkenntnis- bzw. wissenschaftstheoretische Funktion zu berücksichtigen.
Die Stellung Descartes‘ ist auch insofern eine besondere, als sich an ihm bis in die Gegenwart die Geister scheiden, im Unterschied zu seinen heute praktisch vergessenen philosophischen Zeitgenossen oder auch zu großen Fortsetzern wie Spinoza und Leibniz, deren theoretische Impulse sich längst erschöpft haben und die heute nur noch philologisch behandelt werden. Descartes dagegen ist von ungebrochener Aktualität, seine Philosophie kann man sich noch zu eigen machen, man kann noch Cartesianer sein – und im Grunde sind es alle. Aus dieser Tatsache resultiert allerdings auch seine Umstrittenheit, und ich beginne die Ausführungen mit einem Blick auf einige jüngere Stellungnahmen pro und contra Descartes. Daran anschließen wird sich ein Aufriss des historischen Kontextes, denn natürlich steht auch der originellste Denker im Schnittpunkt geschichtlicher Tendenzen; auch sein Erscheinen gehorcht dem Prinzip des zureichenden (historischen) Grundes.
So apostrophiert der amerikanische Descartes-Forscher Lawrence Nolan in der Präsentation des von ihm edierten gewichtigen Cambridge Descartes Lexicon den Philosophen als „the father of modern philosophy“2 und verortet ihn, für die Freunde von Ranglisten, unter die „top five philosophers of all time“3.
Es ist, was Nolan unerwähnt lässt, Schopenhauer gewesen, der bezüglich Descartes‘ erstmals das Bild vom „Vater der neuern Philosophie“4 bemüht hat. Aber schon Hegel hatte Descartes – unter Vermeidung der trivialen genealogischen Metapher – als „wahrhaften Anfänger der modernen Philosophie“5 bezeichnet. Wenn wir das in solchem Kontext für uns ungewohnte Wort ‚Anfänger‘ durch sein lateinisches Äquivalent ersetzen, wird die Sache klar: Descartes war der Initiator der neuzeitlichen Philosophie. Und da jede zeitgenössische Philosophie kraft historischer Notwendigkeit in dieser Tradition steht – selbst und gerade, wenn sie sich explizit dagegen wendet – ist sie Descartes auch verpflichtet; ich werde die hierin liegende Verschränkungen von Kontinuität und Diskontinuität noch genauer betrachten. Die gesamte geschichtliche Reichweite von Descartes‘ Denken musste aber auch Hegel als Philosoph des spekulativen Idealismus, d. h. als Denker einer Sinntotalität und der vorindustriellen Epoche, noch verborgen bleiben.
Eine originelle und höchst bedeutsame Variation dieser anerkennenden Zuweisungen formuliert Edmund Husserl in seiner Krisis-Schrift von 1935. Er bezeichnet Descartes mit einer ebenfalls merkwürdig wirkenden Metapher als „Erzvater der Neuzeit“6 und würdigt damit nicht nur Descartes‘ philosophische Ausnahmestellung, sondern erhebt ihn zur prägenden Gestalt der Epoche – eine Beurteilung, der sich meine Interpretation anschließt und die für die Wahl ihres Titels maßgebend war.
Noch ein Wort zu Nolans Erhebung Descartes‘ unter die fünf größten Philosophen: Die Verortung eines Denkers in einer Rangliste scheint zwar für eine konkurrenz- und wettkampforientierte Gesellschaft wie die unsere naheliegend, enthält aber doch etwas Missliches, genauer gesagt ein irrationales Moment: Warum bildet Nolan eine Gruppe von gerade fünf größten Denkern, und soll dies bedeuten, dass er Descartes Platz 5 zuweist? Es muss wohl so sein, denn sonst gäbe die Fünfzahl keinen Sinn.
Verhält es sich aber so, fragt sich sogleich, wer denn die vier ihm vorgeordneten Denker sind. Die beiden ersten Plätze wird man wohl allgemein und aus historischen Erwägungen den Gründerfiguren Platon und Aristoteles zubilligen (falls man nicht geradezu noch älteren Denk-Giganten wie Thales und Anaximander oder Parmenides und Heraklit oder auch Sokrates den Vorzug gibt). In jedem Fall aber wird es schwierig, denn es kommen persönliche Präferenzen ins Spiel: Wer vermag sich etwa heute noch vorzustellen, dass vor fünfzig Jahren, trotz des damals die halbe Welt beherrschenden Kommunismus, Karl Marx im Westen der ‚angesagteste‘ Philosoph war?!
Wie dem auch sei, um die beiden verbleibenden Positionen werden, abhängig vom Geschmack des Urteilenden und entlang historisch wechselnder Präferenzen, wohl Denker wie Augustinus und Thomas von Aquin, Kant und Hegel, aus dem 19. Jahrhundert Nietzsche und, als Gestalten der Gegenwart, Wittgenstein und Heidegger konkurrieren – und je nach Kombination wird Descartes gar aus der Spitzengruppe herausfallen. Man sieht: derartige Ranglisten haben wenig zu bedeuten7.
Descartes‘ Beurteilung als Initiator der modernen Philosophie ist äquivalent zu der, dass Descartes nicht nur der erste moderne, sondern der die Moderne prägende Philosoph gewesen ist. Dies reflektiert der Titel der vorliegenden Schrift, die es sich zum Ziel gesetzt hat, sowohl den Sinn wie die Berechtigung dieses Urteils am Werk selbst aufzuzeigen. Ein wesentlicher Grund dafür soll aber schon jetzt benannt werden: Descartes‘ Modernität besteht darin, dass seine Philosophie rein weltlich, säkular ist und sich sachlich vollständig vom religiösen Hintergrund der mittelalterlichen Philosophie gelöst hat, auch wenn die Tatsache, dass er den ‚ontologischen Gottesbeweis‘ des Anselm von Canterbury (1033-1109) wiederbelebt, das Gegenteil zu beweisen scheint. Die mit Humanismus und Renaissance einsetzende Säkularisierung, der beginnende Verlust der Deutungshoheit des christlich-theologischen Paradigmas für Welt und Leben, wird durch Descartes auf einem vorher nicht erreichten Reflexionsniveau fortgesetzt und in gewissem Sinn bereits vollendet.
Eine zweite Erwägung sei hier angeschlossen: Die Kennzeichnung Descartes‘ als Vater der modernen Philosophie könnte die Konnotation mit sich führen, dass seine Nachfolger den von ihm gesetzten Impuls vertieft und sachlich treffender ausgearbeitet hätten. Hier sei mit aller Vorsicht die Hypothese gewagt, dass die von Descartes beeinflussten Philosophen, insbesondere die sog. deutschen Idealisten, trotz ihres Ausbaus der cartesischen Ansätze zu umfassenden, viele Bände füllenden Systemen, in gewissem Sinne nicht über Descartes hinausgekommen, wenn nicht gar hinter ihn zurückgefallen sind.
Wie dem auch sei – wenn wir dem Philosophieren, das ja nichts als eine bestimmte Methode des Nachdenkens ist, und zwar die Bestimmung durch das Allgemeine und die Selbstreflexion des Denkens, eine Seinsgestalt zuweisen, wie es ja ständig geschieht, wenn wir von der Philosophie sprechen, so müssen wir sagen, dass Descartes einer abgelebten Sache, wie es die Philosophie in ihrer scholastischen Form war, durch seinen Bruch mit der Tradition und den Neuansatz beim Cogito, dem Denken oder denkenden Ich, einen belebenden Impuls vermittelte, von dem diese Art des Denkens über Jahrhunderte zehrte.
Und im Unterschied zu den zuvor genannten Mitbewerbern um philosophische Spitzenplätze bedeutet Descartes‘ Denken nicht nur die Fortentwicklung und Verfeinerung eines bestehenden Paradigmas, sondern stellt einen integralen Teil eines echten denkgeschichtlichen Umbruchs dar, der nicht nur zu einer tiefgreifenden Veränderung der Einstellung des Menschen zur Welt führt, sondern eine bis dato nicht absehbare Erweiterung wirklichen menschlichen Wissens von Welt und Kosmos und eine reale Transformation der irdischen Welt in Gestalt der Technik wenn auch nicht hervorbringt, so doch wesentlich fördert. Der Ausdruck ‚wirkliches Wissen‘ ist dabei in seinem vollen Gewicht zu nehmen, er bezeichnet ein Wissen, das im menschlichen Leben erfahrbare Wirkungen zeitigt, Wirkungen nicht nur in der weichen Form veränderter Anschauungen, wie sie seit je von Religionen und Philosophien ausgegangen sind, sondern in der harten, materiellen Form der Technisierung von Welt und Leben, Wirkungen, die sich wahrscheinlich auf die menschlichen Dispositionen viel massiver ausgewirkt haben und noch auswirken werden als je die rein ‚geistigen‘ Konzeptionen es vermochten. Und dies in zweierlei Hinsicht, denn neben den positiven Leistungen der Technik liegen uns heute leider auch deren negative Kollateraleffekte vor Augen, die das gesamte Projekt der Moderne, wenn wir es mit Jürgen Habermas so bezeichnen wollen8, zu einem echten Experiment werden lassen, insofern sein Ausgang ungewiss ist.
Der theoretische Beitrag Descartes‘ zum Projekt der, wie wir auch sagen können, neuzeitlichen wissenschaftlichen Zivilisation ist fundamental, und gelegentlich werden ihm, als bedeutendstem von deren Vordenkern, von heutigen Betrachtern auch die negativen Effekte angelastet. So behaupten z.B. die Brüder Gernot Böhme und Hartmut Böhme in ihrem Buch Das Andere der Vernunft (1984), durch die von Descartes theoretisch vollzogene „Trennung von Körper und Geist sei die Zivilisation auf die schiefe Bahn geraten“9. Und das amerikanisch-kanadische Philosophenduo Hubert Dreyfus und Charles Taylor fordert in seiner aktuellen Schrift Die Wiedergewinnung des Realismus (2016), das von Descartes begründete „Denkschema, das das metaphysische und erkenntnistheoretische Selbstverständnis der westlichen Moderne [] bis heute beherrscht, [müsse] final destruiert werden“10.
Ich lasse diese kritischen Urteile zunächst unkommentiert; ihren philosophiegeschichtlichen Hintergrund werde ich im Schlusskapitel meines Buchs aufweisen und diese Urteile selbst einer Metakritik unterziehen11. Ich füge nur hinzu, dass mir kein anderer Philosoph bekannt ist, dem jemals eine derartige Wirkung konzediert worden wäre, eine gesamte zivilisatorische Epoche geprägt, im vorliegenden Falle: negativ geprägt zu haben. Als Figuren vergleichbarer Wirkungskraft fallen einem allenfalls Jesus ein, und der war kein Philosoph, oder auch Karl Marx, dessen als weltver-ändernd intendierte Theorie jedoch inzwischen ihres katastrophischen und zugleich weltgeschichtlich ephemeren Charakters überführt wurde. Die genannten Autoren sind auch nur zwei der zahlreichen aktuellen Beispiele für die in neuerer Zeit vor allem durch Edmund Husserl und Martin Heidegger ins Werk gesetzte Kritik an Descartes, und wenn das alte soldatische Motto ‚Viel Feind, viel Ehr‘ auch für Philosophen gälte, würde Descartes in der Tat auch in dieser Hinsicht den Ehrenplatz einnehmen.
Auf (philosophische) Auseinandersetzungen und daraus möglicherweise resultierende Ehren stellt sich Descartes im übrigen schon früh ein. So notiert er bereits zur Zeit der Cogitationes Privatae: „Von Freunden kritisiert zu werden, ist ebenso nützlich, wie es ehrenvoll ist, von Gegnern gelobt zu werden“12.
Allerdings sind Descartes auch in unzweideutiger Form Ehren zuteil geworden. So stellte derselbe Husserl eine der diversen Einleitungen in seine philosophische Phänomenologie unter den Titel von Cartesianischen Meditationen und bestimmte darin sein eigenes Denken als eine Art kritischen „Neu-Cartesianismus“13.
Descartes‘ epochale Leistung besteht unter anderem, um nur diesen einen, für seine Kritiker wesentlichen Punkt vorwegzunehmen, in seiner naturphilosophisch leitenden Idee, dass die Welt, als Kosmos wie als ‚irdische‘ Natur, den Menschen als Leibwesen eingeschlossen, zu verstehen ist als ein Ensemble von Mechanismen, das in seiner Funktionsweise strengen, naturgegebenen Prinzipien, den sog. Naturgesetzen, gehorcht. Das ist eine uns vollkommen vertraute Annahme – auch dies ein Beleg für Descartes‘ epochale Wirkung.
Um Descartes‘ Intentionen in vollem Umfang zu verstehen, genügt es daher nicht, wie es oft geschieht, die Aufmerksamkeit auf sein berühmtestes Lehrstück, die in den Meditationen über Erste Philosophie gegebene Metaphysik zu beschränken. Diese ist lediglich ein, wenn auch fundamentaler Teil von Descartes‘ umfassendem philosophischen Projekt. Meine Untersuchung zielt darauf ab, dies Projekt in möglichster Breite und Tiefe sichtbar zu machen.
Aus diesem Grund steht im Mittelpunkt der Arbeit eine Interpretation der Hauptschriften (Kap. V-XII). Ein knapper Blick gilt den geistesgeschichtlichen Bedingungen, denen Descartes, wie jeder Denker, unterliegt und von denen er sich, soweit sie ihm zu Bewusstsein kommen, abzusetzen versucht, denn sein Verhältnis zur Tradition ist essenziell kritisch (Kap. II). Kap. III legt den für sich interessanten biografischen Prozess frei, in dem sich der Philosoph Descartes formt und Kap. IV gibt einen Überblick über das Gesamtwerk und seinen durch Descartes‘ weiten Philosophiebegriff bedingten inneren Zusammenhang. Daraus resultiert auch die Begründung für die Auswahl der in den Folgekapiteln dargestellten Einzelschriften.
In Kap. XIII wird das zentrale Lehrstück des Dualismus der Substanzen in seiner sachlichen Notwendigkeit aus dem denkgeschichtlichen Kontext abgeleitet sowie das Reflexionsdefizit naturwissenschaftlich inspirierter Dualismus-Kritik aufgewiesen. Kap. XIV schließlich reflektiert die differenzierte, den Anschluss an Descartes mit dessen Kritik verbindende Auffassung Husserls sowie die radikale Descartes-Kritik Heideggers, dessen Fundamentalontologie sich als systematischer Anti-Cartesianismus lesen lässt.
Husserl und Heidegger bzw. der naturwissenschaftliche Anti-Dualismus haben das heute durchweg negative Descartes-Bild geprägt; die neueren Kritiken halten sich in dem vorgegebenen Rahmen und perpetuieren die dort entwickelten Argumente. Dies wird abschließend aufgezeigt und zugleich kritisch hinterfragt an der schon erwähnten Schrift Dreyfus‘ und Taylors über die Wiedergewinnung des Realismus.
1 Vgl. Lit.-Verz.
2 A.O., S. I
3 Ebd., S. XXV
4 Zit. Specht 2006, S. 161
5Vorlesungen zur Geschichte der Philosophie, TWA 20, S. 123
6Krisis II, § 16; Husserl 1996, S. 82 – Zu Husserls eigenartiger Wortwahl vgl. unten, Kap. XIV 1.1 (Fußnote).
7 Dass sich selbst über Jahrhunderte geltende Bewertungen nach eigenem Verständnis zeitenthobener Institutionen wie der katholischen Kirche verändern, belegt der Aufstieg des Thomas von Aquin zu deren offiziellem Theologen-Philosophen. Dieser hatte die Rolle nicht immer inne, sondern gewinnt erst in der nachmittelalterlichen Theologie nach und nach die gleiche Reputation wie der zuvor maßgebende ‚Kirchenvater‘ Augustinus. In seiner Enzyklika Inscrutabili Dei consilio (‚Der unerforschliche Ratschluss Gottes‘) von 1878 stellt Papst Leo XII. Thomas noch gleichrangig neben Augustinus, in der Enzyklika Aeterni Patris (‚Ewiger Vater‘) von 1879 jedoch weist er Thomas unter allen Philosophen den ersten Platz an (vgl. Regenbogen/Meyer 2005, Art. Katholizismus).
Die Bedeutungslosigkeit von Ranglisten gilt analog für die von Verlagen gern zu Werbezwecken aufgestellte Behauptung, eine aktuelle Monographie sei die definitive Darstellung zu einem Denker. Da Philosophie sich zum guten Teil in der persönlichen Aneignung der großen Gestalten der Tradition vollzieht und sich in der Publikation der gewonnenen Einsichten niederschlägt, wird es – sozusagen systembedingt – keine definitive Interpretation eines Autors geben. Es gibt allerdings – wer wollte dies leugnen – Darstellungen unterschiedlicher Qualität und Relevanz!
8 Vgl. Habermas‘ Aufsatz Die Moderne – ein unvollendetes Projekt (1980), der zugleich dem ihn enthaltenden Sammelband den Titel gibt (vgl. Lit.-Verz.)
9 Zit. Th. Thiel: Vernünftige Widerfahrnis. Dem Philosophen Gernot Böhme zum Achtzigsten. FAZ, 03.01.2017, S. 11
10 A.O., Klappentext
11 Vgl. unten, Kap. XIV
12 A.O., AT X, S. 217; Wohlers, S. 195
13 Husserl 1987, S. 3
II. Historischer Hintergrund
1 Die Ursprünge wissenschaftlichen Denkens
Um Descartes entsprechend seiner historischen Bedeutung zu verorten und zu würdigen, empfiehlt sich ein (notwendig sehr knapper) Rückblick auf die Geschichte des theoretischen Denkens in Europa – und nur für Europa ist meines Wissens eine derartige zweieinhalbtausendjährige, auch in der Gegenwart noch andauernde Kontinuität des Denkens nachweisbar14, die die Traditionen nicht nur konserviert, sondern sie unter dem Gesichtspunkt theoretischer und praktischer Wahrheit ständig revidiert.
Diese Geschichte beginnt bekanntlich im antiken Griechenland und natürlich haben auch die Griechen, für ihr Pantheon ebenso wie in der Mathematik und der Astronomie, Anregungen von den benachbarten Hochkulturen – Ägypter, Babylonier, Perser – aufgenommen15. Eine eigene griechische Kultur wird etwa um 600 v.Chr. erstmals greifbar in den beiden großen Epen Homers, der Ilias und der Odyssee, sowie in den Dichtungen des Hesiod. Dort begegnet uns jener Apparat der olympischen Götter, der die griechische und späterhin auch die römische Religion repräsentiert und bis zur Entstehung des Christentums in Geltung bleibt.
Mit der Zuweisung bestimmter Zuständigkeiten an die einzelnen göttlichen Agenten – Zeus als Oberherr und Gott des Himmels und der Erde, Poseidon als Herr der Meere, Hades als Herr der Unterwelt, Athene für Weisheit stehend, Dike für das Recht, Aphrodite für die Liebe usw. – ergibt sich eine sektorielle Ordnung und Einteilung der Wirklichkeit, die man als prä-oder protowissenschaftlich einstufen mag.
In dem derart vorbereiteten Kontext entfaltet sich wenig später, im sechsten und fünften Jahrhundert, die Idee menschlich-profaner Theorie in der doppelten Orientierung einer praktischen, auf Einblick in Lebenszusammenhänge ausgerichteten Weisheit (gr. ‚sophia‘) einerseits, eines theoretischen, auf sachliches Wissen über Natur und Kosmos abzielenden Nachdenkens andererseits. Der praktische Aspekt begegnet uns in Gestalt der sieben Weisen, in deren Aphorismen zur Lebensweisheit die Idee von Moral, Sittlichkeit und rechtem Tun erstmals losgelöst vom religiösen Hintergrund erscheint. Der theoretische Aspekt manifestiert sich in Gestalt der sog. milesischen Naturphilosophen Thales, Anaximander und Anaximenes. Letztere bilden erstmals eine vom Rückgriff auf anthropomorph Göttliches freie Idee von Natur und Kosmos als eines dem menschlichen Sein vorgeordneten und es tragenden Ganzen aus. Und wie die praktische Weisheit auf Erfassung der für ein Gelingen des Lebens wesentlichen Verhaltensweisen abzielt, die in den Sprüchen der Weisen normativ, zumeist als Imperative, formuliert werden, richtet sich das theoretische Interesse in reduktiver Einstellung auf die Freilegung von konstitutiven Merkmalen der Naturwirklichkeit, der sogenannten archaî, der Prinzipien. So stellt der gleichermaßen den sieben Weisen zugerechnete Thales als archê, als Anfang und Ursprung von Allem, das Wasser (hydor) heraus, Anaximander das Unbegrenzte (apeiron), und Anaximenes glaubt in der Luft (aér) die allgemeine Substanz zu erkennen.
Das theoretische Paradigma naturphilosophischer Prinzipienforschung wird durch die nachfolgenden Denker ausgebaut. Heraklit erfasst die universelle Bewegtheit des Naturseienden, Parmenides bereitet mit seiner Bestreitung von Bewegung zugunsten eines identischen, statischen ‚Seins‘ die Idee einer dem Wechsel der Phänomene entzogenen und diesen steuernden Instanz vor, der später vom römischen Dichter und Vertreter des philosophischen Atomismus Lukrez (um 99-53 v.Chr.) so genannten lex naturae, des ‚Naturgesetzes‘16, und die Pythagoreer intuieren die zahlhafte Struktur der Naturwirklichkeit und führen erste Experimente zu deren mathematisch-quantitativer Erfassung durch, allerdings erst auf dem uns heute entlegen erscheinenden Feld der musikalischen Tonhöhen. Die Entwicklung dieser sog. vorsokratischen Naturphilosophie kulminiert, vermittelt durch Aristoteles, in der bis in die frühe Neuzeit vertretenen und noch im Gegenwartsbewusstsein topischen Lehre des Empedokles von den vier Grundstoffen (‚Elementen‘; lat. elementa, gr. stoicheioi) Wasser, Erde, Luft und Feuer sowie in dem durch die Denker Leukipp und Demokrit repräsentierten und terminologisch bis in die neueste Physik wirkenden ‚Atomismus‘, der Lehre von den Atomen als Bausteinen der Welt.
Mit Sokrates (470-399 v.Chr.) erfolgt die Abwendung vom naturphilosophischen Paradigma zugunsten einer anthropologich-moralischen Reflexion, die sodann von Sokrates‘ Schüler Platon vertieft und metaphysisch überbaut wird. Platon greift allerdings in einem seiner zahlreichen Dialoge, dem Timaios, die naturphilosophischkosmologische Betrachtungsweise nochmals auf und unternimmt einen Versuch, mittels der Synthese von Elementenlehre und pythagoreischer Zahlenharmonie, einschließlich einiger Anleihen bei dem von ihm ansonsten totgeschwiegenen Atomismus, die Idee einer mathematisch repräsentierten Gesetzesordnung des Kosmos auszuarbeiten – ein Versuch, der sich jedoch souverän, da völlig spekulativ, über die Empirie hinwegsetzt. Erst Aristoteles fügt die frühen Ansätze zu einer großen naturphilosophischen Synthese zusammen, wenn auch unter Auslassung der für wirkliche Naturwissenschaft ja essentiellen mathematischen Dimension und mittels der Verschiebung der Erkenntnisproblematik auf rein begriffliche Erwägungen. Aristoteles‘ Weise der Naturbetrachtung wie seine gesamte Philosophie werden in thomistischer Adaption für das hohe Mittelalter kanonisch, und noch in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts, zur Zeit des beginnenden Humanismus, verfasst der Spätscholastiker Wilhelm von Ockham (kurz vor 1300-1347) eine Kurze Zusammenfassung der Physik des Aristoteles (Summulae in libros physicorum)17.
Der durch Thomas von Aquin (1225-74) rezipierte Aristotelismus ist im hohen Mittelalter gleichbedeutend mit Philosophie überhaupt (Aristoteles wird stets als ‚der Philosoph‘ apostrophiert) und bildet bis in die frühe Neuzeit den verbindlichen Gegenstand des Philosophieunterrichts an den zumeist von der Kirche abhängigen und kontrollierten Universitäten (mit der Sorbonne in Paris als „Alma Mater des europäischen Hochschulwesens schlechthin“)18 und dementsprechend auch an den von Jesuiten geführten Collèges, wie Descartes es in La Flèche absolviert. Wenn Descartes später eine zwiespältige Kritik an dem dort genossenen Philosophieunterricht übt19 (darauf wird noch zurückzukommen sein) und doch andererseits „die Bücher der Alten“ lobt, die man gelesen haben müsse20, liegt darin kein Widerspruch: Descartes‘ Ablehnung richtet sich gegen die sich in begrifflichen Subtilitäten verlierende Naturphilosophie des Aristoteles und dessen als Grundlage von Wissenschaftlichkeit ausgegebene Syllogistik, seine Anerkennung gilt jedoch den vorsokratischen Philosophen und ihrem wenig spekulativen, wenn auch im Ertrag noch rudimentären physikalischen Realismus sowie natürlich den griechischen Mathematikern, an deren Problemstellungen er unmittelbar anknüpft.
2 Emblematische Ereignisse der geschichtlichen Krisis
2.1 Überblick
Wissenschaftliche Theorien, zumal philosophische, sind nicht voraussetzungslos, sondern erwachsen auf historischem Boden – das ist eine einigermaßen triviale Feststellung. Hegel zufolge ist jedes Individuum ein Kind seiner Zeit, und dies gilt natürlich auch für den Philosophen und somit auch für Descartes. Die historischen Zeiten aber werden traditionell in Form der Epochen gegliedert und miteinander verknüpft, und so lässt sich die erste große Philosophie der Neuzeit nicht verstehen ohne einen Blick zurück zu werfen – zumindest bis ins späte Mittelalter und dessen Mitte des 14. Jahrhunderts anhebende finale Krisis.
Auch wenn unter Historikern inzwischen die einen klaren Epochen-schnitt suggerierende Scheidung eines ‚Mittelalters‘ von einer ‚Neuzeit‘ obsolet zu werden beginnt21, ist sie aus philosophischen wie allgemein geistes- bzw. ideengeschichtlichen Gründen unbestreitbar und unverzichtbar. Zumindest soll hier heuristisch an diesen Epochenbegriffen festgehalten werden, zumal, wie oben angeklungen, gerade Descartes gern das Merkmal einer Gründungsfigur neuzeitlichen Philosophierens zugewiesen wird22. Die Epochengliederung ergibt allerdings nur Sinn unter der Annahme eines jeweiligen Übergangsfelds zwischen zwei Zeitaltern, einer dialektischen Durchdringung von Kontinuität und Diskontinuität, mit einem Terminus des Antidialektikers Heidegger gesprochen, der Verwindung einer Epoche23.
Die epochale Scheidung zwischen Antike und christlicher Ära ist im übrigen durch die christliche Theologie selbst in der Frontstellung gegen das am Ende überwundene ‚Heidentum‘ entwickelt und fixiert worden, und wer an der sachlichen Berechtigung dieser Unterscheidung zweifelt, lese einmal Benedetto Croces Aufsatz Perché non possiamo non dirci <cristiani>24. Es steht somit nur die Abgrenzung eines ‚Mittelalters‘ von einer ‚Neuzeit‘ oder ‚Moderne‘ zur Diskussion. Im Verlauf der Untersuchung wird sich auch deren sachliche Berechtigung erweisen. Es ergibt jedenfalls keinen Sinn, wie Le Goff lediglich die Kontinuitäten zwischen Mittelalter und Renaissance herauszuarbeiten, ohne die Brüche zwischen ihnen zu berücksichtigen, und in der Renaissance nur die Schlussphase eines „langen Mittelalters“25 zu sehen. Damit gerät allerdings die Funktion der Renaissance als Katalysator und Impulsgeber für die nach Le Goff erst eigentlich im 18. Jahrhundert einsetzende Neuzeit aus dem Blick, und der Übergang erscheint seinerseits als unmotiviert26.
Hier ist jedoch nicht der Ort, die geschichtliche Struktur einer derartigen Dialektik oder Verwindung der Epochen eingehender darzustellen. Es sollen im Folgenden lediglich einige Bemerkungen zum „Lebenston“27 des Mittelalters und daran anschließend an zwei emblematischen Beispielen die Verwindung des mittelalterlichen Lebensgefühls durch Humanismus und Renaissance zur Anschauung gebracht werden.
Unbestrittenes Lebenszentrum des mittelalterlichen Menschen ist die Religion. So schreibt Le Goff: „Bekanntlich war das Mittelalter eine zutiefst religiöse Epoche, geprägt von der Macht der Kirche und der Stärke einer fast allgegenwärtigen Frömmigkeit“28. Und Johan Huizinga führt in seinem berühmten Werk Herbst des Mittelalters aus: „Das Leben der mittelalterlichen Christenheit ist in all seinen Beziehungen durchdrungen, ja völlig gesättigt von religiösen Vorstellungen. Es gibt kein Ding und keine Handlung, die nicht fortwährend in Beziehung zu Christus und dem Glauben gebracht werden“29.
Diese Ubiquität des Religiösen nimmt mitunter Formen an, die Späteren als geradezu grotesk erscheinen müssen. Ein Beispiel dafür ist der Mystiker und Schüler Meister Eckharts, Heinrich Seuse (1295-1366), von dem Huizinga berichtet: „Bei Tisch pflegte Seuse, wenn er einen Apfel aß, diesen in vier Teile zu zerschneiden: drei Teile verzehrte er im Namen der Dreieinigkeit, und den vierten aß er <in der minne, al diu himelsch muter irem zarten kindlein Jesus ein epfelli gab zu essen>“, also in liebevollem Andenken daran, wie die Gottesmutter ihrem zarten Kind einen Apfel gab, und „er aß dieses letzte Stück mit der Schale, weil kleine Knaben Äpfel ungeschält essen. In den Tagen nach Weihnachten – zur Zeit also, da das Jesuskind noch zu klein war, um Äpfel zu essen – aß er das vierte Stückchen nicht, sondern opferte es Maria, damit sie es ihrem Sohn gäbe. Jeglichen Trunk nahm er in fünf Zügen zu sich, um der fünf Wunden des Herrn willen; da aber aus Christi Seite Blut und Wasser floß, tat er den fünften Zug zweimal“30. – „Das“, so Huizingas Kommentar, „ist das <Heiligen aller Lebensbeziehungen> in seiner konsequentesten Form“31 – einer Form, darf man hinzufügen, die durch einen extrem veräußerlichten Formalismus gekennzeichnet ist, der allerdings dem Individuum in seiner Schwäche und seinem Sinnbedürfnis eine Stütze geben mag.
Wir können uns wohl das mittelalterliche Lebensgefühl am ehesten wie eine Art Traum vorstellen, ganz der Transzendenz zugewandt bzw. zwischen Himmel und Erde, Diesseits und Jenseits oszillierend. Zur Illustration mag der Hinweis auf die Architektur der gotischen Dome dienen. Bekanntlich drücken sie den mittelalterlichen ‚Zug nach oben‘ durch ihre schwindelerregend aufragenden Kirchenschiffe und Türme aus. Ebenso vielsagend sind die durchlaufend und erhöht angebrachten bunten Glasfenster voller biblischer und ‚himmlischer‘ Szenen. Nicht nur bringen sie, von der Sonne durchstrahlt, dem Frommen die Glaubensinhalte anschaulich nahe, sie umstellen ihn vielmehr mit einem himmlischen Panoptikum, und wie er zu den heiligen Gestalten aufblickt und sich dadurch in die höhere Sphäre versetzt fühlt, sieht er sich von ihnen angeschaut und in ihren Bereich hineingenommen: Im Schauen fließen ihm Irdisches und Himmlisches ineinander.
Nur in solch mystischer, traumdurchsponnener Atmosphäre, in der Ideales und Reales verschmelzen, konnten sich Ideen wie die der Kreuzzüge zur Befreiung Jerusalems und der heiligen Stätten der Christenheit bilden, die eine Zeitlang gewaltige Anziehungskraft ausübten (und bei denen die religiöse Motivation der Beteiligten weder die krude Verfolgung von persönlichen und Machtinteressen noch die Begehung abscheulicher Grausamkeiten ausschloss).
Philosophisch reflektierte sich diese Haltung in dem uns heute abstrus erscheinenden Universalienstreit, der Jahrhunderte dauernden Diskussion darüber, ob den Allgemeinbegriffen oder den durch diese bezeichneten Einzeldingen der größere Realitätsgehalt zukomme – als hätten Begriffe eine vom Denken unabhängige Wirklichkeit.
Aber die hypertrophe Religiosität, die religiöse ‚Hochspannung‘, konnte nicht Bestand haben. Was sich bei dem Mystiker Seuse als innige Liebe zu Gott darstellt, entartet auf der Ebene des bildungsfernen Volks zur „fast mechanischen [Vervielfältigung] der heiligen Gebräuche“32 und zu krudestem Aberglauben.
Und während in Deutschland Männer wie Meister Eckhart und Heinrich Seuse im Geist der Devotio moderna und der Imitatio Christi die Glaubensinnerlichkeit auf ihre Spitze treiben, entfalten sich im lateinischen Süden Europas erste Züge einer neuen Weltzuwendung und Selbstvergewisserung des Menschen und führen zur geistigen Neuorientierung in Form des Humanismus und der Renaissance. Dieser Epochenwandel darf als historische Vorbereitung auf Descartes‘ denkerische Unternehmung nicht unberücksichtigt bleiben. Statt ihn in allgemeinen Begriffen zu referieren, veranschauliche ich ihn in Form zweier Exkurse an zwei konkreten, allerdings emblematischen Beispielen.
Das erste Beispiel betrifft eine Episode aus dem Leben des italienischen Frühhumanisten und Dichters Francesco Petrarca (1304-1374). Kaum jünger als der erwähnte Seuse und damit zeitlich noch im Spätmittelalter zu verorten, löst er sich doch schrittweise aus dessen Verengungen. Er ist auch der erste, in dem das Bewusstsein aufgeht, dass eine Epoche sich ihrem Ende nähert und eine neue anhebt, und er prägt für die vergehende die abwertende, aber bis heute gültige Bezeichnung Media Ætas – Mittelalter, welche das Millenium zwischen der untergegangenen Antike und der sich auf diese rückbesinnenden Gegenwart zu einem bloßen Intermezzo herabsetzt. Petrarcas berühmte, im Folgenden näher zu betrachtende Schilderung seiner Besteigung des Mont Ventoux in der Provence ist ein Dokument des einsetzenden Wandels.
2.2 26. April 1336: Besteigung des Mont Ventoux durch den Dichter und Humanisten Francesco Petrarca
Es ist die Schönheit und Majestät des mächtigen Mont Ventoux, des mit über 1900 Metern höchsten Berges der Provence, der den humanistischen Dichter Francesco Petrarca nach eigenem Zeugnis so fasziniert hat, dass er am 26. April des Jahres 1336 zusammen mit seinem jüngeren Bruder Gherardo den Berg in einem anstrengenden Tagesmarsch bezwang. Petrarca selbst berichtet von der Unternehmung in einem Brief an seinen Freund und Mentor Francesco Dionigi (1280-1342), Augustinermönch, Bischof von Monopoli bei Neapel und Professor für Theologie und Philosophie an der Sorbonne:
„Den höchsten Berg dieser Gegend, den man nicht zu Unrecht Ventosus, ‚den Windigen‘ nennt, habe ich am heutigen Tag bestiegen, allein vom Drang beseelt, diesen außergewöhnlich hohen Ort zu sehen. Viele Jahre lang hatte mir diese Besteigung im Sinn gelegen; seit meiner Kindheit habe ich mich nämlich, wie du weißt, in der hiesigen Gegend aufgehalten, wie eben das Schicksal mit dem Leben der Menschen sein wechselvolles Spiel treibt. Dieser Berg aber, der von allen Seiten weithin sichtbar ist, steht mir fast immer vor Augen“33.
Der langjährige Aufenthalt in der Provence, auf den Petrarca als schicksalhaftes Ereignis anspielt, verdankte sich tatsächlich besonderen Umständen: Im Jahre 1302 hatte Francescos Vater, ein angesehener florentinischer Notar, an einer politischen Verschwörung teilgenommen und wurde mit Verbannung bestraft. Deshalb kommt Francesco 1304 im Exil in Arezzo zur Welt. Nach allerlei Irrfahrten gelangt die Familie schließlich nach Avignon, der Residenz der zu jener Zeit aus Rom vertriebenen Päpste. Der Vater findet hier eine Anstellung, jedoch keine Unterkunft. Deshalb nimmt die Familie Wohnung im nahegelegenen Landstädtchen Carpentras, das in Sichtweite zu dem eindrucksvollen Berg liegt. Hier betreibt Francesco mit großer Begeisterung seine ersten Studien der antiken Literatur, die seinen Ruhm als Wegbereiter des Humanismus begründen werden, und hierher kehrt er 1326 nach Beendigung des ungeliebten, aber vom Vater erzwungenen juristischen Studiums an der damals berühmten Universität Bologna zurück. In Avignon begegnet Petrarca am Karfreitag des Jahres 1327 in einer Kirche Madonna Laura, der ‚edlen Frau‘, die er zeit seines Lebens aus demütiger Ferne verehren wird. In seinem nicht wie damals üblich auf Lateinisch, sondern – auch dies ein Zeichen des beginnenden Wandels – in der Volkssprache Italienisch verfassten Gedichtzyklus Canzoniere hat Petrarca dieser Liebe ein literarisches Denkmal gesetzt.
Was aber macht die so viele Jahre zurückliegende Besteigung des Mont Ventoux zu einem Ereignis, das es wert ist, in Erinnerung gerufen zu werden? Die Bedeutung ist eine geistesgeschichtliche, und sie liegt in der vom Dichter selbst gegebenen Begründung, das Motiv seiner Unternehmung sei die curiositas, die Neugierde gewesen, diesen ungewöhnlichen Fleck Erde mit eigenen Augen kennenzulernen. Denn mit dieser Erklärung stellt die Unternehmung das vermutlich erste historische Zeugnis einer Landschaftserkundung dar, die keinen praktischen Nutzen im Auge hat und weder kriegerischen noch wirtschaftlichen Zwecken dient, sondern rein um ihrer selbst willen geschieht, die dem Verlangen entspringt, die Natur in ihrer Eigenart zu erleben und ihre Schönheit zu genießen.
Uns Menschen des 20. und 21. Jahrhunderts, die vom Fernweh und der Sehnsucht nach unberührter Natur getrieben in die entlegensten Zonen des Erdballs aufbrechen, in die Karibik, zum Nordkap und nach Feuerland, das heiße Innere Australiens durchqueren und vom seltsamen Charme der in die Wüste gesetzten Wolkenkratzer Dubais angezogen werden, erscheint Petrarcas Wunsch freilich nicht als ungewöhnlich.
Für dessen Zeitgenossen jedoch hat in jener Epoche des Übergangs vom Mittelalter zur Neuzeit, die Natur einen gänzlich anderen Stellenwert. Die große Mehrheit lebt bäuerlich und damit ohne Alternative ‚naturnah‘. Doch ist die Existenz gerade deshalb erhöhten Gefahren ausgesetzt. Ungünstige Witterung führt zu Missernten und Hungersnöten, die fehlenden technischen Möglichkeiten machen die Arbeit zu erschöpfender Fron und in den Zonen nicht gerodeten Landes ist das Leben mitunter durch Raubtiere, durch Bären und Wölfe, bedroht. So fühlt sich der arbeitende Mensch jener Zeit oft hilflos eingespannt zwischen die launische, mitunter gewalttätige Natur und seinen feudalen Herrn.
Und noch etwas kommt hinzu: für den gläubigen Menschen des Mittelalters bildet, wie im Vorhergehenden festgestellt und an Heinrich Seuses Stil der Frömmigkeit exemplifiziert, die Religion das Zentrum des Lebens. Das irdische Dasein gilt als Zeit der Vorbereitung auf das ‚ewige‘ Leben, das als das eigentliche betrachtet wird. Der Mensch ist Viator mundi, ein Pilger durch das irdische Jammertal auf dem Weg zur himmlischen Heimat. Man fürchtet, dass die Hingabe ans Weltliche – und dazu zählt auch der Naturgenuss – die Seele von ihrer eigentlichen Bestimmung, der Hinwendung zu Gott, ablenkt und so die Erlangung der ‚ewigen Seligkeit‘ bedroht. Bedeutendster und wirkungsvollster Inspirator solch radikaler Weltverneinung war der Kirchenvater Augustinus, der im Verlangen nach mundanem Wissen, also der seit je die Philosophie antreibenden curiositas, nichts als „Begierlichkeit der Augen“ und eine Variante der allgemeinen menschlichen Konkupiszenz, folglich eine Sünde zu sehen vermochte34.
In Petrarcas Lebensanschauung jedoch kündigt sich eine Hinwendung zum Irdischen, zur Natur wie zur Geschichte, d.h. eine Zurückweisung der mittelalterlichen „Curiositas-Verdikte“35 an, und der zitierte Bericht, dem wir uns jetzt zuwenden wollen, dokumentiert dies.
Francescos Bericht
Im Morgengrauen des 26. April 1336 brechen Francesco und der Bruder Gherardo in Begleitung zweier Träger vom Örtchen Malaucène zu Füßen des Berges zu ihrer Wanderung auf. Bald treffen sie auf einen alten Schafhirten, der ihnen eindringlich von ihrem Vorhaben abrät. Er habe selbst in jungen Jahren den Aufstieg versucht, aber nichts heimgebracht als Erschöpfung und Reue. Seit jener Zeit aber sei nie mehr der Versuch gemacht worden, den abweisenden Berg zu bezwingen. Die Brüder schlagen jedoch die Mahnung des Alten in den Wind; „ungläubig wie eben jugendliche Herzen Warnern gegenüber sind“36, wächst ihnen „am Verbot das Verlangen“37.
Das Erlebnis des Aufstiegs ist aber für Francesco nicht in sich selbst gehaltvoll, sondern gerät ihm, noch ganz im Geiste des Mittelalters, unversehens zum Gleichnis für die Pilgerfahrt der menschlichen Seele zum Ziel alles Strebens: Während der zielorientierte Bruder unbeirrt und geradlinig auf steilen Wegen dem Gipfel zustrebt, sucht der feinsinnige und weniger robuste Francesco die Mühe des Aufstiegs durch die Wahl sanfter verlaufender Pfade zu mildern. Doch er muss bekümmert feststellen, dass seine Weichlichkeit ihn mitunter gar keine Höhe gewinnen lässt und es dann verdoppelter Anstrengung bedarf, um den vorauseilenden Bruder, der Francescos Schwierigkeiten mit freundlicher Ironie kommentiert, wieder einzuholen. Dessen Gedanken aber greifen über das Hier und Jetzt hinaus:
„Dort schwang ich mich auf den Flügeln des Geistes vom Körperlichen zum Unkörperlichen hinüber und ging mit mir selbst mit ungefähr folgenden Worten ins Gericht: ‚Was du heute so oft bei der Besteigung dieses Berges erfahren hast, wisse, daß dies dir und vielen widerfährt, die das selige Leben zu gewinnen suchen [] In der Tat liegt das Leben, das man das selige nennt, auf hohem Gipfel, und ein schmaler Pfad, so heißt es, führt zu ihm hin‘“38.
Und doch vermögen diese frommen Betrachtungen Petrarcas Lust am Schauen nicht auf Dauer zu bezwingen. Auf dem Gipfel des Berges angelangt, ergreift ihn die Gewalt der Eindrücke mit Macht:
„Zuerst stand ich, durch den ungewohnten Hauch der Luft und die ganz freie Rundsicht bewegt, einem Betäubten gleich da. Ich schaue zurück nach unten: Wolken lagen zu meinen Füßen [] Ich wende dann meine Blicke in Richtung Italien, wohin mein Herz sich stärker hingezogen fühlt. Die Alpen selber, eisstarrend und schneebedeckt [] zeigten sich mir ganz nah, obwohl sie weit entfernt sind. Ich seufzte, ich gestehe es, nach italischer Luft, die mehr dem Geist als den Augen sich darbot, und ein unwiderstehliches, brennendes Verlangen erfaßte mich, sowohl Freund als Vaterland wiederzusehen []“39 – die antiken Ideale von Freundschaft und Vaterlandsliebe klingen an.
Und während der Bruder wegen der vorgerückten Stunde bereits zum Abstieg mahnt, erwacht in Francesco vollends das ‚landschaftliche Auge‘ und erschließt ihm die Großartigkeit der Szenerie:
„[Gleichsam geweckt,] wandte ich mich um und blickte zurück gegen Westen []. Der Grenzwall der gallischen Lande und Spaniens, der Kamm der Pyrenäen sind von dort nicht zu sehen, nicht weil, soviel ich weiß, irgendein Hindernis dazwischenträte, nein allein infolge der Schwäche der menschlichen Sehkraft“40 – das ist noch typisch mittelalterlich: die Unzulänglichkeit des Menschen ist stets die Erklärung für jegliche Schranke, die Frage nach dem Verursacher wird nicht gestellt. Doch Francesco fährt fort zu schauen: „Die Berge der Provinz von Lyon [] zur Rechten, zur Linken sogar der Golf von Marseille und der, der an Aigues-Mortes brandet, waren ganz deutlich zu sehen, obwohl dies alles einige Tagereisen entfernt ist. Die Rhône lag geradezu unter meinen Augen. Während ich dies eins ums andere bestaunte und bald an Irdischem Geschmack fand, bald nach dem Beispiel des Körpers die Seele zu Höherem erhob, kam ich auf den Gedanken, in das Buch der Bekenntnisse des Augustinus zu schauen“41.
Und hier, in den berühmten Confessiones des Kirchenvaters Augustinus, die auf Petrarca stets eine tiefe Wirkung ausgeübt hatten, stößt er auf einen Satz, den er als auf sich selbst gemünzt empfindet und der ihn schließlich das ganze Unternehmen der Bergbesteigung als eitel und nichtig verwerfen lässt. Dort liest er:
„Und es gehen die Menschen hin, zu bewundern die Höhen der Berge und die gewaltigen Fluten des Meeres [] und verlassen dabei sich selbst‘“42.
Tief betroffen durch diese Aussage, die der große Theologe und Philosoph des vierten Jahrhunderts gegen die Weltfreude und Diesseitsorientierung des antiken Menschen gerichtet hatte, tritt Petrarca den Rückweg an. Mit dem Entschluss, sich ebenfalls von der Welt abzuwenden und nur noch dem Heil der Seele nachzustreben, zerfällt die Landschaftsempfindung in ihm:
„Wie oft, glaubst du, habe ich an diesem Tag auf dem Rückwege mich umgewendet und den Gipfel des Berges betrachtet, und er schien mir kaum die Höhe einer Elle zu haben im Vergleich zur Höhe menschlicher Betrachtung, wollte man sie nur nicht in den Schmutz irdischer Gemeinheit eintauchen [non in lutum terrene feditatis immergeret]“43.
Mit dieser Abwertung des Irdischen als dem eo ipso Schmutzigen und Gemeinen behält bei Petrarca – bereits am Ausgang der Epoche – die mittelalterlich geprägte Weltverneinung, zumindest literarisch, noch einmal die Oberhand. Zwar ist die Rede von der „Höhe menschlicher Betrachtung“ bereits humanistisch-neuzeitlich, zwar hat Francesco das Neue getan, hat praktisch die Hinwendung zur interessierten Betrachtung der Natur vollzogen, und in diesem thaumázein, dem Sich-Verwundern, liegt ja nach Auffassung des Aristoteles der Ursprung von Wissenschaftlichkeit44. Aber Francesco begreift dies Neue noch nicht als solches und wagt nicht, es mit Lebensbedeutung zu erfüllen. Noch ist die Macht des Akosmismus zu groß, um dem Individuum ein vorbehaltloses Ja zu sich selbst im Hier und Jetzt zu erlauben.
Vielleicht hat aber auch der Text nur die Form eines Briefes und solche Identifikation des Erzählers mit dem Autor greift zu kurz. Der große Schweizer Kulturhistoriker und Freund Nietzsches Jakob Burckhardt (1818-1897) hatte Petrarca als einen der ersten völlig modernen Menschen bezeichnet und dessen Modernität in seiner subjektiven Hinwendung zum weltlichen Dasein, etwa in der poetischen Hingabe an das Erlebnis der Liebe zu Laura, gesehen. Aber der Text zeigt uns eine zweite Form von Modernität, die sich verkörpert in der stummen Rolle des Bruders mit dem germanischer Tradition entstammenden Namen Gherardo (Gerhard). Wir erfahren nicht, was Gherardo denkt und fühlt, aber wir sehen ihn konstant und besonnen, ohne sich in theologisch-philosophische Betrachtungen zu verlieren, dem ins Auge gefassten Ziel zuschreiten. Auf dem Gipfel ist wiederum er es, dem die Notwendigkeit rechtzeitigen Abstiegs in den Sinn kommt, der umsichtig Weg und Zeit ins Verhältnis setzt.
So zeigt uns der Text zwei Aspekte der Modernität: in Francesco die Hinwendung zum romantischen Naturerleben und im Bruder Gherardo den rationalen, zielorientiert die Zweck-Mittel-Relation berücksichtigenden Tätigen.
Es gehört indessen zur Dialektik des Geistigen, dass auch das explizit Negierte, wie in Francescos Verwerfung des Irdischen am Schluss des Briefes, insofern es ausgesprochen bzw. der Schriftform übergeben wird, in die Welt tritt. Der Autor trägt die Widersprüche der Epoche in sich aus, wie übrigens jeder andere Mensch auch – aber in seinen Schriften werden sie manifest. Die in Petrarcas Text greifbar werdende Spannung zwischen der spontanen Hingabe an ein profanes Erlebnis und der expliziten Negation seines Wertes lässt sich lesen als subjektiver Reflex der den Epochenwandel kennzeichnenden Dialektik von Fortschritt und Beharrung.
2.3 7. Dezember 1486: Der Thesenanschlag des Pico della Mirandola
Das zweite geistesgeschichtlich symbolträchtige Ereignis, von dem zu berichten ist, erfolgt (was nichts besagen will) genau 150 Jahre nach der Besteigung des Ventoux durch Petrarca, und wiederum ist sein Protagonist ein noch junger, dabei wie jener am geistigen Leben der Zeit intensiv interessierter Mann, Italiener wie Petrarca: Es handelt sich um den 1463 geborenen und bereits 1494 im Alter von nur 31 Jahren verstorbenen Giovanni Pico della Mirandola, Graf von Concordia, einer Herrschaft in der oberitalienischen Emilia, nahe Bologna. Pico ist ein Denker „voll von neuen Fermenten“45 und nach dem Urteil mancher Geisteshistoriker der „faszinierendste italienische Denker des [15.] Jahrhunderts“46.
Auch Picos Unternehmung ist gekennzeichnet durch eine gewisse jugendliche Kühnheit und den Versuch, geistige Schranken zu überwinden. Und auch sein Projekt bleibt unvollendet, allerdings nicht durch eigene, innere Hemmung wie bei Petrarca, der zwar den Berg bezwingt, aber sein Ja zur Welt, zum profanen Wissen und zum Naturgenuss wieder zurücknimmt. Bei Pico verhält es sich umgekehrt. Zwar scheitert sein Plan an äußeren und als solchen für ihn unüberwindlichen Widerständen, aber in seiner Haltung bleibt er unberührt.
Im Unterschied zu der persönlich motivierten, wenn auch, als Ausdruck des Willens zu einer neuen Weltlichkeit, symbolhaltigen Aktion Petrarcas zielt Picos Plan von vornherein auf Außenwirkung und ist entsprechend spektakulär angelegt: Am 7. Dezember des Jahres 1486 publiziert der junge, nicht einmal 24 Jahre alte Adelige durch öffentlichen Anschlag ein Manifest mit 900 (sic!) Thesen (‚Conclusiones‘) philosophischer und religiöser Natur, und er verbindet diese Demonstration seines geistigen Standorts mit einer Einladung an alle Gelehrten von Europas Universitäten, in öffentlicher Disputation diese von ihm vertretenen Thesen auf die Probe zu stellen, und zwar an keinem geringeren Ort als in Rom, dem Sitz der Kurie und der Hauptstadt des christlichen Abendlandes. Die von Pico für die Disputation vorbereitete einleitende Rede (‚Oratio‘), von der noch zu sprechen sein wird, schließt mit der unmissverständlichen Aufforderung an die „hochverehrten Väter“47, das heißt die erwarteten geistlichen Würdenträger: „[] so laßt uns mit dem Wunsche für Erfolg und Glück, als tönte das Signal einer Trompete, nun das Gefecht beginnen“48.
Allein die Konzeption eines solchen Projekts kann als Indiz einer sich in Gärung befindlichen Zeit gedeutet werden, und beiläufig erinnere ich daran, dass Luthers Thesenanschlag in Wittenberg nur gut dreißig Jahre später erfolgte. Denn durch das Mittelalter hindurch ist (ungeachtet bestimmter theologischer und philosophischer Auseinandersetzungen innerhalb der geistlichen Zunft) die Wahrheitsfrage monopolisiert, und die ausschließliche Zuständigkeit dafür liegt bei der kirchlichen Autorität, in letzter Instanz beim Papst bzw. den Konzilien. Im Prinzip gilt diese Frage auch als beantwortet: Die Wahrheit ist verkörpert in der christlichen Religion, im katholischen (d.h. ‚allgemeinen‘) Glauben. Für einzelne Streitfragen hinsichtlich der angemessenen Interpretation der biblischen Lehre sind die Doctores der Theologie und Philosophie an den im späten Mittelalter aufblühenden Universitäten zuständig, allesamt zugleich Geistliche bzw. Ordensleute und/oder in gehobenen Positionen der kirchlichen Hierarchie tätig, etwa als Bischöfe und Kardinäle, und damit in letzter Instanz wieder dem Papst gegenüber verantwortlich. Mit den im 13. Jahrhundert entstandenen großen Summen des Thomas von Aquin (1225/7-1274), der Summe der Theologie und des philosophischen Hauptwerks Summe gegen die Heiden (Summa contra Gentiles, gerichtet gegen die Glaubenslosen, nicht so sehr gegen Moslems und Juden) haben christliche Philosophie (eine andere ist nicht zugelassen) und Theologie im Prinzip ihre definitive, im Katholizismus bis heute kanonische Ausbildung erfahren.
Welches waren Picos Thesen und welchen Zweck verfolgte er mit der geplanten Disputation? Nach Picos eigenen Worten sind „die im folgenden angeführten Thesen – neunhundert an der Zahl – aus den Gebieten der Dialektik [d.h. Logik], der Moralphilosophie, der Physik [d.h. Naturphilosophie], der Mathematik, der Metaphysik, der Theologie, der Magie und der Kabbalistik [entnommen und enthalten] teils eigene Gedanken [nämlich 200 der Thesen], vor allem aber Ansichten der Chaldäer [d.h. Perser], Araber, Juden, Griechen, Ägypter und Lateiner“49.
Unabhängig vom konkreten Inhalt der Thesen verweist schon die Nennung der Quellen auf eine Ansammlung heterogener Lehren. Die breite Auswahl erklärt sich aus Picos Überzeugung, dass eine jede tradierte Lehre Anteil an der Einen Wahrheit habe und dass sich dem zufolge „die Vereinbarkeit aller philosophischen Traditionen [müsse] nachweisen [lassen]“50. Picos Ideal ist die „pax philosophorum [], die Versöhnung aller Philosophien“51 auf der Basis eines „umfassenden Synkretismus“52, eine Bestrebung, die ihm in Anspielung auf seine Herkunft den ironisch gemeinten Titel eines Princeps Concordiae, eines ‚Fürsten der Eintracht‘, eingebracht hat.
Es liegt auf der Hand, dass die Kirche mit einer solchen Infragestellung ihres Alleinstellungsmerkmals und des Absolutheitsanspruches ihrer Doktrin nicht einverstanden sein konnte und sich nicht mit orientalischer Esoterik wie der jüdischen Kabbala und den chaldäischen Orakeln auf eine Stufe gestellt sehen wollte, und entsprechend wurde die Disputation von Papst Innozenz VIII. untersagt. Als Gründe für das Verbot führte man die nicht zu bestreitende Maßlosigkeit des ganzen Projekts an: Picos Anspruch, in seinem jugendlichen Alter mit der gesamten Gelehrtenwelt über gleich 900 Thesen zu disputieren, belege sein Bedürfnis, mit seiner Bildung großzutun und sei Ausdruck von Selbstüberschätzung – ein verständlicher Vorwurf, wenn man sich vergegenwärtigt, dass die akademische Doktorarbeit seit je nur die Ausarbeitung einer einzigen wissenschaftlichen These fordert.
Picos Gegner denunzierten zudem dreizehn der Thesen als häretisch. Als Pico sich in einer Apologia dagegen verteidigt, verwirft der Papst kurzerhand alle neunhundert Thesen. Um sich einer Anklage wegen Häresie zu entziehen, flieht Pico nach Frankreich, wird aber bei Lyon verhaftet und nach Rom ausgeliefert. Erst zwei Jahre später wird er auf Betreiben der Medici freigelassen. Fortan lebt er in Florenz, unter dem Schutz Lorenzos des Prächtigen, und tritt wieder in Verbindung mit Marsilio Ficino (1433-1499), dem Haupt der von Lorenzo als Gegengewicht gegen den herrschenden klerikalen Aristotelismus gestifteten neuen ‚platonischen Akademie‘. Im Jahr 1492, zwei Jahre vor seinem frühen Tod (und im Jahr von Kolumbus‘ Entdeckung Amerikas), wird Pico vom inzwischen inthronisierten Borgia-Papst Alexander VI. rehabilitiert.
Die Überwindung der traditionellen Kluft zwischen Aristotelismus und Platonismus, vereinfacht gesagt zwischen Idealismus und Transzendenzverlangen einerseits, empirisch orientiertem Rationalismus andererseits, war ein Hauptanliegen des Versöhners Pico, der in Padua und Paris den (scholastischen) Aristotelismus mit Interesse studiert hatte, zugleich aber dem überschwänglichsten Platonismus zuneigte. Der Kontrast dieser Lehren bricht allerdings bereits bei den Schulgründern selbst auf: Aristoteles kritisiert die Ideen-Konzeption seines Lehrers an diversen Stellen seines Werks und apostrophiert die Ideen abfällig als ‚Vogelgezwitscher‘, Platon seinerseits klagt, der Jüngere habe gegen ihn ausgetreten wie ein junges Füllen gegen die Mutter53.
Der Dissens der beiden größten Philosophen hat seine eindrucksvolle Darstellung in Raffaels um 1510 geschaffenem Fresko Die Schule von Athen in den Stanzen des Vatikan gefunden – ein Beleg für die zeitgenössische Aktualität des Themas. Das Gemälde zeigt Platon und Aristoteles, herausgehoben inmitten weiterer antiker Philosophen und Mathematiker; Platon hält seine kosmologische Spekulation Timaios in der einen Hand und weist mit der anderen zum Himmel, zum Reich der über alles Sichtbare hinausreichenden Ideen und der ewigen göttlichen Schönheit, Aristoteles präsentiert seine Nikomachische Ethik und weist mit ausgestreckter Hand nach vorn, in Richtung des Betrachters, auf den vor Augen liegenden und den Menschen zur Erkenntnis und zur Bewährung rufenden Bereich des Erfahrbaren und Zwischenmenschlichen.
Nicht weniger radikal als Picos gesamtes Projekt, das ja im Grunde nichts Geringeres als eine generelle Revision der Wahrheitsauffassung anstrebt, ist ein einzelner Aspekt der Unternehmung. Pico hat zur Eröffnung des Kongresses eine Rede vorbereitet, die die geistlichen Teilnehmer auf seine Sicht einstimmen soll: deren Kernstück besteht in der Propagierung eines neuen Menschenbilds. Um ihre Bedeutung voll zu erfassen, bedarf es einiger vorbereitender Hinweise.
Gattungskonform hat Pico seine Rede nicht mit Titel versehen, und er hat sie, bedingt durch das Scheitern seines Projekts sowie seinen frühen Tod, auch nicht selbst veröffentlichen können. Erst in einer nach seinem Ableben erstellten Ausgabe seiner Schriften erhält sie den Titel, unter dem sie berühmt wurde: De hominis dignitate – Über die Würde des Menschen. Dieser Titel ist allerdings nicht originell, denn bereits einige Jahre zuvor hatte der Florentiner Humanist Giannozzo Manetti (1396-1459) seinen Traktat De dignitate et excellentia hominis (‚Über die Würde und Vorzüglichkeit des Menschen‘) veröffentlicht. Doch weist gerade diese Doublette auf eine wichtige Zeittendenz, nämlich auf den Durchbruch einer neuen, optimistischen Anthropologie.
Vorgearbeitet worden war dieser Tendenz durch Petrarca, der den Menschen als homo creator, als schöpferisches Wesen definiert hatte. Damit war er über die klassische aristotelische Definition des Menschen als vernunftbegabtes bzw. sprachlich verfasstes Wesen (zôon logon echon) und staatliche Gemeinschaften bildendes Wesen (zôon politikón) hinausgegangen und hatte ihn durch Zuweisung des bis dato allein Gott vorbehaltenen Schöpfer-Attributes nobilitiert – und die Bedeutung der Kategorie des Schöpferischen ist ja für das Selbstverständnis der Renaissance kaum zu überschätzen.
Solche Aufwertung des Menschen gewinnt ihre Kontur erst vor dem Hintergrund des mittelalterlichen Menschenbildes. Wenn aus christlicher Sicht, wie an den Bemerkungen zur mittelalterlichen Frömmigkeit und an dem ebenfalls auf der Schwelle des Wandels stehenden Petrarca illustriert, die eigentliche Bestimmung des Menschen das jenseitige, ‚ewige‘ Leben ist, wird das Diesseitsleben zur bloßen Phase der Bewährung ohne Eigenwert herabgesetzt, es wird zur Vorbereitung, zum Wartestand. Einer solchen Denkweise geht natürlich der Wert des Gemeinschaftslebens nicht auf und setzt keine Energie für dessen Gestaltung frei. Die Beschwernisse des Daseins auf individueller wie sozialer Ebene treffen den Einzelnen ungemildert, da unbegriffen: Armut und Alter, Krankheit, Krieg und Plünderung, verderbliche Naturereignisse ebenso wie wirtschaftliche Ausbeutung und politische Repression, verschärft noch durch die Last des Sündenbewusstseins und die Androhung ewiger Strafe, werden als schicksalhaft und gottgegeben erlebt.
Vor dem Hintergrund solchen Denkmusters erklärt sich eine Schrift wie die des Kirchenrechtlers Lotario di Segni, des späteren Papstes Innozenz III. (1160-1216), mit dem Titel De miseria humanae conditionis (‚Über das Elend der menschlichen Situation‘) von 1195. Der Mensch ist für Lotario nur ein Auswurf, körperlich ein vergänglicher Haufen Kot, von Sünde befleckt und zu ewiger Höllenstrafe bestimmt: „Die Strafen ändern sich, aber sie hören nie auf“54. Die einzige Hoffnung auf Heil liegt in der Kirche und ihrem Oberhaupt, dem Papst, „in die Mitte gestellt zwischen Gott und Mensch, diesseits Gottes, aber jenseits des Menschen, weniger als Gott, aber mehr als ein Mensch[!]“55. Und noch 1455 handelt der Florentiner Humanist Poggio Bracciolini (1380-1459) in einem von Enttäuschung geprägten Alterswerk das Thema Mensch unter dem gleichen Titel ab: De miseria conditionis humanae. Man sieht: statt im Rahmen des Möglichen auf Milderung der menschlichen Leiden zu sinnen, werden diese zur conditio humana hypostasiert.
Gegen den anthropologischen Pessimismus wendet sich die Hauptrichtung von Humanismus und Renaissance. Dabei ist zu beachten, dass beide Auffassungen vom Menschen, wie gar nicht anders möglich, Vereinseitigungen, perspektivische Verzerrungen darstellen, die jeweils einen Zug überbetonen. Die Lebenssituation der meisten Menschen der Renaissance ist, wie sozial bewusste Forscher wie Eugenio Garin immer wieder betonen, elend genug: Es herrschen wie eh und je Ausbeutung, Armut der Vielen, maßloser Reichtum Weniger, kurz: das Hobbessche homo homini lupus – der Mensch dem Menschen ein Wolf.
Die Kirche als Verwalterin metaphysischen Trostes und – gerade in Gestalt des Renaissance-Papsttums – Nutznießerin der Verhältnisse hat alles Interesse daran, diese Situation als konstitutionell und damit unveränderlich zu beschreiben. Dagegen decken die Intellektuellen, in der Rückschau auf eine idealisierte Antike, die andere, produktive Seite des Menschen auf und, wie alle Entdecker, verabsolutieren sie den Wert ihrer Entdeckung und übertreiben die kreativen Züge des Menschen hervor, das heißt, sie idealisieren ihn. Und während die erste, die kirchliche Einseitigkeit konservativ, auf Verewigung der Verhältnisse gerichtet ist, will die zweite Potentiale, Möglichkeiten erschließen. Und auch wenn die Entwicklung dieser Potentiale sich vorerst nur in einer großartigen Blüte der bildenden Kunst niederschlägt, erschließt sie doch den Sinn für künftige Veränderung.
In Picos Rede findet diese optimistische Anthropologie ihren unüberbietbaren Ausdruck. Dargeboten wird sie, in Anlehnung an eine Schrift Platons und zugleich an die biblische Genesis, in Form eines Mythos über die Erschaffung des Menschen (die Rede von Erschaffung selbst ist bereits mythisierend). Auf den platonischen Mythos gehe ich kurz ein.
Platons Erzählung findet sich im Frühdialog Protagoras (St. 320ff.), und sie wird von der Titelfigur, dem Sophisten Protagoras, selbst vorgetragen. Ihr Inhalt ist, in kurzen Worten, der folgende: Als die Götter beschlossen hatten, Lebewesen zu erschaffen, beauftragten sie Prometheus und seinen Bruder Epimetheus damit, eine jede Art mit den natürlichen Eigenschaften auszustatten, die ihr die Lebensfristung ermöglichten und sicherstellten, dass keine Gattung je als ganze von ihren natürlichen Feinden ausgerottet würde (das ist sozusagen eine frühe Fassung der Idee ökologischen Gleichgewichts!). Der gedankenschwache, sich selbst überschätzende Epimetheus überredet seinen Bruder, ihm die Zuteilung der Eigenschaften zu überlassen, und so versieht er die eine Art mit körperlicher Kraft, um Beute zu machen, eine andere mit Schnelligkeit zu rascher Flucht, schafft ihnen Fell für den Winter, Flügel zum Fliegen, Höhlen für den Rückzug usw. Als es an die Ausstattung des Menschen geht, stellt Epimetheus bestürzt fest, dass er seinen Werkzeugkasten erschöpft hat und nun der Mensch nackt und mittellos im Dasein steht. Um dem abzuhelfen, stiehlt, wie bekannt, der kluge Prometheus den Göttern das von Athene gehütete Feuer sowie dem Hephaistos die Schmiedekunst, d.h. die technische Intelligenz und rüstet den Menschen mit beidem aus. Doch auch dies reicht noch nicht hin, um den Menschen gegen die Gefahr des Untergangs der Art zu sichern, deshalb verleiht zuletzt Zeus selbst ihm noch Scham und Rechtsgefühl, die ihn befähigen, Gemeinschaften zur gemeinsamen Abwehr natürlicher Bedrohungen zu bilden, deren Funktionieren allerdings stets durch internen Zwist gefährdet bleibt.
Pico adaptiert diesen Mythos christlich-neuplatonisch, verändert seine Intention und stellt ihn an den Beginn seiner geplanten Rede. In seiner Erzählung bemerkt „der höchste Vater und Schöpfergott“, nachdem er das „Haus der Welt [], den hocherhabenen Tempel seiner Göttlichkeit“56, erbaut hat, dass ihm ein Gegenüber fehlt, ein Wesen, das „imstande wäre, die Einrichtung des großen Werks zu beurteilen, seine Schönheit zu lieben, seine Größe zu bewundern“57, und er beschließt, zu diesem Zweck den Menschen zu erschaffen. Da aber muss Gott, in Analogie zum Epimetheus des platonischen Mythos (sic