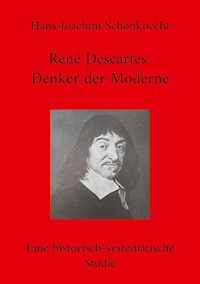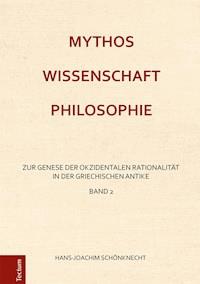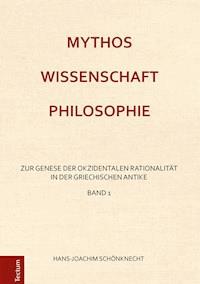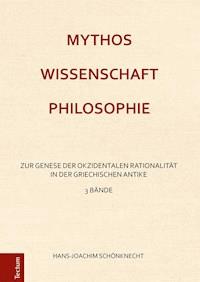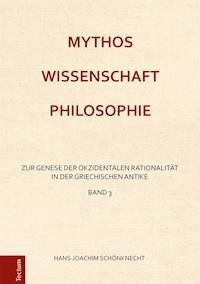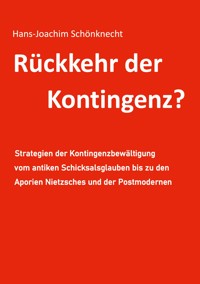
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Verdankt sich die Existenz des Menschen in der Welt bloßem naturgeschichtlichen Zufall (sog. Kontingenz), wie die Naturwissenschaften nahelegen oder ist sie tiefer, wesentlicher verwurzelt und objektiv sinnvoll, wie die Religionen suggerieren? Die Schrift stellt die geschichtlich wichtigsten Versuche zur Kontingenzbewältigung dar, bis zur radikalen, bis heute stark nachwirkenden Sinnbestreitung durch Friedrich Nietzsche. Die Schrift zeigt Nietzsches bisher wenig beachtete gedankliche Inkonsistenzen auf und weist nach, dass der Mensch nicht nur zufällig, sondern wesentlich zur Welt gehört, welche ohne den Menschen eine andere wäre und dass es keinen Grund für existentiellen Pessimismus gibt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 624
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Vorwort
I. Zufall und Kontingenz als Phänomene
1. Exposition des Problems
2. Ist Zufall ein ‚Nichtwissen der Ursachen‘?
3. Philosophischer Sinn von Kontingenz
4. Kontingenz und Objektivismus
5. Kontingenz der
Welt
6. Kontingenz des
Subjekts
II. Religionen als Strategien der Kontingenzbewältigung
1. Vorüberlegungen
2. Vom Animismus zum Schicksalsglauben
3.
Ananke – Heimarméne – Moira – Tyche
4. Von der Macht des Schicksals zur göttlichen Providenz: Kritik des Schicksalsglaubens im Christentum
III. Christlicher Tribut an Kontingenz
1. Gnosis – Negative Theologie –
Verborgenheit Gottes
2. Theodizee als Kontingenzabwehr
3. Exkurs: Voltaires
Candide ou l’optimisme
als literarische Bestreitung von Theodizee und göttlicher Providenz
4. Vermittlung von Vorsehungsglauben und Kontingenzerfahrung: Kants Aufsatz
Über das Mißlingen aller philosophischen Versuche in der Theodizee
IV. Kontingenzabwehr durch
Geschichtsphilosophie
1. Historischer und geistesgeschichtlicher Kontext
2. Geschichtsphilosophie vs. Geschichtstheologie Voltaire und Bossuet
3. Zwischenüberlegung
4. Kontingenzabwehr und Ersatz von Theodizee durch spekulative Geschichtsphilosophie: Herder und Lessing
4.1 Geistesgeschichtlicher Kontext
4.2 Empathie statt Ratio: Herders
Auch eine Philosophie der Geschichte zur Bildung der Menschheit
4.3 Versöhnung von Aufklärung und Christentum? Lessings
Die Erziehung des Menschengeschlechts
4.3.1 Lessings geistesgeschichtliche Voraussetzungen
4.3.2 Lessings Dilemma: Flucht in den Chiliasmus
V. Paradigmenwechsel: Natur als Garant von Sinn: Kants
Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht
1. Theoretischer Rahmen von Kants Geschichtsphilosophie
2. Anthropologie als Leitfaden
3. Politik als Fortschrittsmotor
VI. Systematische Eliminierung von Kontingenz: G. W. F. Hegel
1. Geschichte als Substanz der Wirklichkeit
2. Geschichte und Geist
3. Hegel ein Abschluss
VII. Schellings Auflösung von Hegels Vermittlungen
1. Hegels
absolute Vermittlung
2. Schellings Destruktionsversuch
VIII.
Nemo contra Deus nisi Deus ipse
: Schopenhauers Kampf gegen Kontingenz durch ihre Bejahung
1. Wissenschaftsgeschichtlicher Exkurs
2.
Die Welt als Wille und Vorstellung
3. Mit Kant gegen Kant – Kant als Schopenhauers zentrale Referenz
4. Der Wille als
Ding an sich
5. Leben als Leiden? – Moralphilosophische Voraussetzungen von Schopenhauers Willensmetaphysik
6. System des Irrationalismus und
Nihilismus
7.
Nihilismus
als Determinismus und Quietismus
IX. Wege aus der Kontingenz? Die Ansätze von Karl Marx und Sören Kierkegaard
1. Standortbestimmung
2. Der sozialphilosophische Weg: Karl Marx und der Kommunismus
3. Der religionsphilosophische Weg: Sören Kierkegaard
3.1 Biographische Voraussetzungen Kierkegaards
3.2 Das Kontingenz-Motiv bei Kierkegaard
3.3 Resümee zu Kierkegaard
X. Apostel der Kontingenz: Friedrich Nietzsche
1. Grundzüge von Nietzsches Persönlichkeit und geistigem Profil
1.1 Nietzsches Weg zum erfolgreichen Philologen
1.2 Begegnung mit Richard Wagner
1.3 Wendung zur Philosophie
2. Nietzsches Radikalität: Kontingenz des Menschen
2.1 Kontingenzerfahrung und Sinnerleben
2.2 Nietzsches Ja zur naturwissenschaftlichen Erkenntnis
2.3 Exkurs: Traditionelle Konzeptionen der Sinnstiftung und deren naturwissenschaftliche Destruktion
2.4 Kontingenz des Menschen im Kosmos
2.5 Nietzsches Naturalisierung des Geistes: Herleitung der Substanzen und Werte aus ihrem Gegensatz
2.6 Kontingenz des Bewusstseins
2.7 Menschwerdung als Super-GAU der Natur
3. Nietzsches
Neuer Glaube
:
Die ewige Wiederkunft des Gleichen
3.1 Ein Satz von Quasi-Mythen
3.2 Kontingenz als Surrogat von Sinn: Die These der ewigen Wiederkunft
3.3 Historisch-systematische Kritik der Wiederkunfts-Lehre
XI. Resümee und Ausblick
1. Rückkehr der Kontingenz? – Immanenz des Sinns!
2. Nietzsche
in nuce
3. Verwilderte Romantik – Nietzsche und die Folgen (Kritik des Postmodernismus und der ‚Diversität‘)
4. Ausblick
Literaturverzeichnis
Vorwort
Als Untertitel der vorliegenden Schrift hatte ich zunächst die Formulierung Über den geschichtlichen Ort des Menschen vorgesehen. Dies hätte die systematische Relevanz des Themas unterstrichen. Der jetzt gewählte konkretere Untertitel reflektiert den mehr oder weniger historisch-chronologisch angelegten Aufbau der Darstellung. Im Effekt läuft diese auf eine solche Ortsbestimmung hinaus: der geschichtliche, sich von allen früheren Konstellationen unterscheidende Ort des heutigen Menschen ist eine Art Schwebezustand zwischen Sinn und Kontingenz. Auf der einen Seite erweitert seit etwa 500 Jahren die als moderne Naturwissenschaft apostrophierte Forschungsweise das Wissen über Realia ins Unüberschaubare, verbunden mit der gigantischen Praxis globaler technischer Umgestaltung der Lebensweise. Auf der anderen Seite und als Komplement dazu dünnt sich die einst von der Religion geleistete Gesamtdeutung, die die menschliche Existenz mit dem Ganzen, dem Absoluten, verknüpfte, also die Sinnschicht, immer mehr aus, entzieht dem menschlichen Dasein den Seinsgrund und stößt es in die Kontingenz, in metaphysische Zufälligkeit.
Vor diesem Hintergrund entfaltet sich die Untersuchung, grob gesagt, mit drei Schwerpunkten. Nach einer Reflexion auf den Phänomencharakter der Begriffe Kontingenz und Zufall werden zunächst die antiken, religiös geprägten Sinnsetzungen samt ihrer im Kontext der europäischen Aufklärung virulent gewordenen Krise dargestellt (Kap. I-III). In den Kapiteln IV bis VII folgen die mit der neuzeitlichen Auflösung von Sinnstrukturen einsetzenden Versuche zur Repristination des Sinns mittels geschichtsphilosophischer Spekulation sowie deren schließliches Obsoletwerden. Mit Kap. VII beginnt die Darstellung von Positionen, die in verfehlter Absolutsetzung naturwissenschaftlicher Weltsicht Kontingenz dogmatisch behaupten: bei Schopenhauer metaphysisch verbrämt, bei dem für gegenwärtiges Philosophieren zentral bedeutsamen Nietzsche in nihilistischer und selbstreferentieller Verabsolutierung der Sinnlosigkeitsthese. Dem Nietzsches Werk durchziehenden Selbstwiderspruch unterliegt auch der abschließend unter dem Stichwort verwilderter Romantik kritisierte, fundamentalphilosophisch ganz von Nietzsche abhängende Postmodernismus.
Im übrigen zielt die Arbeit nicht auf systematische Geschlossenheit; sie versteht sich in zweifacher Hinsicht als dialogisch: zum einen als Dialog mit der denkgeschichtlichen Tradition, in der Bemühung, deren Substanz, d. h. deren weiterwirkenden Gehalt, zu erfassen, zum anderen als Dialog des Autors mit sich selbst, in der Aufmerksamkeit auf die eigene Perspektive und Zugriffsweise auf den Gegenstand. Beide Dialoge sind mit der Fertigstellung des Manuskripts für den Druck nicht abgeschlossen, sondern setzen sich fort …
Wie bei früheren Schriften gilt mein Dank auch diesmal wieder meiner Frau Ursel, die meine Arbeit mit Geduld begleitet und mit manchem guten Rat gefördert hat.
Hans-Joachim Schönknecht
I. Zufall und Kontingenz als Phänomene
1. Exposition des Problems
Der Titel vorliegender Untersuchung mag in mehrfacher Hinsicht Fragen aufwerfen. Zunächst ist ja bereits das Thema selbst als Frage formuliert. Das ist ein konventionelles Mittel von Autoren, das Interesse des Lesers zu wecken, birgt für diesen aber das Risiko, dass der Autor die Antwort selbst nicht weiß und der Leser, nach der Mühe der Lektüre, nicht klüger ist als zuvor. Und dies Risiko besteht in erhöhtem Maße, wenn das Argument ein philosophisches ist. Hatte doch schon Platon, der eigentliche Begründer und Namensgeber dieser Wissenschaft (oder, wenn man lieber will, dieser Begriffskunst), sie wohlweislich als philo-sophia, d. h. als Liebe, Neigung, Lust zur Weisheit (bzw. zum Wissen) bezeichnet und nicht als deren Erlangung und Besitz, was den Titel Sophia als solchen gerechtfertigt hätte, wie sie – der Name sagt es – unbescheidenerweise die Sophisten, als selbsternannte Weisheitslehrer, für sich in Anspruch nahmen. Platon war vielmehr der Überzeugung, dass unverkürzte Weisheit bzw. Wissen nur dem Gotte zukomme, jedoch die menschlichen Möglichkeiten übersteige – zumindest in diesem letzten Punkt ist ihm zuzustimmen.
Sodann aber scheint auch der Sinn des nicht der Alltagssprache angehörenden Begriffs Kontingenz einer Nachfrage bedürftig. Dieser wissenschaftssprachliche, insbesondere philosophische Terminus leitet sich her vom lateinischen Substantiv contingentia, dem seinerseits das Verb contingere zugrunde liegt. Dieses hat die Grundbedeutung ‚berühren‘ und bezeichnet in seinem für unseren Kontext zunächst maßgebenden Sinnaspekt das (zeitliche) Sich-Berühren (zweier Ereignisse). Das alltagssprachliche Äquivalent des Fachterminus Kontingenz – so übertragen es die Wörterbücher – ist ganz treffend das Wort Zufall. In seiner etymologischen Form Zusammen-Fall bezeichnet es wie Kontingenz das Zusammentreffen zweier voneinander unabhängiger Vorgänge, ihr zeitliches In-eins-Fallen1. Ein solches liegt etwa vor, wenn einer Person auf dem Weg zur Arbeit vom Dach eines Hauses, an dem Ausbesserungen stattfinden, ein Ziegel oder das Werkzeug eines Dachdeckers auf den Kopf fällt und die Person schwer verletzt oder gar tötet. Hier fallen zwei Vorgänge unvorhersehbar, aber mit erheblicher Auswirkung zusammen. Der Weg von Herrn X zur Arbeit und die Ausbesserung am Dach von Familie Y haben ‚nichts miteinander zu tun‘, doch treten sie in tragische Berührung zueinander. Das ist es, was wir ‚Zufall‘ nennen. Das Leben ist von Zufällen aller Art durchzogen, die ‚glücklicherweise‘, d. h. wiederum zufällig, meist keinerlei tragische Auswirkungen haben. Erblicke ich beim Bummel durch die Stadt einen lange nicht mehr gesehenen Freund, ist diese Begegnung auch zufällig, jedoch ohne Anflug von Tragik – im Gegenteil!
Allerdings scheint gerade das zufällig, kontingent Geschehene sich erklärendem Verständnis zu entziehen – dies liegt ja, wie aufgezeigt, in seinem Begriff –, und wer trotzdem Erklärungen versucht, gelangt in der Regel nicht über Trivialitäten hinaus oder endet in dem die voraufklärerische Welt bedrückenden Aberglauben, der Ereignisse aus Konstellationen der Gestirne, durch göttliche Schickung oder ganz trivial durch die schwarze Katze und ähnliches erklärte.
Betrachten wir dazu nochmals das Beispiel des vom Dachziegel getroffenen Herrn X: dass er die bestimmte Straße zu seiner Arbeit nimmt, hat den trivialen Grund, dass es der für ihn bequemste Weg ist, und nähme er auch eine andere Straße, könnte ihm dort das gleiche zu-stoßen (ein weiterer Ausdruck für das Zufällige!) Dass einem Dachdecker mitunter das Werkzeug oder Werkstück aus der Hand gleitet, ist ebenso gewöhnlich, anders gesagt, es ist trivial wahr. Allerdings dürfte ein Ereignis mit solch gravierenden Folgen – Zufall hin oder her – die Berufsgenossenschaft oder gar den Staatsanwalt auf den Plan rufen und nach Erklärungen suchen lassen: War die Baustelle nicht ausreichend gesichert? War der Arbeiter noch halb betrunken vom Vorabend? Und was dergleichen Fragen mehr sind.
Das zeitliche Zusammentreffen beider Ereignisse wird aber kein Verständiger zu erklären versuchen. Um es in der Vorstellungsweise der Naturwissenschaften zu sagen: Hier sind zwei in sich transparente Kausalketten ohne ersichtlichen Grund in einem bestimmten Zeitpunkt miteinander in Berührung gekommen, eben ‚zusammen-gefallen‘: ein klassischer Zufall, der als solcher niemandem als Schuld zuzurechnen ist (und wahrscheinlich dem nachlässigen Handwerker mildernde Umstände schafft).
Allerdings zeigt das Beispiel: Ist der Zufall auch nicht an sich fassbar, ist er auch keine Substanz, hat er als Begriff doch eine positive Funktion für die Erkenntnis. Er stellt eine Art Grenzstein für die Ursachensuche dar, indem er signalisiert: Hier hört das Erklären auf. Und darin mag sogar ein erzieherischer Aspekt liegen: uferlosem Hin- und Hergerede wird das Wort abgeschnitten!
2. Ist Zufall ein ‚Nichtwissen der Ursachen‘?
An dieser Stelle sei sogleich eine grundsätzliche Überlegung angeschlossen. Sie bezieht sich auf eine von G. W. F. Leibniz (1646-1716) gegebene Interpretation des Zufallsbegriffs. In seiner Theodizee führt Leibniz aus: „Alle Wissenschaftler stimmen darin überein, dass der Zufall [hazard], ebenso wie das Schicksal [fortune], nur ein scheinbar Reales ist; er ist das Nichtwissen der Ursachen, die ihn hervorbringen“2.
Dass Leibniz dem Zufall die Qualität des Realen abspricht, mag sich gegen Aristoteles richten, der in seiner Physik die Überzeugung bekundet, „daß Schicksalsfügung und Zufall [týche kai autómatou] wirklich etwas sind“3, und wir müssen Leibniz‘ Kritik zustimmen. Zurückzuweisen ist allerdings der zweite Teil von Leibniz‘ Aussage, der Zufall sei das ‚Nichtwissen der Ursachen, die ihn hervorbringen‘, die ihrerseits die Feststellung des Erzdeterministen Spinoza paraphrasiert: „Zufällig wird ein Ding [] lediglich im Hinblick auf unser Erkenntnisdefizit genannt“4.
So sehr es dem neuzeitlichen Empfinden von der Notwendigkeit eines zureichenden Grundes5 für jedes Ereignis widersprechen mag, gilt doch für Zufälle wie das mehrfach angeführte Beispiel des Unfalls: beide Ereignisse sind durch keine gemeinsame Bedingtheit miteinander verknüpft. Was sie verbindet, ist ihre Gleichzeitigkeit, aber diese hat keinen bedingenden oder Ursache-Charakter, und eben hier liegt das Kontingente. Verhielte es sich anders, und dem Ereignis lägen verborgene Ursachen zugrunde, die uns nur unbekannt und unerforschbar sind, wie Leibniz annimmt, hieße das, die Welt als kausal geschlossenes System und die Wirklichkeit als deterministischen Mechanismus aus lauter Zwangsläufigkeiten aufzufassen, wie es Spinoza tat und wie es im späten 19. Jahrhundert bei einigen philosophierenden Naturwissenschaftlern Mode wurde, etwa beim Autor der ironisch so betitelten Welträtsel, Ernst Haeckel (1834-1919), der alles Geschehen vom Gesetz mechanischer Kausalität gesteuert sah6. Haeckels Ansatz war eine Art naturwissenschaftlich gestützter Rückfall in den Schicksalsglauben der Alten, demzufolge alles Sich-Ereignen strenger Notwendigkeit folgt, also Verhängnis ist, wie es uns die Atridensage vorführt. Dahinter steckt eine Art schlechter Metaphysik.
Eine Berechtigung erhält Leibniz‘ Definition allerdings, wenn wir auf die zwischen den beiden bisher synonym behandelten Begriffen Zufall und Kontingenz bestehende Differenz sehen und uns von dem die Etymologie der Begriffe so plastisch veranschaulichenden Beispiel der unerklärlichen Koinzidenz zweier Ereignisse lösen. Der Begriff der Kontingenz bezeichnet nämlich grundloses Sein im allgemeinsten Sinne. Wir nennen kontingent etwas faktisch Seiendes, ein Faktum, dessen Seinsgrund sich nicht zeigt bzw. aufweisen lässt. Wir könnten es treffend und weniger objektzentriert auch als das dem Denken Inkommensurable bezeichnen. Wie bei dem berühmten Präzedenzfall für Inkommensurabilität, der Hypotenuse c=√2 im rechtwinkligen Dreieck mit den Katheten a, b=1, findet der Intellekt zwischen zwei Sachverhalten keine ratio, mit dem griech. Terminus: keinen logos, kein fassbares Verhältnis.
Das angeführte Beispiel aus der Geometrie führt zu weiterer Klärung der kritisierten Bestimmung Leibniz‘ bzw. Spinozas, Zufall sei Unkenntnis der Ursachen. Das Ursache-Wirkung- bzw. Grund-Folge-Verhältnis sind jeweils ein solcher Logos, eine Ratio, die resultieren aus der Methode, dem Verfahren, ein auffälliges Phänomen durch Rückführung auf ein anderes, das erste bedingendes Phänomen zu erklären, d. h. ihm eine Ratio zu unterlegen. Die gefundenen Rationes, Zusammenhänge, mögen sich zu komplexesten Systemen auswachsen, mit zahllosen Interdependenzen wie etwa im Wetter genannten Phänomenkomplex, im Ökosystem Wald, im physiologischen System Lebewesen, im Handlungssystem Wirtschaft, im geologischen Phänomen Erde – die Liste der Beispiele könnte endlos verlängert werden. Aber etwa das hier Vorgetragene mit dem System Kosmos korrelieren zu wollen, dessen Ratio – in Parenthese – selbst nicht voll durchschaut ist, macht definitiv keinen Sinn, auch wenn Jahrtausende sich an derartigen Korrelationen versucht haben. Wo keine Ratio besteht, hört nicht nur das Erklären auf, sondern verliert auch die Annahme ihren Sinn, der Mangel der Erklärung sei ein bloßes, transitorisches Defizit des Denkens. Die Welt ist kein System, sie erscheint nur so in jeweils spezifischer Verengung des Blicks, perspektivisch, d. h. unter Voraussetzung eines bestimmten Logos. Sie im deterministischen Sinn als System an sich zu interpretieren, wie Spinoza tat, ist ein Rückfall in den Mythos.
Andere Autoren waren denn auch in dieser Hinsicht weniger dogmatisch, etwa Sören Kierkegaard, der wie Aristoteles überzeugt war, dass „der Zufall [] wesentlich mit in die Wirklichkeit hineingehört“7. Allerdings verfängt sich Kierkegaard hier in den Fallstricken des Logos, denn um wesentliche Zugehörigkeit behaupten zu können, müsste man ja am thematisierten Gegenstand Essentielles von Akzidentellem unterscheiden können. Eine derartige Unterscheidung ist allerdings illusorisch für Begriffe allgemeinster Art, wie es der der Wirklichkeit ja ist.
Diese Bestimmungen werden uns im Folgenden noch beschäftigen.
3. Philosophischer Sinn von Kontingenz
Was aber schafft einem anscheinend so banalen, weil ubiquitären Phänomen wie dem Zufall oder der Kontingenz – dies wäre die dritte Frage, die sich dem Leser stellt – die Würde philosophischer Thematisierung? Zu einer möglichen Begründung sei wiederum auf Aristoteles verwiesen, der den Ursprung des Philosophierens und der Wissenschaft überhaupt in das Sich-Verwundern, griechisch thaumázein, über nicht selbstevidente Phänomene setzte, die im Beobachter das Verlangen ihrer Erkundung wachrufen8. Aristoteles nennt als Beispiel etwa die halbjährlichen Wendepunkte der Sonne, die sog. Solstitien, und konstatiert: „Denn wunderbar [i. S. v. verwunderlich, erstaunlich, zur Klärung anregend] erscheint es einem jeden, der den Grund noch nicht erforscht hat“9. Was Aristoteles nicht wissen kann: Es wird noch Jahrhunderte dauern, bis darüber wirklich Klarheit hergestellt ist.
Philosophie und Wissenschaft, hier unterscheidet Aristoteles nicht, forschen also nach Gründen bzw. Ursachen der Erscheinungen, suchen nach Erklärungen, und Aristoteles entwickelt im unmittelbaren Anschluss an die zitierte Textstelle seine berühmte Lehre von den vier Ursachentypen, die die ersten beiden Bücher seiner Metaphysik umfasst und die er bereits in der Physik vorgetragen hatte.
Neben dieser sehr allgemeinen Antwort auf die philosophische Bedeutung der Kontingenz findet sich jedoch eine speziellere. Diese ist ebenso einfach wie auf den ersten Blick kryptisch. Philosophisch relevant ist Kontingenz nämlich dadurch, dass sie sich an der Wurzel unseres persönlichen Daseins zeigt.
4. Kontingenz und Objektivismus
Um des kontingenten Moments im Dasein ansichtig zu werden, bedarf es allerdings einer besonderen Einstellung des Blicks, und zwar der von Descartes theoretisch begründeten und die neuzeitliche Naturwissenschaft prägenden Haltung der Voraussetzungslosigkeit. Diese ist keineswegs die natürliche Einstellung des Menschen zur Wirklichkeit (sofern bei einem so durch und durch auf Geschichtlichkeit angelegten, die eigene Stelle im Zeitlauf reflektierenden Wesen wie dem Menschen überhaupt – außer dem biologischen Typus – etwas als von Natur gegeben gelten kann).
So machte der erwähnte Aristoteles, der in Bezug auf die mythische Weltauslegung durchaus als Aufklärer gelten muss, die von ihm selbst nicht reflektierte, für wirkliche Naturerkenntnis aber wenig ergiebige Voraussetzung: „Gott und die Natur machen nichts zwecklos“10 und sieht die Natur von Zwecken durchwaltet. Bezüglich des Kosmos hat uns die moderne Astronomie der Unhaltbarkeit solcher teleologischen Betrachtung belehrt, bezüglich der Sphäre des Lebendigen leistete dies der Darwinismus. Zwar zeigen sich überall zweckmäßig Organisiertes, Funktionszusammenhänge, aber nirgends eine diese Zweckmäßigkeiten konstituierende Zwecktätigkeit.
In Übernahme eines von Edmund Husserl (1859-1938) geprägten Terminus könnte man die neuzeitliche Einstellung als objektivistisch und die ihr entsprechende Auffassung von Erkenntnis als Objektivismus bezeichnen11. Objektive Betrachtung bezeichnet die Intention, die Sache selbst und an sich zu erfassen, von persönlichen Überzeugungen abzusehen, Vorannahmen zu vermeiden und von allen Vermittlungen zu abstrahieren. Ihre Instrumente sind Wahrnehmung, Beobachtung, verständige Reflexion. Als Verfahrensweise der neuzeitlichen Naturwissenschaften ist der Objektivismus bei Husserl negativ konnotiert – und Husserls Vorbehalt hat dann seine Berechtigung, wenn versucht wird, die objektivistische Methode dogmatisch zu verabsolutieren.
Denn die Naturwissenschaften als Träger solch objektiver, deutungsfreier Erkenntnis operieren mit bestimmten, von ihnen selbst nicht reflektierten und mit ihren methodischen Mitteln auch nicht reflektierbaren Vorannahmen, etwa der Idee allgemeiner Gesetzmäßigkeit in Naturprozessen und deren mathematischer Abbildbarkeit. Andererseits sprechen die an der Theorie- bzw. Problemfront auftretenden Irrtümer und Teilwahrheiten, vorläufigen Wahrheiten, auch nicht gegen ihre Objektivität, sind diese Wissenschaften selbst doch die einzige Instanz, die die eigenen Erkenntnisse als unzulänglich aufzudecken, zu ‚falsifizieren‘ (K. Popper) und damit auch korrigieren vermag.
Diese objektivierende Haltung der Naturwissenschaften, zu deren Gewinnung es gut zweier Jahrtausende okzidentaler Denkgeschichte bedurfte – und soweit ich sehe, hat keine andere Kultur ähnliches vermocht –, wird in der vorliegenden Untersuchung philosophisch fruchtbar gemacht für die Freilegung der fundamentalen Kontingenzen im Dasein, und zwar in einer doppelgleisigen Annäherung an die Wirklichkeit: zum einen in Richtung auf Welt, zum anderen in Richtung auf das Subjekt, das ein jeder von uns ist.
5. Kontingenz der Welt
Was sich objektiv, in sachlicher Beschreibung von sich her zeigt, ist für uns Heutige Folgendes: das als Welt (Universum, Mundus, Monde, World usw.) bezeichnete kosmische Gebilde von ungeheurer zeitlicher und räumlicher Erstreckung, in dessen jedes Vorstellungsvermögen sprengenden Weiten ein Erde (Terra, Terre, Earth usw.) genannter Planet um seine Sonne kreist, um eine von Milliarden (!) Sonnen, die ihrerseits dem Laien generell, aber auch den Astronomen noch größtenteils unbekannte Planeten mit sich führen mögen.
Es zeigt sich auf dem Planeten, neben manchen anderen Merkwürdigkeiten, das Phänomen des Lebens, das sich, einer noch vorwissenschaftlich getroffenen, aber offenbar in ihrem Sachgehalt unanfechtbaren Einteilung zufolge in drei große Gattungen von Lebewesen gliedert, in Pflanzen, Tiere und Menschen. Die beiden ersten Gattungen sind ihrerseits in eine derart unüberschaubare Zahl von Arten differenziert, dass man am Sinn, sie alle unter den jeweils gleichen Gattungsbegriff zu subsumieren, zweifeln könnte; sie sind jedenfalls integraler Bestandteil des dort, auf der Erde, entwickelten, nach bestimmten Prinzipien funktionierenden ökologischen Gefüges. Die dritte der Gattungen wird traditionell nicht in Spezies, sondern in sogenannte Rassen untergliedert, eine Unterscheidung, die grauenhafte politische Folgen gezeitigt hat, aber sich bei genauerem Zusehen als an ganz äußerlichen Merkmalen, vor allem der Hautfarbe, abgelesen zeigt. In den wesentlichen Kennzeichen, vom Körperbau bis zur Intelligenz, ergeben sich keine signifikanten Unterschiede zwischen den ‚Rassen‘. Deshalb subsumiert sie die biologische Taxonomie generell unter den Typ Homo sapiens. Die wahrnehmbaren Differenzen sind vor allem historisch-kultureller Natur12.
Beim Menschen fallen demnach Gattung und Spezies zusammen, und er bildet damit auch im tieferen biologischen Sinne eine Sondergattung. Diese ist zwar leiblich ebenfalls in der Biosphäre verwurzelt, aber diesem durch das Phänomen des Bewusstseins, verbunden mit ausgeprägter Intelligenz, zugleich enthoben. Sie ist, als das Ganze objektivierend, diesem gegenübergestellt.
In dieser Enthobenheit wurzelt der philosophisch fundamentale Dualismus von Mensch und Welt als elementare Tatsache der Erfahrung, welche in der Neuzeit, abstrahiert zum essentiellen Gegensatz von res cogitans und res extensa, Denken und Sein, Subjekt und Objekt und dgl., einen im Grunde metaphysischen Prioritätsdiskurs in Gang gesetzt hat, der sich in Form antithetischer Positionsbestimmungen wie Idealismus vs. Materialismus, Transzendentalismus vs. Realismus, Epistemologie vs. Ontologie und dgl. bis heute perpetuiert.
Die Kontingenz liegt im Fall der Existenz der Welt und der belebten Erde (für den Menschen sozusagen der Fall aller Fälle) darin, dass es für diese Phänomene, deren Realität unbestreitbar ist, keinerlei Erklärung und Begründung, keinen Hinweis auf Ursprung und Ursache gibt. Wir sind mit einem absoluten Faktum konfrontiert. Zwar gibt es philosophierende Naturwissenschaftler, die sich auch hier eine Erklärung anmaßen. Von der Inkonsistenz solcher Versuche wird weiter unten die Rede sein.
6. Kontingenz des Subjekts
Anscheinend spiegelt die Existenz des Einzelnen eine klare, weitgehend durchschaubare Ordnung wider: Du bist hineingeboren in diese bestimmte Gemeinschaft deines Ortes, seiner Landschaft, der Region, des Volkes und seiner Traditionen bzw. in die selbst in dies alles eingebettete Familie, zeigst physiognomische, physiologische und Verhaltensähnlichkeiten mit Eltern, Geschwistern, Großeltern. Du wählst dir bestimmte Vorbilder, folgst vielleicht Vater oder Mutter in der Berufswahl, wählst jedenfalls, wie alle anderen, einen Beruf aus dem Pool der vorhandenen Möglichkeiten. Deine Existenz erscheint so als stimmiges Resultat aus natürlichen und sozialen Bedingtheiten sowie Akten freier Wahl13 im nicht überschreitbaren historisch-sozialen Kontext - niemand wird heute mehr Hufschmied oder Bürstenmacher oder gar Garnträger und Geschirrfasser14 – mit den Berufen selbst ist auch die Möglichkeit, sie zu wählen und zuletzt auch ihre bloße Kenntnis verschwunden. Ein jedes Individuum, sagte Hegel zu Recht, ist ein Sohn seiner Zeit, und sein Leben folgt dem ‚ewigen‘ Rhythmus von Geburt, Adoleszenz, Berufswahl, Familiengründung, Kinderaufzucht und Tod – in der jeweils zeittypischen Ausprägung und den zahlreichen individuellen Varietäten.
Für Kontingenzen ist auch hier Raum, und zwar in negativer wie positiver Hinsicht. Sie können den Einzelnen bitter treffen, aber doch auch nur in einem begrenzten Feld von Möglichkeiten wie Krankheit, vorzeitigem Tod, Scheitern im beruflichen und familiären Leben, Naturkatastrophen und Krieg. Selten im Geschichtslauf ist das Positiv-Kontingente, etwa die jahrzehntelange, durch Putins Überfall auf die Ukraine abrupt zerstörte Periode des Friedens und Wohlstands im Nachkriegseuropa, günstige berufliche Möglichkeiten für Viele, Dinge, um die andere Weltgegenden uns beneiden und die ein Niveau von Sekurität und Saturation repräsentieren, das bei einigen geistig Unbedarften in subjektivistischen Übermut ausartet: sie fangen an, ‚quer‘ zu fühlen und nennen es ‚querdenken‘ – aber auch solches Verhalten ist unter dem antiken Titel der Hybris ein die Menschheitsgeschichte durchziehendes Phänomen!
Als kontingent lässt sich solches sozial Positive nur hinsichtlich seines nicht prognostizierbaren Erscheinens bezeichnen. Das Auftreten eines Politikers wie Gorbatschow, der die Prinzipien von Glasnost und Perestroika in die sowjetische Politik einführte und durch den am Ende die deutsche Wiedervereinigung ermöglicht wurde, war so nicht erwartbar und aus deutscher Perspektive kontingent, ein Glücksfall (wenn sich auch aus der sowjetischen Misere und der weltpolitischen Situation Gründe für eine Reformpolitik ergeben). Andererseits ist der positive Ausgang der deutschen Frage Resultat politischen Wollens und der Beherrschung der zu seiner Realisierung erforderlichen Instrumente; mit der berühmten Politik-Metapher Max Webers zu sprechen: es ist Ergebnis des erfolgreichen ‚Bohrens dicker Bretter‘, mit ‚Leidenschaft‘ und zugleich mit ‚Augenmaß‘ – und das politisch Gute ist nie sicherer Besitz. Was ‚Querdenker‘ nicht begreifen!
Doch erreicht all dies noch nicht das essentiell Kontingente der Conditio humana. Dieses wird erst sichtbar, wenn wir in einer sozusagen ‚cartesianischen‘ Operation bzw. Husserlschen epoché eine hypothetische Trennung unseres Ich, des Ich, das ein jeder von uns ist, von allem ihm Äußerlichen vollziehen, die eigene Leiblichkeit eingeschlossen. Dann zeigt sich: dieses Ego, dieser Ich-Kern, der scheinbar mit seinen physischen wie sozialen Bedingungen und Umständen ein so stimmiges Ganzes bildet und der nach einer älteren, offensichtlich zu kurz greifenden Theorie nichts als die Resultante seiner sozialen Rollen darstellt, hätte sich ebenso gut in ganz anderer Form inkorporieren können: als indischer Paria, afrikanischer Slumbewohner oder auch als Sklave beim Bau der ägyptischen Pyramiden, als steinzeitlicher Jäger und Sammler – die Zahl der Möglichkeiten ist grenzenlos (hinzugerechnet die noch immer so leichtfertig aktualisierte Möglichkeit, bereits im Mutterleib abgetrieben worden zu sein und dadurch den Status eines Ich gar nicht erst erreicht zu haben!) Meine Präsenz in diesem Hier und Jetzt – in einigermaßen gesicherten oder gar komfortablen Umständen – ist im metaphysischen Sinne reiner Zufall und auch durch keine biologische, psychologische, soziologische, historische oder sonstwie gerichtete Analyse abzuleiten. Die Kontingenz ist eine totale und objektive! Und sollte die Existenz des Menschen doch, wie Jahrtausende glaubten, durch höheren Beschluss zustande gekommen sein, wäre es durch eine Macht von äußerster Willkür, die den Namen Gott nicht verdiente.
Alle anderen Kontingenzen übertrifft schließlich das Faktum des individuellen Todes: Wir müssen alle sterben, unser aller Lebenszeit ist limitiert, und dies in höchst ungerechter Weise. Denn die Unterschiede in der Lebensdauer sind erheblich und können leicht eine Spanne von zwei und mehr Jahrzehnten, also einer Generation, erreichen.
Es war die Weisheit der Antike, für das factum brutum des Todes versöhnende Erklärungen zu formulieren, etwa durch den Hinweis auf das Naturgesetz, dem zufolge allem in der Zeit Entstandenen auch das zeitliche Vergehen bestimmt ist, nicht nur dem ephemeren Einzelwesen, sondern auch viel dauerhafteren Gebilden wie Völkern und Staaten. Es war Heraklits große Einsicht, dass der Zeitablauf selbst Veränderung, Entstehen und Vergehen, bedeutet. Er fasste dies in berühmt gewordene Sentenzen wie das Panta rhei (Alles fließt) oder die, dass man nicht zweimal in denselben Fluss steigen könne.
Auch der späte Stoiker Epiktet (ca. 50-138 n. Chr.) berührte das Problem der Kontingenz im Lebensvollzug mit seiner Unterscheidung zwischen den Dingen, die in unserer Gewalt stehen, wie unsere Absichten und die Versuche ihrer Realisierung einerseits, und auf der anderen Seite den Faktoren, welche uns konditionieren, etwa Herkunft, Veranlagung, Sterben, denen wir ohne Einflussmöglichkeiten ausgesetzt sind.
Und doch haben die Religionen, zumindest die subtiler entwickelten, diese Wahrheit niemals akzeptiert. Schon der griechische Mythos gestattete sich die Inkonsequenz, den Göttern Geburt und zugleich Unsterblichkeit zuzuerkennen, und auch die sterblichen Menschen überdauerten zumindest als Schatten, entkörperte ‚Seelen‘ in der ‚Unterwelt‘ – allerdings ein in den Augen der Griechen selbst höchst unbefriedigender Zustand, wie Homer uns mit der Klage Achills wissen lässt15!
Andere Religionen ließen der Phantasie noch freieren Lauf, konzipierten ‚Seelenwanderung‘, Metempsychose, durch verschiedene Inkorporationen, oder geradezu ‚ewiges‘ Leben in einem transzendenten Reich des Friedens und der Leidenslosigkeit.
So wurde das persönliche Sterbenmüssen seit je als Zumutung empfunden und nach Kräften eskamotiert. Selbst die nimmermüde Psychologie bietet zwar Trauerarbeit für Hinterbliebene an, hat sich aber an Vorbereitungskurse zum Sterben, soweit ich sehe, noch nicht gewagt. Dabei bestimmte schon der platonische Sokrates die Philosophie als Einübung ins Sterben16! Und Sokrates unterzog sich der Vollstreckung des Todesurteils, wie später auch Seneca, in souveräner Weise.
1 Im entgegengesetzten Sinn wird der Terminus Kontingenz übrigens in der Psychologie verwendet. Dabei wird auf die ursprüngliche Bedeutung des lat. contigere – sich berühren abgestellt. Im psychologischen Experiment wird als kontingent bezeichnet eine vom Probanden hergestellte Beziehung zwischen zwei Ereignissen, die in Wirklichkeit jedoch nicht besteht. Für den Probanden wird das Entdecken einer vermeintlichen Kontingenz zum Stimulus der Theoriebildung (etwa der Art: wenn A, dann B), die anschließende Aufdeckung des Irrtums durch den Experimentator, führt zu theoretischer und emotionaler Enttäuschung; vgl. dazu etwa: P. Watzlawick: Wir wirklich ist die Wirklichkeit? München/Zürich 1967, S. 58f.
2Essais de théodicée III § 303 (1710); zit.: H. Kranz: Art. Zufall. Historisches Wörterbuch der Philosophie [HWPh], Hg. J. Ritter u. a., Basel 1971ff., Bd. 12, Sp. 1409; Übs. Vf.
3 Vgl. a.O., II, 196b15 – Vgl. aber den Hinweis auf Aristoteles’ eigene Einschränkung dieser Bestimmung.
4Ethik nach geometrischer Ordnung dargestellt [Ethica more geometrico], I. Teil, Lehrsatz 33, Anmerkung 1; Werke I/2, Hamburg 2006, S. 38.
5 Vgl. Leibniz: Monadologie § 32
6 Vgl. dazu vom Vf.: Descartes – Denker der Moderne (Norderstedt 2022), Kap. XIII 2.2.
7Der Begriff Angst. Werke I (Hg. L. Richter, Reinbek 1965), S. 13 (Hervorh. Vf.) – Zu Kierkegaard vgl. unten, Kap. IX 3.
8 Vgl. Metaphysik 982b
9 Ebd., 982a
10De caelo I 4, 271a33
11 Vgl. zu Husserls Rede vom Objektivismus, speziell bei Descartes: Schönknecht 2022, S. 451ff.
12 Die aus den Zeiten des Imperialismus und Kolonialismus bekannte Tendenz bestimmter Wissenschaftler, anhand von vermeintlich minderwertigen Rassen ein Übergangsfeld zwischen Primaten und Menschen zu konstruieren, ist längst als Ideologie entlarvt. Beispiel einer solchen Haltung ist der bereits erwähnte, seinerzeit hochberühmte Biologe Ernst Haeckel, der Verfasser der in Millionen-Auflage verkauften Schrift. Welträtsel (Ich verweise nochmals auf mein Descartes-Buch, Kap. XIII 2.2). Nicht weniger ideologisch ist allerdings der erstmals von Friedrich Nietzsche unternommene, aktuell von dem ‚Postmodernen‘ Giorgio Agamben oder auch von dem Tierphilosophen R. D. Precht weitergeführte Versuch, die substantielle Differenz zwischen Mensch und Tier wegzureflektieren (vgl. zu Ersterem meine Schrift Die Verweigerung der Vernunft, Norderstedt 2006, S. 79-157, zu Letzterem dessen Schrift Tiere denken – Vom Recht der Tiere und den Grenzen des Menschen; München 2018); zu Nietzsche vgl. unten, Kap. XI.
13 Wenn auch manche Philosophen solche Freiheit mit kunstvollen Argumenten bestritten haben, stellt sie doch eine Tatsache der Erfahrung dar, und allein darauf soll es hier ankommen.
14 Zu den beiden letzteren vgl. Goethe: Wilhelm Meisters Wanderjahre III, 5
15 Vgl. Odyssee XI, V. 467ff.
16 Vgl. z. B. Phaidon 61ff.
II. Religionen als Strategien der Kontingenzbewältigung
1. Vorüberlegungen
Nach dem bisher Gesagten ist die existenzielle Dimension der Kontingenz kein am Tage liegendes Faktum, sonst bedürfte es dieser Überlegungen nicht; sie ist aber auch nicht schlechthin verborgen, denn dann könnten diese Reflexionen nicht vollzogen werden. Das Kontingente oder Zufällige hat seinen Ort in der labilen, beweglichen Zwischenschicht der Realität, die menschliches Bewusstsein heißt. Es kann sich dort melden, aber auch völlig unbeachtet bleiben. Im Sinne von Sigmund Freuds (1856-1939) Diktum, dass das Ich nicht Herr im eigenen Hause sei, ist das Argument ‚idealer‘ Gegenstand der Verdrängung.
Demzufolge ist nicht anzunehmen, dass das Erlebnis der Kontingenz ein Signum neuerer Zeit ist, sondern dass es essenziell zur menschlichen Welterfahrung gehört. Nur artikuliert sich dieses Bewusstsein nicht explizit, sondern muss aus seinen Verstellungen erschlossen werden. Diese Verstellungen resultieren aus der Tendenz des Menschen, das kontingente Moment der Existenz zu eskamotieren, dem Dasein Ordnung und Notwendigkeit zu unterlegen.
In diesem Sinne lassen sich die Religionen, als die frühesten Formen theoretischen Zugreifens auf Wirklichkeit, insgesamt als Praktiken der Kontingenzbewältigung interpretieren. Dafür nur wenige Beispiele.
Stellt etwa der römische Autor Petronius Arbiter (um 14-66 n. Chr.), Verfasser des berühmten Satyrikon, fest: Prima in orbe Deos fecit timor (Zuerst hat Furcht in der Welt die Götter hervorgebracht), so hat dieser Gedanke, der sich analog bereits bei den griechischen Sophisten findet, gewiss seine Richtigkeit. In der Anfangszeit des Menschseins, einer noch weitgehend unbekannten und rätselhaft-bedrohlichen Natur ausgesetzt, konnte noch ‚alles passieren‘; die Kontingenzerfahrung war eine totale und die Furcht war folglich ubiquitär. Die Reaktion des Menschen auf diese Situation war einerseits die erfolgreiche tätig-praktische Organisation des Lebens – denn offenbar überlebte er ja –, andererseits die numinose Hypostasierung der Natur durch Projektion seiner eigenen Geistigkeit: In allen Erscheinungen sah er wollende und handelnde Kräfte gleich ihm am Werk, die er als essentiell übermächtig erlebte. Um es in der noch idealistisch gefärbten Sprache des späten Schelling (1775-1854) zu sagen: „Der ursprüngliche Mensch [] ist natura sua das Gott Setzende“17.
Dementsprechend war das Erleben numinos geprägt, und die numinosen Mächte wurden ebenso als Bedrohung wie als mögliche Beschützer empfunden. Das Unverfügbare waltete uneingeschränkt18. Aber man konnte es hilfesuchend anrufen: Nach einigen Interpreten verweist das deutsche Wort Gott etymologisch auf diesen Zusammenhang: Es leite sich her von einem altgermanischen Verb für ‚anrufen‘19.
Wenn es in einer religionsgeschichtlichen Abhandlung bezüglich des Glaubens der Kelten heißt: „Die Götter waren unsichtbare Wesen“20, drückt diese simpel klingende Feststellung den Sachverhalt exakt aus: Dem numinosen Bewusstsein erschien in die sichtbare Welt verschlungen eine zweite, in der anschaulichen Realität wirkende und von ihr gar nicht zu trennende Sphäre solcher numinosen, an ihnen selbst unsichtbaren Wesenheiten. Genau dies drückt ja das archaische Verb (an)wesen aus. Es bedeutet: „als lebende Kraft vorhanden sein“21; es bezeichnet also die Präsenz unsichtbarer Wesenheiten, die sich für die Naturreligionen in den natürlichen Dingen, in Bäumen, Quellen, Äckern usw. kundgaben in Form von Baum- und Quellnymphen, Wald- und Wassergeistern oder als ‚Kornmutter‘ und Herdgöttin phantasiert wurden. Oft wurde die gleiche Wesenheit als möglicher Bringer von Glück und Unglück zugleich vorgestellt, d. h. auch ihr vermeintliches Wirken war noch Quelle von Kontingenz. Damit sind diese Wesen geradezu Personifizierungen der Kontingenzerfahrung, des Erlebens von Unverfügbarem, zustande gekommen durch Projektion der eigenen Lebendigkeit und Bewusstheit auf Phänomene der umgebenden Welt. Durch Gebet, Opfer, Zauber, Magie und Orakelwesen suchte man ihr bedrohliches Potential an schädlicher Kontingenz in den Griff zu bekommen, es kalkulierbar zu machen, mit einem ebenfalls von Max Weber geprägtem Ausdruck: es zu rationalisieren.
2. Vom Animismus zum Schicksalsglauben
Eine Art Fortschritt in der Kontingenzbewältigung stellt gegenüber diesem Glauben an die jederzeit und überall mögliche Manifestation schädlicher, ja bösartiger Mächte – in der nordischen Mythologie wimmelt es bekanntlich von Zwergen, Riesen, Kobolden und anderen „Un-Holden“ – der Schicksalsglaube dar.
Im stark anthropomorph geprägten griechischen Mythos etwa objektiviert sich die Kontingenzerfahrung in einer ganzen Reihe göttlicher Schicksalsmächte, die die vielfältigen Hinsichten abdecken, in denen sich die Erfahrung von Zufälligkeit, menschlicher Ohnmacht und mangelnder Verfügungsgewalt ergeben kann. Der Natur des griechischen Polytheismus entsprechend wird das Göttliche als sogenannte Person-Bereich-Einheit erlebt, worin in für Heutige schwer nachvollziehbarer Form der göttlich-personale und der sachliche Aspekt in ein veränderliches Verhältnis zueinander treten und jeweils eine der Hinsichten überwiegen kann. Besteht für einen solchen Gott, für eine solche Person-Bereich-Einheit, ein Kult, ist dies ein Indiz für das Überwiegen des personalen Moments22. Beispiel: „Themis [(heilige) Ordnung, Sitte, Brauch] ist eine schönwangige Göttin, die zum Mahle ruft (Homer Ilias 15,87ff.), aber dann ist es eben themis [d. h. es gehört sich], zum Mahle zu gehen“23. Es ergibt sich so eine ständige Präsenz von Göttlichem im Profanen – besser gesagt: es gibt kein rein Profanes – es erfolgt ein ‚Heiligen aller Lebensbeziehungen‘ (J. Huizinga), das sich – bei völlig veränderten religiösen Voraussetzungen – bis ins christliche Mittelalter durchhält24 und sich mit vorrückender Moderne auflöst. Da gibt es tendenziell nur noch Profanes.
Die zur Besorgung der Kontingenzen des Lebens zuständigen Götter, also die Schicksalsmächte, sind so konzipiert, dass sie die Hauptbereiche des Unverfügbaren abdecken, dieses so doch in gewissem Sinne kompatibel machen, die Unmittelbarkeit der Bedrohung relativieren, die Furcht zügeln, kanalisieren und damit der Wirklichkeit das völlig Unkalkulierbare und Irrationale nehmen.
Die hauptsächlichen Gestalten solcher Schicksalsmächte sind im griechischen Mythos Ananke, Heimarméne, Moira und Tyche, aber es gibt diverse weitere. Alle vier Bezeichnungen bedeuten in etwa Schicksal und Schicksalsfügung, in allen steckt die Vorstellung, zum Teil etymologisch nachweisbar, des Teils oder Anteils, nämlich des dem einzelnen Menschen zugemessenen Teils an den Kontingenzen, die das Leben bereithält, und zwar im Guten wie im Schlechten. Bei allen vier Begriffen ergeben sich im Verlauf der uns fassbaren neun Jahrhunderte griechisch-römischer Antike (von ca. 600 vor bis 300 n. Chr.) Variationen in ihrer sachlichen Bedeutung, der ihnen zugewiesenen Wichtigkeit und der Intensität ihres Kultes. Hinzu kommen Differenzierungen infolge ihrer rationalisierenden Übernahme in die philosophische Terminologie und Vorstellungsweise und der unterschiedlichen Rezeption in den verschiedenen philosophischen Schulen, von den vorsokratischen Naturphilosophen über die Platoniker, Epikureer, Skeptiker bis zu den Neuplatonikern, und (späten) Stoikern (um nur die wichtigsten zu nennen).
3. Ananke – Heimarméne – Moira – Tyche
So bedeuten Ananke und Heimarméne mehr oder weniger synonym die strenge Notwendigkeit des Schicksals (necessitas) und werden zum Ausgangspunkt der späteren Vorstellung einer Naturgesetzlichkeit. Moira, abgeleitet von meros – Teil, Portion, lateinisch: sors – Los, Losanteil, betont das Los des Einzelnen, seinen persönlichen Anteil an den für alle gültigen Schicksalsereignissen wie den Imponderabilien des Lebenslaufs sowie dem unausweichlichen Altern und Sterben, ein Anteil, der qualitativ und quantitativ variieren und durch Verhalten in Grenzen beeinflusst, aber natürlich auch durchs ‚Schicksal‘ konterkariert werden kann: der eine lebt konzentriert, mit sportlicher Bewegung und ausgewogener Ernährung, planmäßig auf die Realisierung seiner hohen Lebenserwartung hin – da trifft ihn der fatale (vgl. lat. fatum; ‚amor fati‘) Ziegel; der andere frönt dem Genuss und erreicht 100 Jahre – wenn es ‚gut geht‘ – ‚gerecht‘ ist es jedenfalls nicht; das Moment von Kontingenz ist aus dem Leben nicht eliminierbar!
Der göttlich-personale Anteil ist bei Moira ausgeprägt, insofern die Vorstellung dreier namentlich benannter Moiren mit unterschiedlichen Zuständigkeiten gebildet wird. Es sind Klotho, die den Lebensfaden spinnt, Lachesis, die dem einzelnen sein persönliches Lebensschicksal zuteilt und Atropos, die am Ende den Lebensfaden abschneidet. In diesen Figuren wird neben der Personalisierung die Tendenz zur Systematisierung sichtbar, der Versuch, ein vermeintliches Ganzes in Aspekte zu differenzieren; es ist die sich im Mythos vielfältig vorbereitende Perspektive, aus der dann die den mythischen Vorstellungen die personifizierende Hülle abstreifende und auf den begrifflichen Gehalt reduzierende Philosophie hervorgeht25.
Die Person-Bereich-Einheit Tyche schließlich entspricht der römischen Fortuna und betont das Zufällige und Unvorhersehbare am Geschick, das, was zum Ausdruck kommt in der barocken Allegorie vom Rad der Fortuna, das in seiner unaufhörlichen Bewegung jetzt dem einen zu Glück und weltlichen Ehren verhilft und gleichzeitig einen anderen ‚ins Unglück stürzt‘, um im nächsten Augenblick die Konstellation umzukehren und so den Menschen lebenslang ‚zwischen Hoffen und Bangen‘ hin und her zu werfen und jedenfalls ‚in Atem zu halten‘. Tyche wäre diejenige, die in unserem Beispiel den Dachziegel gerade in dem Augenblick der Hand des Arbeiters entgleiten lässt, in dem unten Herr X vorbeigeht, sodass der Ziegel ihn tödlich trifft – oder auch knapp verfehlt: in beiden Fällen hätte Tyche ‚ihre Hand im Spiel‘ – wir sehen, nebenbei gesagt, wie in unserer Sprache solche uralten Vorstellungen sedimentiert sind. Und es ist Tyche, an der Aristoteles sein Programm der Rationalisierung vorführt, wenn er diese mythische Gestalt zur akzidentellen Ursache herabsetzt26.
Aristoteles untersucht das Phänomen der Tyche in einer ausführlichen Reflexion über das Verhältnis von „Schicksalsfügung und Zufall [tyche kai autómaton]“27 und kommt zu dem Ergebnis, dass Ereignisse „auf Grund von Fügung [apo tyches] [diejenigen sind], die im Bereich sinnvoll gewollter Handlungen bei (Wesen), die die Fähigkeit zum planenden Vorsatz haben [vulgo: beim Menschen], zufällig [tou automátou] eintreten“28. Und an anderer Stelle heißt es von Tyche noch drastischer: „Nur, im eigentlichen Sinn ist sie Ursache von nichts“29. Aus der gefürchteten wie mit Hoffnungen besetzten Schicksalsgöttin der Mythosreligion wird beim Philosophen ein bloßer Nebeneffekt menschlicher Handlungen – in der Tat ein Schritt zur Befreiung von irrationaler Furcht!
Ein bemerkenswertes historisches Schicksal(!) erfährt auch die Schicksalsmacht der Heimarméne. Etymologisch auf meresthai – ‚seinen Anteil erhalten‘ zurückzuführen, bedeutet sie seit Heraklit die alles Geschehen in der Welt steuernde „unverbrüchliche Schicksalsfügung“30, die die Stoiker als „Weltvernunft, Natur und ewige Ursache aller Dinge, als Zusammenhang des Verschiedenen und unverbrüchliche Ordnung und Kette der Ursachen“31 radikalisieren und die in säkularisierter Form zur von diesen selbst nicht reflektierten Voraussetzung der neuzeitlichen Naturwissenschaft wird.
In ethischer Hinsicht allerdings wird diese unter den Namen der Heimarméne gestellte Idee eines strengen Determinismus aufgrund ihrer ruinösen Folgen für die Idee menschlicher Freiheit und Verantwortlichkeit und ihrer Begünstigung des Fatalismus sowohl von den philosophischen Schulen der Aristoteliker und Platoniker kontrovers diskutiert, wie vom jungen Christentum bekämpft. Mit letzterem tritt das stoische Konzept insbesondere auch dadurch in Konflikt, dass Heimarméne als blinde, willkürlich waltende und treffende Macht vorgestellt wird, d. h. als subjektlos und ethisch indifferent. Dies ist vor dem Hintergrund der grundsätzlich ethisch geprägten Stoa verständlich, ging es ihr doch primär darum, dass der Einzelne in der Haltung der apatheía (Apathie, Leidenschaftslosigkeit) seine Tugend (areté) bewährte und so seine innere Freiheit bewahrte. In Bezug auf diese um die vier Kardinaltugenden Einsicht, Tapferkeit, Besonnenheit und Gerechtigkeit zentrierte Aufgabe sank alles, was dem Menschen von außen an Gutem und Schlechtem widerfahren konnte, also die noch heute so genannten, die Kontingenz unzweideutig zum Ausdruck bringenden Schicksalsschläge, zum Unbedeutenden, Gleichgültigen (adiáphoron) herab32. Das unzugänglich Opake der Heimarméne wurde so zum Katalysator für Tugend.
Berühmtes Beispiel stoischer Haltung ist der bereits erwähnte Philosoph Seneca, der im Jahre 65 n. Chr., durch Kaiser Nero wegen angeblicher Teilnahme an der Pisonischen Verschwörung zum Suizid gezwungen, dieses Schicksal „mit der Gefasstheit des Stoikers auf sich [nahm]: Er öffnete sich die Pulsadern und starb nach gelassenem Gespräch mit seinen Freunden, [solchermaßen] bewährend, was er im Leben gelehrt hatte“33.
4. Von der Macht des Schicksals zur göttlichen Providenz: Kritik des Schicksalsglaubens im Christentum
Wenn auch das junge Christentum in der moralischen Entschiedenheit eine Nähe zum Stoizismus aufweist – Seneca saepe noster, ‚Seneca steht oft auf unserer Seite‘, sagten die frühchristlichen Theologen34 – widerspricht doch die Ansetzung der alles Weltgeschehen bestimmenden blinden Schicksalsmacht der Heimarméne der dem Christentum teuren Idee der prónoia oder providentia, der göttlichen Voraussicht und des weisen Waltens Gottes zum Besten der Welt und des Menschen. Der Idee der göttlichen prónoia zufolge dient selbst das den Menschen treffende zeitliche Unglück, als von Gott gesandtes oder zumindest zugelassenes ‚Leid‘ demütig hingenommen, noch dem Erwerb ewigen Heils.
Im Hinblick auf unser Thema der Kontingenz ließe sich der Gegensatz zwischen blinder Heimarméne und göttlicher prónoia dahingehend bestimmen, dass erstere ‚objektiv‘ Kontingenz verkörpert – es ist bloßes Faktum und ‚nichts dahinter‘ –, während Letztere nur ‚subjektiv‘, sozusagen aus der Perspektive Hiobs, als kontingent erscheint, es aber objektiv, dem religiösen Sinne nach, keineswegs ist. Gott hat seine Gründe, es so zu fügen, aber die Einsicht des Menschen ist zu schwach und darf sich deshalb nicht anmaßen, diese zu begreifen. In diesem Sinn spricht noch Hegel von der selbst für die ansonsten voraussetzungslose Philosophie unverzichtbaren Voraussetzung, die „in Form der religiösen Wahrheit“ laute, „daß die Welt nicht dem Zufall und äußerlichen, zufälligen Ursachen preisgegeben sei, sondern eine Vorsehung die Welt regiere“35. So befremdlich die Annahme in der ‚religiösen‘ Formulierung auch erscheinen mag, ist doch unbestreitbar, dass jeder Bemühung um Erkenntnis (im vorliegenden Fall: der Geschichte) die Überzeugung (der ‚Glaube‘) einer inhärenten Struktur zugrunde liegt, denn deren Aufdeckung ist ja die Intention des Erkennenden!
Der aufgezeigte Gegensatz zwischen Heimarméne und göttlicher prónoia sei rückgreifend an der Theologie von Homers Ilias verdeutlicht. Dort zeigt sich die ethische Indifferenz der Schicksalsmächte u.a. darin, dass ihnen auch die Götter selbst, einschließlich des Zeus, des ‚Vaters der Götter und Menschen‘, unterworfen sind. In der Ilias gibt es diverse Situationen, in denen dies deutlich wird. Zur Illustration diene die einen Höhepunkt der gesamten Handlung darstellende Tötung des Hektor durch Achilleus im 22. Gesang. Während Achill noch den fliehenden Hektor um die Mauern Trojas herum verfolgt, erwägt Zeus, inmitten der vom Olymp herab zuschauenden Götterschar, den ihm am Herzen liegenden Hektor vorerst kraft seiner göttlichen Macht noch zu verschonen, erregt damit aber den Widerspruch seiner Achill zugetanen Tochter Athene, die den Vater vor einem Frevel gegen die bei Homer das Schicksal verkörpernde Moira warnt.
Die Entscheidung fällt, indem Zeus mit theatralischer Geste die ‚Todeslose‘ beider Krieger auf seine goldene ‚Schicksalswaage‘ legt und zusehen muss, wie die Schale mit dem Los des Hektor sich senkt, während die des Achill sich hebt: „Richtete vor sich da der Vater [Zeus] die goldene Waage, legte zwei Lose hinein des stark betrübenden Todes, [] faßte die Mitte und wog: Des Hektors Todesgeschick sank und ging fort zum Hades“36.
Die Moira hat (bereits) gegen Hektor entschieden – da bleibt dem Göttervater nur das Zuschauen, will er nicht selbst gegen das Schicksal freveln. Der Gebrauch der Waage mit den sich gegeneinander bewegenden Schalen bedient sich der in der Physik nicht nur des Leibes fundierten Universalmetapher von Aufstieg und Untergang und stellt eine Art Scheinrationalisierung dar: ‚in Wirklichkeit‘ entscheidet die Moira nicht nach Kriterien, ist sie, mit Aristoteles zu sprechen, doch die Ursache von nichts, ein bloßer euphemistischer Name zur Verhüllung der Kontingenz – ein Verfahren, das als fiktive Erklärung in vorphilosophischer, in puncto Logik noch anspruchsloser Zeit durchaus seine Funktion als Placebo erfüllte.
Allerdings verweist der Gebrauch des lateinischen fatum, das bedeutungsmäßig sowohl in Beziehung zu necessitas und heimarméne wie zu moira steht37, auf eine Säkularisierung bzw. Profanierung des Sinns schon in römischer Zeit, vielleicht unter dem Einfluss des erstarkenden Christentums.
Darauf deutet etwa die sprichwörtlich gewordene Sentenz des im zweiten nachchristlichen Jahrhundert lebenden Grammatikers Terentianus Maurus hin: Pro captu lectoris habent sua fata libelli (‚Die Bücher haben ihre Schicksale entsprechend dem Verständnis des jeweiligen Lesers‘). In dieser Redensart, von der in der Regel nur der zweite Teil ‚habent sua fata libelli‘ zitiert wird und die im Deutschen eine erstaunliche Fülle unterschiedlicher Interpretationen erfahren hat38, die uns hier nicht interessieren, ist offenbar der numinose Sinn von fatum geschwunden und ‚Schicksal‘ bedeutet nur noch die durch die Vielzahl der Möglichkeiten – hier der unterschiedlichen Dispositionen der Leser – resultierende literarische Wirkung der Bücher.
In seiner Schwundform kann man den Gedanken jedoch auch empirischpraktisch auf die Tatsache beziehen, dass das an die Öffentlichkeit gegebene und seinen Verfasser überdauernde Buch in die unterschiedlichsten Hände gelangen kann. In diesem Sinn bezeichnen die fata des Buchs einfach seine durch mehr oder weniger intensive Vervielfältigung bestimmte und in den einzelnen Stationen unvorhersehbare Reise durch die privaten und öffentlichen Bibliotheken der Welt, nicht zu vergessen auch das ‚Schicksal‘, das dem Original-Manuskript zuteilwird!
In diesem profanen Sinn eines zufälligen, kontingenten Sich-Ereignens an einem gegebenen Substrat – sei dies Buch, menschliches Individuum, Gemälde, Gebäude usw. – wird heute, in religiös entspannter Zeit, der Begriff des Schicksals unbefangen auf alles bezogen, was einem Ding oder einer Person durch die Zeitläufe hin widerfahren kann.
17Philosophie der Mythologie, 8. Vorlesung. Darmstadt 1966, Bd. I, S. 185
18 Ich entnehme den Ausdruck ‚Unverfügbares‘: A. Grabner-Haider: Alt-Europa, in: Grabner-Haider/Prenner: Religionen und Kulturen der Erde. Darmstadt 2004, S. 56 passim. – Die Prägung des Terminus Unverfügbarkeit geht wohl auf den evangelischen Theologen Rudolf Bultmann (1884-1976) zurück, der diese zum wesentlichen Kennzeichen Gottes erhob. Dieser Ansatz steht wiederum im Zusammenhang mit Heideggers Kritik der abendländischen Metaphysik, die den Begriff Seiendes auf das ‚Verfügbare‘ eingeengt habe (vgl. H. Forster/Red.: Art. Unverfügbarkeit. HWPh 11, Sp. 334).
19 Vgl. Grabner-Haider, a.O., S. 55. Diese Herleitung ist aber nicht unumstritten. So leitet Kluges etymologisches Wörterbuch (Ausg.1989) den Ausdruck Gott von einem idg. Verb für ‚opfern‘ ab. Ebenfalls idg. lautet ein Appellativ für Gott ‚Zuteiler‘, was auf seine Rolle als Schicksalsmacht anspielt.
20 Grabner-Haider, a. O., S. 49
21Duden Die Deutsche Rechtschreibung (Ausg. 1996)
22 Vgl. dazu W. Pötscher: Art. Personifikation. Der Kleine Pauly IV (München 1979), Sp. 661ff.
23 Ebd., Sp. 662
24 Vgl. zum letztgenannten Aspekt: Schönknecht, Descartes [] (2022), Kap. II 2.1
25 Zu analogen Tendenzen der Systembildung beim frühen Dichter Hesiod vgl. vom Vf.: Mythos – Wissenschaft – Philosophie (Marburg 2017), Bd. 1, Kap. 8.3.4
26 Vgl. Physik II 5
27 A. O. 196 b 10ff.
28 A. O., 197 b 20ff.
29 Ebd., 197 a 14
30 Diogenes Laertius II, IX 7
31 A. Zierl: Art. heimarméne. WbaPH, Sp. 184
32 Vgl. Schönknecht: Mythos [], Kap. III 4
33 J. Kroymann: Einführung, in: Seneca: Vom glückseligen Leben. Stuttgart 1978,
S. 13
34 Vgl. G. Stroumsa: Das Ende des Opferkults Die religiösen Mutationen der Spätantike. Berlin 2011, S. 163
35Die Vernunft in der Geschichte (Hg. J. Hoffmeister) Hamburg 51955, S. 38
36Ilias 22, 209ff.
37 Vgl. W. Eisenhut: Art. Fatum. Der Kleine Pauly II, Sp. 520
38 Vgl. dazu den informativen Artikel auf Wikipedia
III. Christlicher Tribut an die Kontingenz
1. Gnosis – Negative Theologie – Verborgenheit Gottes
Allerdings bringt sich das Phänomen der Kontingenz, obwohl es durch die Idee göttlicher Providenz prinzipiell bewältigt scheint, auch in der christlichen Theologie noch zur Geltung. Im Christentum, ja im Monotheismus generell, ist Gott (Jahwe, Allah) die Schicksalsmacht. Als personal und geistig vorgestellt, entscheidet er zwar frei, aber nicht willkürlich, sondern mit Gründen, und zwar stets ‚aus gutem Grund‘. Schon Platon identifizierte Gott mit dem Guten39, sah das Göttliche, im Gegensatz zum homerischen Mythos, als frei von jedem Neid40, behauptete gar Gottes Fürsorge für den Menschen auch im Kleinen41 und sah den Glauben an Göttliches als höchste moralische Pflicht und unabdingbare Voraussetzung für ein stabiles persönliches und staatliches Leben, eine Annahme, die im übrigen nicht ignoriert werden sollte.
Aber auch die christliche, im Unterschied zur jüdischen und islamischen stark spekulativ und logiklastig ausgerichtete Theologie muss dem Faktum der Kontingenz Tribut zollen. Dies wird erzwungen durch die Tatsache, dass zwar in verschiedenen Naturbereichen wie der näheren Gestirnwelt, dem organischen Leben und den Strukturen der Materie zumindest in der Nahperspektive ein bewunderungswürdiger Grad ebenso komplexer wie stabiler Ordnung besteht, so dass er die Annahme eines weisen und wohlwollenden Schöpfers geradezu zu erzwingen scheint, dass jedoch diese Annahme konterkariert wird durch die offensichtlich völlige Indifferenz der vermeintlichen Schöpfungsmacht gegenüber den unbestreitbaren grausamen und chaotischen Vorgängen der Wirklichkeit, vom zerstörerischen Wüten der elementaren Naturkräfte über die grausame Ordnung des Fressens und Gefressenwerdens im Tierreich bis zu den von Menschen an ihresgleichen begangenen Scheußlichkeiten, von denen die letzte immer als die definitiv unüberbietbare erscheint.
Im Grunde ist das Christentum als solches, mit seiner zentralen Vorstellung des Messias und Christos, des Heilands und Retters der Welt, ganz auf dieses Ineinander von Ordnung und Chaos hin konzipiert, für welches Kontingenz nur einen anderen Begriff darstellt. Aber nicht nur die Tatsache, dass die erwartete Totalsanierung ins Unabsehbare vertagt ist und derweil die Chose unvermindert weitergeht, belastet die Theologie, vielmehr bedarf das Faktum selbst der Begründung und Rechtfertigung; ihr Anspruch auf Wissenschaftlichkeit selbst zwingt die Theologie zu dem Unternehmen, das Faktum des Negativen kommensurabel zu machen.
Dieser Zwang treibt die Theologie von ihren Anfängen an um und hat zu einer Reihe charakteristischer Lösungsversuche geführt. Vom ‚Heidentum‘ geerbt wurde die gnostische Konzeption, die das Schlechte und Böse einfach in die selbst als böse vorgestellte Ursprungsmacht, den Demiurgen, rückverlegte, einen guten Heiland gegen den bösen Demiurgen ausspielte und so einen Dualismus zweier feindlicher Prinzipien in den Weltgrund projizierte. Dieser Ansatz lief der Trinitätsidee zuwider und wurde von der sich stabilisierenden katholischen (von gr. kat’holon: ‚auf das Ganze bezogenen‘, ‚allgemeinen‘) Kirche bald als häretisch ausgeschieden. (Der gnostische Ansatz zieht sich allerdings subkutan durch die abendländische Geschichte, wir finden seine Spuren bei vielen Modernen, u. a. bei Schelling, Nietzsche, Heidegger, Adorno42).
Ein zweites Denkmotiv war eine sich durch die Geschichte der Gotteslehre hindurch ziehende ‚negative Theologie‘. Ihr zufolge ist Gott toto coelo (sic!) von allem Weltlichen, Endlichen verschieden, weshalb über ihn mit unseren am Endlichen gebildeten Begriffen nicht adäquat ausgesagt werden kann. Lediglich was er nicht ist, lässt sich sagen. In diesem Sinn befindet Thomas von Aquin (1225-74): „Zur Erkenntnis Gottes muß man den Weg der Verneinung beschreiten“43. Diese These hält Thomas aber nicht davon ab, eine Fülle von ‚Gottesbeweisen‘ zu entwickeln und das Problem dadurch zu entspannen, dass er nach dem Prinzip der analogia entis, der „Ähnlichkeit der Geschöpfe [mit Gott]“44 durch Umkehrung endlicher Bestimmungen oder deren Steigerung bis zum Umschlagspunkt eine Fülle ebenso verneinender wie bejahender Gottesprädikate deduziert, etwa die noch heute geläufigen Bestimmungen, dass „Gott ewig [ist]“45, dass „in Gott keine Materie [ist]“46, dass „Gott kein Körper [ist]“47 oder auch so metaphysisch-kryptische Zuschreibungen wie die, dass „Gott sein Wesen [ist]“48 und dass „Gott nicht das Sein als Form aller Dinge [ist]“49.
Radikaler klingt die negative Theologie allerdings beim bedeutendsten der Neuplatoniker, bei Plotin (203-269). Von analogia entis kann keine Rede sein, wenn Plotin befindet, dass das Göttliche nicht denkt, nicht will, kein Bewusstsein hat und es – in Abwandlung von Platons Rede, das (göttliche) Gute sei noch jenseits des Seins – „jenseits der Einsicht“50 verortet. Sehen wir von dem inneren Widerspruch in Plotins Argument ab, dass das Göttliche uneinsehbar sein soll und der Denker ihm dennoch (negative) Bestimmungen zuschreibt, bleibt festzuhalten: Mit der Abtrennung des Göttlichen von allem Endlichen, Weltlichen fällt Letzteres komplementär der Grund- und Substanzlosigkeit, d. h. der Kontingenz anheim.
Schließlich reflektiert sich die Kontingenz-Bedrohung im Theologumenon vom Verborgenen Gott, dem Deus absconditus. Bereits paulinisch ist der Gedanke, dass in der Gestalt Christi sich Entbergung (Offenbarung) und Verbergung Gottes uno actu vollziehen, indem der Glaube an Christus den Nichtchristen Torheit ist51. Starke Beachtung findet das Motiv bei Martin Luther, dem zufolge „der verborgene [Gott] in der Menschheit [d.h. in der Gestalt Jesu] versteckt [ist]“. Das Motiv bleibt präsent über Pascal und Jakob Böhme bis in die dialektische Theologie Karl Barths, bei dem es heißt: „<Gottes Kraft ... ist und bleibt ... verborgen>“, und diese Tatsache „fordert vom Menschen den <Sprung ins Leere>“52. Dass dieser Sprung auch im Leeren enden, dass die in den Glauben gesetzte Hoffnung nichtig sein könnte, bedeutet die Auslieferung des Menschen an Kontingenz. Wir werden diesem Motiv bei Kierkegaard erneut begegnen.
2. Theodizee als Kontingenzabwehr
Ein spezifisch philosophisches, durch den neuzeitlichen Rationalismus geprägtes Verfahren zur Rettung der Idee der göttlichen Providenz, d. h. zur Kontingenzbewältigung, ist die erstmals von G. W. F. Leibniz (1646-1716) terminologisch fixierte und thematisch ausgearbeitete Theodizee, die Rechtfertigung Gottes angesichts des physischen und moralischen Übels in der Welt53. Leibniz geht bereits von der rationalistischen Überlegung aus, dass es zur Vermeidung einer universellen Zufälligkeit und Kontingenz der Dinge der Annahme einer allmächtigen Ursache bedürfe. Es geht ihm nicht primär, wie noch Descartes, um einen Beweis der Existenz Gottes, sondern um die Lösung des erstmals von Epikur (342-271 v. Chr.) formulierten und von diesem negativ beantworteten Widerspruchs zwischen der Proklamation göttlicher Allmacht und Güte und der Tatsache zahlloser Leiden in der Welt. Für Epikur stellte sich die Frage so: „Der Gott will entweder die Übel abschaffen und kann es nicht, oder er kann und will es nicht, oder er will es nicht und kann nicht, oder er will und kann. Wenn er will und nicht kann, ist er schwach, was auf Gott nicht zutrifft. Wenn er kann und nicht will, ist er neidisch, was dem Gott gleichermaßen fremd ist. Wenn er weder will noch kann, ist er neidisch und schwach, also auch kein Gott. Wenn er will und kann – was allein dem Gotte zukommt –, woher stammen dann die Übel? Oder warum schafft er sie nicht ab?“54
Für den geistig aufgeschlossenen Menschen des christlichen Kulturkreises dürfte die von Epikur formulierte Problematik noch heute von Interesse sein, betrifft sie doch den Kern der Conditio humana, die menschliche Situation schlechthin, wie ihre unverminderte, durch die Präsenz vielfältigen Unglücks bestätigte Aktualität belegt. Epikur beantwortet die Frage nicht, wie man aus moderner Sicht vermuten könnte, mit einem Bekenntnis zum Atheismus, sondern wählt eine nur mit Bezug auf seine Naturphilosophie verständliche Lösung. Als Fortsetzer von Demokrits atomistischer Theorie des Kosmos, welch letzterer für ihn ewigen Bestand hat, entwickelt Epikur seine Theologie in Abhängigkeit von der Kosmologie. Demzufolge umfasst der Kosmos – eigentlich sehr modern – eine Vielzahl von Welten, ja es gibt „derartiger Welten unzählig viele“55.
In die nach atomistischer Raumvorstellung zwischen den Welten liegenden Zwischenräume, die sogenannten Intermundien56, versetzt Epikur die Götter, die dort – in homerischer Tradition – ein „unvergängliches und glückseliges“57 Leben führen und sich um die Beschwernisse der Sterblichen in keiner Weise kümmern. Mit den Kontingenzen des Lebens müssen die Menschen selbst fertig werden, und sie vermögen dies Epikur zufolge prinzipiell vermittels philosophischer Rationalität, die sie zu einem umsichtig geführten Leben befähigt und „zur ungestörten Seelenruhe“58 führt, unter anderem dadurch, dass die Philosophie uns auch die essenzielle Bedeutungslosigkeit des von den meisten so gefürchteten Todes erkennen lässt59. Die von ihm selbst aufgeworfene Theodizee-Problematik beseitigt Epikur also durch ihre Liquidation. Die Annahme der göttlichen Indifferenz und Weltferne lässt die Frage sinnlos werden – das ist in der Tat ein zukunftsträchtiges Konzept. Zur heftigen Bekämpfung Epikurs durch die Kirche mag auch dieser Aspekt der von diesem Philosophen durchgehend propagierten Versöhnung des Menschen mit seiner Endlichkeit beigetragen haben!
Epikurs elegante Lösung des Theodizee-Problems ist denn auch für Leibniz als Christen nicht akzeptabel. Die Idee göttlicher Güte und Providenz sucht er mit dem heute nur noch als frommer Sophismus erscheinenden Argument zu retten, Gott lasse das Übel zu um willen der menschlichen Freiheit, sich im Widerstreit des Guten und Bösen für das Gute entscheiden zu können. Unter dieser Voraussetzung ist eine Welt, in der es neben Gutem auch noch Übel gibt, einer Welt ohne Übel, aber auch ohne menschliche Freiheit vorzuziehen. Da das Verhältnis des Guten zum Schlechten in der Welt (dem Philosophen!) im ganzen akzeptabel erscheint, erklärt Leibniz auch gleich die Welt so wie sie besteht, zur besten aller möglichen Welten und bekennt sich damit zu einem philosophischen Optimismus.
Dass diese harmonisierende Sicht der Dinge nicht unwidersprochen bleiben würde, liegt auf der Hand, und der uns geläufige Begriff Optimismus ist selbst ein erstes Dokument solchen Widerspruchs. Der vom lateinischen Wort optimum: ‚das Beste‘ abgeleitete Ausdruck wurde nämlich im Jahre 1737 von französischen Jesuiten in der polemischen Absicht geprägt, Leibniz‘ Theodizee wegen ihrer rationalistischen Verrechnung Gottes und der rein rationalen Behandlung der Problematik des Bösen in der Welt zu desavouieren. Komplementär wurde, ebenfalls ironisch, der als Grundeinstellung zum Leben ebenso populär gewordene Gegenbegriff Pessimismus geprägt60.
Im Unterschied zu dem von der Aufklärung verfochtenen, aber von späteren Philosophen überwiegend als trivial empfundenen Optimismus machte Pessimismus im 19. Jahrhundert eine bemerkenswerte Karriere als philosophischer Terminus bzw. Grundorientierung61 und ging ebenfalls in die Gemeinsprache über. Der Begriff wurde zum Kern philosophischen Selbstverständnisses bei Schopenhauer und Nietzsche. Letzterer interpretierte, nach anfänglich begeisterter Zustimmung, Schopenhauers philosophische Position als Pessimismus der Schwäche und Ausdruck von décadence und setzte dem einen Pessimismus der Stärke, d. h. des Amoralismus und der Bejahung des irrationalen, Leiden schaffenden Zustands der Welt entgegen. Nietzsche resümierte seine Position in der berühmt gewordenen Sentenz, „daß nur als ein ästhetisches Phänomen das Dasein und die Welt gerechtfertigt erscheint“62.
Dass ein solcher zynischer, mit Nietzsches verschleierndem Ausdruck: dionysischer Pessimismus ebenso inakzeptabel ist wie ein fader, das Schlechte in der Welt verharmlosender Optimismus, dürfte auf der Hand liegen.
3. Exkurs: Voltaires Candide ou l‘optimisme als literarische Bestreitung von Theodizee und göttlicher Providenz
Aus einer der jesuitischen geradezu entgegengesetzten, nämlich der aufklärerischen Perspektive vollzieht der geniale Spötter Voltaire (1694-1778) die Kritik des Leibniz‘schen Optimismus in seiner literarisch großartigen, vor Witz sprühenden Satire Candide ou l‘optimisme (1759), in der deutschen Übersetzung treffend als Candid oder die Beste aller Welten betitelt63. Der junge Mann Candide, der in sich Züge literarischer Figuren wie Odysseus, Parzival und Don Quichotte vereinigt, ist der reine Tor (sein Name ist abgeleitet vom lateinischen candidus: weiß, rein, klar, ungekünstelt), der naiv und gläubig die Lehre seines philosophischen Lehrers Pangloss (zusammengesetzt aus griechisch pan: ‚alle‘ und glossa: ‚Sprache‘, eine deutliche Anspielung auf den als Universalgelehrten geltenden Leibniz64) annimmt, dass es in der Welt bei allem „physischen und moralischen Übel“65 doch grundsätzlich gut und gerecht zugehe, und dessen Lebensmaxime heißt: „Vertrauen wir der Vorsehung“66.
Um Candide zu Realitätssinn zu verhelfen, treibt ihn sein Autor in unglaublichen Abenteuern durch die ganze Welt, von dem „Rauchloch Westfalen[sic!]“67 aus über Bulgarien, Spanien, Portugal nach Buenos Aires und Surinam und zurück über Frankreich und England nach Venedig und schließlich Konstantinopel – immer auf der Spur seiner geliebten Kunigunde, der Tochter seines adeligen Herrn, der ihn, als nicht standesgemäß, gerade wegen dieser Neigung aus dem Hause getrieben hatte und dessen Besitztum durch Kriegswirren selbst ruiniert wird. Mit allen Scheußlichkeiten der Welt, mit Krieg, Mord, Raub, Sklaverei, Prostitution, religiösem Wahn, politischen Intrigen, adeligem Dünkel wird der harmlose Candide konfrontiert, und doch bricht bei jedem der wenigen positiven, menschlich schönen Erlebnisse die Neigung wieder durch, das Ganze als positiv zu sehen – „besonders gegen Ende der Mahlzeiten [!]“68