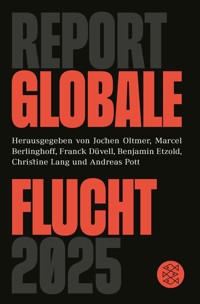
Report Globale Flucht 2025 E-Book
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die forschungsbasierte Perspektive auf das Thema Flucht Flucht ist eine globale Herausforderung, über die oft nur verkürzt berichtet wird. Der »Report Globale Flucht« bietet ein Gegengewicht: Über 30 Autorinnen und Autoren aus verschiedenen Wissenschaftsbereichen schreiben hier über Hintergründe, Entwicklungen und Diskurse rund um das Thema Flucht. Der Band stellt damit forschungsbasiertes Wissen bereit und beleuchtet ein Thema, über das oft nur punktuell, einseitig und populistisch berichtet wird. Schwerpunkt des diesjährigen Reports ist das Thema Lager. In diesem Band schreiben unter anderem Albert Scherr über Flüchtlingslager und -politik in Jordanien, Vera Rugova und Tengiz Dalalishvili über die Lage in Armenien und Bergkarabach und Jochen Oltmer über den Umgang mit Flüchtlingen in der Weimarer Republik. Der »Report Globale Flucht« erscheint im Auftrag des Projekts »Flucht- und Flüchtlingsforschung: Vernetzung und Transfer« (FFVT) und wird herausgegeben von Jochen Oltmer, Marcel Berlinghoff, Benjamin Etzold, Christine Lang und Andreas Pott.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 368
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Herausgegeben von Jochen Oltmer, Marcel Berlinghoff, Franck Düvell, Benjamin Etzold, Christine Lang und Andreas Pott
Report Globale Flucht 2025
Über dieses Buch
Im »Report Globale Flucht« beleuchten über 30 Autor:innen aus unterschiedlichen Wissenschaftsbereichen wichtige Aspekte rund um eines der drängendsten Themen unserer Zeit. Schwerpunkt des Reports 2025 sind Flüchtlingslager.
René Kreichauf untersucht, wie Verstetigungs-, Urbanisierungs- und »Campization«-Prozesse auf die Struktur und Funktion von Flüchtlingslagern einwirken. Alex Fusco beschreibt die Transformation der Lager an den EU-Außengrenzen hin zu stark regulierten Räumen, und Petra Molnar warnt im Gespräch mit Benjamin Etzold vor dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz als Grenz- und Überwachungstechnologie. Anne Irfan erläutert Entstehung, Geschichte und Kontroversen der UNRWA, des UN-Hilfswerk für Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten. Außerdem berichten Autor:innen über das regionale Fluchtgeschehen und die Asylpolitik in Jordanien, im Sudan, in Armenien u.v.m.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Herausgegeben von Jochen Oltmer, Marcel Berlinghoff, Franck Düvell, Benjamin Etzold, Christine Lang und Andreas Pott im Auftrag des Projekts »Flucht- und Flüchtlingsforschung: Vernetzung und Transfer« (FFVT)
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
© 2025 S. Fischer Verlag GmbH,
Hedderichstr. 114, 60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: Andreas Heilmann und Gundula Hissmann, Hamburg
Das Projekt »Flucht- und Flüchtlingsforschung: Vernetzung und Transfer« (FFVT) wird gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF).
Die folgenden Institute führen das Projekt durch:
Bonn International Centre for Conflict Studies (BICC)
Centre for Human Rights Erlangen-Nürnberg (CHREN, Universität Erlangen-Nürnberg)
German Institute of Development and Sustainability (IDOS, Bonn)
Institut für Migrationsforschung und Interkulturelle Studien (IMIS, Universität Osnabrück)
ISBN 978-3-10-492238-6
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Vorwort
Literatur
Fokusthema: Lager
René Kreichauf – Die Transformation der Flüchtlingslager im Jahrhundert globaler Vertreibungen
Verstetigungs-, Urbanisierungs- und »Campization«–Prozesse
Vom Lager zum Wohnen? Ausdifferenzierung und verschiedene Erscheinungsformen des Lagers
Flüchtlingslager als Big Business: Ökonomisierung und Profit
Das Lager im Jahrhundert globaler Vertreibungen
Alex Fusco – Flüchtlingslager an den Rändern der Europäischen Union
Hotspots auf den Inseln und Lager auf dem Festland
Migrationssteuerung oder humanitäre Versorgung?
Das »Lager als Spektakel« und die wirtschaftliche Bedeutung
Schluss
Literatur
Sahat Zia Hero und Jaitun Ara im Gespräch mit Benjamin Etzold
Literatur
Im Lager. Felix Nussbaum (1904–1944)
Literatur
Bildnachweis
Grenzen
Boris Nieswand – Das Flughafenasylverfahren: Ein soziologischer Blick auf die Transitzone und die Fiktion der Nichteinreise
Die Flughafen-Grenze als Spektakel
Das deutsche Flughafenasylverfahren im historischen Entstehungskontext
Die fiktive Nichteinreise
Schluss
Petra Molnar im Gespräch mit Benjamin Etzold über »intelligente Grenzen«
La Frontera: Artists along the US-Mexican Border. Ein Langzeitprojekt des Fotografen Stefan Falke
Stand des Flüchtlingsschutzes
Anne Irfan – as ist die UNRWA? Gründung, Mandat und Herausforderungen des UN-Hilfswerks für Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten
Ursprünge
Entwicklung
Kontroversen
Clara Schmitz-Pranghe, Zeynep Şahin-Mencütek, Ruth Vollmer, Katja Mielke und Markus Rudolf – Perspektiven nach der Rückkehr? Zur Rolle von Rückkehrbereitschaft, Netzwerken und Mobilität für Reintegrationsverläufe
Was verstehen Rückkehrer:innen selbst unter Rückkehr und Reintegration?
Einflussfaktoren für den Reintegrationsverlauf
Die Rolle der Reintegrationsunterstützung
Schlussfolgerungen
Jörg Dollmann, Jannes Jacobsen, Christoph Nguyen und Sabrina J. Mayer – Faktoren der Rückkehrbereitschaft nach gewaltsamer Vertreibung: Eine empirische Untersuchung ukrainischer Geflüchteter
Warum entscheiden sich Geflüchtete und Vertriebene zur Rückkehr?
Rückkehrmotive auf dem Prüfstand
Fazit
Franck Düvell – Ukrainische Vertriebene in der EU. Ein Fall rassistisch motivierter Privilegierung?
Wurden aus der Ukraine fliehende Ausländer:innen bei der Flucht und anschließenden Aufnahme diskriminiert?
Wurden andere Flüchtlingsgruppen benachteiligt, weil die Richtlinie über den befristeten Schutz auf sie keine Anwendung fand?
Stellt der befristete Schutzstatus wirklich eine Vorzugsbehandlung dar?
Kann man wirklich sagen, dass »die EU« Ukrainer:innen bevorzugt behandelt?
Sind Ukrainer:innen »weiße Europäer«?
Welche weiteren Faktoren prägen den Umgang Westeuropas mit Ukrainer:innen?
Schluss
Tabea Scharrer – Wie Migrationsabwehr und gefährliche Migrationsrouten zusammenhängen. Das Beispiel der Lösegeldschleusung in Libyen
Lösegeldschleusung
Der Wandel der Migrationsrouten für somalische (Flucht-)Migrant:innen
Rose Jaji – Der Flüchtlingsbegriff in Afrika: Ein Fall von politischer Auslegung. Aufnahme Geflüchteter und fließende kategoriale Übergänge im Kontext der Dekolonisierung
Zweigeteilte und apolitische Kategorisierungen in Afrika nach der Unabhängigkeit
Schluss
Literatur
Nachgefragt und Nachgelesen
Jochen Oltmer – Asylpolitik und Schutzsuchende in der Weimarer Republik
Debatten im Reichstag um den Status von Schutzsuchenden in der Weimarer Republik
Praktiken des Flüchtlingsschutzes und Internationalisierung der Flüchtlingspolitik
Schluss: Prekärer Schutz durch beschränkte Duldung in der Weimarer Republik
Thomas Meyer – Hannah Arendt und die Flüchtlinge
Erstaunlicher Optimismus
Außerhalb jeder staatlichen Ordnung
Recht, Rechte zu haben
Umbau der etablierten politischen Begriffe
Schwäche von Arendts Analysen
Schluss
Michael Mayer – Asyl nur für Deutsche? Die vergessene Entstehungsgeschichte des umkämpften Asylartikels im Grundgesetz
Die Entstehung einer Asylpolitik für SBZ-Flüchtlinge im Jahre 1947
Die Verhandlungen des Parlamentarischen Rats
Die Wirkungsgeschichte des Asylrechts im Grundgesetz
Fred Nyongesa Ikanda im Gespräch mit Nadine Segadlo und Marcel Berlinghoff
Flucht regional
Franck Düvell – Einführung in die Rubrik
Literatur
Jan Busse und Stephan Grigat im Gespräch mit Christine Lang und Franck Düvell
Albert Scherr – Jordanien
Ein Modell für die Neuausrichtung internationaler Flüchtlingspolitik?
Jordaniens Flüchtlingspolitik verhindert Integration
Einblicke in die prekäre Situation von Flüchtlingen in Lagern und Aufnahmegemeinden
Widersprüche der deutsch-jordanischen Partnerschaft
Saskia Jaschek – Sudan
Hintergründe
Sudan als Kristallisationspunkt für Flucht und Migration
Fluchtentwicklungen seit Kriegsbeginn
Flucht in der Region
Ausblick
Klaus Neumann – Australien
Resettlement
Asylsuchende und indochinesische Bootsflüchtlinge
Abschreckung und Abschottung
Ist ein Politikwechsel vorstellbar?
Australische Asylpolitik als Blaupause für eine europäische Politik?
Vera Rogova – Die Vertreibung der Armenier:innen aus Bergkarabach
Situation der Geflüchteten
Hintergründe des Konflikts
Neue Realität nach dem Krieg und die Verhandlungen über ein Friedensabkommen
Perspektiven für die Bergkarabach-Armenier:innen
Fluchtziel Bundesrepublik Deutschland
Kayvan Bozorgmehr und Andreas W. Gold – Gesundheitsversorgung geflüchteter Menschen in Deutschland: Regelungen, Zugangswege und Versorgungsstrukturen
Zugangswege zur Gesundheitsversorgung
Strukturen der Gesundheitsversorgung
Fazit
Zerrin Salikutluk, Kien Tran und Tae Jun Kim – Institutionenvertrauen im Kontext von Migration und Flucht: Erkenntnisse aus dem NaDiRa.panel
Politisches Vertrauen und Polizeivertrauen im Fokus
Diskriminierung und Vertrauen
Fazit
Das NaDiRa.panel am Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung
Marina Ruth – Hürdenlauf in Ausbildung und Erwerbsarbeit. Wie kann die Migrationssozialarbeit Hindernisse für junge Geflüchtete abbauen?
Ausbildung und Erwerbsbeteiligung junger Geflüchteter in Deutschland
Hürden beim Zugang zu Ausbildung und Erwerbsarbeit
Welche Unterstützung bietet die Migrationssozialarbeit?
Schlussfolgerungen
Sam Zamrik im Gespräch mit Laura Lotte Lemmer
Dominic Sauerbrey – Fluchtchronik 2024/25
März 2024
April 2024
Mai 2024
Juni 2024
Juli 2024
August 2024
September 2024
Oktober 2024
November 2024
Dezember 2024
Januar 2025
Februar 2025
Die Mitwirkenden
Vorwort
Zum Jahresausklang 2024 ist in Syrien das Assad-Regime gefallen, Ursache einer der jüngsten und umfangreichsten Fluchtbewegungen weltweit. Ob sich die politische, wirtschaftliche und soziale Situation in Syrien zum Besseren wenden wird, muss sich erst noch erweisen. Syrische Schutzsuchende hoffen insbesondere in den Nachbarstaaten Türkei und Libanon auf eine Rückkehr, denn dort ist die Lage der Geflüchteten teils höchst prekär.
Politische Stimmen in anderen Aufnahmeländern, wie Deutschland oder Österreich, begannen unmittelbar nach dem Umsturz in Syrien, Rückführungen zu fordern, obgleich die Zukunft Syriens in höchstem Maße ungewiss ist: Das Land ist in großen Teilen stark zerstört. Die Wirtschaft liegt darnieder, sie ist seit Beginn des Bürgerkriegs um 85 % geschrumpft. Auch deshalb ist zweifelhaft, ob das Land Hunderttausende oder gar Millionen Rückkehrer:innen aufnehmen und erfolgreich reintegrieren kann. Die Forschung zeigt, dass Rückkehrer:innen oft als Binnenflüchtlinge enden, wie im Irak, oder Konflikte um knappe Ressourcen anheizen, wie in Afghanistan.[1] Vorstellungen von einer schnellen und massenhaften Rückkehr erscheinen demnach unrealistisch und riskant, denn diese könnte die syrische Gesellschaft überlasten und die Instabilität des Landes weiter vertiefen. Vergessen werden sollte auch nicht, dass sich ein Großteil der syrischen Schutzsuchenden in den europäischen Ankunftsländern inzwischen angesichts einer Aufenthaltsdauer von rund einem Jahrzehnt intensiv in die Gesellschaften hinein vernetzt und ihren Lebensmittelpunkt längst nach Europa verlagert hat. Das zeigt sich in Deutschland beispielsweise an der sehr hohen Bereitschaft, so rasch wie es die gesetzlichen Vorschriften erlauben, die deutsche Staatsangehörigkeit anzunehmen (2023 stammten 38 % aller Antragstellenden aus Syrien). Vor diesem Hintergrund und angesichts der Tatsache, dass ein erheblicher Teil der Schutzsuchenden als Kinder und Jugendliche nach Europa kam, sollte die Rückkehrneigung nicht überschätzt werden.
Darüber hinaus lässt sich momentan noch gar nicht ausmachen, ob nicht eher neue Fluchtbewegungen anstelle einer Rückkehr die Situation in Syrien kennzeichnen werden: Unter anderem die fortgesetzten Angriffe der Türkei und ihrer Verbündeten auf kurdische Siedlungen in Nordsyrien führten bereits im Dezember 2024 zu neuen Vertreibungen. So sprach das Amt der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA) im Dezember 2024 von 1,1 Millionen neuen Vertriebenen, darunter 100000 Kurd:innen.[2]
Ungewissheiten kennzeichnen auch die Lage in der Ukraine, einem weiteren wichtigen Zentrum der globalen Fluchtverhältnisse: Gegenwärtig lässt sich nicht ausmachen, dass 2025 Zerstörung und Vertreibung im Rahmen des russischen Kriegs gegen die Ukraine enden werden.[3] Bis Ende 2024 stieg die Zahl der ukrainischen Geflüchteten in der EU von rund 4,1 auf 4,5 Millionen weiter an. Insbesondere die gezielten russischen Terrorangriffe auf Elektrizitäts- und Heizkraftwerke – bis zu 80 % der Stromerzeugungskapazitäten sind beschädigt oder zerstört – trieben erneut Menschen außer Landes, zumindest während der Wintermonate. Der Verlust des Zugangs zu Strom und Wärme erweist sich als ein weiterer Fluchtgrund, der bislang in der Forschung kaum untersucht worden ist.
Inzwischen können sich laut dem Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung (ifo-Institut) in München nur noch 39 % der Ukrainer:innen in der EU eine Rückkehr vorstellen, 25 % wollen demgegenüber an ihren neuen Wohnorten bleiben. Im Juni 2024 verlängerte die EU den befristeten Schutzstatus für Ukrainer:innen bis März 2026. Aller Voraussicht nach handelt es sich um die letztmalige Verlängerung des durch die EU-Massenzustromrichtlinie geschaffenen vorübergehenden Schutzstatus für Ukrainer:innen. Ob ein Aufenthaltsstatus, und gegebenenfalls welcher, nach März 2026 für ukrainische Schutzsuchende zur Verfügung stehen wird, ist momentan ungewiss.
Anders als im Falle Syriens und der Ukraine fand die Vertreibung der armenischen Bevölkerung Bergkarabachs kaum Aufmerksamkeit in der europäischen Öffentlichkeit – gewiss auch, weil nur wenige der von dort Geflohenen Grenzen der EU überschritten. In Bergkarabach, einer armenischen Enklave in Aserbaidschan, wurden nach einer Abriegelung des Gebiets und einem kurzen Krieg Ende 2023 über 115000 Menschen vertrieben. Das entspricht nahezu der gesamten armenischen Bevölkerung der Region. Etwa 15 % sind in andere Staaten weitergezogen, vor allem dann, wenn sie dort Angehörige hatten. Das EU-Parlament sieht in der Vertreibung einen Fall »ethnischer Säuberung«.[4] Dennoch blieb eine Unterstützung Armeniens durch die EU weitgehend aus und auch die Berichterstattung riss schnell wieder ab. Insbesondere das weitere Schicksal der Vertriebenen ist 2024 international kaum thematisiert worden.
Ebenso wenig Aufmerksamkeit in Europa fand 2023/24 der Bürgerkrieg im Sudan. Inzwischen befinden sich 14 Millionen Sudanes:innen auf der Flucht.[5] Der Großteil von ihnen ist insofern immobilisiert, als sie wegen fehlender Ressourcen und geschlossener Grenzen nicht über Möglichkeiten der Migration verfügen. In der EU haben 2023 nur rund 9600 Menschen aus dem Sudan um Asyl nachgesucht. Die Medien berichteten kaum über die sudanesischen Fluchtverhältnisse, auch die internationalen politischen Reaktionen blieben sehr verhalten. Es handelt sich mithin um eines der vergessenen Fluchtzentren der Welt.
Um Afghanistan ist es international ebenfalls still geworden, obgleich seit der Machtübernahme der Taliban 2021 weitere 1,6 Millionen Menschen geflohen sind und 350000 Afghan:innen in der EU Asyl beantragt haben. In Deutschland sank allerdings 2024 die Zahl der von dort kommenden Schutzsuchenden im Vergleich zu 2023 stark ab. Selbst die Fluchtbewegungen im Konflikt zwischen Israelis und Palästinenser:innen fanden in den vergangenen Monaten in der internationalen Öffentlichkeit kaum mehr Interesse. Die Vertriebenen im Gazastreifen bleiben wegen der Grenzsperren dort weiterhin gefangen,[6] ihre Bewegungsmöglichkeiten innerhalb des schwer zerstörten Territoriums sind gering. Der israelische Angriff auf die Hisbollah im Libanon dauerte hingegen nur einige Wochen, so dass die meisten der rund 900000 Binnenvertriebenen in ihre Häuser zurückkehren konnten oder können.
Trotz des Rückgangs der Zahl der Asylanträge in Europa im Vergleich zu den Vorjahren blieb das Thema Flucht auch 2024 ein zentraler Gegenstand politischer und medialer Debatten. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund des Aufstiegs rechtspopulistischer und rechtsextremer Positionen, denen es gelungen ist, die Themen Migration und Flucht für ihre Zwecke zu instrumentalisieren, dominieren in den EU-Staaten Abwehrreflexe, Restriktionsspiralen und Abschiebephantasien.
So versuchte 2024 die italienische Regierung, Asylverfahren nach Albanien auszulagern. Sie folgte damit einem ähnlichen Plan der abgewählten konservativen britischen Regierung, per Boot über den Ärmelkanal eingereiste Asylsuchende in das ostafrikanische Ruanda auszufliegen, um deren Asylverfahren dort durchführen zu lassen.[7] Anders als das Ruanda-Modell bieten Asylverfahren in Albanien in den Augen von Bundesinnenministerin Nancy Faeser ein »interessantes Modell«.[8] Italien wollte im zentralen Mittelmeer aufgegriffene erwachsene und als nicht-vulnerabel geltende Männer in Albanien ausschiffen, um dort die Asylverfahren durchzuführen. Zu dem Zweck sind zwei geschlossene Flüchtlingslager aufgebaut worden, in denen die Verfahren von jährlich 36000 Personen durchgeführt werden sollten. Die ersten Verfahren scheiterten bereits im Ansatz: Italienische Gerichte stellten fest, dass der Transfer nach Albanien unrechtmäßig sei. Daraufhin mussten die kurzzeitig in den albanischen Lagern untergebrachten Menschen nach Italien transportiert werden. Die Lager stehen seither leer und das italienische Personal wurde abgezogen. Allerdings hält die italienische Regierung weiterhin an dem Plan fest.
Zu den aktuellen europäischen Abwehrreflexen passt auch die Beschränkung der Resettlement-Programme zur Umsiedlung von Schutzsuchenden, die bereits in Drittstaaten vom UN-Hochkommissariat für Flüchtlinge (UNHCR) anerkannt wurden. Der UNHCR sieht einen weltweiten Bedarf von einer Million Resettlement-Plätzen. In der EU nehmen nur noch 14 Staaten an den Programmen teil, mit Litauen, Slowenien und der Slowakei sind zuletzt drei Länder ausgestiegen. Die Quote hat weiterhin einen Umfang von rund 30000 freiwilligen Aufnahmen pro Jahr, unter anderem, weil die Niederlande ihre Quote erhöht haben. Bislang war in Deutschland von geplanten 6560 aufzunehmenden Personen nach § 23 Absatz 4 des Aufenthaltsgesetzes die Rede, verteilt auf verschiedene Programme. Hinzu tritt noch das Bundesaufnahmeprogramm für besonders gefährdete Afghan:innen (Stichwort »Ortskräfte«). Es wurde mit dem Ende der Koalitionsregierung im November 2024 zunächst gestoppt. Laut Programm für die Bundestagswahl 2025 will die CDU alle freiwilligen Aufnahmeprogramme beenden, dazu gehört auch die Familienzusammenführung von subsidiär Geschützten.[9] Von den ohnehin nur sechs Landesaufnahmeprogrammen (Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Thüringen) soll dasjenige in Brandenburg eingestellt werden. Nichtregierungsorganisationen berichten zudem, dass angesichts der Unsicherheit über die Zukunft der Programme die Bearbeitung von Anträgen verschleppt wird. Dabei ist zu bedenken, dass solche Resettlement-Programme sowie die Familienzusammenführung die einzigen legalen Migrationsmöglichkeiten für Schutzsuchende bieten, ungenehmigter Migration also vorgebeugt werden kann. Eine Beschränkung solcher legalen Wege führt nicht zu einer Abnahme der Flüchtlingszahlen in Deutschland, sondern, so zeigt die Forschung, kann zur Zunahme ungenehmigter Migration beitragen.[10]
Auf einen weiteren Abwehrreflex einiger EU-Mitgliedstaaten verweist die Praxis der heimlichen Zurückweisung von Schutzsuchenden durch staatliche Organe an den Außengrenzen nach einer unerlaubten Einreise, sogenannte Pushbacks.[11] Dies ist ein Verstoß gegen die Europäische Menschenrechtskonvention. Seit vielen Jahren wird Griechenland der Vorwurf gemacht, solche Zurückweisungen sowohl an den Festlandgrenzen zur Türkei als auch an den Seegrenzen in der Ägäis durchzusetzen. Beides leugnet die griechische Regierung vehement. Im Januar 2025 allerdings hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte geurteilt, dass Griechenland »eine systematische Praxis von ›Pushbacks‹ von Drittstaatlern durch die griechischen Behörden« verfolge[12] und dabei sogar Menschen ungesetzlich in verschiedenen, teils informellen Einrichtungen festhalte, auf die wir auch in unserem diesjährigen Fokusthema »Lager« eingehen. Dies ist insofern ein bedeutsames Urteil, als es die europäischen Staaten ermahnt, in ihrer Migrationspolitik rechtstaatlich zu handeln.
Angesichts des politischen Primats der Abwehr und der Rückführung wird in den politischen und medialen Debatten oft übersehen, dass ein Großteil der Schutzsuchenden irgendwann Mitbürger:innen und Kolleg:innen werden. Überhaupt sind in der Flüchtlingsdebatte Narrative über die erfolgreiche gesellschaftliche Teilhabe von Schutzsuchenden, bei der zahlreiche Barrieren überwunden werden mussten,[13] nur selten zu vernehmen. So sind zum Beispiel allein in Deutschland rund 230000 Syrer:innen sozialversicherungspflichtig beschäftigt, es wurden große Summen in ihre Aus-, Fort- und Weiterbildung investiert. Zwar machen sie nur rund ein Prozent aller Arbeitnehmer:innen aus, aber die Unternehmen, die sie beschäftigten, können sie angesichts von (Fach-)Arbeitskräftemangel und über 700000 unbesetzten Stellen schwerlich ersetzen. Nicht weniger als rund 200000 Kinder und Jugendliche aus syrischen Familien befinden sich gegenwärtig an deutschen Schulen. Es wäre also ein erheblicher Verlust, wenn bereits weitreichend integrierte Geflüchtete, wie die genannten Syrer:innen, nun massenhaft zurückkehrten oder sie gar zurückgeführt werden würden.
Trotz der Verstärkung der Politik der Abwehr gegenüber Schutzsuchenden lassen sich auch Initiativen ausmachen, die die Mitsprachemöglichkeiten von Flüchtlingen verbessern. Die Bundesregierung hat 2024 ein Refugee Advisory Board (RAB) eingerichtet. Dies ist ein Ausschuss, der sich aus Geflüchteten zusammensetzt und die deutsche Regierung berät. Er geht auf § 34 des Globalen Paktes für Flüchtlinge zurück, der die Beteiligung von Geflüchteten an der Ausgestaltung von Flüchtlingspolitik einfordert.[14] In Deutschland ging die Initiative zur Gründung eines entsprechenden Gremiums von der Flüchtlingsselbstorganisation R-Seat (Refugees Seeking Equal Access at the Table) aus und wurde von der Beauftragten für Migration, Flüchtlinge und Integration der Bundesregierung aufgegriffen. Der RAB ist ein Element eines internationalen Projekts, an dem sich bislang die USA, Kanada, Australien und Neuseeland beteiligen. Deutschland ist der erste europäische Staat, der dieses Projekt unterstützt.[15] Der Ausschuss wird schlussendlich aus zwölf ehrenamtlichen Mitgliedern bestehen, die über Fluchterfahrung verfügen und teils aus von Flüchtlingen geleiteten Organisationen kommen. Ziel ist es, nicht mehr länger nur über, sondern auch vermehrt mit Geflüchteten zu sprechen und sie in die Gestaltung von Politik einzubeziehen: So ist beispielsweise geplant, dass die Mitglieder des Ausschusses deutsche Regierungsdelegationen, etwa des Auswärtigen Amtes oder des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, zu internationalen Treffen oder Konferenzen begleiten.
Der Report Globale Flucht 2025 schließt mit seinem Fokusthema »Lager« nahtlos an den Vorgängerreport an, der dem Fokusthema »EU-Flüchtlingspolitik« galt. Flüchtlingslager sind nicht nur seit Jahrzehnten ein zentrales Element globaler Flüchtlingspolitik, sondern gewinnen auch in der EU ein immer größeres Gewicht, wie insbesondere die Asylverfahrens- und Screening-Verordnungen im Rahmen des »Neuen Pakt für Migration und Asyl« der EU vom Dezember 2023 verdeutlichen.[16] Diverse Beiträge des Reports 2025 widmen sich der zentralen Frage nach den Möglichkeiten, Schutz zu finden, unter anderem an den EU-Außengrenzen sowie dem Stand des Flüchtlingsschutzes in Deutschland und weltweit. Wie im Vorwort des Reports 2024 angekündigt, haben wir zwei Beiträge zur Situation palästinensischer Flüchtlinge einwerben können (Anne Irfan sowie Jan Busse und Stephan Grigat). Mehrere Autor:innen verweisen auf Entwicklungen der vergangenen Jahrzehnte (unter anderem Rose Jaji, Michael Mayer und Jochen Oltmer) mit dem Ziel, die Gegenwart des Flüchtlingsschutzes besser einordnen zu können. Auch wenden sich verschiedene Berichte erneut explizit Fluchtsituationen und Flüchtlingspolitik außerhalb Europas zu (unter anderem die Beiträge zu Jordanien, dem Sudan und Australien). Aber auch der konkreten Situation in Deutschland ist wiederum eine ganze Rubrik gewidmet, wo unter anderem Fragen der Gesundheitsversorgung und des Arbeitsmarktzugangs von Geflüchteten diskutiert werden. Abgerundet wird die Vielstimmigkeit des Bandes durch eine Reihe künstlerischer Beiträge.
Wir danken den Autor:innen sowie dem S. Fischer Verlag, und hier insbesondere unserer Lektorin Johanna Klahn für die erneut sehr reibungslose Kooperation. Laura Lotte Lemmer hat sich dankenswerterweise der Beiträge angenommen, die aus dem Feld der Kultur stammen. Unser Dank gilt außerdem dem Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), das diese Publikation im Rahmen der Förderung des Projekts FFVT ermöglichte.
Fußnoten
[1]
Kenyon Lischer, The Global Refugee Crisis.
[2]
OCHA – UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs: Recent Developments in Syria. Syria Flash Update No. 5, https://www.unocha.org/publications/report/syrian-arab-republic/syria-flash-update-no-5-recent-developments-syria-12-december-2024 (23.12.2024).
[3]
Hierzu siehe den Beitrag von Franck Düvell zu den ukrainischen Vertriebenen in der EU in diesem Band.
[4]
EU Parliament accuses Baku of »ethnic cleansing« in Nagorno-Karabakh, Euronews, 5.10.2023, https://www.euronews.com/2023/10/05/eu-parliament-accuses-baku-of-ethnic-cleansing-in-nagorno-karabakh (23.12.2024).
[5]
Hierzu siehe den Beitrag von Saskia Jaschek zum Sudan in diesem Band.
[6]
Hierzu siehe das Interview mit Jan Busse und Stephan Grigat zu Flucht und Vertreibung in und um Israel/Palästina in diesem Band.
[7]
Lemberg-Petersen, Externalisierungsbestrebungen europäischer Staaten.
[8]
Was hinter dem »Albanien-Modell« steckt – und wer dafür in Frage käme, in: Stern, 27.5.2024, https://www.stern.de/politik/deutschland/asylverfahren-in-drittstaaten--das-steckt-hinter-dem--albanien-modell--34745378.html (23.12.2024).
[9]
Dies ist ein ergänzender Schutzstatus der EU, der Formen von Gefährdung berücksichtigt, die nicht unter die Genfer Flüchtlingskonvention fallen, sondern sich aus der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) ableiten.
[10]
Hierzu siehe den Beitrag von Tabea Scharrer zur Lösegeldschleusung in Libyen in diesem Band sowie Cooper, Legal Pathways’ Effects on Irregular Migration.
[11]
Stierl, Europas nasse Grenzen.
[12]
European Court of Human Rights: »Pushback« of Turkish national to Türkiye without examining risks she faced on her return was in breach of Convention, 7.1.2025, https://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003–8124877–11378031 (14.1.2025).
[13]
Hierzu siehe den Beitrag von Marina Ruth zur Rolle der Migrationssozialarbeit in diesem Band.
[14]
Global Compact on Refugees: Meaningful Participation of Refugees and Stateless People in the Global Refugee Forum 2023 and Beyond, 27.11.2023, https://globalcompactrefugees.org/news-stories/meaningful-participation-refugees-and-stateless-people-global-refugee-forum (10.1.2025).
[15]
Friedrich-Ebert Stiftung: Shifting Power: Advancing Refugee Participation at the Global Refugee Forum, 12.12.2023, https://geneva.fes.de/e/shifting-power-advancing-refugee-participation-at-the-global-refugee-forum.html (23.12.2024).
[16]
Bendel, Durchbruch und Desaster.
Literatur
Adema, Joop/Giesing, Yvonne/Poutvaara, Panu: Rückkehrabsichten und Integration von ukrainischen Geflüchteten, in: ifo Schnelldienst, 77.2024. H. 10, S. 3–18, https://www.ifo.de/publikationen/2024/aufsatz-zeitschrift/rueckkehr-oder-integration-welche-perspektiven-haben-gefluechtete (23.12.2024).
Bendel, Petra: Durchbruch und Desaster: Die jüngste Einigung auf eine Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems, in: Oltmer et al. (Hg.), Report Globale Flucht 2024, S. 19–35.
Cooper, Rachel: Legal Pathways’ Effects on Irregular Migration, Institute of Development Studies. K4D Helpdesk Report, Brighton 2019, https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5cd99936e5274a38bed21639/569_Regular_Pathways_Effects_on_Iregular_Migration.pdf (23.12.2024).
Kenyon Lischer, Sarah: The Global Refugee Crisis: Regional Destabilization & Humanitarian Protection, in: Daedalus, 176.2017, H. 4, S. 85–97.
Lemberg-Pedersen, Martin: Externalisierungsbestrebungen europäischer Staaten, in: Oltmer et al. (Hg.), Report Globale Flucht 2024, S. 75–86.
Oltmer, Jochen/Berlinghoff, Marcel/Düvell, Franck/Lang, Christine/Pott, Andreas (Hg.): Report Globale Flucht 2024, Frankfurt a.M. 2024.
Stierl, Maurice: Europas nasse Grenzen, in: Jochen Oltmer/Marcel Berlinghoff/Franck Düvell/Ulrike Krause/Andreas Pott (Hg.), Report Globale Flucht 2023, Frankfurt a.M. 2023, S. 57–69.
Fokusthema: Lager
René Kreichauf
Die Transformation der Flüchtlingslager im Jahrhundert globaler Vertreibungen
Flüchtlingslager spiegeln die Beständigkeit von Flucht und Vertreibung wider. Sie werden weltweit als temporäre, oftmals räumlich und rechtlich abgetrennte Unterbringungsstätten in Form von Zelten, Hütten, Containersiedlungen aber auch wohnhausähnlichen Gebäuden von staatlichen und/oder privaten Akteur:innen, Nichtregierungsorganisationen (NGOs), den Vereinten Nationen sowie von Geflüchteten selbst geplant, errichtet und betrieben. Sie bieten Menschen, die gezwungen sind, ihre Heimat zu verlassen, unmittelbaren Schutz und decken ihre grundlegendsten Bedürfnisse. Lager dienen aber auch der Kontrolle, Steuerung und Verwaltung von Geflüchteten. Sie zeichnen sich aus durch bauliche und räumliche Abtrennung (Zäune, Mauern, Stacheldraht, Sicherheitspersonal), Zwang und Festhaltung (beispielsweise durch die Pflicht, in einem Lager zu leben) und teilweise Eingrenzung im Lager beziehungsweise Ausgrenzung aus der Gesellschaft.
Als moderne Institution entwickelte sich das Flüchtlingslager in afrikanischen Kolonien europäischer Imperialstaaten Ende des 19. Jahrhunderts, um kolonialisierte und rassifizierte Bevölkerungen von ihrem Land zu vertreiben und dann räumlich zu konzentrieren. Im Laufe des 20. Jahrhunderts, laut Zygmunt Bauman dem »Jahrhundert des Lagers«, entwickelten sie sich auch in den imperialen Zentren zu einer Institution mit verschiedenen Formen und Funktionen. Oft gerechtfertigt durch rassistische und koloniale Ideologien, wurden Lager zu Zwecken wie Ausgrenzung, Disziplinierung (Kriegsgefangenenlager), Zwangsarbeit und Ausbeutung (Arbeitslager, GULAGs, Konzentrationslager) sowie der systematischen Vernichtung (nationalsozialistische Vernichtungslager) verfolgter Gruppen geschaffen. In, zwischen und nach den Weltkriegen wurden sie auch für die erzwungene Massenunterbringung, Rückführung oder Umsiedlung von Flüchtlingen, Vertriebenen und Zwangsrekrutierten in andere Länder und zur Integration in Nachkriegsgesellschaften eingerichtet.
Seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts haben Kriege und territoriale Konflikte, oft verbunden mit postkolonialen Staatengründungen und Globalisierungsprozessen, massenhafte Vertreibungen und großflächig angelegte Flüchtlingslager hervorgebracht. Im Globalen Süden entwickelten sich Zelt- und Containerstädte für die Bereitstellung humanitärer Hilfe. In europäischen Staaten, Australien und den USA wurden Flüchtlingslager zu einem Kernbestandteil restriktiver Asylgesetzgebungen sowohl an Außengrenzen als auch innerhalb nationalstaatlicher Territorien mit dem Ziel der Verwaltung, Kontrolle, Konzentration und Abschreckung von Geflüchteten. Diese Trends haben sich im 21. Jahrhundert, das wir angesichts der nie da gewesenen Zahl von mehr als 110 Millionen Geflüchteten (über 1,5 % der Menschheit) als Jahrhundert der globalen Vertreibungen bezeichnen können, weiter verstetigt. Dabei sind auch neuartige Erscheinungsformen und Funktionen entstanden, die eng mit aktuellen politischen, wirtschaftlichen und sozialen Entwicklungen verbunden sind.
Dieser Beitrag geht auf drei zentrale Merkmale der aktuellen Transformation von Lagern ein. Zunächst zeigt er, dass sich Lager durch zeitliche und räumliche Verstetigungsprozesse urbanisieren. Anschließend wird die Herausbildung von Lagern als urbane Wohnform beschrieben. Schließlich wird gezeigt, dass Lager in globale wirtschaftliche Prozesse eingebunden sind und sie – neben Versorgung, Kontrolle und Verwaltung – auch Profitinteressen dienen.
Verstetigungs-, Urbanisierungs- und »Campization«–Prozesse
Die Tendenz zur zeitlichen und räumlichen Verstetigung stellt ein grundlegendes Merkmal von Flüchtlingslagern dar. Viele Geflüchtete verbringen mehrere Monate und Jahre in Lagerzuständen – beispielsweise wegen anhaltender und neuer Krisen, ungeregelter Aufenthaltsfragen oder angespannter Wohnungsmärkte in Städten. Diese »permanente Temporalität« zeigt sich im Globalen Süden in der Urbanisierung von Flüchtlingslagern: Lager verstädtern sich oder wachsen in Städte hinein und werden Teil davon. Damit einher gehen mehrere Entwicklungen: Die Personengruppen in den Lagern werden vielfältiger – so leben etwa verschiedene Geflüchtete vergangener und aktueller Fluchtbewegungen aber auch anderweitig von der Gesellschaft ausgegrenzte Gruppen zusammen. Zudem entwickeln sich spezifische städtische Infrastrukturen und Dienstleistungen (Bildungs-, Kultur- und Sporteinrichtungen, Gesundheitsversorgung, religiöse Orte), wirtschaftliche Aktivitäten (Handel, Märkte, Geschäfte, Restaurants) und Formen politischer Verwaltung. Nicht zuletzt finden räumliche Aneignungsprozesse und Neuordnungen statt. Dadurch bewegt sich das Lager hin zu einer »normalen«, aber weiterhin prekären Siedlungsform, die sich mit informellen Siedlungen überschneidet.
Auch im Globalen Norden sind Flüchtlingslager kaum mehr aus städtischen, aber auch ländlichen Räumen wegzudenken. Sie können dabei sehr unterschiedliche Ausprägungen und Funktionen annehmen, die eng mit Migrationsgesetzen, aber auch lokalen Unterbringungspraktiken verbunden sind. In den USA und Australien werden zum Beispiel Geflüchtete, die einen Grenzübergang passieren und Asyl beantragen, in »Detention Centers« oder auch Abschiebegefängnissen inhaftiert, manchmal für den gesamten Zeitraum ihrer Asylverfahren. Geflüchtete, die entweder direkt aus den Grenzlagern oder aus Folgegefängnissen entlassen werden, werden oft in städtischen Obdachlosenheimen untergebracht. In Europa besteht die Lagerlandschaft weitgehend aus einem ineinandergreifenden System aus Aufnahme (»Hotspots« an den Außengrenzen, großangelegte Erstaufnahmeeinrichtungen), (Folge-)Unterbringung (kleinteilige Gemeinschaftsunterkünfte) und Abschiebung (Gefängnisse, »Rückführungszentren«). Diese Funktionen verschwimmen allerdings. Zum Beispiel finden Abschiebungen auch in Erstaufnahmeeinrichtungen und Folgeunterbringungen statt und Geflüchtete verbringen oft Jahre in Ankunftszentren (zum Beispiel aufgrund eines Rückstaus in der Unterbringungsversorgung oder wegen behördlicher Willkür). Zudem unterscheiden sich Flüchtlingslager, oftmals unabhängig von ihrer Bestimmung, räumlich, baulich und architektonisch. So werden ehemalige Flughäfen, Lagerhallen, Schulen, Verwaltungsgebäude und Hotels umgenutzt und neu errichtete Containerdörfer, Zeltlager sowie sozialwohnungsbauähnliche Gebäude angelegt. Zunächst als temporäre Unterbringung (sowohl hinsichtlich der Dauer ihrer Anlage als auch der Aufenthaltsdauer von Geflüchteten) gedacht, haben sie sich auch in Europa verstetigt.
Neben diesen staatlichen Lagern errichten Geflüchtete nicht nur in Grenzregionen und auf Fluchtrouten (wie zum Beispiel in Frankreich der »Dschungel von Calais«), sondern auch in Städten und aufgrund angespannter Wohnungsmärkte und staatlicher Ausgrenzungspraktiken informelle Camps. In einer Lagerhalle in der Nähe des zentralen Busbahnhofs Belgrads existiert mit über 3000 Geflüchteten das momentan größte informelle Lager Europas. In Brüssel sind seit 2019 entlang des Stadtkanals am Rande der Innenstadt gleich mehrere Zeltlager von Geflüchteten entstanden, unter anderem weil die Stadtverwaltung die Unterbringung männlicher Asylsuchender eingestellt hat. Auch in US-Städten entstehen seit einigen Jahren informelle Behausungen, weil Stadtregierungen den Zugang zu Obdachlosenheimen beschränken. Die Herausbildung dieser informellen Lager verdeutlicht einerseits Einschränkungen und Unterbrechungen der Mobilität und Bewegungsfreiheit von Geflüchteten, die »stranden« und von der öffentlichen Wohnraumversorgung ausgeschlossen werden. Andererseits spiegeln sie aber auch Widerstände gegen restriktive und gewaltvolle Asyl- und Lagerpraktiken wider sowie das Bedürfnis von Nähe und Zugang zu städtischen Strukturen und Netzwerken.
Insgesamt beschreiben diese Entwicklungen »Campization«-Prozesse, die sich durch drei parallel laufende Trends auszeichnen: erstens die Ausbreitung von dauerhaft angelegten und räumlich isolierten Lagern, zweitens das Eindringen der Logiken des Lagers in städtische Strukturen, Stadtentwicklungspolitiken und in die Wohnraumversorgung sowie drittens die Ausweitung lagerähnlicher Unterbringungen auf andere Gruppen.
Vom Lager zum Wohnen? Ausdifferenzierung und verschiedene Erscheinungsformen des Lagers
Wie bereits angedeutet, hat sich in den vergangenen Jahren eine Gleichzeitigkeit verschiedener Lagerformen herausgebildet. In Europa ist auf der einen Seite eine verstärkte Abschottung von Geflüchteten in Lagern, vor allem in Lagern in Grenzräumen aber auch in Aufnahmezentren, erkennbar.[1] Diese Massenlager werden für mehrere tausend Personen errichtet, schränken die Mobilität von Geflüchteten erheblich ein und zeichnen sich durch ein fortgeschrittenes Maß an personeller, baulicher und biometrischer Kontrolle aus. Die Brutalität der Abschottung an europäischen Außengrenzen, an denen jährlich Tausende Menschen sterben, setzt sich räumlich in dieser hoch technologisierten Form der Lager fort.
Auf der anderen Seite haben sich Lager insbesondere in Städten als permanente und prekäre Mischform urbanen Wohnens herausgebildet. Diese unterscheiden sich auf den ersten Blick optisch, räumlich und baulich von »klassischen« Flüchtlingslagern. Sie sind in städtische Wohn- und Unterbringungskonzepte integriert und tragen zur allgemeinen Wohnraumversorgung bei. In Berlin – einem zentralen Ort der Aufnahme von Geflüchteten in Europa – stellt die Anlage von sogenannten modularen Unterkünften für Geflüchtete (MUF) das größte öffentliche Wohnungsbauprogramm seit der deutschen Wiedervereinigung 1990 dar. MUF werden aus vorfabrizierten Betonmodulen in dauerhafter Qualität für über 20000 Menschen errichtet (s. Abbildung 1). Sie verfolgen das politische Ziel, sich explizit von Flüchtlingslagern abzusetzen und sollen Orte der sozialräumlichen Integration (sowohl hinsichtlich ihrer baulichen Struktur, als auch der Bewohner:innen) darstellen. Sukzessive werden diese Unterkünfte auch für andere Bevölkerungsgruppen geöffnet, die Probleme haben, Wohnraum auf dem angespannten regulären Wohnungsmarkt zu finden. Dafür erarbeitet die Berliner Regierung momentan eine Strategie zur »Gesamtstädtischen Steuerung der Unterbringung (GStU)«, durch die die Unterkunftsversorgung von Geflüchteten und wohnungslosen Menschen zentralisiert wird. Diese Überschneidung der Verwaltung und Unterbringung international Vertriebener und städtisch Verdrängter wird in nordamerikanischen Städten schon länger praktiziert und findet zunehmend auch in europäischen Städten wie Paris und Hamburg Anwendung.
Quelle: René Kreichauf.
Diese Entwicklungen zeigen, dass Lager Wohnmerkmale übernehmen. Sie schleichen sich in die städtische Wohnraumversorgung ein, behalten allerdings ihre wesentlichen Lagerfunktionen (Kontrolle, Verwaltung, Konzentration) bei. Zudem veranschaulichen sie, dass sich in Städten Krisen von Obdachlosigkeit, Wohnraummangel und Armut mit der Lagerunterbringung Geflüchteter überlappen und räumlich wie sozial vermischen. Darüber hinaus wird deutlich, dass die Räume, Logiken und Praktiken der Lagerunterbringung oft Ausgangspunkte für neoliberale Experimente in der Wohnungsbau- und Sozialpolitik bieten, von denen zahlreiche Akteur:innen profitieren.
Flüchtlingslager als Big Business: Ökonomisierung und Profit
Flüchtlingslager stellen ein Milliardengeschäft dar und sind in globale Wirtschaftsprozesse integriert. Im Lager kommen verschiedene Dienstleistungen und Akteur:innen zusammen: Internationale Organisationen wie das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR), staatliche und nichtstaatliche, gewinnorientierte und gemeinnützige humanitäre Organisationen bis hin zu Bauunternehmen, Lagerbetreibern, Lebensmittellieferanten und Catering-Unternehmen, Sicherheitsfirmen und Sozialarbeiter:innen. Aber auch innerhalb des Lagers, und von Geflüchteten geschaffen, entwickeln sich Ökonomien, die im Globalen Süden wie im Norden mit städtischen Wirtschaftskreisläufen verwoben sind.
In den meisten europäischen Ländern wird die Lagerunterbringung an private Betreiberunternehmen ausgesourct, die wiederum andere Unternehmen für spezifische Dienstleistungen wie zum Beispiel Sicherheitspersonal beauftragen. So betreiben etwa in Berlin über 25 zumeist profitorientierte Unternehmen die aktuell mehr als 100 Unterkünfte. Ein zentraler Akteur ist die Hero GmbH, einer der größten Anbieter von Lagern und Betreuungsdiensten in Europa, die im Besitz der multimillionenschweren Brüder Kristian und Roger Adolfsen ist. Ihnen wurde wiederholt vorgeworfen, ein komplexes Netzwerk von Tochter- und Holdinggesellschaften zu nutzen, um Gelder für die Flüchtlingsbetreuung in die eigenen Taschen zu leiten.
Auch der Bau wohnraumähnlicher Unterkünfte, wie die MUF, ist von wirtschaftlichen Interessen getrieben. MUF gehen auf ein Konzept des globalen Beratungsunternehmen McKinsey & Company zurück, das die Berliner Regierung 2016 mit der Neuorganisation der Lagerbetreuung beauftragte. Sie sind ein anschauliches Beispiel für die Art und Weise, wie Unterkünfte als neoliberale Experimente der Wohnversorgung genutzt werden. MUF werden von der Wohnungsbaugesellschaften gebaut und vom Berliner Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) zur Unterbringung von Geflüchteten angemietet. Das LAF wiederum beauftragt private Unternehmen mit dem Betrieb. Die Mietzahlungen werden vom Bund refinanziert und liegen mit ca. 18,50 Euro pro Quadratmeter auf dem Niveau hochpreisiger Mietwohnungen im Berliner Stadtzentrum. Durch diese hohen Mieten, die dichte Belegung und die Gegenfinanzierung durch den Bund amortisiert sich der Bau dieser Unterkünfte vergleichsweise schnell und ist weitaus kostengünstiger als der Bau dringend benötigter Soialwohnungen. In Anbetracht der sich zuspitzenden Wohnungskrise in Berlin stellen MUF daher eine profitable Möglichkeit dar, Wohnraum im Substandard zu bauen. Durch baugesetzliche Ausnahmeregelungen können MUF zudem ohne Bürgerbeteiligung und auf Bauland angelegt werden, das baurechtlich nicht für Wohnraumnutzung vorgesehen ist. Mit MUF können so Grundstücke erschlossen, in Wert gesetzt und künftig weiterentwickelt werden, während gleichzeitig die Vergabe von Bau- und Betreiberaufträgen vielseitige wirtschaftliche Potenziale und Kreisläufe freisetzt.
Diese Beispiele zeigen, dass die Anlage, Funktionsweise und Verstetigung von Lagern mit vielfältigen wirtschaftlichen Möglichkeiten einhergehen, die zu deren Aufrechterhaltung beitragen. Lokal durchaus unterschiedlich ausgestaltet sind sie doch Teil eines global stetig wachsenden Wirtschaftszweigs. Der Staat wirkt darauf vielfältig ein: durch Asylgesetze, die die Lagerunterbringung für einen gewissen Zeitraum vorschreiben, lokale Unterbringungspolitiken, die zunehmend auch andere Gruppen umfassen, und durch eine neoliberale Wohnungsbaupolitik, welche die Grundlage für den profitorientierten Bau von Unterkünften als neue substandardisierte Form des sozialen Wohnungsbaus schafft. Flüchtlingslager sind damit nicht immer eine finanzielle Last für staatliche und städtische Haushalte, sondern wirtschaftlich produktive und profitable Orte – allerdings auf Kosten der Wohn- und Lebensbedingungen Geflüchteter und anderer marginalisierter Gruppen.
Das Lager im Jahrhundert globaler Vertreibungen
Auch im 21. Jahrhundert sind Flüchtlingslager ein prägendes Merkmal stetig wachsender Fluchtbewegungen. Aufgrund von Prozessen der Verstetigung, Urbanisierung und »Campization« sowie der Einbindung in wirtschaftliche Kreisläufe haben sich Lager in unterschiedliche, manchmal neuartige Formen ausdifferenziert. Sie sind zum Symbol und zu Orten sowohl schärferer Grenzpraktiken als auch neuer Formen städtischen Wohnens geworden, in denen sich die Lebensumstände erheblich unterscheiden können. Ein Lager, das der Abschiebung geflüchteter Menschen dient, ist hinsichtlich seiner baulichen Merkmale, Formen von Kontrolle, Machtausübung, Ein- und Ausgrenzung nicht gleichzusetzen mit offenen und zunehmend als Wohnraum gestalteten Flüchtlingsunterkünften. Einerseits wird daher deutlich: Lager ist nicht gleich Lager, weder im globalen noch im lokalen Vergleich.
Trotz dieser Ausdifferenzierungen ist aber andererseits festzuhalten: Das Lager bleibt ein Lager. Vor allem weil Geflüchtete zumeist nicht freiwillig in einem Lager leben, administrative Vorgaben die autonome Organisation und Gestaltung ihres Haushalts einschränken und ihr Zugang (sowie der von Gästen) geregelt wird, grenzen sich Lager auch weiterhin von regulären Wohnformen ab – egal, wie sehr sie optisch und planerisch versuchen, keine Lager zu sein. Flüchtlingslager bewegen sich somit auf einem breiten Spektrum zwischen Formalität und Informalität, Geschlossenheit und Offenheit, Kontrolle und Selbstverwaltung sowie Temporarität und Dauerhaftigkeit und sie können verschiedene Funktionen (zum Beispiel Transit, Erstaufnahme, Abschiebung, Wohnen) einnehmen.
Diese Entwicklungen sind eng mit globalen Vertreibungs- und Verdrängungsprozessen verbunden, durch die nicht nur die Zahl geflüchteter, sondern auch die wohnungsloser Menschen steigt. Weltweit leben über 150 Millionen Menschen ohne festen Wohnsitz (im Vergleich zu 100 Millionen im Jahr 2015). In der EU sind über eine Million Menschen von Obdachlosigkeit betroffen und eine weitaus größere, aber unbekannte Zahl lebt in prekären Wohnverhältnissen. Somit finden die internationalen Fluchtbewegungen des 21. Jahrhunderts vor dem Hintergrund einer verschärften Verdrängung städtischer Bewohner:innen auf Wohnungsmärkten statt, die durch immer teurer werdenden Wohnraum geprägt sind. Die Verschränkung von globalen und städtischen Marginalisierungsprozessen und wachsenden sozialräumlichen Ungleichheiten wird sowohl im Globalen Süden in der Überschneidung von Flüchtlingslagern und informellen Siedlungen als auch im Norden in der gemeinsamen Unterbringung und Verwaltung von Geflüchteten und wohnungslosen Gruppen deutlich. Flüchtlingslager übernehmen eine entscheidende Rolle in der für viele Akteur:innen profitablen Verwaltung, Konzentration und Unterbringung einer zunehmenden Zahl gesellschaftlich ausgegrenzter Menschen, für die die Logik des Lagers, prekäres Wohnen sowie wirtschaftliche Rationalisierungsprozesse zur Normalität werden.
Literatur
Dalal, Ayham: The Refugee Camp as Urban Housing, in: Housing Studies, 37.2022, H. 2, S. 189–211.
Hartmann, Melanie: Zwischen An- und Ent-Ordnung. Sammelunterkünfte für Geflüchtete als Räume des Politischen, Wiesbaden 2020.
Kreichauf, René: From Forced Migration to Forced Arrival: the Campization of Refugee Accommodation in European Cities, in: Comparative Migration Studies, 6.2018, H. 7, S. 1–22.
Martin, Diana/Minca, Claudio/Katz, Irit: Rethinking the Camp: On Spatial Technologies of Power and Resistance, in: Progress in Human Geography, 44.2020, H. 4, S. 743–768.
Picker, Giovanni/Pasquetti, Silvia: Durable Camps: the State, the Urban, the Everyday, in: City, 19.2015, H. 5, S. 681–688.
Fußnoten
[1]
Hierzu s. den Beitrag von Alex Fusco zu Lagern an den europäischen Außengrenzen in diesem Band.
Alex Fusco
Flüchtlingslager an den Rändern der Europäischen Union
Seit 2015 hat sich die Errichtung von Lagern als eine der wichtigsten Strategien zur Steuerung der irregulären Migration in Europa herauskristallisiert. Das lässt sich am Beispiel Griechenlands sehr gut beobachten. Das Land stand im Sommer 2015 im Fokus der EU-Migrationspolitik, als über eine Million Menschen an seinen Küsten ankamen. Griechenland war nicht der einzige EU-Mitgliedstaat, der eine politische Antwort auf die Zuwanderung von Flüchtlingen entwickeln musste – Italien, Spanien, Zypern und Malta sahen sich mit ähnlichen Herausforderungen konfrontiert. Aber Ausmaß und Geschwindigkeit der Migrationsbewegungen lagen in Griechenland höher.
Im Folgenden werden die beiden unterschiedlichen Geographien von Lagern dargestellt, die sich als Reaktion herausbildeten: der sogenannte Hotspot-Ansatz, der hauptsächlich auf den griechischen Inseln umgesetzt worden ist, und die Lager, die auf dem Festland errichtet wurden. Der Beitrag stellt die verschiedenen Logiken dar, die bei der Errichtung und Aufrechterhaltung der Lager wirkten und zeichnet die Entwicklung der Lager von vielfältigen halboffenen zu stark kontrollierten und regulierten Räumen nach.
Hotspots auf den Inseln und Lager auf dem Festland
Nach Angaben des Flüchtlingshochkommissariats der Vereinten Nationen (UNHCR) verzeichnete Griechenland allein im Oktober 2015 über 210000 Ankünfte von Geflüchteten auf dem Seeweg. Die Zahl hatte in den Sommermonaten stetig zugenommen und überschritt nun zum ersten und einzigen Mal die Zahl von 200000. Zu diesem Zeitpunkt wurde Griechenland eher als Transit-, denn als Zielland betrachtet. Die Inseln der östlichen Ägäis waren ebenso offen wie die griechischen Nordgrenzen. Bundeskanzlerin Angela Merkel erklärte, »Wir schaffen das!«, und die Balkanroute bildete eine Art Korridor. Anfangs registrierte Griechenland die Ankommenden nicht einmal, während Serbien und Mazedonien den Migrant:innen 72 Stunden Zeit gaben, ihr jeweiliges Staatsgebiet zu durchqueren. Ende 2015 begann der griechische Staat jedoch, willkürliche Registrierungsverfahren einzuführen, bei denen die Aufnahmezentren der Lager eine zentrale Rolle spielten.
Der »Hotspot-Ansatz« wurde im Mai 2015 in die »Europäische Migrationsagenda« der EU-Kommission aufgenommen. In den offiziellen EU-Dokumenten ist ein Hotspot kein Ort als solcher, sondern ein ganzer Ansatz, in dessen Kern jedoch bestimmte Orte der sogenannten »Erstankunft« – die »Reception and Identification Centres« (RICs) – stehen. Die gängigere Verwendung des Begriffs bezieht sich jedoch auf die Zentren selbst und in dieser Weise wird der Begriff auch in diesem Beitrag verwendet, um solche Orte auf den griechischen Inseln von den Lagern auf dem Festland zu unterscheiden. Die Hotspots waren Teil einer doppelten Strategie zur Rationalisierung und Europäisierung – also Standardisierung – der Techniken und Verfahren zur Identifizierung, Registrierung und »Sortierung« der in Europa ankommenden Migrant:innen. Die Hotspots waren nicht nur eine Strategie, um die große Zahl der Ankommenden zu kontrollieren, zu disziplinieren und biometrisch zu erfassen. Sie dienten auch als Mittel, um widerspenstige Staaten an den EU-Grenzen zu disziplinieren, die es (strategisch) versäumt hatten, die auf EU-Gebiet Ankommenden zu registrieren. Das galt insbesondere für Italien und Griechenland. Im September 2015 wurde der erste Hotspot auf der Insel Lampedusa eröffnet; innerhalb von sechs Monaten folgten Hotspots auf den griechischen Inseln Lesbos, Chios, Kos, Leros und Samos sowie an mehreren anderen Orten in Italien (Pozzallo, Taranto und Trapani).
Diese Hotspots selbst lassen sich als »Maschinen mit vielen beweglichen Teilen« begreifen.[1] Dies veranschaulicht der vielleicht berüchtigste Insel-Hotspot: Lesbos. Das Hauptlager oder RIC – das Lager Moria – befand sich außerhalb des Dorfes Moria, etwa drei Kilometer vom Hafen in der Inselhauptstadt Mytilini entfernt. In den ersten Jahren wurde der Zugang zum Lager Moria nicht kontrolliert. Im Laufe der Zeit entwickelte sich aber ein Kontrollspektrum, das von laxen Sicherheitsvorkehrungen und Drahtzäunen mit Löchern bis hin zu einem streng überwachten Lager und einem strikten Zugangsverbot für Nicht-Bewohner:innen reichte. Das Lager Moria verfügte über ein eigenes Internierungszentrum – ein Teil des Lagers, der als Gefängnis fungierte und in dem die Bewohner:innen in einer Form staatlichen Gewahrsams festgehalten wurden. Das Lager selbst war von Olivenhainen umgeben. Dieser Bereich wurde bald zum inoffiziellen Ausweichgebiet für Neuankömmlinge, die im Lager selbst keinen Platz mehr fanden. Das nahe gelegene Kara Tepe (Mavrovouni auf Griechisch) wurde zum offiziellen Ausweichquartier für Moria, ein zweites Lager, das speziell für die Unterbringung von Familien und besonders vulnerablen Gruppen eingerichtet wurde. Im Bezirk Neapoli entstand außerdem ein selbstverwaltetes Lager namens Pikpa als ein autonomer Raum speziell für als besonders schutzbedürftig geltende Menschen. Welche Möglichkeiten des Zugangs bestanden und wie kontrolliert und interniert wurde, unterschied sich zwischen den Orten und änderte sich auch im Laufe der Zeit.
Bei dem Hotspot auf Lesbos handelte es sich somit nicht um ein einzelnes, in sich geschlossenes Lager, sondern vielmehr um eine Strategie, die mehrere Standorte und Räume umfasste, welche sich ständig fortentwickelten. Ab 2016, nach dem Abkommen zwischen der EU und der Türkei und als Teil des »Hotspot-Ansatzes«, wurden die Inseln »geschlossen«. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Lager selbst geschlossen wurden, sondern dass die Weiterreise (mit Fähren oder kommerziellen Flugzeugen, die die Inseln ansteuern) verboten wurde. Irregulär Ankommende, einschließlich derjenigen mit Vorregistrierungsdokumenten oder International Protection Applicant Cards (der Bestätigung der Registrierung als Asylbewerber:innen in Griechenland), durften die Inseln nicht verlassen und wurden von Grenzbeamten physisch daran gehindert. Die Inseln fungierten somit als Gefängnisräume, in denen Menschen ohne Ketten, Mauern oder Zäune inhaftiert werden konnten. Im Sommer 2020 wurden auf der Insel Lesbos schätzungsweise über 21000 Menschen unter miserablen Bedingungen festgehalten, die von zahlreichen Beobachter:innen als eindeutige Verstöße gegen die grundlegendsten Menschenrechte bezeichnet wurden.
Parallel zur Entwicklung der Hotspots auf den Inseln verfolgte der griechische Staat eine Politik der Verteilung von Geflüchteten auf dem Festland (Karte 1). Als Anfang 2016 klarwurde, dass die nördlichen Grenzen Griechenlands geschlossen werden sollten, wurden Pläne für die Unterbringung der Flüchtlinge erstellt, die sich wegen der Grenzsperren nicht mehr weiterbewegen konnten. Der UNHCR übernahm die Aufgabe, für 20000 Menschen Plätze in Hotels oder Wohnungen zu finden, während die übrigen (ca. 30000–40000, genaue Zahlen sind jedoch umstritten) in staatlich beaufsichtigten Lagern untergebracht werden sollten. Diese Lager sollten über das gesamte Festland verteilt werden. Das Migrationsministerium forderte die Provinzgouverneure auf, potenzielle Lagerstandorte zu ermitteln, und bald wurde eine Reihe von verlassenen oder halbverlassenen städtischen Gebäuden, staatlichen Grundstücken und Industriebrachen ausfindig gemacht. Um sie für Lagerzwecke zu nutzen, wurden Zelte aufgestellt, provisorische Toiletten eingerichtet, Gemeinschaftsduschen gebaut und grundlegende Reparaturen durchgeführt. Obwohl diese Lager Teil derselben Unterbringungspolitik waren, unterschieden sie sich erheblich in ihrer materiellen Beschaffenheit: Sie reichten von baufälligen Schulgebäuden in halbverlassenen Dörfern nahe der albanischen Grenze bis hin zu ehemaligen Fabriken in den Industriegebieten außerhalb von Athen. Interessanterweise war der griechische Staat in vielen dieser Lager nicht oder kaum vertreten. Stattdessen wurden sie anfangs von internationalen Organisationen, wie dem UNHCR oder der International Organization for Migration (IOM), beziehungsweise von Nichtregierungsorganisationen verwaltet.
Datenquelle: eigene Recherchen.
Diese Lager waren keine Internierungszentren – die registrierten Bewohner:innen konnten sie nach Belieben betreten und verlassen. In den ersten Monaten gab es in den meisten Fällen weder Sicherheitsvorkehrungen noch Zäune. Die Einrichtungen blieben und bleiben auch weiterhin Räume des Ausharrens. Die Menschen warten dort auf das Ergebnis ihres Asylverfahrens – was zwischen einem und vier Jahren dauern kann. Während dieses Zeitraums stand es den Bewohner:innen zunächst im Grunde frei, das Lager zu verlassen. Jedoch konnte dies den Abbruch ihres Asylverfahrens oder den Ausschluss aus dem staatlichen Unterbringungsprogramm bedeuten. Die Bewohner:innen der Lager auf dem Festland wurden also nicht »räumlich«, sondern »zeitlich« festgesetzt. Während die Hotspots auf den Inseln die Menschen biometrisch erfassten und sie physisch an der Weiterreise hinderten, sorgten die Lager auf dem Festland dafür, dass die Bewohner:innen vor Ort blieben, indem ihre biometrische Identität und ihre Asylverfahren dort gebunden waren. Zu erwähnen ist, dass die Bedingungen der Unterbringung in den Lagern zwar nie zufriedenstellend waren, aber auch nie auf das Niveau auf Lesbos und Samos sanken.
Fußnoten
[1]





























