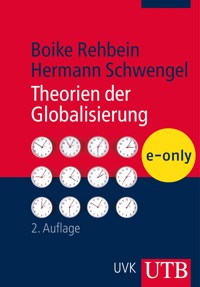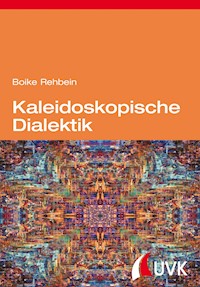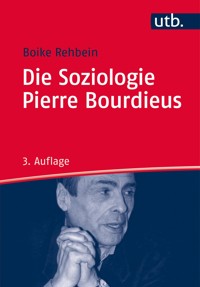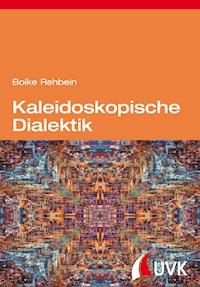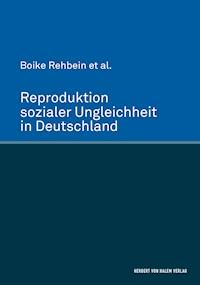
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Herbert von Halem Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Boike Rehbein und sein Forschungsteam legen mit dieser Untersuchung die konstitutiven Mechanismen der sozialen Ungleichheit und die dadurch geschaffenen Trennlinien innerhalb der deutschen Gesellschaft frei. Für diese großangelegte Studie führten sie zwischen 2010 und 2015 über 300 qualitative Interviews zu Lebensläufen und erfassten eine repräsentative Stichprobe. Die Analyse dieser empirischen Daten zeigt, dass die Sozialstruktur Deutschlands durch das Zusammenspiel jahrhundertealter Traditionslinien, der Weitergabe von Habitus und Kapital an die jeweils nächste Generation und die unbewusste symbolische Klassifikation erklärt werden kann. Damit einhergehend wird in diesem Buch die deutsche Sozialstruktur Schritt für Schritt aufgefächert und erläutert, von historischen Klassenstrukturen über Gender, Migration und institutionelle Selektion bis zur Konstitution von Lebensläufen und Lebensstilen. Der Forschungsansatz basiert im Kern auf der Soziologie Pierre Bourdieus, wurde aber im Zusammenhang mit parallelen Untersuchungen in Brasilien, Indien und Südostasien weiter ausgearbeitet und im Hinblick auf internationale Vergleichbarkeit verallgemeinert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 389
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis
Einleitung
1 Klassen, Habitus und Kapital
1.1 Reproduktion
1.2 Soziale Klassen
1.3 Bedeutung und Wandlung der Kapitalformen
1.4 Habitustypen
1.5 Habitus und Kapital in der Migration
2 Die Praxis der Reproduktion
2.1 Klassifikation
2.2 Selektive Anerkennung von Auslandsqualifizierten
2.3 Gender, Partnerschaft und Klasse
2.4 Ethos
2.5 Lebensstile
2.6 Reproduktion der Ungleichheit im Lebenslauf
Schluss
Anhang: Zur Methode
Literatur
Die Autorinnen und Autoren
Abbildungsverzeichnis
Tabellen
Tabelle 1: Korrelation des väterlichen und des eigenen Berufs
Tabelle 2: Beruf des Großvaters väterlicherseits und eigener Beruf
Tabelle 3: Partnerschaft innerhalb der Berufsgruppe
Tabelle 4: Korrelation des eigenen Bildungsniveaus mit dem des Vaters
Tabelle 5: Klasse und höchster Bildungsabschluss
Tabelle 6: Klasse und Berufsklasse
Tabelle 7: Was würden Sie mit einer größeren Geldmenge machen?
Tabelle 8: Welcher Schicht gehörten die Eltern Ihrer Kindheitsfreunde an?
Tabelle 9: Klasse und Beruf des Vaters
Tabelle 10: Besitzen Sie Folgendes im Wert von über 500 000 Euro?
Tabelle 11: Haushaltseinkommen der Klassen
Tabelle 12: Stammen Sie aus einer namhaften Familie?
Tabelle 13: Veränderung der Berufsstruktur Deutschlands (in Prozent)
Tabelle 14: Horizontale Verschiebungen im Bereich der Dienstleistungen...
Tabelle 15: Kodierbogen der Elementarkategorien
Tabelle 16: Erklärung der Elementarkategorien
Tabelle 17: Merkmale der qualitativen Habitustypen
Tabelle 18: Merkmale der quantitativen Habitustypen
Tabelle 19: Verteilung der Habitustypen im Sample
Tabelle 20: Korrelation zwischen Klasse und Migrationsstatus
Tabelle 21: Integrationsgefühl und Herkunft
Tabelle 22: Korrelation von Integration, Klasse und Migrationsstatus
Tabelle 23: Aspekte des geschlechtlichen Klassenhabitus
Tabelle 24: Was ist Ihnen an einer Partnerin am wichtigsten?
Tabelle 25: Was ist derzeit das wichtigste Problem in Deutschland?
Tabelle 26: Haben Sie in Ihrer Kindheit ein Musikinstrument erlernt?
Tabelle 27: Haben Sie in Ihrer Kindheit ein Musikinstrument erlernt?
Tabelle 28: Wie oft sind Sie in Ihrem Leben ins Ausland gereist?
Tabelle 29: Besuchen Sie Fast-Food-Restaurants?
Tabelle 30: Biografische Mechanismen der Identitätsarbeit
Diagramme und Abbildungen
Abbildung 1: Multiple Korrespondenzanalyse Klassen
Diagramm 1: Mitgliedschaft in einem Verein oder einer Organisation
Diagramm 2: Klasse und Besuch eines Gymnasiums
Diagramm 3: Hatten Ihre Eltern eine Bibliothek zu Hause?
Abbildung 2: Raum der qualitativen Habitustypen
Abbildung 3: Vektoren des Raums der Habitustypen
Abbildung 4: Raum der quantitativen Habitustypen
Abbildung 5: Die Habitustypen der deutschen Sozialstruktur
Diagramm 4: Halten Sie sich für selbstbewusst?
Abbildung 6: Ethos und Klasse
Abbildung 7: MCA Ethos
Diagramm 5: Besuchen Sie Sternerestaurants?
Diagramm 6: Trinken Sie an einem gemütlichen Abend Rotwein?
Einleitung
Das 21. Jahrhundert steht bislang im Zeichen wachsender Umweltzerstörung und rasant steigender sozioökonomischer Ungleichheit. Dem Wachstum des Billiglohnsektors im In- und Ausland und geringer Lohnsteigerungen steht eine Explosion der Kapitaleinkünfte und Spitzengehälter gegenüber. 1970 verfügten die reichsten zehn Prozent der Deutschen über 44 Prozent des Vermögens, 2010 über 66 Prozent, wobei das reichste Prozent der Bevölkerung 36 Prozent des Vermögens sein eigen nennen konnte (Wehler 2013: 73). 1985 betrug das Verhältnis des Vorstandsgehalts deutscher Aktiengesellschaften zum Durchschnittslohn ihrer Arbeiter 20:1, 2011 lag es bei 200:1 (ebd.: 70). Diese Zahlen sind beunruhigend und werden in den Medien fast täglich thematisiert. Im Folgenden werden wir jedoch argumentieren, dass derartige Zahlen die Ursachen sozialer Ungleichheit eher verdecken, anstatt zu ihrer Klärung beizutragen.
In den Medien und in der Fachwelt wird soziale Ungleichheit oft als technisches und ökonomisches Problem behandelt. Man sieht viele Zahlen und Schaubilder, die sich meist auf Einkommen oder Vermögen beziehen. Manchmal werden auch Indikatoren berücksichtigt, die das Bildungsniveau oder den Gesundheitszustand messen. Sogar in der Soziologie bieten Arbeiten zu sozialer Ungleichheit vor allem Zahlen. Anhand dieser Zahlen werden Menschen gelegentlich in Schichten oder Gruppen eingeteilt, die soziale Strukturen veranschaulichen sollen.
Im vorliegenden Buch stehen die Lebensverhältnisse der Menschen im Vordergrund. Es basiert auf Hunderten von Interviews und Gesprächen mit Bewohnern Deutschlands unterschiedlichster sozialer und geografischer Herkunft. Im Buch geht es allerdings weniger darum, die Verhältnisse qualitativ zu beschreiben, anstatt sie quantitativ zu messen, sondern es geht darum, grundlegende Mechanismen sozialer Ungleichheit zu erklären. Wir stellen die These auf, dass soziale Ungleichheit auf Strukturen beruht, die von Menschen produziert und reproduziert werden. Das Buch soll die Mechanismen aufklären helfen, die dabei am Werk sind.
Der Erklärungsansatz greift auf die Soziologie Pierre Bourdieus zurück, die auch in Deutschland einflussreich geworden ist. Im Zentrum dieses Ansatzes steht die Idee, dass Handlungsmuster in unterschiedlichen sozialen Umgebungen eingeübt werden. Die Handlungsmuster verfestigen sich im Lebenslauf immer mehr zu einem Habitus. In kapitalistischen und formal demokratischen Gesellschaften sind für das erfolgreiche Handeln Ressourcen erforderlich, deren korrekten Einsatz der Habitus gewährleisten muss, beispielsweise Geld, soziale Netzwerke, Zertifikate, wertvolle Gegenstände, Ansehen oder körperliche Fähigkeiten. Diese Ressourcen bezeichnet Bourdieu (1982) als Kapital, womit ausgedrückt werden soll, dass die Ressourcen der Konjunktur entsprechend investiert werden müssen. Da die sozialen Umgebungen unterschiedlich sind, bilden die Menschen unterschiedliche Habitus aus und erwerben unterschiedliche Arten und Mengen von Kapital. Auf dieser Grundlage haben wir in Deutschland mehrere, klar voneinander getrennte soziale Klassen ermittelt, die sich insbesondere durch Kapital sowie auf anderer Ebene auch durch Habitus und Lebensweise unterscheiden. Diese Unterschiede sind graduell und fließend. Symbolische Trennlinien in der Gesellschaft machen einige von ihnen zu klaren Gegensätzen oder Schranken. Die Menschen werden durch Klassifikation aktiv eingeordnet und integriert oder ausgegrenzt.
Den Hintergrund des vorliegenden Buches bildet ein international vergleichendes Forschungsprogramm. Nachdem wir die Mechanismen sozialer Ungleichheit in Brasilien (Souza 2009, 2010) und Laos (Rehbein 2007) explorativ untersucht und einen Ansatz ausgearbeitet hatten, der sich sowohl auf Asien wie auch auf Lateinamerika anwenden lässt, haben wir unsere Theorie und Methode auf Deutschland übertragen. Normalerweise verläuft der Prozess, wenn überhaupt, in die umgekehrte Richtung: Man erforscht eine nordatlantische Gesellschaft und behauptet dann entweder die universale Geltung der Ergebnisse sowie der Theorie oder überträgt diese auf die Erforschung des globalen Südens. Wir haben unsere Forschung hingegen im globalen Süden begonnen, auch wenn die Grundlage unserer Überlegungen – die Soziologie Bourdieus – in Europa zu verorten ist. Wir können daher behaupten, dass die Mechanismen der Produktion und Reproduktion sozialer Ungleichheit, die wir in diesem Buch vorstellen, in Gesellschaften des globalen Nordens und des globalen Südens identisch sind, obwohl sich die sozialen Strukturen wie auch Habitusformen und Kapital stark voneinander unterscheiden (Rehbein/Souza 2014).
Die Forschung haben wir in den genannten drei sowie in mehreren anderen Ländern gemeinschaftlich durchgeführt. An jedem Ort hat sich ein Team gebildet, das aus Ortsansässigen, Ortsfremden und vorübergehenden Mitgliedern anderer Teams bestand. Die interkulturelle Zusammensetzung jedes Teams gewährleistete eine größere Vielfalt und Objektivität, indem einem selbstverständlichen Ethnozentrismus jeder Sozialforschung entgegengewirkt wurde, neue Perspektiven eingebracht werden konnten und ständig ein wechselseitiger Vergleich mit den anderen Gesellschaften stattfand.
Da im Team zur Erforschung Deutschlands im Zeitraum zwischen 2009 und 2015 mindestens 15 Personen konstant mitgearbeitet haben, konnte eine relativ gute empirische Grundlage aufgebaut werden. Wir haben rund 300 qualitative, lebensgeschichtliche Interviews von 30 bis 120 Minuten Dauer geführt, größtenteils transkribiert und im Team mittels Sequenzanalyse ausgewertet. Abschließend haben wir ein repräsentatives Sample von 61 qualitativen Interviews und eine quantitative Erhebung erstellt. Die quantitative Erhebung umfasst knapp 3000 Fälle und ist großenteils repräsentativ nach Alter, Wohnort, Bildungsniveau und Herkunft. Auch die in der Forschung meist vernachlässigten Gruppen der Migranten, Obdachlosen, älteren Frauen und Ultrareichen sind fast repräsentativ vertreten. Alle Zitate im Buch stammen aus unseren qualitativen Interviews, während alle Statistiken auf unserer quantitativen Erhebung beruhen. Unsere Vorgehensweise wird im Anhang genauer erläutert.
Thesen
Die beiden leitenden Thesen des Buches lauten, dass soziale Ungleichheit in Deutschland auf der Existenz unsichtbarer sozialer Klassen beruht und durch Klassifikation reproduziert wird. Als soziale Klasse bezeichnen wir zunächst eine Gruppe, die keinen Zugang zu den zentralen Tätigkeiten der höheren Klassen hat und ihre Tätigkeiten von den niedrigeren Klassen abgrenzt. Als Klassifikation gilt die symbolische Bewertung von Menschen und ihren Merkmalen. Soziale Ungleichheit definieren wir zunächst als ungleichen Zugang zu gesellschaftlich wertgeschätzten Tätigkeiten und Gütern. Nicht in allen Gesellschaften ist ein Bildungstitel, ein Abend in einem exklusiven Club, ein stressiger Job im Management oder der Besitz einer teuren Armbanduhr erstrebenswert. Wenn jedoch die Wertschätzung allgemein verbreitet und der Zugang beschränkt ist, haben unterschiedliche soziale Gruppen unterschiedliche Chancen des Zugangs. Ein promovierter Manager verfügt mit einer sehr viel höheren Wahrscheinlichkeit über eine teure Armbanduhr und den Zugang zu einem exklusiven Club als eine Reinigungskraft. Diese Wahrscheinlichkeit überträgt er auch auf seine Nachkommen.
Die Theorien sozialer Ungleichheit haben ebenso wie die politischen und alltäglichen Interpretationen nordatlantischer Gesellschaften angenommen, dass die kapitalistische Transformation einen radikalen Bruch mit der Vergangenheit bewirkte. Die wesenhafte Gleichheit der Menschen sollte entweder sofort oder kontinuierlich politisch und sozial umgesetzt werden. Ungleichheit scheint in dieser Form von Gesellschaft durch den Markt zu entstehen, auf dem es um die Vermehrung von ökonomischem Kapital geht. Diese kapitalistische Gesellschaft sollte die vorläufig oder endgültig höchste Stufe der historischen Entwicklung verkörpern und nur in nordatlantischen Gesellschaften vollständig verwirklicht sein.
Die kapitalistische Transformation hat im Hinblick auf die sozialen Strukturen jedoch keinen radikalen Bruch mit der Vergangenheit erzeugt. Mit der Einführung der Demokratie in Europa und Amerika waren nicht alle Menschen auf einen Schlag gleich, sondern nur eine kleine Minderheit partizipierte am Staat. Sklaven, Frauen, Ausländer sowie teilweise auch Arbeiter und Bauern waren aus der Demokratie ausgeschlossen und wurden erst später nach und nach integriert. Die Defizite an Kapital und Habitus konnten ihre Nachfahren größtenteils bis heute nicht ausgleichen. Das beruht darauf, dass der Ungleichheit zwischen den sozialen Klassen nicht aktiv begegnet wird, sondern dass sie sich vielmehr fortschreibt, indem alle Klassen eigene Kulturen mit eigenen Habitusformen haben, die in die vorkapitalistische Zeit zurückreichen, auch wenn sie einem ständigen Wandel unterworfen sind.
Die ungleich in den Kapitalismus integrierten Klassen unterschieden sich von den legitimen Gleichen durch ihre Denk- und Handlungsweisen, durch ihre sozialen Verbindungen, durch ihr Ansehen, durch die Verfügung über wichtige Ressourcen und durch ihren inneren Zusammenhang. Sie bildeten jeweils eigene Traditionslinien (Vester et al. 2001). Die Traditionslinien haben unterschiedliche Kulturen und vermitteln unterschiedliche Habitus. Theodor Geiger (1932: 13) hat eine Generation vor Bourdieu deutlich gemacht, dass die Klassen ihre eigenen Habitusformen weitergeben. Mit Edward P. Thompson (1963) interpretieren wir soziale Klassen daher in erster Linie als praktizierte Kulturen.
Soziale Revolutionen bewirken Prozesse des Kulturwandels und teilen die Traditionslinien damit in unterschiedliche Generationen, die wir als Soziokulturen bezeichnen (Rehbein 2007). Soziokulturen sind gleichsam unterschiedliche historische Schichten in einer Gesellschaft. Die sozialen Umbrüche zeigen sich in Diskursen, weil sie die gesellschaftlichen Symbolsysteme berühren. Das kann so weit gehen, dass Eltern und Kinder einander kaum noch verstehen, weil sie nicht mehr dieselbe Sprache sprechen. An der Oberfläche erscheint eine Vielfalt unterschiedlicher Habitus und Lebensstile, die trotz aller Individualisierung eine auf Traditionslinien und Soziokulturen beruhende Einheitlichkeit aufweisen.
Jede soziale Klasse vermittelt ihren Mitgliedern eine Kultur, die sie für bestimmte Institutionen, Segmente innerhalb derselben und Funktionen in der Tätigkeitsteilung prädisponiert. Wir sprechen von Tätigkeitsteilung, weil wir die Verteilung aller sozial relevanten Tätigkeiten betrachten und nicht nur die der Berufsarbeit, die wir weiterhin mit dem Begriff der Arbeitsteilung bezeichnen und als besonderen Teil der Tätigkeitsteilung interpretieren (Rehbein 2009). Für das Verständnis sozialer Ungleichheit ist nicht nur die Verteilung der Lohnarbeit von Bedeutung, sondern auch die von Bildung, Hausarbeit, sozialem Engagement und politischer Partizipation.
Die Klassenkultur ist im Habitus verkörpert, besser gesagt, einige Schichten des Habitus werden durch die Klassenkultur gebildet. Ihre Vermittlung geschieht in Institutionssegmenten, die entweder einer Klasse oder zwei bis drei benachbarten Klassen vorbehalten sind. Prinzipiell haben alle Menschen die gleichen Zugangsrechte zu Schulen, Universitäten und Arbeitsplätzen. Faktisch sind diese Institutionen jedoch in unterschiedliche Stufen oder Segmente geteilt. Kaum ein Kind eines ungelernten Arbeiters schafft es auf die Universität, und kaum ein Kind eines Vorstandsvorsitzenden geht in einer Hochhaussiedlung auf die Hauptschule. Jedes Institutionssegment rekrutiert den entsprechenden Habitus und trägt damit zur Reproduktion der Traditionslinie bei. Allerdings entspricht die Hierarchie der Institutionssegmente nicht genau der Hierarchie der Klassen. Beispielsweise besuchen Angehörige der beiden unteren Klassen teilweise gemeinsam die Hauptschule. Dadurch gleichen sich ihre Habitus einander in einigen Aspekten an, so dass die Trennlinien zwischen den Klassen in diesen Aspekten nicht mehr deutlich sichtbar sind.
Die Rekrutierung für die Institutionen beruht auf Klassifikationen, die Bestandteile der Klassenkulturen sind. Am Ende werden aus jeder Institution unterschiedliche Gruppen entlassen, die sich in ihrer soziokulturellen Verankerung und der Gesamtmenge ihres Kapitals unterscheiden und für unterschiedliche Tätigkeiten ausgerüstet sind. Die Tätigkeiten werden gesellschaftlich bewertet und mit Zugangsbedingungen versehen. Die Anforderungen der Tätigkeitsteilung und die Zusammensetzung des Kapitals der in Institutionssegmenten befindlichen Gruppen ändern sich fortwährend. Zu jedem Zeitpunkt aber ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Mitglieder der höchsten Klassen und Institutionssegmente über das meiste relevante Kapital verfügen (Schneickert 2013a). Das wird durch die Rekrutierung für die Funktionen und geschätzten Tätigkeiten sichergestellt. Die Menschen, die die höchsten Positionen besetzen und über die Vergabe der am höchsten bewerteten Tätigkeiten entscheiden, stammen mit hoher Wahrscheinlichkeit aus der höchsten Klasse. Auch wenn die Rekrutierung nach rein formalen, transparenten und funktionalen Kriterien erfolgt, klassifiziert die rekrutierende Person den Bewerber nach Eigenschaften und Kriterien, die sie selber inkorporiert hat (Leepak/Snell 2002; Jodhka/Newman 2009).
Der zentrale Gegenstand des Buches ist die Produktion und Reproduktion sozialer Ungleichheit in einer kapitalistischen Gesellschaft, der deutschen. Produktion und Reproduktion vollziehen sich vorrangig symbolisch, gesellschaftlich und vorbewusst. Die Ungleichheit beruht auf einer inkorporierten Wertehierarchie. Mit der Abwertung anderer Menschen und ihrer Eigenschaften geht der Ausschluss von der vollen Mitgliedschaft in der eigenen Gruppe durch die Begrenzung des Zugangs zu Tätigkeiten und Positionen in der Gruppe einher. Diese Art der Klassifikation findet in jeder sozialen Klasse und Gruppe statt. Allerdings verfügen nicht alle Gruppen über die gleiche Macht über das soziale Leben. Die abwertende Klassifikation ist in jeder Gruppe also mit unterschiedlichen Konsequenzen verknüpft, die der Macht der jeweiligen Gruppe entsprechen. Die Macht und die Bewertungen der Gruppe werden historisch jeweils an die nächste Generation weitergegeben. Das ist in kapitalistischen Gesellschaften unsichtbar, weil sie an der Oberfläche aus gleichen Individuen bestehen. Deshalb ist die Reproduktion besonders wirksam.
Die soziale Klasse ist damit nicht der erklärende Faktor, sondern die Erklärung besteht im Verhältnis von Lebensbedingungen zu Klassifikation und Rekrutierung, vermittelt durch den Habitus. Die soziale Klasse ist gleichsam Resultat des Verhältnisses und seine Bedingung, indem sie Grundlage und Folge der Reproduktion ist. Die Klassenzugehörigkeit und der durch sie vermittelte Anspruch an die soziale Position – an das Leben – verbinden sich mit den realen Möglichkeiten zur Reproduktion der sozialen Position.
Die meisten der genannten Thesen sind nicht neu. Wir fügen der Theorie sozialer Ungleichheit jedoch unsere Definition der Klasse und ihren Zusammenhang mit der symbolischen Reproduktion hinzu. Vor diesem Hintergrund haben wir in jedem Kapitel auch völlig neue empirische Ergebnisse zu bieten. Wir haben vier Klassen ermittelt, von denen eine in zwei Traditionslinien zerfällt. Sie werden in den Kapiteln 1.1 und 1.2 vorgestellt. Die Klassen werden durch drei symbolische Trennlinien abgegrenzt, die Gegenstand von Kapitel 2.1 sind. Sechs Habitustypen, die das Kapitel 1.4 erläutert, inkorporieren die Klassenkulturen und differenzieren sie im Lebenslauf aus. Auf die eigene soziale Position sind auf der Grundlage des Habitus unterschiedliche Reaktionen möglich, die sechs ethische Grundhaltungen bedingen. Sie werden in Kapitel 2.4 vorgestellt. Habitus, Kapital und soziale Position werden im Lebenslauf reproduziert und ausdifferenziert. Dieser Prozess ist Gegenstand der Kapitel 2.5. und 2.6. In den Kapiteln 1.5 und 2.2 zeigen wir, in welcher Weise Migrantinnen und Migranten in die deutsche Klassenstruktur aufgenommen werden. Kapitel 1.3 erläutert die Kapitalverfügung, Kapitel 2.3 Gender und Partnerschaft.
Konfiguration
Das Buch präsentiert lediglich unseren momentanen Erkenntnisstand. Er ist begrenzt auf die empirische Forschung, die wir durchgeführt haben, und das Niveau unserer theoretischen Diskussionen. Wir haben ihn allerdings durch internationale Vergleiche entwickelt und aus dem ethnozentrischen Monolog befreit. Ferner versuchen wir, die Grenzen unserer Erkenntnis darzustellen und unsere Ergebnisse für andere Arbeiten anschlussfähig zu gestalten. Damit folgen wir dem wissenschaftstheoretischen Konzept der Konfiguration (Rehbein 2013).
Unsere Forschungsergebnisse wurden und werden fortwährend überarbeitet und miteinander kontrastiert. Hier präsentieren wir eine Konfiguration, die uns vorerst relativ überzeugend und konsistent erscheint, die aber keineswegs das letzte Wort zum Thema sein soll. Der Begriff der Konfiguration reflektiert den unabgeschlossenen, hermeneutischen und empirisch fundierten Charakter von Erkenntnis. Er richtet sich gegen den formalen Universalismus ebenso wie gegen den Relativismus. Der Universalismus, der einem Teil der Sozialwissenschaften zugrunde liegt, geht davon aus, dass wahre Aussagen für alle wirklichen und möglichen Fälle gelten, also letztlich unabhängig von der Wirklichkeit sein müssen. Wenn man leugnet, dass sich derartige Sätze aufstellen lassen, gerät man unweigerlich in einen Relativismus, für den es keine universale Wahrheit gibt. Beide Ansätze teilen die Vorstellung, dass Wahrheit unabhängig von der Wirklichkeit sein könne, insbesondere unabhängig von der Gesellschaft.
Tatsächlich beziehen sich alle wissenschaftlichen Sätze auf einen Gegenstand und sind daher mit der Empirie verwoben. Sie gelten für diesen Gegenstand und können durch weitere Forschung oder ähnliche Sätze in ihrer Geltung ausgedehnt werden. Im Zuge der Ausdehnung der Erkenntnis werden Grenzen, blinde Flecken und Mängel sichtbar. Es wird auch sichtbar, dass es ganz andere Ansätze zur Erforschung desselben Gegenstands gibt, die auf anderen Theorien, aber auch auf anderen Fragestellungen, Perspektiven und außerwissenschaftlichen Interessen beruhen. Die Interaktion zwischen den verschiedenen Ansätzen kann dazu führen, dass sie in einen neuen Ansatz „aufgehoben“ werden, der mehrere Perspektiven umfasst, sie aber nicht durch eine neue Perspektive ersetzt, sondern nur verdeutlicht, welche Relation die aufgehobenen Perspektiven zueinander haben. Diese ständige Interaktion haben wir durch die Kommunikation zwischen unseren Forschungsteams gefördert.
Das Konzept der Konfiguration beinhaltet die wechselseitige Kritik innerhalb des Teams, aber auch seitens unserer Interviewpartner. Tatsächlich haben wir den größten Teil unserer Erkenntnis durch unsere Interviews erworben. Die Interviewten waren nicht allein Objekte, sondern haben uns auch unsere eigenen sozialen Positionen, Perspektiven, Vorannahmen und Grenzen vor Augen geführt. Das wird im Buch kaum deutlich, weil wir hier nur die Ergebnisse präsentieren, nicht aber den Erkenntnisprozess. Die Darstellung haben wir unter uns aufgeteilt, so dass die Anfertigung des Manuskripts keine Gemeinschaftsarbeit mehr war, sondern in der Verantwortung der einzelnen Autorengruppen bzw. Autorinnen und Autoren lag.
Danksagungen
An der Forschung für dieses Buch haben sich weit mehr Menschen beteiligt, als unmittelbar ersichtlich ist. Zunächst waren mehrere Personen über einen längeren Zeitraum Mitglieder des Teams, haben es aber vor der Verschriftlichung der Ergebnisse verlassen, weil sie sich anderen Aufgaben widmen mussten. Hierzu zählen insbesondere Suraj Beri, Claudia Hencke, Thomas Leithäuser, Anna Oechslen, Tamer Söyler, Katrin Voigt, Roberto Dutra Torres, Katrin Wintergerst.
Großen Anteil an unserer Forschung hatten die viele Jahre währenden Diskussionen mit Michael Vester und seiner Schule. Hierzu zählen auch die methodologischen Workshops von Helmut Bremer, Andrea Vester-Lange und Christel Teiwes-Kügler. Die intensive Auseinandersetzung hat an der Entwicklung unserer Gedanken einen großen Anteil gehabt und eine Fokussierung unserer Forschungsfragen ermöglicht. Wir haben ein besseres Verständnis nicht nur der deutschen Sozialstruktur, sondern auch unserer eigenen Vorverständnisse auf diese Weise erlangt. Dafür danken wir allen an den Diskussionen Beteiligten.
Die Forschung für dieses Buch wurde ohne jegliche Drittmittel durchgeführt. Alle Mitglieder des Teams haben aus freien Stücken am Projekt mitgearbeitet. Entstehende Kosten wurden durch Mittel der Humboldt-Universität gedeckt. Dafür danken wir dem Präsidenten, dem Dekanat der Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftlichen Fakultät sowie dem Institut für Asienund Afrikawissenschaften. Der Forschungsprozess war für uns alle nicht nur lehrreich, sondern geradezu vorbildlich, weil wir nicht durch externe Vorgaben gebunden und durch die Dauer einer Projektförderung beschränkt waren. Die finanziellen Mittel der Universität haben die empirischen Erhebungen ermöglicht.
An der Durchführung der Erhebungen waren zahlreiche Personen beteiligt, die nicht als Autoren und Autorinnen dieses Buches auftauchen. Zunächst danken wir den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die uns bei den Interviews geholfen haben. Sodann bedanken wir uns besonders herzlich bei Matthias Arnold vom SINUS-Institut, der unsere quantitative Erhebung umgesetzt hat. Schließlich gebührt nachdrücklicher Dank unseren Kolleginnen und Kollegen der anderen Teams, vor allem in Brasilien, Indien und Laos, die zum Gelingen des Forschungsprogramms ebenso viel beigetragen haben wie wir.
1 Klassen, Habitus und Kapital
1.1 Reproduktion
Boike Rehbein
Die Strukturen sozialer Ungleichheit sind trotz der zahlreichen Umbrüche und Veränderungen der letzten Jahrzehnte in Deutschland erstaunlich stabil geblieben. Wir beobachten eine ganz deutliche Vererbung der sozialen Position von einer Generation an die nächste. Die strukturellen Bedingungen der Vererbung bezeichnen wir als Reproduktion. Reproduktion bedeutet Stabilität über die Zeit, insbesondere Vererbung von einer Generation an die nächste. Die Reproduktion zeigt sich in der Weitergabe wichtiger Ressourcen und der relativen sozialen Position. Auch wenn die Kinder einen völlig anderen Beruf, andere Interessen und Freunde, andere Fähigkeiten und einen anderen Lebensstil haben als die Eltern, bleibt die soziale Position relativ zum Rest der Gesellschaft in den meisten Fällen sehr ähnlich – sie wird also von den Eltern zum Kind reproduziert.
In den folgenden Absätzen werden wir der Weitergabe sozial wertvoller Eigenschaften und des Zugangs zu ihnen nachgehen. Dabei wird sich herausstellen, dass die Weitergabe nicht individualisiert oder in zufälligen Konfigurationen, sondern innerhalb kaum überwindbarer Grenzen zwischen sozialen Klassen geschieht. Ferner zeigt sich, dass die Eigenschaften nicht isoliert auftreten, sondern in ganz bestimmten Kombinationen. Die Kombinationen ermöglichen uns, die sozialen Klassen genauer zu definieren. Vor diesem Hintergrund werden wir herausarbeiten, welche Eigenschaften sich für unsere Erforschung der Klassen in Deutschland als besonders aussagekräftig erwiesen haben. Im nächsten Kapitel werden wir die sozialen Klassen sowie die Grenzen zwischen ihnen eingehender darstellen und auf der Basis unserer Interviews illustrieren.
Klassen als Merkmalskomplexe
Die in Deutschland abgewerteten Menschen mit geringen Chancen des Zugangs zu wertgeschätzten Gütern und Tätigkeiten haben fast ausnahmslos Eltern, die selber der Abwertung ausgesetzt waren. Diese Kinder sind nicht allein durch die mangelnde gesellschaftliche Anpassung, die Geldknappheit, das geringe Bildungsniveau oder das schwache soziale Netzwerk der Eltern benachteiligt, sondern all diese Faktoren wirken gleichzeitig. Sie werden fast immer durch den Lebenslauf verstärkt, der – stereotyp gesprochen – nicht durch Klavierunterricht, Waldorfschule und Golfclub führt, sondern durch Drogen, Hauptschule und Straßengang. Hierzu gesellen sich die Auswirkungen der elterlichen Position, die Frustration oder Aggression bedingt. Sie äußern sich im günstigen Fall als Vernachlässigung, im ungünstigen als Missbrauch. Unsere Eingangsfrage nach ihrer Herkunftsfamilie beantwortet eine Arbeitslose mit den sechs Worten: „Also Vater Kuhstall gearbeitet, Mutter Schweinestall.“ Damit ist alles gesagt, und das Interview hätte beendet werden können. Es ist klar, dass die Eltern der Interviewten weder Bildung noch Vermögen noch einflussreiche Kontakte mitgeben konnten. Die Formulierung drückt darüber hinaus eine negative Bewertung des Elternhauses aus, geradezu eine Verachtung. Sie ist brutal. Die in ihr implizierte Gewalt wurde im Verlauf des Interviews als elterlicher Missbrauch offenkundig, der dazu führte, dass sich die Interviewte in psychiatrischer Behandlung befindet und arbeitsunfähig ist. Ihr größter Wunsch besteht darin, eine Frisörlehre zu absolvieren – um auf der untersten Ebene in den Arbeitsmarkt und damit die Gesellschaft integriert zu werden.
Wer in ein „besser“ bewertetes Elternhaus geboren wird, hat von Beginn an eine andere Perspektive, andere Ziele und andere Möglichkeiten. „Ich hab halt Volkswirtschaft studiert. Eigentlich war, eigentlich wollte ich immer, für mich war es irgendwie klar, dass ich studieren gehe, ich wusste auch nicht, woher das jetzt so kam, also es war irgendwie total selbstverständlich.“ Eine Studentin mit wohlhabenden Eltern ist überzeugt, in 20 Jahren eine Führungsposition zu bekleiden – was sonst? Und der Gründer eines bekannten Unternehmens der New Economy, sagt: „Ich wusste schon mit acht, dass ich Unternehmer werden will. Dafür bietet Deutschland hervorragende Bedingungen.“ Es ist allerdings kein Zufall, dass sein Vater Ingenieur in leitender Position war und nicht im Kuhstall gearbeitet hat. Ebenso wenig verwundert es, dass seine Freundin im Management arbeitet und aus einer wohlhabenden Familie stammt.
Man hat den Eindruck, dass die skizzierten Menschen unterschiedlichen Gesellschaften angehören, von verschiedenen Planeten stammen. Das ist eine gute Beschreibung sozialer Ungleichheit. Die Menschen leben in unterschiedlichen Welten, deren jede einen eigenen Alltag, eine eigene Sprache, eine eigene Mentalität hat. Sie gehören gleichsam mehreren Stämmen an, die sich von ethnischen Gruppen dadurch unterscheiden, dass sie eine hierarchische Ordnung innerhalb derselben Gesellschaft bilden. Genau das kennzeichnet soziale Ungleichheit. Wie entstehen und perpetuieren sich nun die Stämme oder Kulturen und ihre Hierarchie innerhalb der Gesellschaft?
Die Merkmale der sozialen Person werden in einer Umgebung erworben, die in der Kindheit von den Erziehungspersonen und sodann vom unmittelbaren Umfeld geprägt ist. Es verwundert daher nicht, dass grundlegende Handlungsmuster von einer Generation an die nächste weitergegeben werden. Erstaunlich ist hingegen, in welchem Maße auch Eigenschaften, die in späteren Lebensjahren ausgebildet werden, denen der Erziehungspersonen gleichen. Man würde erwarten, dass das Kind eines Sportlers oder einer Musikerin in frühen Jahren sportliche oder musikalische Fähigkeiten entwickelt, zumal diese möglicherweise zum Teil sogar biologisch vererbt werden. Man würde jedoch nicht unbedingt erwarten, dass die Menschen ähnliche Berufe ergreifen wie ihre Eltern. Genau das ist allerdings in einem überraschenden Maße der Fall.
Tabelle 1 zeigt, dass 30 Prozent der Un- und Angelernten (Berufsklasse 1; nach Oesch 2006), 62 Prozent der gelernten Arbeiter (Berufsklasse 3), 33 Prozent der mittleren Angestellten (Berufsklasse 4) und 39 Prozent der Führungskräfte einen Vater haben, der in derselben Berufsgruppe arbeitete. Dabei ist zu bedenken, dass die Töchter eher den Beruf der Mutter ergreifen als den des Vaters. Diese Korrelation ist in der Tabelle gar nicht berücksichtigt, sondern sie zeigt allein die Identität der Berufsgruppe aller von uns befragten Berufstätigen mit der Berufsgruppe ihres Vaters. Durch diese Beschränkung wollen wir aufzeigen, wie stark die Reproduktion des Berufs selbst in einer einzigen Dimension ist. Korreliert man Söhne nur mit Vätern und Töchter nur mit Müttern, steigen die Prozentzahlen für die Reproduktion des elterlichen Berufs, die in der Diagonale der Tabelle liegen, noch einmal um bis zu 20 Prozentpunkte.
Tabelle 1: Korrelation des väterlichen und des eigenen Berufs
Anm.: Berufsklassen in Anlehnung an Oesch (2006: 88): 1. Un- und Angelernte, 2. Fachkräfte, 3. Semiprofessionelle, 4. Professionelle; das Sample umfasst die aktuell Berufstätigen in der von uns erhobenen Gesamtheit, also rund die Hälfte der knapp 3000 Befragten.
Noch überraschender als der Zusammenhang zwischen dem Beruf einer Person und dem ihres Vaters ist die Ähnlichkeit der Berufe über mehrere Generationen hinweg. Ein Drittel der Deutschen, die im Berufsleben stehen, sind derselben Berufsgruppe zuzurechnen wie ihr Großvater väterlicherseits (siehe Tabelle 2). Wenn wir die Vererbung nicht allein auf den Großvater väterlicherseits beschränken, sondern alle vier Großeltern in Betracht ziehen, ist die Kontinuität der Berufswahl über die Generationen hinweg noch stärker. Außerdem ist die Hälfte der Bevölkerung weiblich, und die Berufswahl der Frauen ist nicht mit der der Männer identisch.
Ferner nimmt die Nachfrage nach manchen Berufsgruppen zu, die nach anderen ab. Beispielsweise sind immer weniger Menschen in der Landwirtschaft und im einfachen produzierenden Gewerbe beschäftigt, während die Nachfrage nach Angestellten im Dienstleistungssektor steigt (Schäfers 2004: 174ff). Diesen einflussreichen Faktoren zum Trotz haben mehr als 30 Prozent der Deutschen einen ähnlichen Beruf wie ihr Großvater väterlicherseits. Tabelle 2 zeigt diese Ähnlichkeit, sie spiegelt aber auch ein Ansteigen des beruflichen Niveaus wider. Während viele Großväter einen einfachen Beruf in Landwirtschaft und Industrie ausübten, sind diese Berufe aus der heutigen deutschen Gesellschaft beinahe verschwunden. Wie mit Tabelle 1 wollen wir mit Tabelle 2 ausdrücken, dass bereits in einer recht isolierten Dimension eine starke Reproduktion der sozialen Position über Generationen hinweg zu beobachten ist.
Tabelle 2: Beruf des Großvaters väterlicherseits und eigener Beruf
Die Vererbung der Berufsklasse wird dadurch verstärkt, dass die statistische Wahrscheinlichkeit, innerhalb der eigenen Berufsklasse zu heiraten, sehr hoch ist. Ganz grob lässt sich sagen, dass die Hälfte aller von uns Befragten, die derzeit berufstätig sind, einen Partner oder eine Partnerin in derselben Berufsgruppe haben (siehe Tabelle 3). Wer nicht innerhalb derselben Berufsklasse heiratet, hat zumeist einen Partner oder eine Partnerin aus der benachbarten Berufsklasse gewählt. Die Zahl der Partnerschaften zwischen weit entfernten Berufsgruppen ist sehr gering. In diesen Fällen gilt weiterhin das alte Prinzip, dass der Mann meist den höheren Beruf hat als die Frau, die Frau also „nach oben“ heiratet. Rund 70 Prozent der Männer heiraten in ihrer Berufsklasse, lediglich in der obersten Berufsklasse heiraten 50 Prozent „nach unten“.
Tabelle 3: Partnerschaft innerhalb der Berufsgruppe
Noch stärker als die berufliche Ähnlichkeit von Eltern und Kindern ist ihre Ähnlichkeit im Hinblick auf das Bildungsniveau. Die PISA-Studien haben immer wieder auf diesen Zusammenhang hingewiesen (siehe auch Albert et al. 2010: 15). Wir haben ihn ebenfalls beobachtet, und zwar zugleich sehr stark und sehr signifikant. Auch dieser Zusammenhang ist in Wahrheit noch enger, als wir ihn in Tabelle 4 darstellen, weil das Bildungsniveau formal insgesamt steigt, also für immer mehr Berufe ein Hochschulabschluss (auch wenn es sich um einen BA ohne akademische Ausbildung handelt) oder wenigstens ein Abitur erforderlich ist. Lediglich sechs Prozent der Kinder von Ungelernten haben das Abitur abgeschlossen, hingegen mehr als 80 Prozent der Akademikerkinder. Damit hat nur ein Bruchteil der Kinder von beruflich benachteiligten Menschen beim Eintritt in den Arbeitsmarkt auch nur die geringste Chance, einen höher qualifizierten Beruf zu ergreifen oder gar in die Führungsetagen von Staatsapparat und Wirtschaft aufzusteigen.
Tabelle 4: Korrelation des eigenen Bildungsniveaus mit dem des Vaters
Die Ungleichheit der formalen Bildung wird ergänzt durch informelle Aspekte. Im Elternhaus werden grundlegende Fähigkeiten und Kenntnisse vermittelt, die für den Schulerfolg entscheidend sind und über die Aufnahme ins Gymnasium, Mitgliedschaft in Vereinen und die gesellschaftliche Bewertung entscheiden. Die Vermittlung dieser Fähigkeiten und Kenntnisse ist sozial unterschiedlich verteilt (siehe Kapitel 1.3 und 1.4). Es gibt eine starke Tendenz dazu, dass die Eltern ihre eigenen Fähigkeiten und Kenntnisse weitergeben und dadurch den Grundstein für die Zukunft ihrer Kinder legen. Auch in dieser Hinsicht kann man eine starke Korrelation zwischen dem höchsten Bildungsabschluss und den Bedingungen im Elternhaus feststellen. Beispielsweise geben weniger als 15 Prozent der Menschen mit höchstens Hauptschulabschluss an, dass ihre Eltern über eine Bibliothek zu Hause verfügt hätten, während rund 60 Prozent der Promovierten sagen, ihre Eltern hätten eine Bibliothek besessen.
Merkmalskomplexe
Nun haben wir in den bis hierher abgebildeten Tabellen lediglich den Zusammenhang zwischen isolierten Faktoren gezeigt. Dass „der Apfel nicht weit vom Stamm fällt“, ist allgemein bekannt. Und dass Menschen grundlegende Fähigkeiten von ihren Eltern übernehmen, dürfte auch niemanden überraschen. Das spiegelt sich in den statistischen Korrelationen wider, von denen wir einige markante in den Tabellen wiedergegeben haben. Hierbei handelt es sich allerdings nur um die Wahrscheinlichkeit der Reproduktion einzelner Merkmale. Die Menschen haben also mit einer hohen Wahrscheinlichkeit ein Merkmal wie Bildungsniveau oder Berufsgruppe mit ihrem Vater oder ihrer Mutter gemeinsam – und zwar trotz der seit den 1970er Jahren bis heute anhaltenden enormen Bildungsexpansion.
Wenn man nun in die Untersuchung einbezieht, dass die einzelnen Merkmale miteinander verknüpft sind und sich teilweise gegenseitig verstärken, zeigt sich eine deutlichere Reproduktion der Ungleichheit. Man muss beispielsweise berücksichtigen, dass ein höheres Bildungsniveau sehr stark mit einem höheren Einkommen korreliert. Mit einem Hochschulabschluss verdient man statistisch mindestens das Doppelte einer Person, die maximal einen Hauptschulabschluss besitzt (Geißler 2014b: 17). Höhere Bildung und höheres Einkommen bedeuten jedoch auch bessere Möglichkeiten, die eigenen Kinder zu fördern. Fasst man die Faktoren der Ausbildung und des väterlichen Berufs zusammen, so zeigt sich, dass ein ungelernter Vater mit hoher Wahrscheinlichkeit Kinder hat, die allenfalls die Hauptschule abgeschlossen haben, sich auf die unteren Segmente des Arbeitsmarkts verteilen und wenig Geld verdienen. Die Beschränkung auf einzelne Merkmale verdeckt diese Bündelung von Faktoren in jeweils bestimmten sozialen Umgebungen und Gruppen. Daher muss bei jedem einzelnen Merkmal gefragt werden, mit welchen anderen Merkmalen es statistisch häufig einhergeht.
Nun erweist die einfache statistische Bündelung von Merkmalen zwar deutlich die Reproduktion von Ungleichheiten, aber die Mechanismen bleiben unverständlich. Ferner kann nicht erkannt werden, wie die einzelnen Merkmale ineinander greifen. Wir haben die komplexe Zusammensetzung von Familien, die Veränderungen des Arbeitsmarkts und des Bildungssektors, die Rolle des informellen Sektors, wichtige Faktoren wie Immobilienoder Wertpapierbesitz, persönliche Beziehungen und die relative Bedeutung all dieser Faktoren bislang nicht berücksichtigt. Wenn wir das tun, wird die „Erblichkeit“ der sozialen Eigenschaften noch weit offensichtlicher, als sie es in den obigen Tabellen wird.
Es zeigt sich erstens, dass nur bestimmte Kombinationen von Faktoren vorkommen, während andere fast oder vollkommen ausgeschlossen sind. Beispielsweise ist es fast ausgeschlossen, dass das Kind eines ungelernten Arbeiters einen Hochschulabschluss erlangt – noch seltener aber sind Kinder von ungelernten Arbeitern, die neben einem Hochschulabschluss solide Kenntnisse der Hochkultur, ein großes Aktiendepot und einen Freundeskreis aus einflussreichen Familien haben. Zweitens wird offenkundig, dass man die Gesamtheit dieser möglichen Kombinationen betrachten muss, um zu verstehen, wie die sozialen Eigenschaften von einer Generation an die nächste weitergegeben werden. Drittens ist der gesamte Lebenslauf, am besten in Verbindung mit den Lebensläufen der Vorfahren, zu betrachten. Auch ein Manager kann kurzzeitig arbeitslos sein oder ein Fußballspieler reich; selten sind sie das ihr ganzes Leben hindurch, und noch seltener sind es ihre Eltern.
Daher haben wir eine methodische Vorgehensweise entwickelt, die auf die Kombination von Merkmalen abzielt. Es kommt vor, dass das Kind eines Managers kein Abitur macht oder verarmt, während das Kind des ungelernten Arbeiters reich sein oder über einen Doktortitel verfügen kann. Es kommt aber statistisch fast nie vor, dass das Kind kaum sozial bedeutsame Eigenschaften mit einer seiner Erziehungspersonen teilt. Vielmehr können wenige dieser Eigenschaften fehlen, aber fast immer ist die Mehrheit der Eigenschaften bei Eltern und Kindern gleichermaßen vorhanden. Da nicht jedes Kind aus jeder Gruppe dieselben Eigenschaften mit den Eltern teilt, reicht es nicht, lediglich den Zusammenhang zwischen den Bildungsniveaus oder den Berufen zu betrachten. Auch eine Kombination der beiden Faktoren ist ungenügend. Es müssen viele Faktoren in ihrer Gesamtheit betrachtet und analysiert werden.
Zu diesem Zweck verwenden wir eine Analysemethode, die Zusammenhänge auch dann erfasst, wenn ein ansonsten wichtiger Faktor, beispielsweise das Abitur des Managerkindes, fehlt, aber die Mehrheit der das Abitur des Managerkindes, fehlt, aber die Mehrheit der wichtigen Faktoren dennoch vorhanden ist. Es handelt sich um das, was Wittgenstein als „Familienähnlichkeiten“ bezeichnet hat (Wittgenstein 1984: Aphorismus 65ff.). Zum Verständnis der Reproduktion von Ungleichheit lässt sich kein einzelner Faktor identifizieren, der alle anderen Faktoren bestimmen würde oder allen Menschen einer bestimmten Kategorie gemeinsam wäre. Vielmehr kommt jedes Merkmal in jeder Gruppe mit unterschiedlich hohen Wahrscheinlichkeiten vor, und die Kombination der wahrscheinlichsten Merkmale ist dergestalt für die Gruppe typisch, dass jedes Mitglied der Gruppe einige dieser Merkmale nahezu mit Sicherheit aufweist.
Wittgenstein illustriert diese Art der Merkmalskombination am Beispiel einer Familie: Die Mitglieder einer Familie haben Gemeinsamkeiten, aber keine zwei haben genau die gleichen Eigenschaften gemeinsam. Es „übergreifen und kreuzen sich die verschiedenen Ähnlichkeiten, die zwischen den Gliedern einer Familie bestehen: Wuchs, Gesichtszüge, Augenfarbe, Gang, Temperament“ (ebd.: 67). Viele Mitglieder der Familie haben den Wuchs gemeinsam, einige von diesen teilen miteinander und mit anderen Mitgliedern die Augenfarbe, und der typische Gang kommt wieder in einer anderen Konfiguration vor. „Wir sehen ein kompliziertes Netz von Ähnlichkeiten, die einander übergreifen und kreuzen. Ähnlichkeiten im Großen und Kleinen.“ (66) Die Ähnlichkeiten kann man in gewisser Weise durch ihre historische Entstehung erklären, aber man kann sie nicht auf allgemeine Kategorien oder Merkmale reduzieren. Bei einem Familienmitglied wurde der Gang durch die Berufstätigkeit verändert, bei einem anderen die Nase durch einen Schlag, bei einem dritten die Grundstimmung durch Einflüsse der Hormone.
So verhält es sich auch mit den sozial relevanten Eigenschaften der Menschen. Für die Ermittlung der sozialen „Familien“ bedienen wir uns einer statistischen Methode, die hierfür geeignet ist, der multiplen Korrespondenzanalyse. Mittels dieser Methode kann das gemeinsame Auftreten von Merkmalen abgebildet und gewichtet werden. Die Gewichtung der Merkmale wird nicht vorgegeben, sondern statistisch errechnet, indem aus der Menge der definierten Merkmale ein mehrdimensionaler Raum konstruiert wird, dessen erste Dimension (die horizontale x-Achse) aus mehreren, auf dieser Dimension abgebildeten Faktoren geprägt wird. Weitere Faktoren bilden die zweite Dimension (die vertikale y-Achse). Prinzipiell werden weitere Dimensionen berücksichtigt, aber nicht abgebildet. Die Aufspannung der Dimensionen durch die Faktoren geschieht durch die Korrelation der Daten selbst.1
Zunächst wollen wir skizzieren, welche Faktoren wir für sozial relevant halten. Ihre Erläuterung nimmt einen Großteil des Buches ein, so dass wir uns an dieser Stelle mit einer kurzen, vorläufigen Einführung begnügen, die verdeutlichen soll, dass es in der deutschen Gesellschaft soziale Klassen mit klar voneinander unterscheidbaren Eigenschaften gibt. Die Eigenschaften bestehen in den Voraussetzungen, Zugang zu gesellschaftlich als wertvoll geltenden Tätigkeiten und Gütern zu erlangen. Im Anschluss an Pierre Bourdieu (1982) subsumieren wir die Voraussetzungen unter die Begriffe Kapital und Habitus. Als Kapital gelten dabei alle Ressourcen, über die man im Hinblick auf eine gesellschaftliche Handlung verfügen kann, während der Habitus alle verinnerlichten Handlungsmuster umfasst. Beide Begriffe überschneiden sich, da Handlungsmuster auch als Ressourcen eingesetzt werden können. Bourdieu bezeichnet diese Seite des Habitus als inkorporiertes kulturelles Kapital. Der Begriff des Habitus kann jedoch nicht unter den des Kapitals subsumiert werden, weil der Habitus nicht allein als Ressource eingesetzt wird und eine unabhängige Untersuchung der Handlungsmuster für das Verständnis von Ungleichheit und der Gesellschaft insgesamt bedeutsam ist. Kapitel 1.4 zeigt – gegen Bourdieu –, dass die Habitusformen nicht aus der Klassenzugehörigkeit abgeleitet werden können.
Bourdieu geht davon aus, dass Handlungsmuster im Lebenslauf verinnerlicht werden und gleichsam die soziale Natur des Menschen oder den Habitus bilden (1976: 189). Die Handlungsmuster werden durch die Praxis in einer bestimmten sozialen Umgebung erworben und entsprechen den in dieser Umgebung geltenden Gepflogenheiten. Je früher im Lebenslauf die Muster erworben und je öfter sie wiederholt werden, desto tiefer prägen sie sich ein. Ein Beispiel wäre das Erlernen der Muttersprache oder eines Musikinstruments, das eine lange Übung mit ständigen Korrekturen und Verfeinerungen voraussetzt, aber ab einer bestimmten Stufe eine lebenslange Fähigkeit begründet. Da sich die soziale Umgebung und die Position des Menschen nicht ständig ändern, weisen die Handlungsmuster eine zeitliche Kontinuität und eine Einheitlichkeit auf, die den Habitus auszeichnet.
Die im Habitus verkörperten Fähigkeiten sind Bourdieu zufolge für den Alltag und die soziale Position mindestens ebenso bedeutsam wie Einkommen und Besitz. Das Gleiche gilt für das kulturelle Kapital, das gesellschaftlich wertvolle Fähigkeiten, Gegenstände und Titel (etwa einen Schulabschluss) umfasst. Ferner sind für einen erfolgreichen Lebenslauf auch soziale Kontakte (beispielsweise ein einflussreicher Onkel) und andere gesellschaftlich wichtige und anerkannte Faktoren erforderlich. Bourdieu fasst all diese Faktoren unter dem Begriff des Kapitals zusammen.
Damit löst sich Bourdieu von der Verengung der Sozialstrukturanalyse auf ökonomische Faktoren und öffnet den Blick für die soziale Konstitution von Ungleichheit. Sie lässt sich nicht auf einen einzelnen Faktor reduzieren und beruht nicht allein auf der Verteilung ökonomischen Kapitals, sondern wird erst durch die Kombination aller Kapitalformen wirksam. Eine Lottogewinnerin oder ein reicher Fußballspieler wird nicht sofort in die enthobene Klasse aufgenommen. Ihnen fehlen die Umgangsformen dieser Klasse, alter Besitz, Kontakte und der gute Name (Hartmann 2002). Den guten Namen bezeichnet Bourdieu auch als „symbolisches Kapital“. Er hat die Bedeutung dieser Kapitalform entdeckt, indem er nachgewiesen hat, dass die anderen Kapitalformen wertlos sind, wenn sie nicht anerkannt werden. Unbekannte Geldscheine haben einen ebenso geringen gesellschaftlichen Wert wie die Erbstücke der Lottogewinnerin und die Manieren des Fußballspielers. Der Wert wird sozial zugeschrieben und muss als selbstverständlich anerkannt und damit in seiner gesellschaftlichen Willkür und Relativität verkannt werden. In seinen Untersuchungen hat Bourdieu dem sozialen und dem symbolischen Kapital leider eine zu geringe Bedeutung eingeräumt. Wir werden in den folgenden Kapiteln das soziale Kapital als gleichwertig mit dem ökonomischen und kulturellen behandeln. Mit dem symbolischen Kapital beschäftigt sich die zweite Hälfte des Buches.
In unseren Interviews wie auch in der verfügbaren Forschung haben sich Einkommen und Vermögen als geeignete Indikatoren des ökonomischen Kapitals und Bildungstitel als die kulturellen Kapitals erwiesen. Das soziale Kapital bestimmen wir durch die soziale Position der Freunde und die Mitgliedschaft in Vereinen, das symbolische Kapital durch Ehrentitel und den Familiennamen. Die Verfügung über diese Arten des Kapitals setzen wir in Beziehung zu den grundlegenden Aspekten des Lebenslaufs: soziale Herkunft (Beruf und Bildungsstand der Eltern und Großeltern), Erziehungsstil und besuchte Schulen (vgl. Kohli 1985). Schließlich nehmen wir Eigenschaften des Habitus hinzu, die sich in unseren Interviews als besonders ungleich verteilt erwiesen haben: das Maß an sozialer Aktivität, die Orientierung an Leistung, das Selbstbewusstsein, Disziplin, Flexibilität, Ordnungsliebe, Freizeitorientierung und Lernbereitschaft. Die Kombination all dieser Faktoren variiert von Mensch zu Mensch, kommt aber für jede soziale Klasse in einer typischen Konfiguration von Familienähnlichkeiten vor. Eine Klasse kann an dieser Stelle vorläufig als Gruppe definiert werden, die keinen Zugang zu den zentralen Tätigkeiten der höheren Klassen hat, sich von den anderen Klassen abgrenzt, eine eigene Kultur hat und gesellschaftlich bedeutsame Eigenschaften von einer Generation an die nächste weitergibt. Diese Merkmale werden über die so genannte Sozialisation von einer Generation an die nächste weitergegeben.
Vor dem Hintergrund dieser Konfiguration haben wir drei Trennlinien in der Gesellschaft ermittelt, die Grenzen zwischen den sozialen Klassen ziehen. Eine soziale Mobilität über diese Trennlinien hinweg ist statistisch fast ausgeschlossen.2 Sie findet meist nur in einer Generation statt: Ein auf- oder abgestiegenes Individuum bleibt ein Einzelfall in der Familiengeschichte. Die Trennlinien sind die der Würde, der Expressivität und der Enthobenheit. Diese Bezeichnungen und ihre Hintergründe werden im Kapitel über die Klassifikation (2.1) genauer erläutert. Die Trennlinien konstituieren soziale Klassen, die sich über Generationen hinweg reproduzieren. Die Klassen haben unterschiedliche Kulturen, vermitteln unterschiedliche Habitus und sind mit unterschiedlichen Lebenswelten verwoben. Klassen sind damit als Traditionslinien nicht nur durch Besitz von Kapital bestimmt, sondern sie sind auch Kulturen, die bestimmte, teilweise ganz auf sie beschränkte Handlungsmuster und Symbolsysteme umfassen und sie den in ihnen Lebenden vermitteln. In Kapitel 1.4 werden wir allerdings zeigen, dass die von den Menschen inkorporierte Kultur nicht aus der Klasse abgeleitet werden kann, sondern in einem gleichsam dialektischen Verhältnis zu ihr steht.
Die drei Trennlinien konstituieren vier soziale Klassen, die wir als Marginalisierte, Kämpfer, Etablierte und Enthobene bezeichnen.3 Die Marginalisierten sind von vielen Bereichen der Gesellschaft ausgeschlossen, insbesondere von einer geregelten und angemessen bezahlten Arbeit. Sie verfügen über eine geringe Gesamtmenge an Kapital und zumeist über einen fatalistischen oder hedonistischen Habitus. Die Kämpfer stellen die „Mitte“ der Gesellschaft und den Großteil der arbeitenden Bevölkerung. Die Etablierten übernehmen die Führungspositionen und verfügen insgesamt über eine große Menge an Kapital. Die Enthobenen sind vom Rest der Gesellschaft geradezu durch eine Mauer getrennt. Sie sind die Großeigentümer des ökonomischen Kapitals und blicken meist auf alte Familienstammbäume von Enthobenen zurück (vgl. Piketty 2014). Die Trennlinien sind nicht mit den Unterschieden zwischen den Institutionssegmenten (oder der Tätigkeitsteilung), nicht mit den Berufsklassen (oder der Arbeitsteilung) und nicht mit den Habitusgruppen identisch, sondern werden über diese reproduziert und dabei gleichsam verwaschen, weil die Rekrutierung und die Ausbildung des Habitus im Lebenslauf nicht in ständischer, geschlossener Weise geschehen, sondern in formal offenen Prozessen.
Wir schätzen die Marginalisierten auf bis zu 20, die Kämpfer auf mindestens 65, die Etablierten auf höchstens 15 und die Enthobenen auf 0,1 Prozent der deutschen Bevölkerung. Die Anteile lassen sich nicht präzise angeben, weil unsere Erhebung zwar repräsentativ im Hinblick auf Geschlecht, Alter, Wohnort und Bildungsstand war, aber die meisten Dimensionen von Kapital und Habitus nicht repräsentativ erfassen konnte – denn diese waren erst als Ergebnis der Erhebung zu ermitteln. Die Erhebung ist auch nicht repräsentativ für die Berufsgruppen, vielmehr ist die Berufsgruppe der Semiprofessionellen überrepräsentiert.
Die Klasse der Kämpfer zerfällt in zwei verschiedene Traditionslinien, die jeweils eher in der alten Arbeiterschaft und in der alten Angestelltenschaft verwurzelt sind. Die Gruppen entsprechen etwa der Facharbeiterschaft und dem Kleinbürgertum bei Vester et al. (2001).4 Wir unterscheiden aufstrebende und defensive Kämpfer. Sie sind nicht mehr klar voneinander zu trennen und weisen wechselseitige Mobilität auf. Noch schwächer ist die alte Differenz zwischen kulturellem und ökonomischem Kapital in der Klasse der Etablierten ausgeprägt (siehe Kapitel 1.4). Ferner besteht eine gewisse Mobilität zwischen beiden Polen der etablierten Klasse.
Abbildung 1: Multiple Korrespondenzanalyse Klassen
Abbildung 1 zeigt das Ergebnis der multiplen Korrespondenzanalyse mit allen Merkmalen, die wir als relevant bestimmt haben. Aus ihr wird ersichtlich, dass bestimmte Merkmale sich mit einigen Merkmalen in räumlicher Nähe befinden und von anderen räumlich weit entfernt sind. Daraus ergeben sich Hinweise auf ein gemeinsames Vorkommen der räumlich eng beisammen liegenden Merkmale. Die sozialen Klassen verteilen sich von rechts oben nach links unten in diagonalen Schnitten über diesen Raum. Rechts oben ist die enthobene Klasse anzusiedeln, links unten die marginalisierte. In jeder Klasse treten die Merkmale, die innerhalb der entsprechenden Diagonalen angesiedelt sind, mit einer besonders hohen Wahrscheinlichkeit auf. Wir werden all diese Merkmale und ihre Korrelationen in den nächsten Kapiteln genauer erläutern.
Die Statistiken im Rest des Buches beruhen auf dieser Analyse. Allerdings haben wir bei der Zuordnung der Fälle nur die oben genannten Indikatoren des Kapitals und lediglich zwei Habitusindikatoren berücksichtigt. Das beruht auf der Differenzierung der Klassen nach Habitustypen, die in Kapitel 1.4 ausgeführt wird und die Klassengrenzen teilweise überschreitet. Das wäre bei einer Definition von sozialer Klasse als Merkmalskomplex auch zu erwarten, aber zu rechnerischen Zwecken wollten wir die Anzahl der einzubeziehenden Merkmale möglichst gering halten.
Die Klassenzugehörigkeit bestimmt nicht nur die gesellschaftlichen Chancen, sondern ganz eindeutig auch die Zufriedenheit mit dem eigenen Leben. 60 Prozent der Marginalisierten sind mit ihrem Einkommen nicht zufrieden, aber nur 20 Prozent der Kämpfer und fünf Prozent der Etablierten. Ähnlich verhält es sich mit der Gesundheit. Nur 35 Prozent der Marginalisierten sind mit ihrer Gesundheit zufrieden, hingegen über 60 Prozent der Kämpfer und 80 Prozent der Etablierten. Ganz allgemein sind 0 Prozent der Enthobenen mit ihrem Leben unzufrieden, ein Prozent der Etablierten, sieben Prozent der Kämpfer und 25 Prozent der Marginalisierten.
Lebenslauf und Institutionen
Auch wenn der Begriff der Klasse heute aus der Mode gekommen ist, benutzen wir alle ihn doch regelmäßig mit Bezug auf die soziologischen Klassiker, andere Gesellschaften oder die Vergangenheit. Wir behandeln die Klasse dabei oft wie eine reale Entität, manchmal sogar wie einen Akteur. In diesem Buch wird hingegen argumentiert, dass zwar die oben erläuterten Merkmale und Trennlinien existieren, die Klasse als Einheit jedoch in vieler Hinsicht eine Konstruktion ist. Sie kann innerhalb der sozialen Praxis oder auch von der Wissenschaft konstruiert werden, aber sie existiert nicht in derselben Weise wie Menschen oder Institutionen existieren (Rehbein/Schneickert/ Weiß 2009). Die Klasse ist damit nicht der unabhängige, erklärende Faktor, sondern die Erklärung besteht im Verhältnis von Lebensbedingungen zu Klassifikation und Rekrutierung, vermittelt durch den Habitus. Die Klasse ist gleichsam Resultat des Verhältnisses und seine Bedingung.