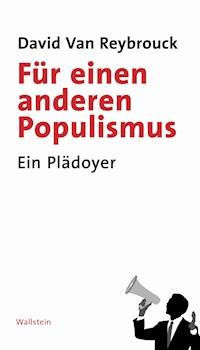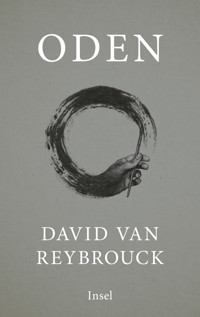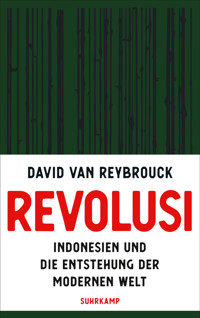
19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Welt hat in diese Revolution eingegriffen, und diese Revolution hat die Welt verändert.
Als Japan 1941 den Angriff auf Pearl Harbor startete, begann sich das historische Fenster für ein anderes Ereignis zu öffnen: Seit Jahrzehnten hatten Indonesier für die Unabhängigkeit von der Kolonialmacht Niederlande gekämpft, im August 1945 wurde sie endlich proklamiert. Doch es folgte ein mehrjähriger, brutaler Krieg. Diese Revolusi war in zweierlei Hinsicht Weltgeschichte: Sie ergab sich aus einem globalen Konflikt und hatte globale Signalwirkung. Denn Indonesien setzte sich an die Spitze der Dekolonisation, die bald auch Afrika erfasste und die politische Landkarte für immer veränderte. In Debatten um Kolonialverbrechen und die Rückgabe geraubter Kunstwerke beschäftigt sie uns bis heute. David Van Reybrouck hat jahrelang recherchiert und mit fast 200 Zeitzeugen gesprochen. Ihre Erinnerungen verknüpft er zu einer historischen Erzählung, deren Sog man sich kaum entziehen kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1154
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Cover
Titel
David Van Reybrouck
Revolusi
Indonesien und die Entstehung der modernen Welt
Aus dem Niederländischen von Andreas Ecke
Suhrkamp Verlag
Impressum
Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.
Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.
Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.
Die niederländische Originalausgabe erschien unter dem Titel Revolusi. Indonesië en het ontstaan van de moderne wereld 2020 bei De Bezige Bij (Amsterdam).Die Veröffentlichung dieses Buches wurde gefördertdurch Flanders Literature (www.flandersliterature.be)
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2022
Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage der Ausgabe des suhrkamp taschenbuchs 5378.
© der deutschsprachigen Ausgabe Suhrkamp Verlag AG, Berlin, 2022© 2020 David Van Reybrouck
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlaggestaltung: Rothfos & Gabler, Hamburg, nach Entwürfen von Tim Bisschop
Umschlagmotiv: Tim BisschopKarten: Carel Fransen
eISBN 978-3-518-77402-1
www.suhrkamp.de
Widmung
für Wil
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Widmung
Inhalt
Informationen zum Buch
Cover
Titel
Impressum
Widmung
Einleitung
1
.»Etwa nicht?«. Warum Indonesien Weltgeschichte geschrieben hat
2
.Das Puzzle wird zusammengesetzt. Niederländische Expansion in Südostasien
1605
-
1914
3
.Das koloniale Postschiff. Soziale Ordnung in einer sich wandelnden Welt
1914
-
1942
4
.»Fliegen, die die Salbe des Apothekers verderben«. Antikoloniale Bewegungen
1914
-
1933
5
.Schweigen. Die letzten Jahre des Kolonialregimes
1934
-
1941
6
.Die Zange und der Ölhahn. Die japanische Invasion in Südostasien Dezember
1941
-März
1942
7
.Das Land des zunehmenden Zwangs. Das erste Jahr der Besatzung März-Dezember
1942
8
.»Kolonialismus ist Kolonialismus«. Mobilisierung, Hunger und wachsender Widerstand Januar
1943
-Ende
1944
9
.»Solange unser Blut noch heiss ist«. Die turbulente Entwicklung hin zur Proklamasi März
1944
-August
1945
10
.»Frei! Von! Allem!«. Republikanische Gewalt und der britische Alptraum August-Dezember
1945
11
.»Ein Akt der Barmherzigkeit«. Das »Britische Jahr« Januar-November
1946
12
.Im Netz gefangen. Das »Niederländische Jahr« November
1946
-Juli
1947
13
.»Inakzeptabel, unerträglich und unfair«. Das »Amerikanische Jahr« August
1947
-Dezember
1948
14
.»Ein grosses Loch, das nach Erde riecht«. Das Jahr der Vereinten Nationen Dezember
1948
-Dezember
1949
15
.Im Morgenlicht. Die indonesische Revolution und die Welt nach
1950
Epilog
Dank
Zu den Quellen
Einleitung
Kapitel
1
Kapitel
2
Kapitel
3
Kapitel
4
Kapitel
5
Kapitel
6
Kapitel
7
Kapitel
8
Kapitel
9
Kapitel
10
Kapitel
11
Kapitel
12
Kapitel
13
Kapitel
14
Kapitel
15
Literatur
Anmerkungen
1.»Etwa nicht?«
2.Das Puzzle wird zusammengesetzt
3.Das koloniale Postschiff
4.»Fliegen, die die Salbe des Apothekers verderben«
5.Schweigen
6.Die Zange und der Ölhahn
7.Das Land des zunehmenden Zwangs
8.»Kolonialismus ist Kolonialismus«
9.»Solange unser Blut noch heiß ist«
10.»Frei! Von! Allem!«
11.»Ein Akt der Barmherzigkeit«
12.Im Netz gefangen
13.»Inakzeptabel, unerträglich und unfair«
14.»Ein großes Loch, das nach Erde riecht«
15.Im Morgenlicht
Ortsregister
Personenregister
Sachregister
Informationen zum Buch
Revolusi
Einleitung
Keine Wellen, keine Schaumkämme. Das ruhige Wasser der Javasee spiegelt den Mond in Tausenden Scherben perlweißen Lichts, die langsam auf dem nächtlichen Meer schaukeln. Ein sanfter Nordostwind bringt ein wenig Kühle, doch wie immer während der Umkehr der Monsunwinde bleibt es auch nach Mitternacht warm, sogar auf See. Millionen Sterne funkeln, die Milchstraße ist ein Streifen verwischter Kreide auf einer alten Schultafel.
Von fern hört man ein leichtes Vibrieren, kaum wahrnehmbar zuerst, aber das Geräusch schwillt an, kommt näher, ist bald ein sehr deutliches Klopfen, das immer lauter wird, ein schweres, regelmäßiges Stampfen. Dann werden im Mondlicht die unverwechselbaren Umrisse eines Dampfers sichtbar, ein majestätischer, weißer Koloss mit senkrechtem Bug, der das Wasser teilt. An den Masten mit Ladebäumen und den Decksaufbauten sieht man, dass es sich um ein Schiff im Liniendienst handelt, das sowohl Fracht als auch Passagiere transportiert. Der dicke Schornstein zieht eine waagerechte Rauchfahne hinter sich her. Hin und wieder stößt er einen roten Funkenregen aus, das Zeichen dafür, dass die Heizer im Kesselraum die Feuer schüren. Doch in der Luft verflüchtigen sich die Funken schnell, das Postschiff gleitet weiter durchs stahlblaue Wasser der Nacht.
Es krängt leicht nach Steuerbord, nicht viel, es ist ein wenig überladen und nicht ordentlich getrimmt. Doch die Krängung nimmt zu, wird zur Schlagseite. Die Passagiere tauschen erschrockene Blicke. Die Dampfpfeife ertönt. Sechsmal kurz, einmal lang: das Notsignal. Und wieder, und wieder. Plötzlich geht alles schnell. Einige Salonpassagiere erscheinen auf dem Promenadendeck; nicht alle tragen Schwimmwesten, und das Sammeln ist schwierig, wenn das Deck zur Rutschbahn wird. Heizer und Kohlentrimmer klettern auf steilen Niedergängen nach oben, aber wo ist oben? Draußen klammern sich die Menschen an Rohre, Trossen, Ketten und Leinen. Wer sich nicht mehr halten kann, rutscht auf dem Deck abwärts, knallt gegen die Reling und landet mit gebrochenen Knochen im Wasser. Kreischen, Brüllen, Knacken, Platschen.
Wenige Minuten später kentert das Schiff, der Schornstein schlägt mit Wucht auf die Wasseroberfläche auf, verschluckt sich, spuckt, schluckt erneut Meerwasser und erstickt schließlich; mit dem letzten Röcheln stößt er Dampf, Ruß, Kohlengrus und Salz aus. Die mächtige bronzene Schraube ragt halb aus dem Wasser und kommt ruhmlos zum Stillstand. Die große Flagge, die stolz am Heck wehte, ist ein schwimmender Fetzen.
Der einst so stattliche Dampfer treibt auf der Seite liegend zwischen den Schiffbrüchigen. Weil sich der Generator auf der Backbordseite befindet, jetzt also oben, bleibt die elektrische Deckbeleuchtung an vielen Stellen an, bis das Schiff endgültig auf den Meeresboden sinkt. Blinkende Glühlampen auf einem untergehenden Schiff. Hell erleuchtete Decks, nasse Trossen, Geknatter von Kurzschlüssen. Und dann: nur noch Luftblasen.
1.»Etwa nicht?«
Warum Indonesien Weltgeschichte geschrieben hat
Eine solche Explosion hatte ich noch nie gehört. Ich arbeitete gerade in meinem Hotelzimmer in der Jalan Wahid Hasyim. Es war ein Knall wie ein gewaltiger Donnerschlag in nächster Nähe, doch der Himmel war stahlblau, genau wie am Vortag und am Tag davor. War vielleicht ein Lastwagen explodiert? Ein Gastank? Von meinem Fenster aus war nirgends Rauch zu sehen, aber von dem bescheidenen Hotel konnte man ohnehin nur einen kleinen Teil der Stadt überblicken. Mit seinen zehn Millionen Einwohnern ist Jakarta eine Megalopolis mit einer Fläche von fast siebenhundert Quadratkilometern; zählt man die Satellitenstädte mit, kommt man sogar auf dreißig Millionen Menschen. Fünf Minuten später rief Jeanne an, in blanker Panik. So kannte ich sie nicht. Ich hatte sie vor einem halben Jahr bei einem Sprachkurs in Yogyakarta kennengelernt: eine junge freie Journalistin aus Frankreich und so entspannt wie kaum jemand sonst. Sie hatte sich Jakarta als Standort ausgesucht, und an diesem Vormittag war sie auf dem Weg zu meinem Hotel. Wie schon mehrmals wollten wir den ganzen Tag Altenheime in abgelegenen Stadtbezirken besuchen, wo ich Zeitzeugen zu finden hoffte, und sie sollte wieder für mich dolmetschen. Doch nun weinte sie. »Jemand hat einen Anschlag verübt! Ich bin vor den Schüssen weggerannt und verstecke mich jetzt in der Mall bei dir um die Ecke!«
Auf die Straße. Hunderte und Aberhunderte von Menschen, wo sich normalerweise endlose Blechlawinen hupend vorbeischieben. Hunderte von Armen, die Smartphones hochhielten, um die Ereignisse zu filmen. Vierhundert Meter vom Hotel entfernt, an der Kreuzung meiner Straße mit der Jalan Thamrin, der Verkehrsader im Zentrum Jakartas, lag eine Leiche. Ein Mann, auf dem Rücken, vermutlich gerade erst ums Leben gekommen. Seine Füße zeigten unnatürlich gerade aufwärts. Polizeibeamte und Soldaten trieben die Menschenmasse zurück, die Lage war noch nicht unter Kontrolle. Auf dem linken Gehweg sah ich Jeanne kommen. Fassungslos beobachteten wir, was geschah, umarmten uns und gingen schnell in mein Hotel. Heute würden wir uns nicht mit den dreißiger und vierziger Jahren beschäftigen.
Die Anschläge vom 14. Januar 2016 waren die ersten in Jakarta nach sieben Jahren. Mitglieder einer extremistischen Muslimorganisation waren auf Mopeds und Motorrollern zu einem Einkaufszentrum gefahren und hatten den dortigen Polizeiposten mit Schusswaffen und Handgranaten angegriffen. Vor einem Starbucks-Café und einer Burger-King-Filiale war eine Bombe gezündet worden – das war die Explosion, die ich gehört hatte –, anschließend hatten sich zwei der Terroristen auf dem Parkplatz der Mall in die Luft gesprengt; die Bilder davon sind immer noch online. In der Nähe liegen einige Botschaften, Luxushotels und eine wichtige UN-Niederlassung, doch sie scheinen keine unmittelbaren Ziele gewesen zu sein. Es gab acht Tote, darunter vier der Angreifer, und vierundzwanzig Verletzte.
Kaum von dem Schreck erholt, stürzte sich Jeanne in die Arbeit, schrieb Berichte für etliche französische Zeitungen und Websites, verfolgte die Nachrichten über den Fernseher in meinem Zimmer und leitete die neuesten Meldungen nach Paris weiter. Wir durchforsteten das Internet in sämtlichen uns bekannten Sprachen. Ich veröffentlichte ein paar Berichte in den sozialen Medien, und bald fragten die ersten Zeitungen und Rundfunksender telefonisch wegen Informationen und Interviews an. Für den Rest des Tages wurde das Hotelzimmer zu einem Nervenzentrum, das französische, belgische, schweizerische und in geringerem Maße auch niederländische Medien mit Informationen versorgte (noch heute haben niederländische Sender und Zeitungen einige Korrespondenten in Jakarta). Ich erinnere mich, das Jeanne sich irgendwann für ein Radiointerview mit France Inter im Hotelflur auf den Teppichboden setzte, während ich über Skype ein Livegespräch mit einem flämischen Fernsehsender führte. Stundenlang waren wir ununterbrochen beschäftigt, bis wir am späten Nachmittag bohrende Kopfschmerzen bekamen und endlich etwas essen gingen.
Am nächsten Tag war alles vorbei.
Sobald feststand, dass es sich nicht um einen weiteren Anschlag wie 2002 auf Bali handelte (mehr als zweihundert Tote vor allem aus westlichen Ländern), ganz zu schweigen von einer Erdbeben- und Tsunamikatastrophe, wie sie 2004 das westliche Indonesien und Thailand heimgesucht hatte (allein in Indonesien über 131000 Tote, und das war nur die offiziell bestätigte Zahl), erlahmte das internationale Interesse. Indonesien wurde wieder zu dem stillen Riesen, von dem man außerhalb Südostasiens selten bis niemals hört. Eigentlich ist das höchst seltsam: Von der Einwohnerzahl her ist Indonesien das viertgrößte Land der Erde, nach China, Indien und den Vereinigten Staaten, die sich kontinuierlicher Aufmerksamkeit erfreuen. Es ist das Land mit der zahlenmäßig größten muslimischen Bevölkerung der Welt. Seine Wirtschaft ist die wichtigste Südostasiens und versorgt große Teile der Welt mit Palmöl, Kautschuk und Zinn. Doch das internationale Interesse bleibt gering, schon seit vielen Jahren. Wer in Paris, Beijing oder New York in einer guten Buchhandlung das Regal mit Büchern über Asien durchstöbert, findet eher etwas über Myanmar, Afghanistan oder Südkorea, ja, sogar Armenien (Länder mit nur wenigen oder um die fünfzig Millionen Einwohnern) als über Indonesien mit seinen 286 Millionen. Einer von siebenundzwanzig Menschen auf dem Planeten ist Staatsbürger Indonesiens, aber im Rest der Welt hat man große Mühe, auch nur einen einzigen Einwohner des Landes zu nennen. Oder um es mit dem klassischen Witz von westlichen Expats in Indonesien zu sagen: »Hast du eine Ahnung, wo Indonesien liegt?« »Öhm … nicht genau. Irgendwo in der Gegend von Bali?«
Schlagen wir einfach mal einen Schulatlas auf. So marginal wie die Rolle, die Indonesien in unserem Bewusstsein spielt, ist auch seine Lage auf der Weltkarte: Diese Kleckse rechts außen, wie ausgespuckt vom Festland zwischen Pazifik und Indischem Ozean, das also ist es. Weit entfernt vom kompakten Westeuropa und dem massiven Nordamerika, die oben liegen, was natürlich eine historische Konvention ist, denn die Erdoberfläche hat keine Mitte und der Kosmos kein Oben und Unten. Verändert man aber die Perspektive und verschiebt Indonesien in die Mitte, erkennt man, dass es sich nicht um irgendein peripheres Gebiet handelt, sondern um einen Archipel in strategisch bedeutsamer Lage, in einer ausgedehnten maritimen Region zwischen Indien und China. Für Seefahrer früherer Zeiten waren die Inseln eine wunderbare Reihe von Trittsteinen zwischen West und Ost, eine Doppelreihe von Inseln sogar, deren Größe nach Osten hin tendenziell abnimmt. Das riesige Sumatra scheint sich an die Malaiische Halbinsel schmiegen zu wollen, es folgen Java, Bali, Lombok, Sumbawa, Flores und so weiter. Nördlich davon liegen Borneo, Sulawesi und die Molukken, massiv die erste dieser Inseln, bizarr die zweite, zersplittert die zuletzt genannte Gruppe. Die beiden Perlenketten treffen bei Neuguinea zusammen.
Karte 1: Das heutige Indonesien (2020)
Indonesien ist der größte Inselstaat der Welt. Offiziell zählt es 13466 Inseln, es können aber auch 16056 sein. Oder 18203. Niemand weiß es genau. Vulkanismus, Erdbeben und Gezeiten verändern unaufhörlich die Küstenlinien, und bei Flut steigt die Anzahl der Inseln. Einmal habe ich das mit eigenen Augen beobachtet: Der Mittelteil einer kleinen tropischen Insel verschwand für sechs Stunden unter Wasser. Waren das nun zwei Inseln oder eine? Nach der Definition der Vereinten Nationen zwei, aber die Bewohner hatten nur einen Namen dafür. Von diesen unzähligen Inseln sind ein paar tausend bewohnt. Wenn auch die meisten sehr klein sind, liegen fünf der dreizehn größten Inseln der Erde ganz oder teilweise auf dem Territorium Indonesiens: Neuguinea, Borneo, Sumatra, Sulawesi und Java. Die erste teilt es sich mit Papua-Neuguinea, die zweite mit Malaysia und dem Sultanat Brunei. Die letzte ist die bevölkerungsreichste Insel der Welt: Java ist ungefähr tausend Kilometer lang und hundert bis zweihundert Kilometer breit, seine Fläche macht nur sieben Prozent des gesamten indonesischen Staatsgebietes aus, aber mit 141 Millionen Menschen zählt es mehr als die Hälfte der Einwohner des gesamten Landes. Kein Wunder also, dass viele entscheidende historische Ereignisse dort ihren Ursprung hatten. Dennoch ist Indonesien längst nicht nur Java. Der tropische Archipel erstreckt sich über mehr als fünfundvierzig Längengrade, ein Achtel des gesamten Erdumfangs, drei Zeitzonen und gut fünftausend Kilometer entlang des Äquators. Könnte man Indonesien anklicken und auf einer Karte über Europa ziehen, würde es von Irland bis zum Westrand Kasachstans reichen; könnte man es ungefähr mittig auf das zusammenhängende Gebiet der Vereinigten Staaten legen, würde es an Ost- und Westküste jeweils fast fünfhundert Kilometer überstehen. In diesem riesigen Gebiet unterscheidet man fast dreihundert ethnische Gruppen und siebenhundert Sprachen. Amtssprache ist Bahasa Indonesia, eine junge, vom Malaiischen abgeleitete Sprache mit zahlreichen Spuren des Arabischen, Portugiesischen, Niederländischen und Englischen.
Es sind aber nicht nur die demografischen und geografischen Superlative, die unser Interesse wecken sollten. Zur Geschichte Indonesiens gehört eine historische Premiere von globaler Bedeutung: Es war das erste Land, das nach dem Zweiten Weltkrieg seine Unabhängigkeit ausrief, nicht einmal zwei Tage nach der Kapitulation Japans. Nach fast dreieinhalb Jahrhunderten niederländischer Anwesenheit (1600 bis 1942) und dreieinhalb Jahren japanischer Besatzung (1942 bis 1945) erklärten Anführer der Unabhängigkeitsbewegung das Land im Namen der indonesischen Nation zum souveränen Staat. Es war der erste Dominostein, der fiel, zu einer Zeit, als große Teile Asiens, Afrikas und der arabischen Welt Kolonien einiger westeuropäischer Staaten wie Großbritannien, Frankreich, Portugal, Belgien und der Niederlande waren.
Diese Unabhängigkeitserklärung kam nicht nur sehr früh; die Bewegung, aus der sie hervorging, war außerdem sehr jung. Sie wurde getragen von einer ganzen Generation 15- bis 25-Jähriger, die bereit waren, für ihre Freiheit zu sterben. Die Revolusi von 1945 war in jeder Hinsicht eine Revolution der Jugend. Wer heute glaubt, dass junge Menschen im Kampf gegen den Klimawandel und den Verlust an Biodiversität nichts bewirken könnten, sollte sich dringend über die Geschichte Indonesiens informieren: Das viertbevölkerungsreichste Land der Erde wäre ohne den Einsatz von Jugendlichen und jungen Erwachsenen nicht entstanden. Wobei zu hoffen ist, dass die jungen Klimaaktivisten auch in Zukunft weniger Gewalt anwenden als die indonesische Jugend damals.
Die indonesische Revolution ist aber hauptsächlich deshalb so außerordentlich faszinierend, weil sie weitreichende Auswirkungen auf die übrige Menschheit hatte: nicht nur auf die Entkolonialisierung in anderen Teilen der Welt, sondern in noch stärkerem Maße auf die Zusammenarbeit zwischen all den neuen Ländern. Auf den Bildern vom Anschlag in Jakarta sieht man an einer Fußgängerbrücke über die Jalan Thamrin ein sehr breites Plakat hängen: »Asian African Conference Commemoration« steht darauf, und in der zweiten Zeile »Advancing South-South Cooperation« – ein starker Kontrast zu dem Rauch und der Panik unten. Das Plakat wies auf einen im Vorjahr veranstalteten internationalen Kongress hin. 2015 war es nämlich sechzig Jahre her, dass Indonesien freundschaftliche Beziehungen zu einer Reihe erst kurz zuvor unabhängig gewordener Länder knüpfte. Gut fünf Jahre nach der endgültigen Souveränitätsübergabe durch die Niederlande hatte in der dynamischen Stadt Bandung im Westen Javas die berühmte Asien-Afrika-Konferenz stattgefunden, das erste Treffen führender Politiker ohne den Westen. Sie repräsentierten nicht weniger als anderthalb Milliarden Menschen, über die Hälfte der damaligen Weltbevölkerung. »Bandung«, wie die Konferenz bald nur noch genannt wurde, war nach Ansicht des afroamerikanischen Schriftstellers Richard Wright, selbst Teilnehmer, »der entscheidende Moment im Bewusstsein von 65 Prozent der Spezies Mensch«. Was dort geschah, werde »das menschliche Leben auf der Erde insgesamt prägen«.1 Das klingt reichlich hochtrabend, war aber nicht weit von der Wahrheit entfernt. In den folgenden Jahren sollte sich die Revolusi nämlich auf alle Kontinente auswirken: nicht nur auf große Teile Asiens, der arabischen Welt, Afrikas und Lateinamerikas, sondern auch auf die Vereinigten Staaten und auf Europa. Die amerikanische Bürgerrechtsbewegung und die Initiativen zur europäischen Einigung waren auch und nicht zuletzt eine Reaktion auf »Bandung«, im Fall Europas eine erzwungene. Es war ein Meilenstein in der Entstehung der modernen Welt. Eine französische Studie aus dem Jahr 1965 wagte den ganz großen Vergleich: Bandung sei nicht weniger als »der zweite 14. Juli der Geschichte: ein 14. Juli planetarischen Maßstabs«.2
In den Tagen nach dem Anschlag fuhren Jeanne und ich wieder von einem Altenheim zum nächsten. Schon in der Woche davor hatten wir großartige Berichte aufzeichnen können, und auch jetzt war es einfach eine Freude, den Zeitzeugen, die wir fanden, das Wort zu überlassen. Obwohl wir beide weder Niederländer noch Indonesier sind, empfanden wir diese Lebensgeschichten als ungeheuer fesselnd. Was man uns erzählte, war eine universelle Geschichte von Hoffnung, Angst und Sehnsucht. Sie handelte auch von uns, von unserer Gegenwart.
Die Revolusi schrieb einst Weltgeschichte – die Welt griff in sie ein und wurde durch sie verändert –, doch leider geriet diese globale Dimension weitgehend in Vergessenheit. In den Niederlanden musste ich mich ständig dafür rechtfertigen, dass ich, »noch dazu als Belgier«, über Indonesien schrieb. »Weil es nicht mehr euch gehört!«, sagte ich dann lachend. Manchmal fügte ich noch hinzu, auch Belgien sei ja unter der holländischen Knute gewesen, ich könne also aus Erfahrung mitreden. Was ich aber eigentlich meinte, war etwas anderes: dass das Land mit der viertgrößten Bevölkerung der Erde doch alle interessieren müsste. Wenn wir die amerikanischen »Gründerväter«, Mao und Gandhi für bedeutend halten, warum dann nicht die Pioniere des indonesischen Freiheitskampfes? Nicht jeder sah das so. Nachdem ich in der Wochenbeilage einer Zeitung über meine Recherchen berichtet hatte,3 reagierte ein Anhänger von Geert Wilders’ Partij voor de Vrijheid auf Facebook pikiert: »Ich finde, dieser Idiot sollte erst mal ein Buch über König Leopold und Belgisch-Kongo schreiben, bevor er solche Töne spuckt.« Nun, ich hatte nicht vor, das noch einmal zu tun.
Dekolonisationsprozesse werden oft auf die Konflikte zwischen dem jeweiligen Kolonisator und der Kolonie reduziert: Frankreich und Algerien, Belgien und Kongo, Portugal und Angola, England und Indien, die Niederlande und Indonesien. Ein Bild, das ein wenig an einen Strichcode erinnert, doch außer den vertikalen Konflikten gibt es grundsätzlich viele »horizontale« Faktoren. Nachbarländer spielen eine Rolle, Verbündete, lokale Milizen, regionale Mächte, internationale Organisationen … All dies darf nicht ausgeblendet werden, sonst halten wir am westlichen Nationalstaat und an seinen kolonialen Grenzen als Bezugssystem fest, denken also weiterhin in den Kategorien des 19. Jahrhunderts. Wer nur durch die Schießscharten der Vergangenheit blickt, sieht nicht unbedingt die ganze Landschaft. Es wird Zeit, die nationale Fokussierung zu überwinden und die globale Dimension der Dekolonisation zu sehen. Ja, das ist anstrengend. Ein Knäuel ist komplizierter als ein Schema mit zwei Lagern, aber die historische Wirklichkeit entspricht nun einmal keinem Schema. Und das gilt erst recht für die indonesische Geschichte und die Revolusi.
Noch einmal: Die Welt hat in sie eingegriffen und ist durch sie verändert worden. Nur noch in zwei Ländern gedenkt man heute der Revolusi als nationaler Geschichte. In Indonesien ist sie seit Jahrzehnten der unveränderliche Gründungsmythos des weiträumigen, hyperdiversen Staates. Ganz gleich, in welchem Teil Indonesiens ich landete, der Flugplatz war auf sehr vielen der Inseln nach einem Freiheitskämpfer benannt. Straßennamen und Standbilder huldigen nach wie vor der Revolusi. Und in den Städten bieten Museen in Form von Dioramen anschauliche, kanonisierte Darstellungen einer Ur-Erzählung, ähnlich wie die Bleiglasfenster in mittelalterlichen Kathedralen, nur ist es in diesem Fall die Ur-Erzählung von der Nation. Sie soll das Inselreich zusammenhalten, gegen eventuelle separatistische Tendenzen wie bei den strengen Muslimen in Aceh auf Sumatra im äußersten Westen des Landes oder den Papuas auf Neuguinea im äußersten Osten. So groß die Unterschiede zwischen den aufeinanderfolgenden Präsidenten in ideologischer Hinsicht auch waren, historisch beriefen sich alle auf dasselbe Ereignis: den heroischen perang kemerdékaan, den Unabhängigkeitskampf gegen die Kolonialmacht. Entsprechend sind die Schwerpunkte in den Geschichtsbüchern für weiterführende Schulen gesetzt. Ein Buch von 2014, Sejarah Indonesia dari Proklamasi sampai Orde Reformasi (Geschichte Indonesiens von der Unabhängigkeitserklärung bis zur Reformära – gemeint ist die Zeit nach Suharto), widmet die ganze erste Hälfte seiner 230 Seiten den wenigen Jahren von 1945 bis 1949, während die Jahrzehnte von 1950 bis 2008 mit der zweiten Hälfte vorliebnehmen müssen.4 Junge indonesische Historiker wenden sich zwar seit einigen Jahren entschieden gegen eine Geschichtsschreibung, die für sie allzu »indonesiasentris« ist, gegen die »Tirani Sejarah nasional«, wie sie es nennen, die Tyrannei der nationalen Geschichte. Doch für das breitere Publikum bleibt die Revolusi in erster Linie eine rein indonesische Angelegenheit.5
In den Niederlanden ist hinsichtlich der Haltung zur Entkolonialisierung einiges in Bewegung gekommen. Man sieht es schon an den Titeln wichtiger Übersichtswerke. Ging es in den Darstellungen einer älteren Historikergeneration meist in erster Linie um den Verlust für die Niederlande (Das letzte Jahrhundert Ostindiens, Abschied von Ostindien, Abschied von den Kolonien, Der Rückzug), so erscheinen in den letzten Jahren immer mehr Bücher, in denen die von den Niederlanden ausgeübte Gewalt im Vordergrund steht (Last des Krieges, Soldat in Indonesien, Raubstaat, Kolonialkriege in Indonesien, Die brennenden Kampongs des Generals Spoor).6 Parallel dazu konfrontieren junge Journalisten und Aktivistinnen die Öffentlichkeit nachdrücklich mit den – zu lange weitgehend verschwiegenen – weniger erfreulichen Seiten der niederländischen Geschichte. Und doch scheinen so viele Jahre facettenreicher und häufig exzellenter Geschichtsschreibung relativ wenig Einfluss auf die öffentliche Wahrnehmung gehabt zu haben. Trotz vorzüglicher Darstellungen der diplomatischen Geschichte, detailreicher politischer Biografien, einiger brillanter Dissertationen und hervorragender populärwissenschaftlicher Bücher ist das Wissen großer Teile der Bevölkerung über die Kolonialzeit und die postkoloniale Ära äußerst dürftig. Als das britische Meinungsforschungsinstitut YouGov im Dezember 2019 der Frage nachging, welches europäische Land besonders stolz auf seine koloniale Vergangenheit sei, lagen die Niederlande weit vor den anderen. Nicht weniger als 50 Prozent der Befragten erklärten, stolz auf das frühere Imperium zu sein, gegenüber 32 Prozent der Briten, 26 Prozent der Franzosen und 23 Prozent der Belgier. Noch auffälliger war der besonders niedrige Anteil der Niederländer, die sich für den Kolonialismus schämten: nur 6 Prozent, gegenüber 14 Prozent der Franzosen, 19 Prozent der Briten und 23 Prozent der Belgier. Über ein Viertel der befragten Niederländer (26 Prozent) wünschte sogar, dass ihr Land immer noch ein Kolonialreich in Übersee besäße.7
Wie ist diese sonderbare Einstellung zu erklären? War der niederländische Kolonialismus denn so viel »besser« als der anderer europäischer Länder, und gibt es deshalb objektiv mehr Grund zu Stolz? Oder finden die neuen Erkenntnisse in den Niederlanden so viel langsamer den Weg ins allgemeine Bewusstsein? Genau dies scheint der Fall zu sein, denn wer die einschlägige Literatur studiert, neigt danach weniger zu nationaler Selbstzufriedenheit. Die Ergebnisse von Jahrzehnten solider historischer Forschung sind eher Anlass zu Scham als zu Stolz, was jedoch kaum wahrgenommen wird. Woran liegt das? Ist der niederländische Geschichtsunterricht nach dem Jahr 2000 nicht deutlich empirischer geworden? Hatte man nicht nach einigen Jahrzehnten übertriebener Ausrichtung auf geschichtswissenschaftliche Methoden und Projektarbeit eingesehen, wie wichtig chronologischer Überblick und historisches Grundwissen sind? Ja, im Jahr 2001 stellte eine Kommission unter Leitung des Historikers Piet de Rooy ein didaktisches Rahmenkonzept für Lehrkräfte im Fach Geschichte vor, das die Vergangenheit in zehn markante Epochen einteilte. Allerdings hatte es zwei Nachteile: Trotz einer zunehmend diversen Gesellschaft war es weiterhin stark eurozentrisch (»Griechen und Römer«, »Mönche und Ritter«, »Perücken und Revolutionen« und so weiter), und es konnte die in den neunziger Jahren beschlossene Reduzierung der Unterrichtsstunden im Fach Geschichte nicht rückgängig machen.8 Schon seit Jahrzehnten ist in den Niederlanden Geschichte nur noch für Zwölf- bis Fünfzehnjährige zwei oder drei Jahre lang Pflichtfach; danach ist es weitere zwei oder drei Jahre lediglich Wahlfach.9 Historisches Bewusstsein ist deshalb nicht sehr weit verbreitet.
Nach den Anschlägen auf das World Trade Center und den Morden an Pim Fortuyn und Theo van Gogh wurde jedoch in der niederländischen Gesellschaft der dringende Wunsch spürbar, die eigene »Identität« genauer zu definieren. Der Bildungskanon für die Niederlande (Canon van Nederland), der 2006 von einer Kommission unter Leitung des Literaturwissenschaftlers Frits van Oostrom präsentiert wurde, gibt einen chronologisch und nach fünfzig Themen geordneten Überblick über die niederländische Geschichte, als historisches Grundwissen, über das alle Niederländerinnen und Niederländer verfügen sollten. Allerdings erzählt dieser Kanon, der im niederländischen Grundschulunterricht (bis zum zwölften Lebensjahr) mittlerweile einen halboffiziellen Status genießt, die Geschichte ganz und gar aus der nationalen Perspektive.10 Außerdem können zehn Epochen und fünfzig Themen, selbst wenn sie noch so sorgfältig gewählt werden, nicht die in den neunziger Jahren gerissenen Lücken schließen, auch nicht durch eine Aktualisierung des Kanons. Themen ohne Unterrichtsstunden nützen nicht viel, Fenster zur Vergangenheit sind erst interessant, wenn man auch genügend Zeit bekommt, durch diese Fenster hinauszuschauen. Wenn außerdem neue Geschichtsbücher für weiterführende Schulen – oder Neuausgaben von älteren – weiterhin mantraartig »Freiheit« und »Toleranz« als Wesensmerkmale der niederländischen Gesellschaft hervorheben, wie kürzlich in einer Dissertation festgestellt wurde, verwundert es kaum, dass sogar junge Amsterdamer Lehramtsstudenten des Fachs Geschichte die nationale Historie äußerst positiv beurteilen.11 Die Geschichte der Niederlande, das ist für sie vor allem der Kampf gegen die spanische Herrschaft im 16. Jahrhundert, die Niederländische Ostindien-Kompanie (VOC) und die wirtschaftliche und kulturelle Blüte im 17. Jahrhundert, die Anfänge der parlamentarischen Demokratie im 19. und der Widerstand gegen die deutschen Besatzer im 20. Jahrhundert. Kollaboration, Sklaverei und Entkolonialisierung sind für diese künftigen Lehrkräfte kaum ein Thema.12 Auf diese Weise bleibt niederländische Geschichte natürlich in hohem Maße »vaterländische« Geschichte. Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang, dass der besonders renommierte Lehrstuhl für vaderlandse geschiedenis der Universität Leiden erst im Frühjahr 2020 in Lehrstuhl für Nederlandse geschiedenis umbenannt worden ist.
Auch bedeutende öffentliche Einrichtungen haben Chancen verpasst. Als das Rijksmuseum Amsterdam 2013 nach umfassenden Renovierungen wiedereröffnet wurde, war von den 63 neu eingerichteten Sälen nur ein einziger der Kolonialgeschichte gewidmet: Saal 1.5 heißt seitdem Nederland overzee (Die Niederlande in Übersee). Ziemlich wenig für das Nationalmuseum eines Landes, das einmal über das drittgrößte Imperium der Welt herrschte und mehr als drei Jahrhunderte lang auf drei südlichen Kontinenten aktiv war. »Lerne in einem prachtvollen Gebäude die eigene Geschichte kennen«, steht auf der Website, aber welche Geschichte ist hier gemeint? Mehr als sechzehn Millionen Besuchern wurde seit der Wiedereröffnung der Eindruck vermittelt, der Imperialismus sei eine eigentlich zu vernachlässigende Randerscheinung der niederländischen Geschichte gewesen. Glücklicherweise hat sich hier in den letzten Jahren eine Kehrtwende vollzogen.13
Seit 2017 bietet das Scheepvaartmuseum in Amsterdam an Bord seines großartigen Nachbaus eines VOC-Schiffs aus dem 17. Jahrhundert ein Virtual-Reality-Erlebnis: Wer eine VR-Brille aufsetzt, schwebt über den Schiffswerften und Seemannsvierteln des damaligen Amsterdam. Eine verblüffende Erfahrung, aber ein Virtual-Reality-Programm zu der Frage, wohin diese Schiffe fuhren und welcher Art der Handel war, dem sie dienten, gibt es nicht. So bleibt das heroische Bild frei von Flecken.
Ich bewundere seit Jahren den wirklich hervorragenden historischen Atlas Bosatlas van de geschiedenis van Nederland, aber wenn ich sehe, dass von den 560 Karten der jüngsten Ausgabe (2011) nur 31 dem niederländischen Imperialismus gewidmet sind, fehlt mir als Leser doch etwas. So vorzüglich das Enthaltene auch ist, man sucht vergeblich nach Karten zum großen Java-Krieg in den zwanziger Jahren des 19. Jahrhunderts, zu Verwaltung und Widerstand in der kolonialen Epoche, zu Alphabetisierung und Gesundheitsversorgung, zur revolutionären Gewalt der sogenannten Bersiap-Zeit, zu den zivilen Internierungslagern der Republik, zu Guerilla und Kontraguerilla nach der Ersten und der Zweiten »Polizeiaktion«, zu Kriegsverbrechen und Massengewalt, zum Feldzug Raymond Westerlings auf Sulawesi, zu den Linggajati-, Renville- und Roem-Van-Roijen-Abkommen – obwohl all dies doch historische Meilensteine von großer kartografischer Relevanz sind. Man kann nur auf eine Neuauflage hoffen.
Auch die populäre Kultur bleibt in bestimmten Mustern gefangen. Soldaat van Oranje, das erfolgreichste niederländische Musical überhaupt, erzählt wie das Buch und der Film gleichen Titels von den Erlebnissen des Widerstandshelden Erik Hazelhoff Roelfzema während des Zweiten Weltkriegs. Im November 2019 konnte die Show den dreimillionsten Besucher begrüßen. Doch dass der Held aus Niederländisch-Indien stammte und sich sein Leben lang als indische jongen sah, wird nirgends erwähnt.14 Und dass er nach dem Krieg in der Phase der Entkolonialisierung eine äußerst fragwürdige Rolle gespielt hat und zur Anwendung von Gewalt bereit war, um die Unabhängigkeit Indonesiens abzuwenden, weiß so gut wie niemand.15
Natürlich muss man für einen Atlas eine Auswahl treffen, und ein Musical stößt erst recht an Grenzen, aber wenn selbst eine 2013 erschienene, gründliche Biografie Wilhelms I., der wie kein anderer König der Niederlande die Geschichte Niederländisch-Indiens geprägt hat, kaum auf die Kolonialpolitik dieses Monarchen eingeht, haben wir ein Problem. Während der Herrschaft Wilhelms I. fand der blutigste aller Kolonialkriege statt, der Java-Krieg von 1825 bis 1830, der mehr Menschenleben kostete als der Dekolonisationskrieg und sogar der zerstörerischste Krieg war, den die Niederlande je geführt haben, doch die Biografie widmet ihm gerade einmal vier Sätze. Unter Wilhelm I. wurde auch das sogenannte Kultivationssystem (cultuurstelsel) eingeführt, eine ökonomische Schreckensherrschaft, die Teile Javas in tiefes Elend stürzte und es den Niederlanden erlaubte, sich in hohem Maß zu bereichern. Die siebenhundert Seiten lange Königsbiografie handelt es auf einer halben Seite ab.16 Bedauerlich bei einer so ausgereiften und maßgebenden Studie, auch wenn der Autor in neueren Arbeiten den kolonialen Aspekten der niederländischen Monarchie im 19. Jahrhundert mehr Beachtung schenkt.17
Vermutlich liegt es öfter an blinden Flecken als an bösem Willen. Vielleicht gilt für viele Niederländer, was Harm Stevens, der für das 20. Jahrhundert zuständige Konservator am Rijksmuseum, vor einiger Zeit in einem Interview erklärte. Auf die Frage, warum er sich erst seit wenigen Jahren auch mit dem Imperialismus auseinandersetze, antwortete er: »Ich habe das immer abgeblockt, weil es mir zu indonesisch wurde. Ich fühlte mich da nicht kompetent, es war Scheu vor dem Unbekannten. Es ist Verleugnung, nicht völlig bewusst, aber trotzdem.«18 Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Die zahlreichen blinden Flecken erwecken allerdings schon den seltsamen Eindruck, dass die Scheuklappen des Eurozentrismus ziemlich bequem sitzen, auch noch in Zeiten der Globalisierung. Oder sogar, dass man nichts wissen will. Dies gilt auf jeden Fall für staatliche Stellen. Schon seit 1969 versprechen sie umfassende Untersuchungen zu möglicherweise unrechtmäßigem Verhalten niederländischer Soldaten im Unabhängigkeitskrieg. Doch nach einer ersten, vorläufigen Bestandsaufnahme, der sogenannten Excessennota von 1969, blieb es beängstigend still. Und zwar bis … 2016, nachdem eine Dissertation, wohlgemerkt nicht aus den Niederlanden, sondern aus der Schweiz, unwiderlegbar nachgewiesen hatte, wie schmutzig dieser Krieg gewesen war.19 Erst dann wurde Geld zur Verfügung gestellt.
Kurz und gut, vielleicht braucht man sich über die auffälligen Lücken im Bewusstsein der niederländischen Öffentlichkeit im Hinblick auf die Kolonialgeschichte nicht zu wundern. Wenn ein Ministerpräsident und studierter Historiker es noch 2006 fertigbrachte, die Volksvertreterinnen und Volksvertreter in der voll besetzten Zweiten Kammer des Parlaments während der Haushaltsdebatte, der wichtigsten Sitzung des politischen Jahres, mit einem euphorischen Verweis auf »diese VOC-Mentalität« zu mehr Tatkraft und Selbstbewusstsein anzuspornen, kann man es weiten Teilen der niederländischen Bevölkerung nicht verübeln, dass sie weiterhin ein im Großen und Ganzen positives Bild vom historischen Übersee-Abenteuer ihres Landes haben. Achtung, Spoiler: Die VOC, die Niederländische Ostindien-Kompanie, war für mindestens einen Genozid verantwortlich. Das war 2006 hinlänglich bekannt, bereits seit 1621 weiß man davon. Als einige Parlamentarier mit empörtem Johlen auf seine Äußerung reagierten, fügte Premier Jan Peter Balkenende eilig ein »Etwa nicht?« hinzu.
Von diesem »Etwa nicht?« handelt dieses Buch. Von Stolz und Scham. Von Emanzipation und Erniedrigung. Von Hoffnung und Gewalt. Es will zusammenbringen, was zahlreiche Historiker mit großer Sachkenntnis ergründet haben, ohne dass ihre Erkenntnisse immer ins Bewusstsein einer breiteren Öffentlichkeit vorgedrungen wären. Es baut auf den erhellenden Darstellungen anderer Autoren, Journalistinnen und Künstler im In- und Ausland auf. Vor allem aber hält es sich an diejenigen, die alles selbst erlebt haben: die letzten Zeugen der Revolusi. Ich bin ein glühender Anhänger von Oral History. Trotz der vielen Stunden auf den Rücksitzen von Mopeds, der manchmal sengenden Hitze und fühlbaren Luftverschmutzung in den Städten, der Hunderte Mückenstiche nach einer Nacht auf dem Deck einer Fähre, der Angst und Aufregung angesichts eines Terroranschlags in nächster Nähe hat sich die Mühe immer gelohnt. Ganz gewöhnliche Menschen haben so viel zu erzählen. Es war in jeder Hinsicht ein Privileg, ihre Geschichten zu hören.
In der Zeit von Juli 2015 bis Juli 2019 habe ich alles in allem etwa ein Jahr Feldforschung betrieben, davon acht Monate in Asien. Ich habe zahllose Inseln besucht und mit vielen Hunderten Menschen gesprochen. Bei 185 von ihnen wurden aus diesen Gesprächen formelle Interviews von mindestens einer halben, in der Regel aber anderthalb Stunden. Oft dauerten sie aber auch viel länger, oder ich kam noch einmal wieder. Allen Zeitzeugen-»Kandidaten« habe ich erklärt, dass ich an einem Buch über die Geschichte der indonesischen Unabhängigkeit arbeitete, und sie dann um die Erlaubnis gebeten, sie zu interviewen und das Erzählte zu veröffentlichen. Mit »formell« meine ich, dass ich alle Gesprächspartner fragte, ob ich ihren Namen und ihr Alter nennen durfte, dass ich mit ihnen chronologisch ihre Lebensgeschichte durchging, dass ich ununterbrochen und für sie sichtbar Dinge notierte, bei bestimmten Aspekten nachhakte und eventuell einige Tonaufnahmen und Fotos machte, all dies mit Zustimmung der Befragten. Wenn jemand über bestimmte Erinnerungen nicht sprechen wollte, fragte ich nicht weiter. Ohne Respekt und Vertrauen geht es für mich nicht. Ein paar Zeitzeugen wollten eventuelle Zitate gern kontrollieren, einige wenige lieber anonym bleiben. Diese Wünsche habe ich selbstverständlich respektiert. Obwohl die Gespräche in ruhiger Atmosphäre verliefen, waren meist viele Emotionen im Spiel: Wut, Kummer, Groll, Heimweh, Reue und Bedauern, Frust und Resignation; aber auch an Humor fehlte es nicht. Es wurde gelacht, getrauert, geschwiegen. Die meisten Informanten waren hochbetagt, doch viele hatten verblüffend genaue Erinnerungen. Wenn ich aus den Gesprächen mit alten Menschen etwas gelernt habe, dann vor allem, dass die Gegenwart schneller verschwimmt als die Jugend, besonders wenn sie dramatisch war. Selbst wenn sich alles andere verflüchtigt hat, taucht in der Einöde des Gedächtnisses noch ein Kinderlied auf. Oder ein Trauma. Manche Felsbrocken lassen sich nicht von der Stelle bewegen.
Die Interviews wurden in fast zwanzig verschiedenen Sprachen geführt: Indonesisch, Javanisch, sundanesischen Sprachen, Bataksprachen, Balinesisch, Minahasa, Togian, Toraja, Buginesisch, Mandar, Ambonesisch, Morotai, Japanisch, Nepalesisch, Englisch, Französisch, Niederländisch. Zählt man noch etliche Dialekte hinzu, bekommt man einen Eindruck von den babylonischen Herausforderungen. Obwohl mein Indonesisch irgendwann für einfache Gespräche ausreichte, habe ich für alle Interviews die Hilfe von Dolmetscherinnen und Dolmetschern in Anspruch genommen, allein schon, weil viele der alten Menschen dieses neumodische Indonesisch gar nicht sprachen. Die Dolmetscher übersetzten ins Englische, Französische, Deutsche oder Niederländische. In seltenen Fällen brauchte es zwei Übersetzungsschritte, mit dem Indonesischen als Zwischenstation. Weil Übersetzer und Dolmetscher die stillen Helden der Globalisierung sind, habe ich jeden von ihnen in den Anmerkungen erwähnt. Ohne sie hätte ich dieses Buch nicht schreiben können.
Aufgespürt habe ich die Zeitzeugen durch unermüdliches Herumfragen. Mal sprach ich einen Imam an, mal die Leiterin eines Altenheims, mal einen jungen Soldaten: Kannten sie vielleicht noch Leute, die etwas Interessantes beitragen konnten? Jedem und jeder in meiner Umgebung erzählte ich von meinem Projekt, was mir zu wertvollen Kontakten verhalf. Soziale Medien verschafften meiner Suche größere Aufmerksamkeit, dank Couchsurfing begegnete ich wunderbaren Menschen. In Indonesien und Japan fand ich ein paar meiner Gesprächspartner sogar über Tinder: Mann oder Frau, jung oder alt, fern oder nah, ich wischte immer nach rechts und akzeptierte alle. So kam ich mit Hunderten von Unbekannten in Kontakt, die ich auf der Straße niemals angesprochen hätte. Hin und wieder musste ich auf meinen Profiltext hinweisen, in dem stand, wer ich war und dass mich vor allem die Großmutter oder der Großvater der jeweiligen Person interessierte. Es funktionierte.
Karte 2: Ausbreitung des Homo erectus (vor ca. 1 Million Jahren)
Den ältesten Indonesier, den ich sah, fand ich allerdings nicht über eine Dating-App. Es war während einer Mittagspause in Leiden, als ich an meiner Dissertation arbeitete. Ich radelte von der Archäologischen Fakultät zum Naturhistorischen Museum, wo ich sein kräftiges Gebiss, seine starke Konstitution und seinen wohlgeformten Kopf bewunderte. Der Konservator der paläontologischen Sammlung holte die Überreste aus einem Tresor und legte sie nacheinander auf eine Filzunterlage. Das waren sie also, ein Backenzahn, ein Oberschenkelknochen und das Schädeldach des »Java-Menschen«, des ersten ausgegrabenen Homo erectus überhaupt. Der niederländische Arzt und Naturforscher Eugène Dubois hatte ihn 1891 auf Java entdeckt. Es war der Fund, der Darwin recht gab: die erste eindeutige Übergangsform zwischen Mensch und Tier.20 Heute wird ihm ein Alter von ungefähr einer Million Jahren zugeschrieben. Homo erectus gelangte von Afrika aus nach Java, das damals noch keine Insel war, sondern zusammen mit Sumatra, Borneo und Bali an der asiatischen Landmasse festhing, weshalb auf einigen dieser Inseln auch Elefanten, Nashörner, Tiger, Orang-Utans und andere Festlandsarten vorkommen. Die Tierwelt der östlicher gelegenen Inseln ist eine ganz andere, eher »australische«, mit Wombats, Wallabys, Tasmanischen Teufeln und weiteren Beuteltieren. Mitten durch den Archipel verläuft eine biogeografische Grenzlinie, die Wallace-Linie, benannt nach Alfred Russel Wallace, dem genialen, aber fast vergessenen Mitentdecker der Evolution. Eine Million Jahre, das ist früh. In Europa kam Homo erectus erst eine halbe Million Jahre später an, die beiden Amerikas wurden erst vor etwa zwölftausend Jahren von Angehörigen der Gattung Homo besiedelt – entlegene Winkel der Erde. Indonesien dagegen gehörte zu den frühesten Ausbreitungsgebieten. Die Evolution des Menschen? Im Grunde hat auch sie etwas von einer Asien-Afrika-Konferenz.
Karte 3: Ausbreitung des Homo sapiens (bis vor ca. 50000 Jahren)
Das gilt sicher auch für die Ausbreitung des Homo sapiens. Wenn jedes Jahrtausend einer Wischbewegung auf Tinder entspricht, müssen wir 925-mal wischen, bevor wir den Nachfolger des Homo erectus von Afrika her ankommen sehen. Vor etwa 75000 Jahren zogen die ersten kleinen Gruppen moderner Menschen vom Festland auf den Archipel – in Europa lebten damals noch Neandertaler.21 Vermutlich handelte es sich um Menschen vom melanesischen Typus mit dunkler Haut, krausem Haar und runden Augen, entfernte Vorläufer der Papuas und Aborigines, der indigenen Völker Neuguineas und Australiens. Sie überquerten die Wallace-Linie – mit welcher Art von Fahrzeugen, wissen wir nicht – und erreichten sogar Tasmanien. Natürlich waren sie Jäger und Sammler, schließlich war das die Lebensweise aller Menschen während 99 Prozent der menschlichen Geschichte. Doch ungefähr 7000 Jahre vor unserer Zeitrechnung (68 Wischbewegungen später) begannen sie im Binnenland von Neuguinea Wurzelgemüse wie Taro und Yam anzubauen, außerdem Sagopalmen und Bananenbäume.22 Auch in China wurde zu dieser Zeit mit neuen Formen von Nahrungsversorgung experimentiert. Statt nur wilden Reis zu pflücken, fingen Menschen an, selbst Reis zu züchten. Darin waren sie nach einiger Zeit so erfolgreich, dass Bevölkerungswachstum und Migration möglich wurden, sogar übers Meer.23 Diese sogenannte Austronesische Expansion brachte Menschen mit klassischen asiatischen Merkmalen – hellere Haut, glattes Haar und mandelförmige Augen – nach Taiwan, auf die Philippinen, nach Borneo, Sulawesi und Java, wo sie um 2000 v.u.Z. (fünf Wischbewegungen später) ankamen. Sie fuhren mit Auslegerkanus, auf beiden Seiten mit Schwimmern stabilisierten Booten, wie sie noch heute in den Gewässern des indonesischen Archipels zu sehen sind. Überall begannen sie Reis anzubauen. Sie züchteten Hühner und Schweine, außerdem Hirse, Taro, Sagopalmen, Yam, Kokospalmen und Bananen. Sie stellten Keramik her und lernten, Metall zu bearbeiten. Ihre Lebensweise war sesshaft, ihre hölzernen Häuser standen auf Pfählen und hatten elegant geschwungene Dächer. Zum Andenken an ihre Ahnen errichteten sie Denkmäler und Menhire – die Toraja im Süden von Sulawesi tun es noch heute.
In den darauf folgenden Jahrtausenden (von 2000 v.u.Z. bis 1200 u.Z.) breitete sich ihre Lebensweise über ein riesiges Gebiet aus: von Madagaskar bis Hawaii und zur Osterinsel. Die dort entstandenen Sprachen gehören alle zur austronesischen Gruppe, vor dem Zeitalter des Kolonialismus die am weitesten verbreitete Sprachfamilie der Welt. Diese Völker waren zweifellos »die größten Segler der Geschichte bis zum 15. Jahrhundert«.24 In südostasiatischen Gewässern hatten sie außerdem buchstäblich den Wind im Rücken: Von November bis März weht dort der Nordostpassat, ideal für die Reise von China nach Indien, von Mai bis September der Südwestmonsun, wie geschaffen für die Rückreise. Bei durchschnittlichen Windstärken von vier bis fünf Beaufort segelt es sich außerdem angenehm; schwere Stürme und hoher Seegang kommen selten vor.25 Nur an den Südküsten des Archipels sind die Wellen hoch – sie kommen von der Antarktis her angerollt –, weshalb es bis zum Aufkommen der Dampfschifffahrt wenig Kontakt mit Australien gab.
Karte 4: Austronesische Expansion (ca. 3000 v.u.Z.-ca. 1200 u.Z.)
Dank des Anbaus von Reis entwickelten sich viel komplexere Gesellschaften. Nassreisanbau brachte höhere Erträge als Trockenreisanbau, doch der Aufwand war auch wesentlich höher. Die frühesten Äcker waren winzig, während später ganze Ebenen in feucht glänzende Reisfelder verwandelt wurden. An Hängen wurden sogar erstaunliche Reisterrassen angelegt. Wenn man je ihr raffiniertes Bewässerungssystem bewundern durfte, weiß man, dass so etwas nicht das Werk eines einzelnen Bauern, einer Familie oder auch nur einer Generation sein kann. Die Instandhaltung all der kleinen Deiche, Kanäle und Wehre ist ohne eine beständige, zentrale Machtinstanz kaum denkbar. Aus Häuptlingen wurden regionale Anführer, die Ernteerträge nahmen zu, Dörfer wuchsen zu Städten heran. Eine agrarische Gesellschaft, die Überschüsse produziert, kann Handel treiben: mit Reis, Gemüsen, Flechtwerk, Keramik, aber auch Luxusgütern. Bereits in den letzten Jahrhunderten v.u. Z. wurde im Gebiet von Vietnam bis Südchina und zum indonesischen Archipel mit bronzenen Dolchen, Beilen und Trommeln gehandelt.26 Lokale Gemeinschaften waren Teil regionaler Reiche geworden.
Ein Schnittpunkt von Kulturen, nicht weniger als das war der Archipel. Die Häfen waren nicht nur Umschlagplätze für Güter, sondern auch für Götter. Reisende brahmanische Priester aus Indien, die eine Art Protohinduismus lehrten, erhielten schon im 5. Jahrhundert von einem Fürsten auf Borneo eine Gabe, bestehend aus »Wasser, geklärter Butter, gelbbraunen Kühen, Sesamsamen und elf Stieren«.27 So steht es in eine Stele eingemeißelt, es ist der älteste erhaltene Text Indonesiens. Zwei Jahrhunderte später schrieb ein Buddhist aus China voller Begeisterung: »In der befestigten Stadt Fo-Qi [dem heutigen Palembang] gibt es mehr als tausend buddhistische Mönche, die ihren Geist auf Studium und gute Taten richten. Sie lesen und studieren alle Themen genau wie in Indien; die Rituale und Zeremonien sind die gleichen. Will ein chinesischer Mönch nach Indien, um die buddhistischen Texte zu hören und zu lesen, sollte er besser erst ein oder zwei Jahre hier verbringen, um die Lehre in die Tat umzusetzen, bevor er nach Indien geht.«28
Die heutige Stadt Palembang im Süden Sumatras war der Hauptort eines mächtigen buddhistischen Reiches, Srivijaya. Sechs Jahrhunderte lang kontrollierte es den Handel und die Seewege zwischen China und Indien. Das Malaiische wurde zur maritimen Verkehrssprache. Auch auf Java konnten indische Religionen Fuß fassen, sogar bis tief ins Binnenland. Vierzig Kilometer nordwestlich des heutigen Yogyakarta entstand um 800 der Borobudur, das größte buddhistische Bauwerk der Welt. Tausende von Reliefs und Hunderte von Buddhastatuen zieren diese atemberaubende Treppenpyramide. Fünfzig Kilometer entfernt wurde von 900 an der Prambanan errichtet, ein mindestens ebenso beeindruckendes Heiligtum, in diesem Fall ein hinduistisches. Die Tempelanlage enthält das schönste Rinderstandbild, das ich je gesehen habe. Hinduismus und Buddhismus existierten friedlich nebeneinander.29 Auf Java und Bali verschmolzen sie zu einer einzigartigen Mischform, in der Hindu-Gottheiten wie Brahma, Vishnu und Shiva zusammen mit dem historischen Buddha angebetet wurden.
Karte 5: Ausbreitung von Hinduismus und Buddhismus
Höhepunkt dieser kulturellen Verschmelzung war das Majapahit-Reich, das im 14. Jahrhundert von Java aus den gesamten Archipel von der Malaiischen Halbinsel bis zum Westzipfel Neuguineas kontrollierte. Ein geeintes Imperium wie das Römische Reich war es nicht – der Herrscher pflegte von der Hauptstadt aus die Verbindungen zu regionalen Vasallen –, dennoch war es für die Freiheitskämpfer des 20. Jahrhunderts die kulturelle Bezugsgröße schlechthin, als mächtiges, ruhmvolles und vor allem autochthones indonesisches Reich, dessen rotweiße Fahne man übernahm; Rot und Weiß sind noch heute die Nationalfarben. Die Architektur, die Holzschnitzkunst, die Batik, die Tänze und die javanische Sprache erreichten im Majapahit-Reich eine nie dagewesene Verfeinerung. Alte indische Heldenepen wie das Mahabharata und das Ramayana bekamen an den Höfen ihre typisch javanische Form: das wundersame Wayang-Schattenspiel mit Puppen. Die Aufführungen dauerten ganze Nächte; der Puppenspieler saß im Schneidersitz hinter einem Behältnis mit den Büffelleder-Puppen, erzählte die alten Geschichten und stellte sie szenisch dar, wobei das Licht einer Öllampe die ausdrucksstarken Silhouetten der Puppen auf eine Leinwand projizierte. Magische Vorstellungen waren es, heroisch, erschütternd, gewalttätig, manchmal urkomisch. Begleitet wurde das Spiel von den sanft berauschenden Klängen des Gamelan, dieser unvergleichlichen polyrhythmischen Musik, die Jahrhunderte später Komponisten wie Claude Debussy, Erik Satie und John Cage beeinflussen sollte.
Karte 6: Größte Ausdehnung des Majapahit-Reiches (1293-1401)
Auch der chinesische Einfluss nahm zu. Von 1405 bis 1433 wurden von China aus sieben umfangreiche Expeditionen unter der Führung des Eunuchen und Admirals Zheng He unternommen. Über den indonesischen Archipel fuhr Zheng He nach Ceylon, Indien, Arabien und bis zur Ostküste Afrikas. Bei allen Fahrten blieben einige Teilnehmer zurück, es waren die Anfänge einer chinesischen Diaspora. Zheng Hes Flotten bestanden zum Teil aus über dreihundert Schiffen und 27000 Seeleuten. Einige der größten Schiffe hatten nach alten chinesischen Quellen eine Länge von 120 Metern. Und das, zur Erinnerung, mehr als ein halbes Jahrhundert bevor Kolumbus mit drei Schiffen, das größte knapp 24 Meter lang, und insgesamt neunzig Mann nach Westen aufbrach. Portugal, die wichtigste Seefahrernation Europas, wagte sich in Zheng Hes Epoche gerade einmal bis nach Marokko.30 Indonesien brauchte Europa nicht, um erschlossen zu werden.
Dank all der Handelskontakte konnte sich auch eine junge, irgendwo im Westen entstandene Religion ausbreiten. Vor allem Händler waren empfänglich für sie. Der javanische Feudalismus war stark hierarchisch, doch der neue Glaube gebot dem Edelmann wie dem armen Schlucker, demütig zu bleiben und fünfmal am Tag kniend zu beten. Einen Teil seines Besitzes musste man den Armen schenken. Im 15. und 16. Jahrhundert breitete sich der Islam auf dem Weg über die Hafenstädte im indonesischen Archipel aus.
Karte 7: Ausbreitung des Islam (bis ca. 1650)
Es war keine Massenimmigration, keine Eroberung und keine zwangsweise Bekehrung; der egalitäre Charakter der neuen Religion sprach einfach viele Menschen an. Die ersten Moscheen wurden in einem hinduistisch-buddhistischen Stil errichtet. Allmählich wurde der gesamte Archipel islamisiert, mit Ausnahme von Bali und Papua, die hindubuddhistisch und animistisch blieben. Könige ließen sich von nun an Sultan nennen, aus Fürstentümern wurden Sultanate, doch das Wayang lebte weiter, ebenso wie der traditionelle Ahnen- und Geisterglaube. Bis zum heutigen Tag. Am Strand an der Südküste Javas riet man mir einmal, lieber keine grüne Badehose zu tragen, weil mich sonst die Meeresgöttin Ratu Kidul verschlingen könne. Nach vierzehn Jahrhunderten Hinduismus und Buddhismus und fünf Jahrhunderten Islam ist dieser Glaube noch quicklebendig.31
»Java, das ist vielleicht ein Durcheinander!« Dem 102-jährigen Djajeng Pratomo schaute der Schalk aus den glänzenden Augen. Ja, so konnte man es auch ausdrücken. Wir saßen in seinem Zimmer in einem Altenheim in Callantsoog im Norden von Nordholland. Es war vier Uhr nachmittags an einem regnerischen Sommertag. Dunkel gefärbte Dünen, der Strand leer, das Meer pickelig vom Regen. Im Zimmer war es brütend heiß, Pratomo hatte es gern warm. Eine Pflegerin hatte gerade das urholländische Gebäck schlechthin gebracht: Poffertjes mit Puderzucker. Der kleine, magere Mann saß in seinem viel zu großen Sessel und kicherte: »Es ist eine sehr komplizierte Angelegenheit, dieses Indonesien«, sagte er, während er ein wenig Puderzucker von seiner Hose klopfte, »so verwirrend!« Pratomo zuzuhören war wie eine Zeitreise. Abgesehen von ein paar Schülern hatte ihn in den vergangenen drei Jahrzehnten niemand mehr interviewt.32 Zum ersten Mal hatte ich in Jakarta von ihm gehört, er sollte »irgendwo in den Niederlanden« wohnen, die genaue Schreibweise seines Namens war unklar. Nach viel kniffliger Online-Sucherei fand ich seinen Namen, dann einen Schulaufsatz, anschließend zwei Schüler, die mich mit ihrem Lehrer in Kontakt brachten. Dieser Lehrer verwies mich an Pratomos Tochter, die mich in Callantsoog herzlich willkommen hieß. Und nun saß ich hier. Pratomo war der älteste Einwohner des Dorfes, eine Lokalzeitung hatte schon über ihn berichtet. Er fand es ziemlich lustig, dass er als Javaner der Nestor eines nordholländischen Dorfes war. »Kommen Sie, nehmen Sie noch ein Poffertje.«33
Während ich auf einem lauwarmen Minipfannkuchen herumkaute, wurde mir wieder bewusst, dass das koloniale Abenteuer der Niederländer nicht mit dem Hunger nach Land begann, sondern mit dem Wunsch nach mehr Geschmack. Die Niederlande fielen nicht in ein Land ein, um dort die Herrschaft zu übernehmen, sie fielen am Anfang in gar nichts ein und wollten auch nichts übernehmen. Sie wollten nur etwas abnehmen, in erster Linie Gewürze. Schon seit Jahrhunderten waren asiatische Gewürze in Europa hoch geschätzt. Das einzige erhaltene Kochbuch aus der römischen Antike, De re coquinaria von Apicius, schreibt für mehr als drei Viertel der Gerichte große Mengen Pfeffer vor.34 Appetit auf Pullus tractogalatus, Huhn mit Milchteigbrei und Honig? Wunderbar, aber man brauchte dafür eine Zutat, die über Tausende von Kilometern herangeschafft werden musste. Dulcia mit Eiern und Pinienkernen? Ohne Pfeffer aus dem fernen Asien leider fade. Römischen Seefahrern kam es auf ein paar Seemeilen mehr oder weniger nicht an. Von der Ostküste Ägyptens fuhren sie für Elfenbein nach Ostafrika, für Weihrauch nach Arabien, doch für Pfeffer sogar nach Indien.35 »India« stand für ungefähr das gesamte Gebiet östlich der Arabischen Halbinsel. Über Land reichten diese frühen Handelsbeziehungen sogar bis nach China. Über die Seidenstraße reisten kostbare Güter: Lackwaren, Gold, Silber, Zucker, Safran, Zimt.36 In Syrien haben Archäologen Skelette aus der römischen Epoche entdeckt, die in Seide aus chinesischen kaiserlichen Werkstätten gehüllt waren.37 In Indien kamen bei Ausgrabungen römische Amphoren, Öllampen und Skulpturen ans Licht. Und noch in Thailand wurden römische Münzen gefunden. In Thailand!38
Die Liebe zu Gewürzen war keine kurzlebige Erscheinung. Im mittelalterlichen Europa war die Küche viel würziger und süßer als die moderne. Die Gewohnheit, süße Geschmacksrichtungen für die Nachspeise aufzusparen, kam erst in der französischen Küche des späten 17. Jahrhunderts auf.39 Mittelalterliche Köche gaben Rosinen, Feigen und Kardamom in ihre Saucen, Kombinationen, die eher an die indische oder arabische Küche erinnern. Mit den Kräutern, die man in Europa auf Wiesen, in Wäldern oder Klostergärten ernten konnte – Schnittlauch, Salbei, Sauerampfer, Petersilie, Rosmarin –, waren die asiatischen Gewürze nicht zu vergleichen. Pfeffer, Muskatnuss, Kardamom, Nelke und Zimt waren hart, holzig und extrem lange haltbar. Niemand in Europa wusste genau, an welchen Pflanzen sie wuchsen. Erst zerstoßen oder gemahlen gaben sie ihre unglaublichen Aromen frei, so herrlich, dass einige mittelalterliche Autoren das irdische Paradies prompt irgendwo im mythischen »India« lokalisierten. Sie galten nicht nur als ungeheuer köstlich, sondern auch als außerordentlich gesund. War bei einem Menschen das Gleichgewicht oder die Zusammensetzung der vier Körpersäfte (Blut, Gelbe Galle, Schwarze Galle, Schleim) gestört, brauchte er Gewürze als Gegenmittel. Muskatnuss galt als »heiß« und »trocken«, Ingwer als »heiß« und »nass«, Pfeffer als sehr »heiß« und »trocken«, und Gewürznelken halfen gegen Zahnschmerzen. Für solche magischen Aromen bezahlte, wer konnte, bereitwillig viel Geld. Wenn ein Londoner Handwerker um 1450 etwa acht Pence am Tag verdiente, kostete ein Pfund Pfeffer oder Ingwer ungefähr zwei Tagelöhne. Ein Pfund Zimt? Drei Tage Arbeit. Ein Pfund Gewürznelken? Viereinhalb Tage. Ein Pfund Safran? Ein Monat.40
Karte 8: Entdeckungsreisen und Gewürzhandel
Jahrhundertelang blieben diese Luxusgüter nicht nur deshalb unvorstellbar teuer, weil sie von sehr weit her kamen (Nelke und Muskatnuss zum Beispiel von den Molukken), viel Handarbeit erforderten (wie etwa Safran, gewonnen aus den Griffeln einer Krokusart) oder extrem selten waren (wie Ambra, das aus den Därmen von Pottwalen stammt), sondern auch, weil so viele Zwischenhändler am Handel beteiligt waren. Wenn das Küchenmädchen eines Brügger Patriziers um 1500 ein wenig Muskatnuss über den Blumenkohl rieb, hatte dieser Samen eine Weltreise hinter sich, bei der er durch die Hände Dutzender Händler gegangen war. Auf den Banda-Inseln, der winzigen Inselgruppe im Osten des indonesischen Archipels, auf der Muskatnussbäume damals noch ausschließlich wuchsen, hatte ein Pflücker den Samen der Muskatfrucht geerntet und getrocknet. Der Dorfälteste verkaufte ihn anschließend an einen javanischen oder malaiischen Händler, der ihn in einem Hafen an der Ostküste Sumatras oder auf der Malaiischen Halbinsel an indische Seefahrer weiterverkaufte. Sie brachten ihn nach Ceylon. Dort wurde er vielleicht von Gujarati, Persern oder Arabern erworben, die ihn zur Südküste der Arabischen Halbinsel weitertransportierten. Führte die Reise durch den Persischen Golf, landete er auf dem Weg über die Märkte von Bagdad und die syrischen Häfen in der Handelssphäre der Levante. Führte sie dagegen durchs Rote Meer, gelangte er über Kairo und Alexandria in die Hände von genuesischen oder venezianischen Seehändlern, die ihn nach Italien brachten, die ersten Christen nach all den Animisten, Buddhisten, Hindus, Muslimen, Jainisten und Zoroastriern auf seinem Weg. Nun musste das Kleinod noch mit Binnen- und Küstenschiffen und auf dem Landweg nach Brügge verfrachtet werden. Natürlich erhöhte sich bei jedem Transfer der Preis, und in jedem Hafen waren Steuern und Umschlagkosten zu entrichten. Kein Wunder also, dass man um 1500 für eine Handvoll Nelken in Venedig oft hundertmal so viel zahlen musste wie auf den Molukken.41 Ging das nicht billiger?
Ja, dachten die Portugiesen, das musste billiger gehen. Im späten 13. Jahrhundert hatte Marco Polo als erster Europäer Sumatra erreicht, und er hatte herausgefunden, auf welchen Inseln welche Gewürzpflanzen vorkamen. Wenn man nun das Mittelmeer links liegen ließ und selbst um Afrika herumfuhr? So groß konnte dieses »Land« doch wohl nicht sein! Das erwies sich als gewaltiger Irrtum. Von 1430 an fuhren portugiesische Seefahrer, in der Hoffnung, bald nach Osten abbiegen zu können, südwärts, doch der afrikanische Kontinent nahm kein Ende. Erst 1498, fast sieben Jahrzehnte nach dem Beginn des Abenteuers, gelang es Vasco da Gama, das Kap der Guten Hoffnung zu umrunden und die Westküste Indiens zu erreichen. Dort erfuhr er, dass man für die besten Gewürze noch weiter reisen musste: für Zimt nach Ceylon, für Pfeffer nach Sumatra und Java, für Nelke, Muskatnuss und Macis (den aromatischen Samenmantel der Muskatfrucht) sogar noch viel weiter, zu den Molukken. Bis 1525 knüpften die Portugiesen ein bescheidenes Handelsnetz in der gesamten Region, mit Hormus am Persischen Golf, Goa im Nordwesten Indiens, Colombo auf Ceylon, Malakka auf der Malaiischen Halbinsel, der Molukken-Insel Ambon und später noch Macau an der Südküste Chinas als Stützpunkten. Auf Ambon errichteten sie ein Fort, die erste westliche Niederlassung im späteren Indonesien. Sie bereicherten das Malaiische um Wörter wie bendera (von bandeira, Flagge), gereja (von igreja, Kirche), sekolah (von escola, Schule) und minggu (Woche, von domingo, Sonntag). Die Insel Ambon hatte eine Bucht, die sich wunderbar als Hafen eignete, und man erreichte von dort schnell die kleinen Vulkaninseln Ternate und Tidore, wo sich die Portugiesen mit Nelken versorgten, und die winzigen Banda-Inseln, wo es die Muskatnüsse gab. Von nun an konnte sich Europa unmittelbar an der Quelle eindecken. Besser gesagt: Portugal konnte sich künftig an der Quelle eindecken und seine Beute – jährlich zehn Tonnen Muskatnüsse und dreißig Tonnen Gewürznelken – mit hohem Gewinn in Europa weiterverkaufen.42
Ging es nicht billiger? Das fragten sich auch die Spanier. Doch statt im Schneckentempo, unablässig kreuzend, nach Süden zu segeln, fuhren sie nach Westen. So groß konnte der Atlantische Ozean doch wohl nicht sein! Wenn die Erde rund war, warteten die Gewürzinseln folglich auf der anderen Seite dieses Meeres! Als Kolumbus 1492 Kuba erreichte, glaubte er, in Japan angekommen zu sein. Etwas später kamen ihm Zweifel: Hispaniola, das musste Japan sein!43 Die anderen Küsten gehörten dann ganz bestimmt zu Indien. Gut, es schien dort weniger Gewürze zu geben als erwartet, aber lag das nicht einfach daran, dass der Winter begonnen hatte? Die Einwohner des vermeintlichen Indien nannte er jedenfalls schon einmal Indios. Eine Generation nach ihm entdeckte Magellan, dass man tatsächlich in westlicher Richtung nach Indien fahren konnte, dafür aber zunächst weit nach Süden musste, fast bis zur mythischen Terra Australis, bis man endlich durch eine Meerenge weit im Süden des südamerikanischen Kontinents nach Westen zum Stillen Ozean kam. Offensichtlich war die Welt viel größer als gedacht. Am Ende einer mehrmonatigen Reise quer über den Pazifik stieß Magellan auf eine Inselgruppe, die er nach dem spanischen König benannte, die Philippinen. Auf einer dieser Inseln wurde er von Einheimischen getötet, aber die Überlebenden seiner Besatzung erreichten noch die so begehrten Molukken.
Wenn es südwärts und westwärts so mühsam ist, dachten die Niederländer, warum versuchen wir es dann nicht einmal im Norden? So groß kann dieses Russland doch wohl nicht sein! Willem Barents versuchte von 1594 an dreimal, einen nördlichen Seeweg in den Fernen Osten zu finden, doch seine letzte Reise scheiterte im Packeis eines noch namenlosen Meeres, das seitdem seinen Namen trägt. Nach der entbehrungsreichen Überwinterung auf der subarktischen Insel Nowaja Semlja stand fest, dass auch die nördliche Route nicht ideal war. Befreundete Archäologen, die in den neunziger Jahren des 20. Jahrhunderts die Winterhütte von Barents und seiner Besatzung untersuchten, haben mir erzählt, dass sie jede Nacht mit Signalraketen Eisbärenwache halten mussten. Für Barents, der zwar den Winter überlebte, aber im Juni 1597 entkräftet starb, muss es eine seltsame Überraschung gewesen sein: angriffslustige Eisbären statt der erhofften tropischen Gewürze. Es blieb nichts anderes übrig, als auf der portugiesischen Route um Afrika herumzufahren. Cornelis de Houtman aus Gouda war der erste Niederländer, dem das gelang. Dank einiger teilweise im Hafen von Lissabon gestohlener Karten und dank Spezialkenntnissen erreichte er 1596 die Westküste Javas, wo er außer Portugiesen und Chinesen auch Pfeffer vorfand.44 Die Niederländer waren weder die ersten noch die reichsten europäischen Kaufleute in der Region. Houtman reiste weiter nach Bali, konnte sich hier und da mit Gewürzen eindecken, hinterließ überall eine Spur der Verwüstung – wie übrigens auch die Portugiesen – und kehrte zwei Jahre später nach Amsterdam zurück. Der Ertrag dieser historischen Expedition deckte gerade einmal ihre Kosten, aber der Weg nach De Oost war offen.
Die folgenden Jahre sind als die Zeit der »wilden Fahrt« in die Geschichte eingegangen: Zahlreiche holländische und seeländische Seefahrer machten sich auf den Weg nach Ostindien. Nicht für König und Vaterland wie die Portugiesen, aus dem einfachen Grund, weil sie keinen König und auch kein Vaterland im üblichen Sinn hatten. Die Niederlande waren 1588 das erste nordwesteuropäische Land ohne König, und die Republik der Sieben Vereinigten Provinzen war kein klassischer, zentral regierter Staat, sondern ein Kooperationsverbund weitgehend autonomer Provinzen oder staten – daher die bis heute in vielen europäischen Sprachen üblichen Pluralformen zur Bezeichnung des Landes (the Netherlands, les Pays-Bas, die Niederlande, los Países Bajos, i Paesi Bassi und so weiter). Diese konföderative Struktur regte zwar ganz bestimmt den Kaufmannsgeist an, sorgte aber auch für erbitterte, kontraproduktive Konkurrenz. Im Jahr 1602 kamen die Generalstaaten, das oberste gemeinsame Entscheidungsorgan der Republik, zu dem Schluss, dass es vernünftiger sei, die Kräfte zu bündeln. Alle existierenden Handelsgesellschaften sollten in einem einzigen Unternehmen vereint werden, der Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC), die das Monopol auf den Ostindien-Handel erhielt. Diese berühmt-berüchtigte Organisation hatte zweihundert Jahre lang Bestand und ist aus zwei Gründen einzigartig: Erstens war sie ein privates Unternehmen mit umfangreichen Hoheitsrechten. Die VOC durfte im Namen der Republik internationale Verträge schließen, Recht sprechen, Forts errichten und Soldaten anwerben, hatte also weitreichende diplomatische, juristische und militärische Befugnisse. Zweitens war sie das erste Unternehmen der Welt mit käuflichen Anteilen, also Aktien: Miteigentümer konnten ihre Anteile jederzeit veräußern. Die Loyalität war deshalb viel geringer ausgeprägt als bei einem Familienunternehmen. Wer Aktien besaß, wollte möglichst schnellen Gewinn. Welche Folgen die Kombination dieser beiden Eigenschaften hatte, lässt sich unschwer erraten: Die VOC musste unbedingt Profite für die privaten Investoren erzielen und war dafür mit allen denkbaren Mitteln staatlicher Machtausübung ausgestattet. Das konnte nicht gut gehen.
Ein weiteres Grundproblem waren die Schiffsbesatzungen. Wer bei der VOC anheuerte, war nicht gerade die Blüte der Nation. Obwohl von den fast fünftausend zwischen 1595 und 1795